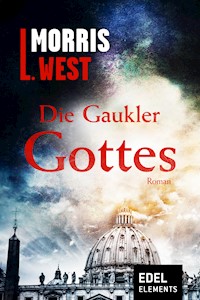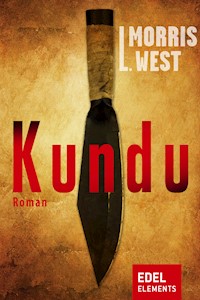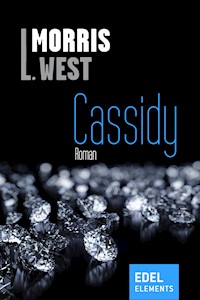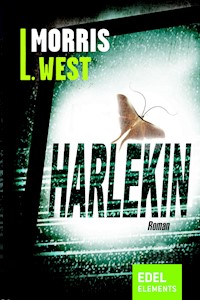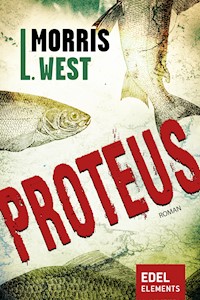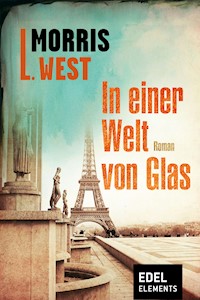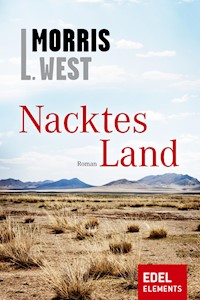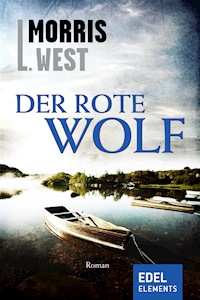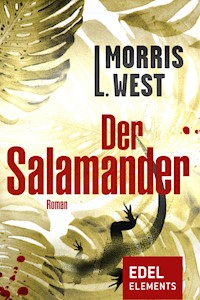Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Verfilmt mit Mario Adorf! In Bad Quellenberg, einer kleinen Stadt in Österreich, stößt der britische Besatzungskommandant Hanlon in der chaotischen Nachkriegszeit auf unerwartete Schwierigkeiten. Sein Fahrer wurde auf dem Weg nach Bad Quellenberg heimtückisch erschossen. Hanlon muß zu seinem Entsetzen erkennen, daß die Einheimischen den Mörder decken. Neben dem Polizeichef Fischer, der Hanlons Bemühungen mit allen Mitteln hintertreibt, begegnen ihm Pater Albertus, sein früherer Novizenmeister; Bürgermeister Holzinger, der, um Stellung und Besitz zu retten, seine hübsche Tochter ins Spiel bring; und Anna, ein junges Mädchen, dessen Frische und Charme ihn tief beeindrucken.Da geschieht ein weiterer Mord, und Besatzungskommandant Hanlon, der von allem Anfang an bemüht war, in seinem Gebiet wieder Recht und Ordnung zu schaffen, muß einsehen, daß seinem Idealismus Grenzen gesetzt sind...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Der zweite Sieg
Roman
Ins Deutsche übertragen von Hannelore Pfeifer
Edel eBooks
»... jedes Mannes Tod macht mich ärmer, denn ich bin an die Menschheit gebunden ...«
Inhalt
Kapitel 01
Kapitel 02
Kapitel 03
Kapitel 04
Kapitel 05
Kapitel 06
Kapitel 07
Kapitel 08
Kapitel 09
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Impressum
1
Sie hatten das Tal hinter sich gelassen und fuhren nun auf der Straße, die sich in gefährlichen Kurven den Berg hinaufwand, höher und höher. Zu ihren Füßen fiel der Hang steil ab zu dem Bach, der unter überhängendem Eis und kahlen Erlenzweigen dahinrauschte. Über ihnen erhob sich die Bergwand mit ihren dunklen Tannenstreifen, und jenseits der Bäume erstreckte sich die Schneedecke gleichmäßig bis zum Gipfel, bis zum Blau des Mittagshimmels.
Der Jeep kam auf der vereisten Straße ins Schleudern; Sergeant Willis riß ihn vom Abhang zurück und hielt an. Sie stiegen aus und kurbelten ihn mit dem Wagenheber hoch, um die Schneeketten anzulegen. Während Willis sie festmachte und über die Kälte schimpfte, ging Major Hanlon auf die Straßenmitte und blickte den Berg hinauf.
Genau über ihm durchschnitt eine breite Schneise den Tannenwald. Zu beiden Seiten ragten die dunklen Stämme wie die Pfeiler eines alten Kirchenschiffs in die Höhe, und ihre Fluchtlinie zog seinen Blick an und lenkte ihn weiter bis hinauf zu der scharfgeschnittenen Silhouette des Bergsattels. Unter den Tannen war der Schnee braun von abgefallenen Nadeln, doch jenseits der Bäume bildete er eine blendendweiße Decke, die nur vom Grau der Felskuppe aufgelockert wurde und eingerahmt war von den Orgelpfeifen des Grauglockners.
Dann sah er den Schiläufer.
Er stand oben auf dem Bergrücken, eine winzige schwarze Puppe, mit dem Kopf im blauen Himmel und den Füßen im weißen Schnee. Hanlon nahm den Feldstecher aus der Hülle an seinem Hals und stellte ihn auf die reglose Figur ein.
Einen Augenblick später setzte sich die Puppe in Bewegung – langsam zuerst, indem sie sich mit den Stöcken abstieß, dann, als sie den steileren Hang erreicht hatte, schneller und schneller. Beim ersten Felsvorsprung bremste der Läufer und wendete in einem Stemmbogen – so eng, daß Hanlon einen Pfiff der Bewunderung ausstieß. Durch das Glas sah er den Schnee aufstäuben und den waghalsigen Winkel, den der Körper des Mannes bildete. Gleich darauf richtete er sich auf und fuhr in einem langen schrägen Schuß abwärts auf die Waldschneise zu. Dort würde er mit neunzig Stundenkilometern ankommen.
Hanlons überraschter Ausruf brachte Willis mit einem Sprung an seine Seite, und so standen sie nebeneinander und verfolgten den Läufer in seiner selbstmörderischen Fahrt den blendendweißen Hang herab. An den vorstehenden Felsen bremste und wendete er nicht mehr; er sprang oder vielmehr flog darüber hinweg wie ein ungefüger Vogel, die Stöcke gleich Flügelspitzen waagerecht hinter sich haltend, um beim Aufsetzen nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Die beiden Männer verfolgten ihn atemlos und warteten, daß er stürze und mit gebrochenen Gliedern den Hang herunterrolle. Aber er stürzte nicht. Immer schneller kam er näher, so daß sie schließlich das Grau seiner Uniform und die grünen Regimentsabzeichen der Gebirgsjäger, das Gewehr auf dem Rücken und das dunkelglänzende Pistolenkoppel erkennen konnten.
Hanlon ließ das Fernglas einen Augenblick sinken und schaute Willis erstaunt an. Der Krieg war seit Monaten beendet. Den offiziellen Berichten nach waren alle österreichischen Einheiten entwaffnet und aufgelöst. Die Besatzungsmächte kontrollierten das Land bis in die entlegensten Winkel. Was wollte dieser Mann hier, der bewaffnet und in Uniform in wilder Abfahrt den Hang herunterkam?
Hanlon hob das Fernglas wieder an die Augen. Der Schiläufer näherte sich dem Ende seiner Fahrt. Er flog dahin wie der Wind, und sie sahen voraus, daß er über die schmale Lichtung hinausschießen und seinen Lauf in dem Tannenriegel beenden würde. Gleich darauf hatten sie ihn aus den Augen verloren; sie starrten den Säulengang der Bäume empor und warteten auf das Krachen und die Schreie. Doch außer dem Rauschen des Baches und dem Flüstern des Windes hörten sie keinen Laut.
Es dauerte vielleicht dreißig Sekunden, bis der Schiläufer wieder auftauchte; er glitt leicht über den Hang, der sich quer zu dem Waldstreifen hinzog. Die beiden Stöcke hatte er mit der einen Hand gefaßt, in der anderen trug er das Gewehr. Am Fluchtpunkt der beiden Baumreihen hielt er an, stieß die Stöcke in den Schnee und schaute zu den Männern hinunter. Die Sonne fiel auf sein Gesicht; sie sahen seine eingefallenen, von Bartstoppeln geschwärzten Wangen und, auf der rechten Seite, das rote Gewebe einer eben verheilten Wunde, die vom Auge bis zum Kinn reichte. Hanlon winkte und rief auf deutsch:
»Grüß Gott! Kommen Sie einen Augenblick herunter! Wir möchten mit Ihnen sprechen!«
Noch ehe er den letzten Satz beendet hatte, sah er, wie der Mann mit der Behendigkeit eines Trappers das Gewehr hochriß und mit ein und derselben Bewegung anlegte und zielte. Er schrie auf und warf sich gegen Willis, um ihn mit sich niederzureißen. Doch bevor sie noch den Boden berührten, hallte der erste Schuß. Während er auf den Jeep zu robbte, um Deckung zu suchen, sah er weitere Kugeln das Eis neben seinem Gesicht aufsprengen und hörte das erregte Echo im Tal.
Er zog seine Pistole aus dem Gurt und rückte vorsichtig in den Schatten der Karosserie. Das Echo klang noch von Berg zu Berg, aber die schmale Lichtung war leer, und Sergeant Willis lag auf der Straße mit einer Kugel im Kopf. Als Hanlon sich über ihn beugte, sah er, daß er tot war; das Blut auf seiner Wange und dem Eis darunter begann bereits zu gefrieren.
Nach einigen Minuten stand Hanlon auf, machte die Schneeketten fest, kurbelte den Wagenheber herunter und hob den Toten in den Jeep. Dann kletterte er auf den Fahrersitz, ließ den Motor an und fuhr sehr langsam die Straße aufwärts in Richtung Bad Quellenberg.
Die Legende berichtet, daß Bad Quellenberg von einem Einsiedler gegründet wurde – dem heiligen Julian, der mit Rehen, Bären, Adlern und Goldfasanen im Gebirge lebte. Er mußte ein sehr gütiger Mann gewesen sein, eine Art heiliger Franziskus, dessen Leben ein Protest gegen die Grausamkeiten seiner Zeit war. Als eines Tages ein Hirsch von einem Wolf angefallen wurde, schlug Sankt Julian gegen einen Felsen, und ein Strahl warmen, heilkräftigen Wassers brach hervor, ein nie versiegendes Heilmittel für Mensch und Tier.
Die Legende hat durch die Geschichtsschreibung an Glaubwürdigkeit verloren. Schon zur Bronzezeit hatten in dieser Gegend Menschen gewohnt. Die Römer leiteten ihren Salzhandel über die Straßen, die von Salzburg aus durch das Gebirge führen, und betrieben Goldbergwerke auf den Hochpässen des Naasfeldes. Später kamen Goten, Vandalen und Avaren; sie alle badeten, ihrer Gesundheit zuliebe oder der Annehmlichkeit und Reinlichkeit halber, in den warmen Quellen, die der Stadt ihren Namen gaben. Auch Martin Luther soll hier gewesen sein; allerdings läßt sich nicht nachweisen, daß er Bäder nahm. Vermutlich hielt er sich die meiste Zeit in den Holzhütten der Bergbauern versteckt, droben auf den Hochalmen, wo im tiefen Winter die Gemsen nach Futter suchen.
Ein geschäftstüchtiger Bauer errichtete an der engsten Stelle des Passes ein Wirtshaus und eine Poststation. Reisende, die aus Kärnten kamen, konnten dort ihre Pferde wechseln, sich an Rehrücken satt essen und die Bauernmädchen ins Hinterteil zwicken, bevor sie weiterfuhren in das unsichere Salzburger Land, wo Wolfdietrich in seiner Steinfestung saß, das Kreuz in der einen Hand und das blanke Schwert in der anderen.
Erst viel später wurde eine Kirche gebaut und eine Klosterschule, und bald erhoben sich die verstreuten Häuser einer Stadt am Hang des Baches, der sich aus dem Gebirge wand und durch die breiter werdende Schlucht weiterzog ins flachere Land. Aus der Herberge wurde ein Hotel. Es kamen Geschäftsleute aus Salzburg und Wien und errichteten Pensionen und Läden, legten Terrassengärten an und bauten Badehäuser, die gespeist wurden von den warmen Mineralquellen im Gebirge. In einem weiten terrassenförmigen Halbkreis wuchsen die Gebäude um die Enge der Schlucht, wie eine Spielzeugstadt zu Füßen des Grauglockners und des Gamsberges.
Noch später wurde ein Tunnel durch das Gebirge getrieben und die Stadt durch die Bahn mit Klagenfurt, Villach und Triest, mit Belgrad und Athen verbunden. Mit der Eisenbahn kamen Baedeker und Thomas Cook, und bald blühte Bad Quellenberg unter dem Goldregen der Touristen wie ein Fleck Enzian.
Im Sommer kamen sie, um ihre Bäder zu nehmen; sie saßen zum Kaffeeklatsch auf der Terrasse, ergingen sich unter den Tannen auf der Promenade und flirteten abends beim Klang der Strauß-Walzer und bei Schuhplattlern und Zitherspiel, womit die Bauern das Lokalkolorit auffrischten. Im Winter kamen sie zum Schilaufen und zwischendurch zur Jagd, so daß die Hoteliers fett und die Bauern reich wurden, und die Holzfäller Mühe hatten, genügend Holz für die Sägemühlen herbeizuschaffen, um mit dem Bautempo Schritt zu halten.
Im Gebirge wurde ein Elektrizitätswerk gebaut, das Stadt und Bahn mit Strom versorgte. Nach dem Anschluß Österreichs an Deutschland kamen die Parteigrößen nach Bad Quellenberg und verbrachten hier ihren Urlaub, Hitlerjugend marschierte singend durch die Täler, und Reichsmarschall Göring erschien, strahlend wie ein Pfau, um sich zu sonnen und Bäder zu nehmen.
Dann brach der Krieg aus – gegen Polen, gegen Frankreich und England, dann gegen Rußland. Die jungen Männer wurden zu den Gebirgsjägern eingezogen und an die Ostfront geschickt. Die Jahre gingen hin, und der kleine Wald der Grabkreuze auf dem Friedhof von Sankt Julian wurde größer und größer. Aus den Hotels wurden Lazarette, und die Läden schlossen einer nach dem andern, da es nichts mehr zu verkaufen gab.
Die Züge verkehrten unregelmäßig, denn auf Villach und Klagenfurt fielen Bomben, und auch die Eisenbahnknotenpunkte Salzburg und Schwarzach waren stark beschädigt. Die wenigen Züge, die noch fuhren, waren voll besetzt mit Soldaten, die ausgemergelt und verbittert aus Udine und Griechenland zurückkamen. Die offenen Güterwagen waren mit defekten Autos und Geschützen beladen; man hatte keine Verwendung mehr dafür, weil es weder Benzin noch Munition gab.
Schließlich kam der Tag, an dem durchs Radio die Kapitulation bekanntgegeben wurde. Die Bewohner von Quellenberg liefen in den Straßen zusammen, die Verwundeten in den Hotels richteten sich in ihren Betten auf, und auf allen Gesichtern stand dieselbe bange Frage: Was nun?
Niemand hatte es mit der Antwort eilig, denn Quellenberg war eine militärisch und wirtschaftlich unbedeutende kleine Stadt, ein Heilbad und Kurort. Man wartete stumm und ängstlich: einen Monat, zwei Monate, bis eine Kompanie Soldaten vom Hauptquartier der Besatzungsmacht in Klagenfurt eintraf. Der Captain war ein junger Mann mit strubbeligem Haar, dünnem Schnurrbart und kalten Augen. Er stellte sich dem Bürgermeister vor und übermittelte ihm seine Befehle.
Das größte Hotel im Ort, Hotel Sonnblick, mußte sofort geräumt und als Hauptquartier für den Kommandanten der Besatzungsmacht im Bezirk Quellenberg hergerichtet werden. Der Kommandant selber würde in achtundvierzig Stunden eintreffen; der Bürgermeister war verantwortlich dafür, daß bis dahin alle Vorbereitungen abgeschlossen waren.
Während die letzten Zimmermädchen aus den Korridoren gescheucht wurden und der erste Wachtposten seinen Platz am Eingang bezog, fuhr Major Mark Hanlon mit einem Toten neben sich die Paßstraße hinauf.
Bürgermeister Max Holzinger stand an dem breiten Erkerfenster seines Wohnzimmers und blickte über die Tannenspitzen in das schneebedeckte Tal.
Immer wieder gefiel ihm diese Aussicht: die breiten Wiesenhänge, zwischen denen sich der Bach mit den kahlen Erlen an beiden Ufern hinschlängelte, die langgestreckten Scheunen unter ihren Schneedächern, die scharfen Linien der Zäune, die Bauernhäuser, die sich um die alte Kirche drängten, die Tannen, die sich wie im Spalier die Berghänge hinaufzogen, die hohen Bergsättel, die wie Wälle die Welt draußen zurückhielten, die Pässe mit ihren trügerischen Nebeln und den Fallwinden. Kein Gewehrschuß hatte die Adler aus ihren Horsten in den Klippen hochgeschreckt. Es waren Männer gefallen – in Rußland, in Rumänien, in Ungarn, in Kreta. Aber ihr Tod hatte sich weit draußen abgespielt. Die überwältigende Majestät der Berge milderte seine Tragik.
Die Parteiführer hatten hier Abwechslung und Zerstreuung gesucht. Verwundete waren hergeschickt worden zur Genesung; sie sollten vergessen, wenn sie konnten. Bis zuletzt hatte Goebbels die Kontrolle über Radio und Presse in der Hand behalten; Verfolgungen, Foltern und Konzentrationslager blieben düstere Legenden, die langen Listen der Toten, der Niederlagen und der zerstörten Städte wirkten fast wie Reiseberichte – furchtbar, aber wie aus einer anderen Welt.
Das Leben im Tal spielte sich nach uraltem Rhythmus ab. Der Winter ging vorüber, die Hänge wurden wieder grün, und die Herden zogen bis zur halben Berghöhe hinauf. Die Bauern kamen immer noch mit Milch, Fleisch und Eiern auf den Markt. Die Genesenden spazierten zwischen Schatten und Sonnenschein auf der Promenade umher und lagen mit den liebeshungrigen Mädchen im Gras. Zum Rauschen der Wassermusik klang die Axt von den Hängen. Mit dem Ende des Sommers kam die zweite Heuernte; die Frauen in ihren bunten Dirndln bündelten das Gras und hängten es zum Trocknen auf die Pfähle. Um die Zeit des ersten Frostes kam der Almabtrieb; das Vieh war mit den letzten Blumen des Jahres und farbigen Papierbändern bekränzt, und die beste Milchkuh trug einen besonders großen, bunten Kopfputz und klapperte triumphal mit ihrer Glocke.
Glocken! Auch sie waren ein Teil des Lebens in diesem Tal – ein Teil seines Friedens: das monotone und doch melodische Geläut der Kuhglocken auf den Almen, das Schlittengeläut im Winter, das Angelusläuten, das morgens, mittags und abends vom Kirchturm ertönte, das Klingen der kleinen silbernen Glöckchen, wenn Pater Albertus den Leib Christi durch die Felder trug, um die Ernte zu segnen, das langsame, traurige Läuten der Totenglocke, das gegen Ende des Krieges immer häufiger wurde. Die Berge fingen den Klang auf und warfen ihn sich gegenseitig zu; sie schufen ein Gewebe von Tönen, das dem des alten Glaubens glich – vertraut und immer gleich, einmal bedrohlich, dann wieder tröstlich, oft nicht beachtet und niemals ganz vergessen.
Eines Tages war eine Anordnung von der Partei gekommen, daß die Glocken zu schweigen hätten und der Rüstungsindustrie gespendet werden sollten. Dem jedoch hatte sich Pater Albertus widersetzt, wie er sich manchen anderen Forderungen widersetzte, und am Ende hatte er gesiegt. Es war ein dürftiger Sieg im Vergleich zu dem großen Kompromiß, den er wie alle anderen eingehen mußte. Doch er war froh, daß er diesmal gewonnen hatte: Die Glocken hatten geholfen, die schwache Illusion des Friedens in dem Tal beinahe bis zum Schluß zu erhalten.
Jetzt waren alle Illusionen hinfällig geworden. Die Wälle waren durchbrochen; die Eroberer strömten herein. Ein blonder junger Mann saß mit einer Handvoll Soldaten in dem Hotel, das Reichsmarschall Göring bewohnt hatte, und ein unbekannter Offizier mit unheilvoll klingendem Titel fuhr die Straße herauf, um seine Herrschaft über die Berge anzutreten.
Bürgermeister Max Holzinger überlegte, wie er ihn begrüßen sollte und welche Antwort er zu erwarten hatte. Über eins war er sich im klaren: seine Würde mußte er wahren; sie war das letzte Gut der Besiegten.
Er hatte schon einmal erfahren, was es hieß, besiegt zu sein.
Im Ersten Weltkrieg hatte er in einem Kärntner Kavallerieregiment gekämpft; von einer Kugel, die sein Knie getroffen hatte, hatte er ein steifes Bein zurückbehalten. Er wußte, was es bedeutete, wenn ein Mann von verlorenen Schlachten erzählen mußte und von schmachvollem Überleben der Geschlagenen. Vae victis! Die Geschichte verzieh nur den Siegern.
Er wußte besser als jeder andere, daß es diesmal noch schlimmer werden würde. Die Geister der Toten klagten an. Die Überlebenden krochen aus Kellern und Konzentrationslagern. Schon versammelten sich die Richter – hart und mitleidslos. Männer wie er selbst, die ihre Augen in vager Hoffnung viel zu lange geschlossen hatten, würden als Mitschuldige angeklagt werden. Sie hatten von den Früchten der Eroberung gegessen; jetzt mußten sie den Staub der Erniedrigung schlucken.
Er starrte in die weiße Landschaft und wünschte, daß der Tag zu Ende wäre.
Er war mittelgroß und hatte trotz seiner fünfzig Jahre tiefschwarzes Haar. Den schmalen magyarischen Kopf und das intelligente Gesicht hatte er von seiner Mutter, einer geborenen Harsanyi aus Budapest. Sie hatte Gerhardt Holzinger aus St. Veit an der Glan geheiratet. Er selber hatte eine Hamburgerin geheiratet, eine hochgewachsene, kräftige Blondine. Sein Sohn war bei der ersten Landung auf Kreta gefallen. Sie hatten noch eine Tochter, brünett, schlank und vital. Sie hatten sie Irmtraud genannt, denn damals waren Walkürennamen Mode. Doch paßte der Name nicht recht zu ihrer unruhigen, zigeunerhaften Schönheit. Sie war sechsundzwanzig – reif zum Heiraten; aber die Männer, die in Frage gekommen wären, waren tot oder in Gefangenschaft und schlugen sich, heruntergekommen und abgerissen, durch das Land.
Holzinger trat vom Fenster zurück und sah, daß die beiden in ihren Sesseln saßen und ihn beobachteten.
Seine Frau saß friedlich über einer Handarbeit. Doch ihre Hände waren unsicher, und sie blickte zuweilen besorgt von der Arbeit auf und zu ihm hinüber. Ihr Haar wurde allmählich grau und ihre Taille stärker, aber sie war nach all den Jahren und trotz all der Sorgen noch immer robust und stattlich. Holzinger spürte ein wehmütiges Gefühl in sich aufsteigen, als er, voller Sorge über die ungewisse Zukunft, sich an die Zeit erinnerte, da sie beide jung gewesen waren.
Irmtraud saß ausgestreckt in ihrem tiefen Lehnstuhl und rauchte. Sie trug Schikleidung, die ihre langen schlanken Beine, den flachen Bauch und ihre jugendlichen Brüste betonte. Ein boshaftes Lächeln spielte um ihre vollen Lippen; ihre Augen hatten einen halb feindseligen, halb belustigten Ausdruck.
Holzinger fragte sich, wie man den jungen Leuten diese Dinge erklären sollte – Niederlage, Verzweiflung, Enttäuschung und Ernüchterung ...
Er stand den beiden Frauen gegenüber und blickte sie an, die Füße leicht gespreizt, um das steife Bein zu entlasten. Er sprach ruhig und wog jedes Wort sorgfältig ab, als fürchte er, sie würden ihn mißverstehen.
»Ich glaube, ihr solltet beide wissen, wie unsere Lage wirklich aussieht.«
»Aber das wissen wir doch«, entgegnete seine Frau mit ihrer gewohnten tiefen, gelassenen Stimme.
Er schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, es ist schlimmer, als ihr glaubt, Liesl.«
»Schlimmer? Wieso?« Seine Tochter richtete sich mit einem Ruck auf; ihre Stimme war vor Neugier scharf und hart.
»Als Parteigenosse werde ich bestimmt mein Amt verlieren. Unser Geld und unser Besitz können konfisziert werden.«
»Du lieber Gott!« Liesls Lippen zitterten; sie beugte sich schnell über ihre Arbeit, um ihre Tränen zu verbergen.
»Aber das können sie doch nicht tun!« Traudls Stimme klang zornig und bestimmt.
»Sie können tun, was sie wollen, Kind«, erklärte Holzinger ernst. »Wir sollten Gott danken, daß wir die Engländer haben und nicht die Russen. Sie respektieren das Recht und die Rechte des einzelnen. Mehr als wir, glaube ich. Allerdings ...« Er zögerte einen Augenblick. »Ich habe einige Vorkehrungen getroffen. Kunzli hat mir eine Schenkungsurkunde ausgestellt; danach bist du, Liesl, Eigentümer dieses Hauses. Die Urkunde ist zurückdatiert auf 1938. Ich hoffe, sie wird einer Nachprüfung standhalten – es sei denn, Kunzli zeigt mich an. Zuzutrauen wäre es ihm. Den übrigen Besitz werden wir ihnen wohl überlassen müssen, wenn sie Anspruch darauf erheben.«
»Und was wird dann aus uns?« Das Mädchen fragte so kühl, als handelte es sich um eine ganz alltägliche Angelegenheit.
»Wir werden es überleben, meine Liebe.« Er lächelte mit leichter Ironie zu ihr hinüber. »Was auch geschieht, verhungern werden wir schon nicht. Ich kann immer noch Arbeit finden – Schnee kehren vor den Hotels oder Kies streuen auf den Promenadenwegen. Unseren Stolz können wir für später aufheben und ...«
Das Telefon klang schrill durch den Raum. Holzinger lief zum Tisch und nahm den Hörer ab. Die Frauen sahen ihm gespannt und mit großen Augen zu.
»Hier ist Holzinger ...«
Sie sahen, während die fremde Stimme im Apparat sprach, daß sein Gesicht alle Farbe verlor. Sie beugten sich vor, um mitzuhören, konnten jedoch nichts verstehen.
»Wann? Wo? Um Gottes willen! Ja, natürlich, ich komme sofort. Auf Wiedersehen.«
Er legte den Hörer auf und wandte sich um. Sein Gesicht war fahl. An den Schläfen sammelten sich kleine Schweißtropfen. Seine Frau kam aus ihrem Sessel auf ihn zu, doch er schob sie mit einer knappen Handbewegung zurück.
»Was ist, Max? Was ist geschehen?«
»Das Schlimmste, Liesl, das Allerschlimmste.« Er strich sich mit der Hand müde über die Stirn. »Der Kommandant der Besatzungsmacht ist eingetroffen. Auf dem Wege hierher wurde sein Fahrer erschossen, von einem Schiläufer in Gebirgsjägeruniform. Ich soll sofort zu ihm kommen.«
Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und ging aus dem Zimmer. Die beiden Frauen sahen ihm mit weiten erschrockenen Augen nach. Als die Tür ins Schloß fiel, schauten sie einander an, und dann begrub Liesl Holzinger ihr Gesicht in den Händen und weinte. Ihre Tochter kniete neben ihrem Sessel nieder; sie strich ihr langsam über das Haar und beruhigte sie mit kleinen zärtlichen Worten, die aufstiegen aus ihrer vergessenen Kindheit.
Nach einer Weile hörte Liesl auf zu weinen und hob den Kopf. Das Mädchen wischte ihr mit einem Spitzentaschentuch die Tränen aus dem Gesicht. Ihre Mutter beugte sich vor und faßte sie mit fiebrigen Händen an den Schultern. Ihre Stimme klang schleppend und bitter; die Augen hatten einen seltsamen, fremden Ausdruck.
»Zum zweitenmal in meinem Leben muß ich das mit anschauen. Zweimal sind die Männer von hier und aus meiner Heimat in den Krieg gezogen und haben ihn verloren. Man nahm uns unsere Männer, unsere Brüder und unsere Söhne und trieb sie in den Tod an irgendeiner Küste oder in der Steppe. Die, die übrigblieben, kamen nach Hause gehumpelt, wie dein Vater. Sie haben wieder mit uns geschlafen, und wir haben ihnen Söhne geboren, nur um auch sie zu verlieren. Sie bauten uns Häuser, die wieder zerstört wurden. Wir pflanzten Gärten und finden sie zertrampelt von neuen Armeen. Jetzt sind wir zu alt, um noch Kinder zu bekommen, und ich glaube auch zu müde, um wieder aufzubauen.«
»Nein, Mutti!« Traudl machte sich frei aus ihrem Griff und trat zurück.
»Doch!« entgegnete Liesl ungeduldig und unnachgiebig. »Doch! Sie schmeißen alles durcheinander und erwarten, daß wir aufräumen. Sie hinterlassen Ruinen und erwarten, daß wir sie wiederaufbauen. Aber bei ihren Entscheidungen haben wir nicht mitzureden. Solange sie siegen, gehört die Welt den Männern. Nur in der Niederlage, da gehört sie den Frauen, denn die besten Männer sind dann tot.
Die Lippen, die du hättest küssen können, sind kalt. Die Arme, die dich hätten halten können, liegen begraben unter dem Schnee. Den Körper, der dich hätte wärmen können, haben die Wölfe gefressen. Krüppel und Alte sind geblieben; Männer, von denen du Kinder bekommst, die du nicht liebst, weil ihre Umarmung ohne Leidenschaft ist. Die Wertvollen, die mit den Eroberern hätten verhandeln können, die mit ihnen zusammen einen neuen Glauben hätten aufrichten können, sind tot. Nur Millionen von Frauen wie du sind übrig. Mache ich dir Angst, Traudl?«
»Nein.« Auf ihren Lippen lag ein ironisches Lächeln. »Du machst mir keine Angst. Alle Männer wollen das gleiche. Es ist unsere Sache, dafür den höchsten Preis zu verlangen. Ich werde genauso gut zurechtkommen wie die meisten Frauen.«
Liesl Holzinger blickte sie überrascht an. Dann lächelte auch sie und nickte langsam. »Ich bin froh. Das macht es leichter für dich – für uns alle.« Mit einer merkwürdig sinnlich-scheuen Bewegung streckte sie ihre Hände aus und ließ sie einen Augenblick auf den schwellenden Brüsten des Mädchens ruhen. Dann strich sie langsam über den flachen Leib und die schlanken knabenhaften Hüften. »Zuletzt siegen doch die Frauen; sie haben die stärkeren Waffen. Die Eroberer kommen an wie die Könige und liegen bald wie Kinder in deinen Armen, nackt und bloß, die Lippen an deiner Brust. Sie sind jung, sie sind einsam und sie sind unsicher, weil sie hier Fremde sind und fern von zu Hause. Das Leben, das sie dir bringen, stehlen sie ihren eigenen Frauen, und das ist deine Rache für alles, was du verloren hast, deine Rache für die Verblendung unserer eigenen Männer, die hinter den Fahnen herliefen, während du allein in deinem Bett lagst und weintest. Kannst du das verstehen?«
Das Mädchen stand mit großen Augen vor ihr, verwundert über den ungewohnten Redefluß ihrer Mutter und leicht erregt durch die Berührung ihrer Hände. Sie nickte. »Ja, ich verstehe. Nur – nur ...«
»Was ist, Kind?«
»Woher weißt du das alles? Wie kommt es, daß du so fühlst?«
Ein schwaches Lächeln lief über Liesl Holzingers müdes Gesicht. Sie schien über ihre Tochter hinwegzublicken, über das Tal und die Berge, zurück in eine vergangene Zeit, ein fernes Land. Sie zog ihre Tochter an sich und hielt den dunklen Kopf gegen ihre Brust.
Dann gab sie ihr in einfachen Worten die Antwort.
Als Holzinger die Stufen zum Eingang des Hotels Sonnblick hinaufging, traten zwei Wachtposten vor und versperrten ihm mit gekreuzten Seitengewehren den Weg. Sie waren bis über die Ohren eingepackt in Überrock, Handschuhe und Pelzmütze; aber ihre Gesichter waren von der Kälte angegriffen und ihre Augen ausdruckslos. Selbst als er sich in korrektem, wenn auch unsicherem Englisch ausgewiesen hatte, ließen sie ihn draußen im Wind stehen, während einer von ihnen hineinging und den Sergeanten der Wache holte.
Dieser fragte ihn eingehend aus, bevor er ihn endlich in das Hotel ließ. Als sie durch die Empfangshalle zum Aufzug gingen, sah er den Direktor, Franz Mayer, und Wilhelm, den alten Dienstboten, hinter den Palmenkübeln stehen und zu ihm herüberspähen. Er nickte ihnen kurz zu, worauf sie sich weiter zurückzogen und wie Kaninchen in ihrem Bau verschwanden. Mit trübem Lächeln blickte er ihnen nach.
Helmut, der kleine Liftboy, bot ihm ein schüchternes »Grüß Gott«, und Holzinger zauste ihm väterlich das Haar, als sie hinauffuhren in den fünften Stock. Er dachte nicht ohne Bitterkeit daran, daß diese Zimmer früher stets für hohe Würdenträger reserviert waren.
Trotz der Brennstoffknappheit war die Zentralheizung voll aufgedreht, und in den großen Steinvasen standen frische Gewächshausblumen. Mayer war, in der Tat, ein Hotelier, der sich auf gepflegten Service verstand.
Der Sergeant führte ihn mit schnellen Schritten über den mit Teppichen ausgelegten Korridor und hielt vor der Suite, die Reichsmarschall Göring keine zwölf Monate zuvor bewohnt hatte. Er drückte auf die Klingel, und eine gedämpfte Stimme rief: »Herein!« Der Sergeant öffnete die Tür und trat zur Seite, um Holzinger eintreten zu lassen. Dann schloß er die Tür, salutierte und erstattete Meldung:
»Dies ist der Bürgermeister. Er sagt, Sie haben ihn hierher bestellt.«
»Danke, Jennings. Sie können gehen.«
»Zu Befehl, Sir.«
Er salutierte noch einmal, die Tür öffnete und schloß sich wieder, dann stand Bürgermeister Max Holzinger dem Vertreter der Besatzungsmacht gegenüber.
Dieser saß an einem großen, mit Einlegearbeit verzierten Schreibtisch, mit dem Rücken zum Fenster, so daß die Linien über seinen braunen Augen und die Falten um seinen breiten Mund im Schatten noch tiefer erschienen. Er hatte eine hohe Stirn und eine kräftige Nase; in seinem widerspenstigen Haar zeigten sich die ersten grauen Strähnen. Holzinger schätzte ihn trotz allem auf höchstens dreißig Jahre.
Er war frisch rasiert, trug eine neue Uniform und ein gestärktes Hemd. Auf seinen Schultern glänzten die Rangabzeichen eines Majors, kleine Kronen aus Kupfer. Seine langen, ausdrucksvollen Hände lagen locker auf einer Leinenmappe vor ihm auf dem Schreibtisch.
Der Captain mit dem strubbeligen Haar, der mit der Vorausabteilung angekommen war, stand neben ihm. Holzinger verbeugte sich förmlich. Er wartete darauf, daß sein Gegenüber die Partie eröffnete.
»Mein Name ist Hanlon; Kommandant der Besatzungsmacht in diesem Bezirk. Wie ich sehe, sind Sie Bürgermeister Max Holzinger. Nehmen Sie bitte Platz.«
Die Stimme klang schroff und befehlsmäßig. Er sprach ein fehlerloses, flüssiges Deutsch mit leichtem Wiener Akzent. Holzinger war überrascht, ließ sich jedoch nichts anmerken und nahm Platz. Hut und Handschuhe legte er auf die Ecke des Schreibtisches und wartete wieder.
Hanlon schlug die Leinenmappe auf und breitete die Akten vor sich aus. Er fragte in unpersönlichem Ton: »Sie kennen die Verordnung über den Waffenstillstand und die Stellung der Besatzungsmächte?«
»Ich habe sie noch nicht bekommen.«
»Gut. Also erstens: Österreich ist von Armee-Einheiten der vier Alliierten besetzt; Engländer, Franzosen, Amerikaner und Russen. Bad Quellenberg gehört zur Britischen Besatzungszone.«
»Ein Glück für uns«, bemerkte Holzinger leise.
Hanlon überging das und fuhr im gleichen unbeteiligten Ton fort: »Für Verpflegung, Unterbringung, Transport und Unterhalt der Besatzungstruppen kommt die österreichische Regierung auf, unter Beteiligung der örtlichen Behörden. Der Vertreter der Besatzungsmacht hat das Recht, Besitz oder Vorräte zu beschlagnahmen, wenn er es für nötig hält. Er hat das Recht, Arbeitskräfte aus seinem Bezirk einzuziehen und die entsprechende Bezahlung festzusetzen. Die örtliche Verwaltung und die örtlichen Polizeieinheiten werden aufgefordert, zur Aufrechterhaltung der Ordnung sowie zur Aufdeckung von Kriegsverbrechen und bei der Fahndung nach den Tätern mit dem Vertreter der Besatzungsmacht zusammenzuarbeiten. Drücke ich mich verständlich aus?«
»Vollkommen verständlich. Sie sprechen ein ausgezeichnetes Deutsch.«
»Danke.« Hanlons Augen behielten ihren kühlen Blick, die Stimme ihren unpersönlichen Klang. »Der Vertreter der Besatzungsmacht wird seinerseits alles in seinen Kräften Stehende tun, um die Ordnung wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten und beim Wiederaufbau der örtlichen Industrie und bei der Rückführung und Neubeschäftigung der entlassenen Soldaten – mit Ausnahme von Kriegsverbrechern – behilflich zu sein. Dies alles gilt unter Vorbehalt derjenigen Anordnungen, die der Oberkommandant des Besatzungsgebietes erläßt.« Er schloß die Mappe und beugte sich vor über den Schreibtisch, wobei er mit seinen braunen Augen den Bürgermeister, der mit unbewegter Miene vor ihm saß, forschend anblickte. »Ich werde Ihnen eine Abschrift der Verordnung zuschicken. Sie werden einige Stunden brauchen, um sie gründlich durchzuarbeiten. Aber im Grunde läuft alles auf das folgende hinaus: Die Österreicher haben Sympathien bei den Alliierten. Arbeiten sie mit uns zusammen, wird es ihr Vorteil sein. Widersetzen sie sich, dann zu ihrem eigenen Schaden.«
»Eines haben Sie vergessen, Herr Major.« Holzinger sprach ruhig, aber entschieden, galt es doch, die eigene Würde zu wahren und den neuen Herren den nötigen Respekt entgegenzubringen.
»Und das wäre?«
»Wie ich gehört habe, dürfen frühere Parteigenossen keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden und werden ersetzt durch Leute, die nicht in der Partei waren. Ich selber war seit Jahren Mitglied der Partei; ich denke, ich sollte Ihnen meinen Rücktritt anbieten.«
Hanlon verzog die Mundwinkel zu einem diskreten Lächeln; seine braunen Augen leuchteten belustigt auf. »Es ist dem Bezirkskommandanten freigestellt, diese Dinge eine Zeitlang schweigend zu übergehen«, sagte er milde. »Ich bin dafür, es in diesem Fall zu tun, und möchte Sie bitten, bis auf weiteres im Amt zu bleiben.«
»Und wenn ich es ablehne?«
»Damit würden Sie sich selber und Ihrer Stadt keinen guten Dienst erweisen.«
»In diesem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als anzunehmen.«
»Ich wußte, daß Sie das einsehen würden«, sagte Mark Hanlon nachsichtig. »Und nun ...« Er lehnte sich in den Sessel zurück. Seine Augen hatten wieder ihren strengen Ausdruck angenommen, und er preßte seine Lippen zusammen, bevor er voller Bitterkeit fortfuhr: »Unsere Zusammenarbeit beginnt mit einem Mord ...«
Holzinger nickte ernst: »Ich habe davon gehört. Ich – ich bitte Sie: Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, daß es mich tief beschämt und mir aufrichtig leid tut.«
»Das glaube ich Ihnen«, entgegnete Hanlon kurz. »Ich nehme an, daß ich bei meinen Bemühungen, den Mörder zu finden und ihn der Justiz zu übergeben, auf Ihre Unterstützung rechnen kann.«
»Sie können unbedingt darauf rechnen. Wenn Sie mir eine genaue Beschreibung des Täters und des Tatortes geben, werde ich mich sofort mit der Polizei in Verbindung setzen und die Almhäuser durchsuchen lassen.«
»Gut.« Hanlon nickte kurz und sprach hastig weiter. »Captain Johnson hier wird Ihnen eine detaillierte Beschreibung übergeben; ich habe sie ihm eben diktiert. Unser Standort auf der Straße ist auf der Karte, die er Ihnen gleichfalls geben wird, eingezeichnet. Die Polizei habe ich von hier aus schon telefonisch benachrichtigt. Ich habe sie gebeten, das Gebiet sofort abzusuchen. Es hat noch nicht wieder geschneit; die Schispuren müßten also deutlich zu erkennen sein. Der Mann stammt aus Quellenberg; es dürfte nicht so schwierig sein, ihn in seinem Versteck aufzustöbern. Er wird ja wohl auffallen mit seiner breiten Narbe im Gesicht.«
»Woher wissen Sie, daß er aus Quellenberg stammt?« fragte Holzinger überrascht.
»Ich habe sein Truppenabzeichen gesehen. Es ist das des Quellenberger Regiments, das fast vollständig aufgerieben wurde, in der Ukraine. Er ist ein ausgezeichneter Schiläufer und fuhr den Hang hinab, als ob er ihn seit seiner Kindheit kannte. Er ist aus dieser Gegend, daran besteht gar kein Zweifel.«
»Sie sind ein äußerst tüchtiger Offizier«, stellte Holzinger etwas gezwungen mit Bewunderung fest.
»Es freut mich, daß Sie das einsehen. Sie werden es hoffentlich auch der Polizei klarmachen. Ich wünsche, daß mir zweimal am Tag Bericht erstattet wird, und zwar mit genauen Angaben an Hand der Karte. Wenn nötig, muß man die Jäger und Holzfäller aus Quellenberg und der Umgebung zu den Nachforschungen mit heranziehen. Ich will, daß dieser Mann gefunden wird; Sie haben dazu achtundvierzig Stunden Zeit.«
»Ich werde mein Bestes tun.«
»Sie selber werden jeden Morgen um neun Uhr dreißig hier sein und mit mir die Angelegenheiten, die die Stadtverwaltung betreffen, durchsprechen.«
»Wünschen Sie sonst noch etwas?«
»Ja. Ich wünsche, daß der Pfarrer der Gemeinde im Laufe des Nachmittags, wann es ihm paßt, zu mir kommt.«
»Der Pfarrer?« Wenngleich Holzinger seine Neugier zu unterdrücken versuchte, konnte er nicht umhin, diese Frage einzuwerfen.
Hanlon nickte. »Ja. Sergeant Willis war Katholik. Wir haben keinen Kaplan. Ich möchte, daß er kirchlich begraben wird. Außerdem ...« Er hielt zögernd inne, und Holzinger kam ihm mit leiser Stimme zu Hilfe: »Ich stehe zu Ihren Diensten, Herr Major.«
»Wir brauchen einen Sarg«, fuhr Hanlon kühl und sachlich fort. »Er muß heute, bis zwanzig Uhr, im Hotel abgeliefert werden. Dann brauchen wir sechs Träger, und zwar die angesehensten Bürger der Stadt. Alle Läden und Geschäfte haben morgen geschlossen; die Bewohner werden vom Hotel bis zum Friedhof die Straße säumen. Der Trauerzug verläßt das Hotel um neun Uhr; der Sarg wird zur Totenmesse in die Kirche getragen. Danach findet im Kirchhof von Sankt Julian die Beerdigung statt. Sie sorgen dafür, daß für die letzten Zeremonien ein Totengräber zur Stelle ist. Das ist für den Augenblick alles.«
Jedes Wort war ein Schlag ins Gesicht, und im letzten Satz kam die ganze Verachtung zum Ausdruck. Holzinger erhob sich und sah dem Vertreter der Besatzungsmacht gerade ins Gesicht. So sehr er sich bemühte, er konnte seine Erregung nicht verbergen; seine Stimme zitterte, als er jetzt sprach.
»Wir werden da sein, Herr Major, wie Sie befehlen. Wir wären sowieso gekommen, auch ohne Ihren Befehl. Sie sind neu hier. Man kann nicht erwarten, daß Sie wissen, was das Begräbnis eines Soldaten für uns bedeutet. Die meisten unserer jungen Männer starben in der Fremde, und wir wissen nicht, wo sie begraben liegen – ob sie überhaupt begraben sind. Wir haben ein Herz für Soldaten – für alle Soldaten. Arme Kerle, einer wie der andere. Wir wünschten, sie lägen alle in einer freundlichen Erde, begraben beim Klang von Kirchenglocken. Wir werden dasein, Herr Major, alle, ohne Ausnahme.«
Er verbeugte sich und wandte sich um. Mark Hanlon starrte ihm nach, als er steif und aufrecht zur Tür humpelte. Dann schlug er die Faust auf den Tisch und fluchte:
»Zum Teufel mit ihm! Zum Teufel mit ihnen allen!«
Der junge Captain sah ihm erstaunt und leicht belustigt zu. Er war dreiundzwanzig – zu jung, um zu hassen, und für Mitleid noch nicht reif.
2
Karl Adalbert Fischer war Polizeichef in Bad Quellenberg. Er war klein und untersetzt, und sein schmaler Kopf bildete einen merkwürdigen Kontrast zu seinem gedrungenen Körper. Er hatte kurze Arme, einen langen Hals und klare, scharfe Vogelaugen. Wenn er in seinem langen Mantel und seiner hohen Schirmmütze durch die Stadt ging, sah er einer Ente sehr ähnlich.
Leutselig wie er war, besaß er eine Vorliebe für dralle Bauernmädchen und Schnaps. Seinen Dienst versah er mit genialer Großzügigkeit, und dieser Eigenschaft hatte er nicht nur seine Beliebtheit bei den Quellenbergern zu verdanken, sondern auch die Tatsache, daß er in den letzten fünfzehn Jahren unbehelligt geblieben war: Er hatte ein gutes Dutzend Säuberungsaktionen der großdeutschen Verwaltung überstanden und damit gerechnet, sich dank seiner Geschicklichkeit und Erfahrung bis zur Pensionierung ungestört im Amt zu halten. Jetzt war er sich seiner Sache nicht mehr so sicher.
Als Max Holzinger sein Büro betrat, wärmte er gerade sein Hinterteil am Ofen, mit einem Schnapsglas in der Hand, den Mund voller Kuchen. Er machte eine unbestimmte Handbewegung und murmelte: »Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Schenk dir ein und wärm dich auf.«
Holzinger warf seinen Hut auf den mit Papieren bedeckten Tisch und zog seine Handschuhe aus. Er goß sich ein Glas der klaren Flüssigkeit ein und leerte es in einem Zug.
Der kleine Polizeibeamte beobachtete ihn aus schlauen, aufmerksamen Augen. Er grinste: »Du bist aufgeregt, mein Lieber. Ich nehme an, du kommst eben von dem Engländer.«
»Das stimmt. Der Kommandant sagte, er hätte mit dir telefoniert.«
»O ja, er hat mit mir telefoniert.« Fischer unterdrückte ein Lachen und schluckte an seinem Schnaps. »Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz. Er spricht wie ein Wiener.«
»Das ist kein Scherz. Ihm ist es sogar sehr ernst.«
»Ich weiß. Ich habe ihm schon unsere volle Unterstützung zugesichert und unseren aufrichtigen Wunsch, ihm zu helfen.«
Holzinger sah ihn scharf an. »Unterschätze ihn nicht, Karl. Er ist intelligent und tüchtig. Er weiß, was er will, und wird alles dransetzen, es zu bekommen. Dieser – dieser Mord bedeutet einen schlechten Anfang für uns.«
»Einen sehr schlechten Anfang.« Fischer stellte sein Glas nieder und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund. »Ich habe meine Leute ausgeschickt, damit sie die Spuren untersuchen. Ich hoffe, sie kommen vor Einbruch der Dunkelheit an.«
»Vor Einbruch der Dunkelheit?« Holzinger sah ihn überrascht an. »Es ist doch kaum Mittag, und der Tatort ist keine zehn Kilometer von hier entfernt.«
»Der Wagen ist alt«, meinte Fischer. »Die Reifen sind abgefahren. Das Steuer ist auch nicht in Ordnung, und die Straße ist vereist. Wenn sie einen Unfall haben, müßten die Leute zu Fuß gehen – und die Besatzungsmacht müßte uns einen neuen Wagen besorgen. Wir könnten ihn wirklich gebrauchen! Außerdem«, er ließ seinen komischen Kopf sinken und zog die Luft durch die Nase ein, »dürfte es am Nachmittag Schnee geben. Wenn er früh genug kommt, gibt es keine Spuren mehr.«
Holzinger starrte ihn ungläubig an, mit einer Mischung von Ärger und Verwunderung. »Karl, die Situation ist wirklich ernst; mit dieser Angelegenheit kannst du nicht herumspielen.«
»Ich spiele nicht.«
»Was denn? Dies ist Mord – und wir beide sind dem Kommandanten gegenüber verantwortlich.«
Fischer entnahm seinem Lederetui eine Zigarette und klopfte damit nachdenklich auf seinen Daumennagel. Seine Augen blickten ausdruckslos ins Leere. »In den letzten zehn Jahren sind viele Morde geschehen, Max«, sagte er bitter. »In gewisser Hinsicht sind wir dafür ebenfalls mitverantwortlich. Ich sehe nicht ein, warum so ein armer verrückter Teufel für sie alle hängen soll.«
»Er hat einen Engländer getötet.«
»Bis vor wenigen Monaten wurden sie genau dafür bezahlt – und wenn sie es nicht getan hätten, wären sie erschossen worden. Vielleicht wußte er nicht, daß der Krieg zu Ende ist.«
»Das Gericht würde das ...«
»Das Gericht!« Der kleine Kopf fuhr in die Höhe. »Das Standgericht, meinst du. Wo die Richter sitzen mit dem Gestank der Krematorien und Konzentrationslager in der Nase und uns alle in einen Topf werfen als Henker und Folterknechte! Ich kann es ihnen auch gar nicht verdenken. Nur, ich werde ihnen diesen Jungen nicht ans Messer liefern. Schau ...« Er ging zu der anderen Seite des Zimmers, an deren Wand noch immer eine Karte mit den Schlachtfeldern Europas hing, die mit kleinen bunten Fähnchen markiert waren. Die Fähnchen hingen traurig herab, und die Karte war bedeckt mit Spritzern von Wein und Kaffee, die von der letzten verzweifelten Feier vor dem Waffenstillstand herrührten.
Es war typisch für Fischer, daß er nicht daran gedacht hatte, sie abzunehmen. Nun stand er daneben und zog die Linien mit seinem kurzen Zeigefinger nach, während ihm der Bürgermeister mit wachsender Verwunderung zusah.
»Ich werde dir zeigen, woher er kam, und du sollst hören, was er unterwegs erlebt hat. Er fing an in der Ukraine, in Mukachevo, dem Feldlazarett für unsere Quellenberger Jungen. Er war Arzt, weißt du, ohne große Erfahrung. Aber unsere Jungen waren ja alle nicht alt, nicht wahr? Er hatte bald mehr Erfahrung, als er wünschen konnte: Amputationen, Bauchschüsse, Erfrierungen, Typhus und all die anderen verdammten Sachen, die anfielen, als die Iwans uns auf der ganzen Front zurückdrängten. Als das Regiment abgeschnitten war, arbeitete er Tag und Nacht weiter, ohne Medikamente, ohne Betäubungsmittel, bis er mit dem Gesicht in das Blut eines Toten fiel und liegenblieb. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, denn als die Kosaken durchbrachen, zogen sie schreiend und grölend mit ihren Bajonetten durch die Lazarette. Daher hat er die Narbe im Gesicht. Wäre er wach gewesen, hätte er es in den Bauch gekriegt. Als er zu sich kam, lag er unter den Toten, und selbst als er schrie, hörte ihn niemand, denn die Kosaken waren schon weitergezogen, und über die Steppe fegte der Schneesturm. Die eine Gesichtshälfte war bis zum Kiefer offen, doch hatte die Kälte das Blut gestillt. Er suchte in den Trümmern nach einem Spiegel und nach Nähmaterial und nähte die Wunde zusammen. Dann durchsuchte er die Taschen der Toten nach Brotresten und Zigaretten. Er zog ihnen die wollenen Kleidungsstücke aus und umwickelte seine Beine mit blutiger Unterwäsche. Dann nahm er ein Gewehr, ein Seitengewehr und die Pistole eines Toten und zog los, um sich nach Hause durchzuschlagen. Weißt du, wie lange er brauchte?« Fischer deutete anklagend mit dem Finger auf seinen Freund. »Zwölf Monate! Zweimal haben sie ihn gefangen, zweimal ist er entkommen. Er lief von Mukachevo nach Budapest, durch halb Ungarn. Die Iwans schlossen die Stadt innerhalb einer Woche ein; also machte er kehrt und kam nach Salonta in Rumänien. Dann ging er nach Süden, nach Jugoslawien, und dann nach Norden, nach Kärnten. Er hat drei Leute getötet. Er hat bei Huren geschlafen und Bauernmädchen verführt, damit sie ihm Essen gaben und ihn versteckten. In Jugoslawien fingen ihn die etniks und folterten ihn so, daß er für keine Frau mehr taugt. Danach lachten sie und warfen ihn zum Sterben vor die Tür. Wie durch ein Wunder blieb er am Leben, seine Wunden verheilten, aber sein Gesicht ist durch die Narbe entstellt wie eine Krampusmaske. Und wie alle gejagten, hungrigen Männer wurde er fast verrückt. Er sah Feinde hinter jedem Baum. Er träumt von nichts als Scheußlichkeiten – noch jetzt, obwohl er seit Wochen zu Hause ist. Nachts wacht er schreiend auf. Das Haus ist für ihn wie ein Gefängnis, und manchmal geht er hinaus mit seinem Gewehr und seiner Pistole und streift durch die Berge. Sie haben versucht, ihm seine Waffen abzunehmen, aber dann tobte er wie ein angeschossener Wolf. In letzter Zeit glaubten sie, es ginge besser mit ihm. Die Alpträume wurden seltener. Er wanderte nicht mehr so oft draußen umher. Und dann mußte das geschehen.«
»Du sprichst, als ob du ihn gut kenntest«, sagte Holzinger langsam.
»Ja, ich kenne ihn gut: Er ist der Sohn meiner Schwester.«
»Gott im Himmel!«
»Du – du verstehst jetzt, warum ich nicht will, daß sie ihn finden.«
»Ich verstehe. Nur sehe ich nicht, wie du ihn schützen willst. Die Besatzung kann Jahre dauern.«
Fischers Gesicht nahm einen entschlossenen Ausdruck an. »Ich werde ihn verstecken. Ich bringe ihn von einem Tal ins andere und von einem Bauernhof auf den andern und lasse den Engländer jeden Berg absuchen, nur den richtigen nicht. Wenn es sein muß, verstecke ich ihn zehn Jahre lang; Hanlon wird niemals auch nur auf Schußweite an ihn herankommen.«
»Dergleichen kannst du niemals geheimhalten, Karl. Die Leute reden – unsere eher mehr als andere. Es wird Hanlon zu Ohren kommen, und dann wird er sich an dich halten.«
Das Gesicht des Polizisten entspannte sich wieder. Er nickte gutmütig, schenkte sich einen Schnaps ein und schlürfte ihn bedächtig. Dann ging er auf den kleinen Stahlschrank in der Ecke des Raumes zu, schloß ihn auf und entnahm ihm ein großes in Leder gebundenes Buch. Er trug es zum Tisch und blätterte darin. Holzinger sah, daß Seite für Seite mit einer kleinen deutschen Schrift gefüllt war.
»Was ist das?« fragte er erstaunt.
»Akten, Herr Bürgermeister. Meine persönlichen Notizen über jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Bad Quellenberg. Tatsachen, Klatsch, Vermutungen. Geheimnisse, die mir im Bett anvertraut wurden; Gespräche, die ich auf Beerdigungen belauscht habe. Das steht alles hier. Das meiste habe ich niemals benutzt, aber es ist da, für den Fall, daß ich es brauche.«
»Hast du mich auch dabei?« fragte Holzinger verlegen lächelnd.
Fischer nickte. »Dich und deine Frau und deine Tochter – und deinen Sohn, Gott hab’ ihn selig. Du bist in guter Gesellschaft; du hast die Seite vor Pater Albertus.«
»Hast du Kunzli auch?«
»Kunzli!« Er grinste verächtlich. »Über den habe ich ein langes Kapitel. Warum fragst du?«
»Ich brauche es vielleicht eines Tages«, antwortete Holzinger leise. Fischer machte eine abwehrende Bewegung. »Nicht einmal für dich, Bürgermeister! In diesem Buch steckt die Arbeit eines Lebens. Ich habe meine Informationen niemals benutzt, um jemanden anzuzeigen, und werde es hoffentlich auch niemals tun. Aber meinen Nutzen werde ich doch daraus ziehen – auf die eine oder andere Art.«
»Du ziehst schon jetzt deinen Nutzen daraus, Karl.«
»Wirklich?« Er hob seinen Kopf empor wie ein Vogel, der bereit ist, bei der geringsten Gefahr davonzufliegen.
»Ja. Siehst du, ich habe alles vergessen, was du mir über den Sohn deiner Schwester erzählt hast. Soviel ich weiß, ist er in Rußland gefallen.«
»Gut.« Fischer stieß das Wort mit tiefer Befriedigung aus, während er sich über den Tisch beugte und zwei Gläser Schnaps einschenkte. »Ich wußte, du würdest mich verstehen, Max. Und wenn du mit Kunzli Schwierigkeiten hast, laß es mich wissen.«
»Das werde ich«, erwiderte Holzinger ruhig. »Prost!«
»Prost!«
Sie hoben ihre Gläser und tranken. An der Wand hinter ihnen befand sich die Landkarte; die Weinflecke darauf sahen aus wie vergossenes Blut.
Wir haben es verdient, dachte Holzinger bitter. Wir haben alles verdient, was über uns hereinbricht: die Regierungen, die wir bekommen, die Söhne, die wir verlieren, die Frauen, die uns verraten. Das Joch liegt wieder auf unseren Schultern – und dennoch überlegt jeder im stillen, wie er dem anderen schaden kann. Verflucht – was für erbärmliche Kreaturen!
Er leerte sein Glas, nahm Hut und Handschuhe und ging, den Ablauf des Begräbnisses mit Pater Albertus zu besprechen.
Die Tür des Pfarrhauses wurde ihm von der Haushälterin, einer Witwe mit straffen, geröteten Wangen und scharfer Stimme, geöffnet. Der Pfarrer sei nicht da, erklärte sie; er sei auf dem Kirchhof und schaufele Schnee wie ein gewöhnlicher Arbeiter. Und ehe Holzinger es verhindern konnte, brach sie in lautes Lamentieren aus über die sonderbaren Gewohnheiten des Pfarrers und über die unerträgliche Last, die er damit auf ihre breiten Schultern lade.
»Er bringt sich noch ins Grab, ganz gewiß. So alt wie er ist, könnte er doch wirklich vernünftiger sein. Wer muß ihn pflegen, wenn er sich jetzt eine Lungenentzündung holt? Ich natürlich! Man wird, weiß Gott, schon schwer genug mit ihm fertig, wenn er gesund ist. Ißt wie ein Spatz, verdünnt seinen Wein, daß er wie Spülwasser schmeckt und schläft des Nachts vielleicht zwei Stunden. Ich will ja nichts sagen, wenn er wenigstens mich schlafen ließe. Ich bin zwei Stockwerke unter ihm, aber ich höre doch, wie er ständig auf und ab geht und seine Gebete murmelt. Und manchmal peitscht er sich so heftig, daß seine Hemden blutig sind. Ich muß sie dann waschen. Man braucht ihn nur anzusehen, da weiß man ...«
»Schon gut, schon gut. Das ist nicht meine Sache.« Holzinger hatte mit wachsender Ungeduld zugehört; er hatte selber Sorgen genug, auch ohne diese Klagen über die asketische Lebensweise des alten Pfarrers. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich um und ging. Die Haushälterin schlug die Tür zu; sie ging in ihre Küche zurück und brummte etwas vor sich hin über Amtspersonen, die wichtig tun und deren Frauen daheim sich auch besser aufführen könnten.
Die Quellenberger hatten für die blonde Hamburgerin mit der tiefen Stimme niemals viel übrig gehabt, und die Eskapaden der Tochter bildeten einen willkommenen Gesprächsstoff rund um die Öfen der Bauernstuben.
Holzinger schlug seinen Pelzkragen hoch und steckte die Hände in die Taschen. Er ging mit vorgeschobenem Kopf, den Blick auf das vereiste Pflaster gesenkt. Die Leute auf der Straße grüßten ihn, doch er sah und hörte nichts, und sie gingen weiter und wußten nicht, was sie davon halten sollten – sie kannten ihren Bürgermeister als einen sehr zuvorkommenden Mann, der jeden Gruß erwiderte.
Vor der hohen Mauer, die den Kirchhof von der Straße trennte, trat ihm ein schmächtiges blondes Mädchen in den Weg und streckte ihm einen Strauß Schneerosen entgegen. Mit ihrer hohen Stimme sagte sie:
»Schneerosen, Herr Bürgermeister! Für die Armen, bitte ...«
Holzinger erschrak, als sie so unerwartet vor ihm auftauchte, aber es lag soviel Unschuld in ihrem kleinen verfrorenen Gesicht, daß er sich zu einem Lächeln zwang; er griff in die Tasche und gab ihr einige Münzen.
Sie dankte ihm mit einem Knicks, drückte ihm die Blumen in die Hand und hüpfte davon, auf das Tal zu. Holzinger betrachtete die zierlichen weißen Blüten mit ihren wächsernen Blättern und fragte sich, was er damit anfangen sollte.
Als er in den Kirchhof trat, fiel sein Blick auf das alte holzgeschnitzte Kruzifix, das sich über dem Wald von Kreuzen erhob. In plötzlicher Eingebung legte er die Blumen zu Füßen des Christus nieder, bekreuzigte sich verlegen und entfernte sich mit einem unbestimmten Schuldgefühl, wie ein Junge, den die Mutter über dem Marmeladeglas erwischt hat.
Dann erblickte er Pater Albertus.
Er schlug das Eis von den grauen Steinstufen des Eingangs und schaufelte es hinter dem nächsten Strebepfeiler zu einem Haufen auf. Mit seinem vollen weißen Haar und seinen gebeugten Schultern, dem abgetragenen Mantel und den schweren Stiefeln sah er aus wie einer der alten Bergbauern. Doch als er sich beim Klang der sich nähernden Schritte aufrichtete und umwandte, um Holzinger zu begrüßen, war er ein völlig anderer Mann.
Als erstes bemerkte man die außergewöhnliche Transparenz seines Gesichtes; es war, als brenne hinter seinen klaren Zügen ein Licht – ein Feuer, das langsam das Fleisch aufzehrte, so daß unter der alten durchscheinenden Haut nur die schmalen Knochen übrigzubleiben schienen.