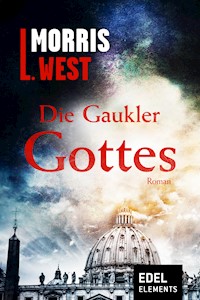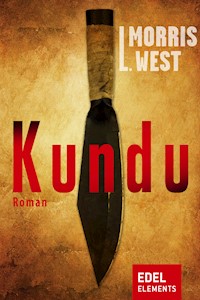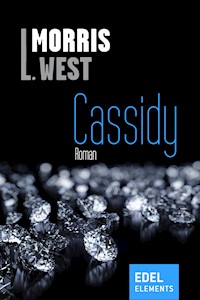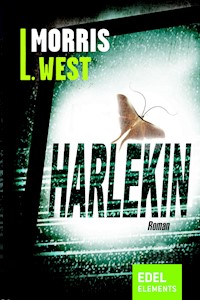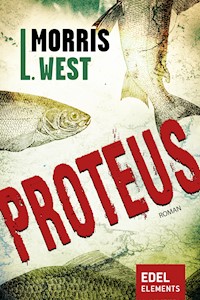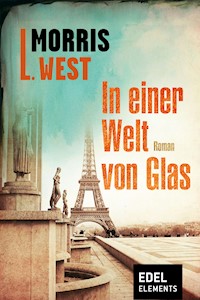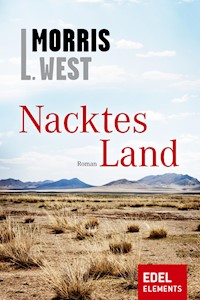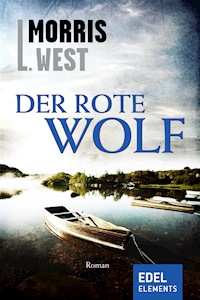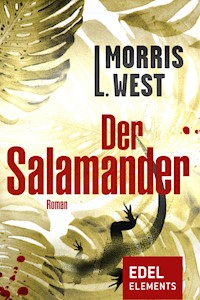Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In den flimmernden, unendlichen Weiten der Südsee liegt südlich von Papeete eine Insel, die den Geographen und Kartographen der zivilisierten Welt bisher verborgen geblieben ist. Zu dieser Insel sind seit jeher die polynesischer Seefahrer, Priester und Seher zur letzten Reise aufgebrochen. Der Erforschung dieser uralten Seefahrer-Kults aus den Südseeinseln hat sich der junge, talentierte Völkerkundler Gunnar Thorkild von der Universität in Hawaii verschrieben. Das Wissen um die Insel hat er von seinem polynesischen Großvater, doch fehlen ihm die Beweise. Um den wissenschaftlichen Nachweis für die Existenz der Insel zu erbringen, begibt sich Thorkild mit seinem internationalen Forscherteam auf die Suche. Unterwegs kommt Thorkilds Großvater, ein alter Seefahrer, an Bord und weist der Mannschaft den Weg zur sagenumwobenen Insel, auf der er sterben will. Die Insel wird tatsächlich entdeckt – doch das Schiff fällt unmittelbar vor der Landung einer mörderischen Flutwelle zum Opfer. Die Überlebenden sind von nun an gezwungen, sich auf der unbewohnten Insel zu behaupten...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Insel der Seefahrer
Roman
Ins Deutsche übertragen von Werner Peterich
Edel eBooks
Dieses Buch widme ich denjenigen unter uns, die,Immer noch Kinder,Selbst am Tor der MitternachtNoch vom Sonnenaufgang träumen.
Irgendeine Insel
Mit dem Schweigen des Meeres darüber
Robert Browning
»Pippa geht vorüber«, Teil 11
Wie es war am Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit
»Gloria«
Im Jahre 1882 berichtete der Agent von Lloyd’s in Rarotonga, daß die Haymet Rocks an die 150 Meilen südsüdwestlich von Rarotonga liegen sollen... Diese Nachricht scheint von der versunkenen Insel Tuanaki auszugehen, die in der Nähe existiert haben soll, aber längst verschwunden ist. Auf der »Fabert« lotete man 24° 07 südlicher Breite und 158° 33 westlicher Länge eine Tiefe von 68 Faden, als man nach einer Insel suchte, die der Überlieferung nach in der näheren Umgebung existieren sollte, von der aber nichts zu sehen war.
»Pacific Islands Pilot« Bd. III, S. 65, Abs. 25
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Impressum
1
Auf dem weißen Strand von Hiva Oa, der hinausführte auf den Mondaufgang und auf die Brecher überm äußeren Riff, saß unter einer Palme Kaloni Kienga, der Seefahrer, und zeichnete Bilder in den Sand. Er war ein alter Mann und geheiligt – geheiligter noch als der Häuptling –, denn er kannte alle Geheimnisse der See: wie der Wind aufseufzte vor einer bösen Bö, wie die Strömungen abbogen, wenn sie an diesem oder irgendeinem anderen Atoll vorüberliefen, und wie das te lapa, der Unterwasserblitz, in zehn Faden Tiefe aufleuchtete, selbst wenn der Himmel um Mitternacht schwarz und sternenlos war.
Die Bilder, welche Kaloni in den Sand zeichnete, waren mystische Zeichen – genauso wie diejenigen, die er auf Armen und Brust tätowiert trug. Ihre Namen wurden nur in der heiligen Sprache der Ahnen genannt. Die steigende Flut würde sie später wieder fortspülen, der Wind ihre Silben verwehen, so daß bis auf die geheiligten Männer niemand sie je verstehen würde.
Für Kaloni war dieses Bilder-in-den-Sand-Zeichnen kein müßiger Zeitvertreib. Es war vielmehr ein schöpferischer Akt, die Erschaffung dessen, was – längst bevor der Same, der ihn geschaffen, in den Leib seiner Mutter eingepflanzt wurde – bestimmt, erträumt worden war und was Wirklichkeit werden mußte. Die Ereignisse, welche er in symbolische Zeichen faßte, mußten geschehen und würden eintreten; er konnte genausowenig etwas an ihnen ändern wie seinen Finger aus dem Sand zurückziehen, ehe nicht das ganze Bild vollendet war.
Der Mond, der heute abend heraufzog, war ein sterbender Mond. An dem Tag, da er neu und jung wieder am Himmel erschien, würde zugleich mit ihm geistergleich das Schiff durch die Fahrrinne gleiten und – die Segel ausgespannt wie die Schwingen eines Seevogels – vor dem Nachtwind hereinlaufen. Er würde die Leinwand knattern hören, wenn das Schiff in der Brise beidrehte, würde die Ankertrosse ausrauschen hören, wenn sie in der Lagune Anker warfen. Schwarz und kahl, mit gerefften Segeln würde es vor der schmalen Sichel des Mondes stehen, am Anker treiben, und seine gelben Lichter würden sich auf dem glatten Wasser spiegeln. Anfangs würde er auch die Stimmen der Mannschaft vernehmen, und danach würde Schweigen eintreten, wenn sie sich niederlegten, um nach der langen Fahrt über den Ozean auszuruhen. Sodann würde schlank wie ein silberner Fisch ein Mann aus dem Schweigen zu ihm kommen: der Verheißene, der Weggenosse, der ihn eine lange Strecke auf seiner letzten Fahrt begleiten würde – bis kurz vor seiner Landung auf jener Insel, wo die Passatwinde zu Hause waren.
Daß er kommen würde, war genauso gewiß wie der Aufgang des Mondes. Gewiß war auch seine letzte Landung: im Heimathafen aller Seekundigen, dem Ort der Heimkehr, der unter der Umlaufbahn des Sirius lag, des Hundssterns, unter dem schimmernden Pfad des Gottes Kanaloa. Kaloni Kienga zeichnete ein letztes Symbol in den Sand, das Zeichen des Schutzgeistes, der ihn bei seiner Ankunft begrüßen würde, um ihn für immer sicher vor jedem Gestörtwerden in seine Arme zu schließen. Dann neigte Kaloni Kienga kniend das Haupt und schlief, bis die steigende Flut seine Fußsohlen netzte.
In derselben Nacht stand zweitausendfünfhundert Meilen weiter im Nordosten James Neal Anderson, der Vorstand des Instituts für Meereskunde der Universität Hawaii, in seinem Garten und beobachtete, wie derselbe Rest des abnehmenden Mondes über der Wahila-Kette aufging. Die linde Luft war geschwängert mit dem Duft von Ingwerblüten, Jasmin und Frangipani. Wo das Licht zwischen Blätter und rankende Orchideen fiel, schimmerte es grüngolden und scharlachrot. Einst hatte er diesen Garten wegen seiner satten Wohlgerüche und seines üppigen Pflanzenwuchses geliebt. Er bot Geborgenheit vor der hektischen Geschäftigkeit und den Intrigen einer großen, vielsprachigen Universität. Später war sein Garten zu einem Ort der Einsamkeit geworden, gefährlich für einen Mann, der nach zwanzig Jahren einer erfüllten Ehe allein zurückgeblieben war. Heute abend sollte der Garten zu einer Hinrichtungsstätte werden.
Es war ein Fehler gewesen, Thorkild ausgerechnet hierher zu bitten. Es gab Dinge, die man am besten in aller Form im Büro des Institutsdirektors erledigte, in der Nähe hilfreicher Ablenkungen durch Telefone, Sekretärinnen und Studenten, die vorsprachen, um ihn zu besuchen. Aber Gunnar Thorkild verdiente etwas Besseres als die unpersönliche Überreichung eines Todesurteils und eine rasche unblutige Hinrichtung. Er war ein viel zu bedeutender Mann, als daß man ihn mit kurzen bedauernden Worten und nichtssagenden Höflichkeitsfloskeln abspeisen konnte.
Gewiß, er war eigensinnig und streitbar, zu polterig bei Auseinandersetzungen und zu ungeduldig, wenn es um die Ansichten seiner Vorgesetzten ging, viel zu wenig gewandt in diplomatischem Verhalten, wie es an einer so großen und empfindlichen Stätte der Gelehrsamkeit an den Kreuzungswegen zwischen Asien und dem Westen erforderlich war. Er war zu schnell aufgestiegen und noch zu jung. Er besaß zu viel Charme für seine Studentinnen und die Frauen der Professoren und nahm zu wenig Rücksicht auf ihre Partner, die weniger ungebunden, weniger hübsch und weniger brillant waren als er selbst. Trotzdem verdiente er Hochachtung, und James Neal Anderson dachte nicht daran, sie ihm zu versagen.
Tanaka, der Hausdiener, kam mit einem Tablett mit Gläsern und Flaschen in den Garten und setzte es auf einen Korbtisch neben einem Ordner nieder, in dem Vergangenheit und Gegenwart von Dr. phil. Gunnar Thorkild aufgezeichnet waren und der alle seine Veröffentlichungen enthielt:
»Lautverschiebungen in den polynesischen Dialekten«, eine »Vergleichende Studie über Mythen und Legenden Ozeaniens«, ein »Handbuch polynesischer Seefahrt« nebst einem Anhang über den »Kult des Seefahrers«.
»Soll ich Ihnen ein Glas einschenken, Doktor?«
»Nein danke, Tanaka. Ich warte, bis unser Gast kommt.«
»Er hat gerade angerufen. Er kommt ein paar Minuten später.«
»Das macht nichts. Ich warte.«
Auf Gunnar Thorkild warten zu müssen war nichts Neues. Er kam zu spät zu Vorlesungen, Sitzungen des Lehrkörpers, Parties, akademischen Feiern; und wenn er schließlich doch kam, dann stets in heller Aufregung und nachlässig gekleidet, setzte ein schiefes Grinsen auf, warf mit einem Ruck seine blonde Mähne zurück und brachte eine weitschweifige und lautstarke Entschuldigung vor, mit der er jedermann auf die Nerven fiel. Wie der Rektor einmal trocken bemerkt hatte:
»Thorkild sieht immer aus, als ob er gerade aus dem Bett käme.« Woraufhin seine Frau anzüglich gemeint hatte:
»Das kommt er ja im allgemeinen auch, mein Lieber. Möchte mal wissen, aus wessen diesmal.«
Vielleicht, so überlegte Anderson und verzog das Gesicht, hätte man sich ihm gegenüber großzügiger gezeigt, wären die Angaben über seine Herkunft in seinem Lebenslauf nicht so überaus deutlich gewesen. Er war der Sohn von Thor Thorkild, einem norwegischen Handelskapitän, und einer Eingeborenen von den Marquesas namens Kawena Kienga, die eine Woche vor Pearl Harbour bei seiner Geburt im Krankenhaus von Honolulu gestorben war. Sein Vater hatte sich selbst samt Schiff der Marine der Vereinigten Staaten zur Verfügung gestellt und das Kind den frommen Schwestern vom Orden des Heiligen Joseph übergeben – und zwar zusammen mit einem Beutel Silberdollar, um damit für die christliche Erziehung des Kindes aufzukommen. Als weder der Vater noch sein Schiff wiederkamen, übernahmen die Nonnen und die Regierung der Vereinigten Staaten den Unterhalt und die weitere Ausbildung des Knaben. Zu ihrer Überraschung mußten sie feststellen, daß sie ein Wunderkind in Händen hatten, das alles Wissen rascher verdaute, als es ihm eingetrichtert werden konnte.
Nach den Schwestern nahmen die Jesuiten sich seiner an, und sechs Monate vor seinem achtzehnten Geburtstag bestand er die Abschlußprüfung des College magna cum laude. Einen Tag nach der Prüfung musterte er als gemeiner Matrose auf einem französischen Frachter an, der nach den Marquesas auslief. Nach seiner Rückkehr fünf Jahre später ließ er sich an der Universität einschreiben, um am Institut für Meereskunde zu studieren. Mit achtundzwanzig war er Dozent für Ethnographie des Pazifik und mit dreiunddreißig Assistenzprofessor. Jetzt hatte er sich neben vier anderen um die Bestallung als Lehrstuhlinhaber beworben. Andersons Aufgabe war es, ihm mitzuteilen, daß seine Bewerbung abgelehnt worden war ...
» Warum, James? Warum?« In sich zusammengesunken hockte Gunnar Thorkild in seinem Sessel: gestreckt ein einsdreiundachtzig Meter langes Bündel Elend und Empörung, das Whiskyglas umklammert, während Anderson mit dem aufgeschlagenen Ordner auf den Knien in sicherer Entfernung von ihm saß.
»Verdammt noch mal, Mann! Nach welchen Kriterien beurteilen sie mich denn? Wenn es um einen akademischen Ruf geht, so wissen Sie, daß er doppelt so gut ist wie der von Holroyd und zehnmal besser als der von dieser blutlosen Auerbach. Was Luton und Samuel betrifft, gewiß, das sind gute Leute. Aber auf dem Gebiet der Feldarbeit sind sie schwach. Sie sind beide nichts weiter als Schreibtischgelehrte. Ich bin dagewesen, James – vom Tuamotu-Archipel bis zu den Gilbert-Inseln! Ich habe gelebt, was ich lehre. Das müßten Sie doch eigentlich am besten wissen.«
»Ich weiß ja, Gunnar. Immerhin habe ich auf Sie gesetzt. Aber Sie wissen schließlich auch, wie diese Berufungen zustande kommen: durch die übereinstimmende Meinung des Lehrkörpers, dem all diese vielen Bürgerrechtsgruppen über die Schulter schauen. Traurig, aber wahr ist es, daß die übereinstimmende Meinung gegen Sie ist.«
»Wer hat denn alles sein Votum abgegeben?«
»Sie wissen doch, daß ich Ihnen das nicht sagen kann. Aber ich will Ihnen die Voten gern vorlesen – ohne Namen zu nennen. Aber ehe ich das tue – wollen Sie sie auch wirklich hören?«
»Darauf können Sie Gift nehmen!«
»Dann gießen Sie sich einen Schluck ein. Sie werden ihn brauchen.« Gunnar ließ Whisky in sein Glas laufen. Direktor Anderson, schlug den Ordner auf und las mit neutraler, eintöniger Stimme:
»... Mr. Gunnar Thorkild ist ein anregender Dozent, beliebt – vielleicht sogar etwas zu beliebt – bei seinen Studenten und seinen jüngeren Kollegen. Seine Theorien sind oft brillant; aber seine Schlußfolgerungen, die er übereilt publiziert, sind weniger als verläßlich. Er ist mehr ein Dichter als ein Wissenschaftler, ein inspirierter Träumer vielleicht, auf jeden Fall aber ein nicht ganz lupenreiner Gelehrter.
Er ist ein leidenschaftlicher Sammler und geschickter Herausgeber von Insellegenden; aber wenn er auf diese Legenden ein neues Land gründet, eine Art von polynesischem Heiligen Gral, verfällt er in Gemeinplätze und Verstiegenheiten. Was bisher allen großen Kartographen entgangen ist und auch durch Satelliten nicht festzustellen war, baut Mr. Thorkild als unumstößliche Tatsache vor uns auf; eine unentdeckte Insel, eine Begräbnisstätte der Häuptlinge und Seefahrer, die irgendwo zwischen Pitcairn und Neuseeland liegen soll.
Er ist noch jung, und folglich besteht Hoffnung, daß sein Urteil mit der Zeit und der Erfahrung ausgewogener ausfallen wird. Wir sollten ihn deshalb für eine Probezeit von drei Jahren als außerordentlichen Professor anstellen. Wir sind jedoch nicht bereit, ihn schon heute als Bewerber für das Amt des Lehrstuhlinhabers für Pazifische Ethnographie zu nominieren ...«
Der Vorstand klappte den Ordner zu. Lange saß Gunnar Thorkild da und starrte in die Neige seines Whiskys. Dann fragte er ruhig:
»Ist das der Mehrheitsbeschluß?«
»Ja.«
»Und wie viele haben unterschrieben?«
»Sieben.«
»Und es besteht keine Möglichkeit, ihn anzufechten?«
»Ich fürchte, nein. Sie würden mich eines großen Vertrauensbruchs schuldig machen, wenn Sie auch nur durchblicken ließen, daß Sie ihn kennen.«
»Das würde ich niemals tun, James. Aber zum Donnerwetter! Mußten sie so hart sein? Gemeinplätze und Verstiegenheiten‹ ... ›ein nicht ganz lupenreiner Gelehrter...‹ Wenn das in meinen Akten steht, bin ich erledigt.«
»Nicht ganz. Sie sind ja immer noch bereit, Sie als außerordentlichen Professor einzustellen.«
»Ach, zum Teufel! Erst kastrieren sie mich, und hinterher fordern sie mich auch noch auf, meine eigenen Eier zum Frühstück zu verspeisen! So geht das nicht, James! Nein, das ist ganz und gar unmöglich! Sie werden morgen früh mein Kündigungsschreiben haben.«
»Wollen Sie mich erst anhören?«
»Was gibt’s denn da noch zu sagen, verdammt noch mal?«
»Nur folgendes: Noch eine Woche, und das Semester ist vorüber. Vorher können Sie sowieso nicht gehen, ohne sich lächerlich zu machen und einen Skandal für die ganze Universität heraufzubeschwören. Dann kommen drei Monate Sommerferien. Vor Ende August werden die Berufungen nicht veröffentlicht. Das ist immerhin eine Atempause. Nutzen Sie sie. Damit Sie wieder klar denken, überlegen Sie einmal genau, ob es sich lohnt, Ihre ganze Karriere wegen einer ersten Ablehnung aufs Spiel zu setzen – ganz egal, wie hart sie formuliert worden ist... Nein! Bleiben Sie sitzen! So können Sie mich nicht behandeln, Gunnar. Ihre letzte Arbeit über die polynesischen Seefahrer – ich habe sie gelesen. Die war gut: klar, logisch und wunderschön belegt. Bloß im Anhang haben Sie alles verdorben. Da sind Sie von der Wissenschaft in die Spekulation abgerutscht. Dort haben Sie die Existenz einer Insel als Tatsache hingestellt, obwohl es sich doch um nichts weiter als eine Theorie handeln kann. Sie sagen, Ihre Kollegen hätten Sie kastriert – aber das Messer dafür haben Sie ihnen selbst in die Hand gegeben. Warum, frage ich Sie? Warum nur?«
»Weil ich weiß, daß diese Insel existiert.«
»Wieso?«
»Der Mann, der mir davon berichtet hat, ist mein Großvater, Kaloni Kienga. Alles andere, was in der Arbeit steht, habe ich von ihm erfahren.«
»Und hat er es Ihnen auch bewiesen?«
»Ja.«
»Aber er hat nicht den Nachweis für die Existenz dieser Insel erbracht -oder wenn doch, dann haben Sie es jedenfalls unterlassen, es in der Veröffentlichung zu tun. Sie haben es Ihrem gelehrten Publikum einfach ins Gesicht geschleudert: ›Friß, Vogel, oder stirb! Es ist so! Weil ich es sage.‹ Und ich frage Sie nochmals: Warum?«
»Weil... ach, verstehen Sie das denn nicht? ... weil irgendwo, irgendwann irgendwas einfach geglaubt werden muß. Kaloni Kienga ist ein großer Mann. In seinem Kopf bewahrt er das Wissen von eintausend Jahren, eine eintausendjährige Tradition. Ich habe ihm geglaubt, glaube ihm immer noch. Hat nicht jeder Mann ein Recht auf einen Akt des Glaubens?«
»Selbstverständlich hat er das. Aber er darf sich nicht beklagen, wenn andere Leute ihn nach Beweisen fragen und ihn kreuzigen, wenn er sie nicht vorweisen kann oder will. Tut mir leid, Gunnar, aber ich bin ein ganzes Stück älter als Sie, und so sehe ich nun mal das, was Ihnen passiert ist. Nun, was werden Sie tun? Lästerungen ausstoßen oder Beweise antreten?«
Vorsichtig setzte Gunnar Thorkild sein Glas ab, wischte sich über Hände und Lippen und stieß einen langen belustigten Pfiff aus.
»Ach, James! James Neal Anderson! Sie sind mir ein hartgesottener Bursche! Lästerungen ausstoßen oder Beweise antreten! Das ist gut! Das sind Donnertöne von der Kanzel herab. Und jetzt sagen Sie mir bitte, wie ich diese Beweise antreten soll. Ehrlich! Keine Ausflüchte!«
»Und keine Beschwerden, wenn ich es Ihnen sage?«
»Nein. Das verspreche ich.«
»Auf zweierlei Art und Weise – ich würde beides akzeptieren. Die erste: Sie finden sich mit dem Urteil Ihrer Kollegen ab und nehmen den Posten an, den sie Ihnen anbieten, wodurch Sie einen Fehler in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit eingestehen würden – einen behebbaren Fehler. Und die zweite: Bitten Sie um ein halbes Jahr Forschungsurlaub – ich verbürge mich dafür, daß er Ihnen gewährt wird – und gehen Sie hin und treten Sie Ihren Beweis an! Finden Sie Ihre Insel! Bringen Sie Längen- und Breitengrad nach Hause, nehmen Sie sie kartographisch auf und photographieren Sie sie! Dann sind Ihnen Bestallung und ein eigener Lehrstuhl sicher – selbst wenn wir einen neuen einrichten müßten, um Sie unterzubringen.«
In brütendes Schweigen versunken saß Thorkild lange da, dann hob er unversehens den Kopf.
»Noch eine Frage, James.«
»Ja?«
»Warum ist Ihnen überhaupt soviel daran gelegen – ob ich’s nun auf diese oder jene Weise versuche?«
»Weil«, erklärte James Neal Anderson, »ich glaube, daß Sie ein soliderer Wissenschaftler sind als die anderen; und ein bedeutenderer Mann, als Sie es bisher erkennen lassen.«
»Haben Sie was dagegen, wenn ich’s mir noch einmal überlege?«
»Durchaus nicht. Hauptsache, Sie geben mir bis Ende Juni Bescheid.«
»Danke, James.«
»Gern geschehen. Noch einen Schluck für den Weg?«
»Besser nicht«, sagte Gunnar Thorkild kleinmütig. »Noch ein Verstoß, und ich bin meinen Führerschein los.«
Ein verwirrt-verlegener Riese, ging er breitbeinig davon. Sein blondes Haar streifte den Plumaria-Baum, seine Schultern waren gesprenkelt mit gelben Blüten. Er ließ James Neal Anderson in seinem duftenden Garten unter einem schmalen abnehmenden Mond zurück, in dem er sein Glas allein austrinken mußte ...
Trotz seines schlampigen Aufzugs und seiner gelegentlichen Ungehobeltheit war Gunnar Thorkilds Wohnung an der South Beretania in ihrer Einfachheit und der darin herrschenden Ordnung geradezu spartanisch. Er hatte sich ein altes schindelgedecktes Haus gemietet und es in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt: das Erdgeschoß enthielt die Küche und ein riesiges Wohnzimmer, das Dachgeschoß sein Arbeitszimmer, in dem er auch schlief. Der erste Bereich stand allen Besuchern offen: Studenten, Freunden, zufälligen oder länger andauernden Liebschaften. Der zweite hingegen war nur ihm allein vorbehalten: ein großer Raum mit Bücherregalen und Karteikästen an den Wänden, dessen einzige Möblierung aus einem Bett, einem Stuhl und einem peinlichst geordneten Schreibtisch bestand. Diesen Bereich durfte niemand betreten außer der alten Molly Kaapu, die zwei Häuser weiter wohnte und täglich vorbeikam, um für ihn zu putzen und zu kochen. Die Fensterläden hier oben waren geschlossen und Decke wie Boden schalldicht isoliert, so daß er in aller Ruhe arbeiten konnte und nichts anderes zu hören war als das leise Summen der Klimaanlage. Er rühmte sich – was tatsächlich der Wahrheit entsprach –, daß er diesen Raum niemals betrunken oder liebeshungrig betrat und, wenn er mit den Schuhen an den Füßen oder einer Frau neben sich schlief, dies unten im Wohnzimmer tat. Allerdings herrschte auch dort die gleiche Ordnung. Seine Besucher konnten es sich gemütlich machen, wie sie wollten, konnten singen, Lärm machen oder tanzen – aber wenn sie Alkohol verschütteten, Asche verstreuten oder so unhöflich waren, nicht aufzuräumen, ehe sie wieder gingen, wurden sie nie wieder eingeladen. »Ich habe auf Schiffen gelebt«, pflegte er zu sagen, wenn er besonders milde gestimmt war. »Wenn man dort seine Koje nicht sauber und seine Kammer nicht aufgeräumt hielt, konnte man nach einer Woche einfach nicht mehr darin leben.«
Molly Kaapu hing an ihm, weil er die alte Sprache sprach und sie zum Lachen brachte, bis ihr das Zwerchfell wegen seiner ungeheuerlichen Geschichten weh tat. Wenn er es allein oder in der Gesellschaft anderer nicht mehr aushielt, pflegte er sie zu sich zu rufen, und dann saßen sie wohl eine Stunde lang über einem Glas Tee, und sie krempelte die Ärmel hoch und massierte ihm Rücken und Nacken, ehe er zu seinen Büchern und den Seminararbeiten seiner Studenten zurückkehrte. Sie war die einzige, die seinen Eingeborenennamen kannte und ihn auch damit anredete: Kaloni – die einzige, der er gern von seinen Wanderjahren in Ozeanien erzählte. Als er an diesem Abend von Anderson heimkam, saß sie glucksend und mit gerunzelter Stirn da und wartete auf ihn.
»Ah-ah. Ich weiß. Etwas Schlimmes? Zieh dein Hemd aus, Kaloni. Laß Molly dir lomi-lomi machen. Und dann erzählst du mir, eh?«
Während sie seine verspannten und verkrampften Muskeln massierte, berichtete er ihr, suchte gelegentlich nach Wörtern, um die fremden Gedankengänge der haole in die Sprache eines einfachen und älteren Volkes zu fassen. Für Molly war das alles Wahnsinn. Die haole machten alles so kompliziert. Wenn etwas war, dann war es. Warum mußten sie es auch noch beweisen? Die Alten wußten es einfach. Sie fuhren übers Meer und richteten sich nach den Sternen, der Form der Wolken und dem Flug der Vögel. Sie schrieben die Dinge nicht auf, sondern prägten sie sich ins Gedächtnis ein, gaben sie mündlich weiter oder faßten sie in Gesänge. Warum sich wegen der haole überhaupt Gedanken machen? Warum nicht zurückkehren zu dem Volk seiner Mutter?
Warum eigentlich nicht, wirklich – nur, daß er niemals ganz zu ihnen gehen konnte; denn er war gespalten und nochmals gespalten durch das Wissen und abermals gespalten durch seine Träume und Sehnsüchte, bis von ihm nichts mehr übrig war als lauter Bruchteile und Fragmente, die von den Passatwinden gleich trockenem Laub davongeweht wurden. Die alte Molly verstand das auch, allerdings glaubte sie immer noch, sie könne ihn wieder zusammensetzen, indem sie ihn mit ihren großen Händen walkte wie Brotteig und alte Lieder aus einer vergessenen Zeit vor sich hinsummte.
Als er endlich schlief, breitete sie die Decken über ihn aus, löschte das Licht und ging. Als sie ihr eigenes Haus erreichte, fand sie ihre Tochter Dulcie halb verschlafen vor dem Fernsehapparat sitzen. Sie reichte ihr die Schlüssel zu Thorkilds Haus und ermahnte sie sanft:
»Heute abend liegt eine schwarze Wolke über Kaloni. Geh zu ihm, Mädchen. Mach ihn vergessen, was die haole ihm angetan haben. Laß ihn wieder spüren, daß er immer noch ein Mann ist.«
Als das Mädchen nackt neben ihm ins Bett glitt, rührte Gunnar Thorkild sich, lächelte, zog sie an sich und murmelte ein einziges verschlafenes Wort: »Ka’u – o tröstende Brüste!«
Wie immer er auch dazu gekommen sein mochte – und es lag nicht in seinem Wesen, nach dem Warum zu fragen –, auf jeden Fall besaß er ein Gefühl der Ehrfurcht, ein Gefühl von Anhänglichkeit und Pflichterfüllung. Er empfand das nicht als Bürde, sondern nahm es genauso hin wie die Dienste der alten Molly und ihrer Tochter und die gelegentlichen Freundschaften, die er in Bars und unten am Hafen schloß.
Am letzten Sonntag eines jeden Monats fuhr er pünktlich um elf Uhr vor der Tür des Jesuitenkollegs an der East Moana Street vor, um das abzuholen, was sie unter sich das »corpus delicti« nannten – den Körper von Michael Aloysius Flanagan S.J., ehemals Mentor von Gunnar Thorkild und ebenfalls ehemals römisch-katholischer Kaplan am Institut für Meereskunde – jetzt ein ausgezehrter Krallenaffe in einem Rollstuhl mit zwei nutzlosen Beinen und einer unverwüstlichen Vorliebe für Intrigen und die weniger erhabenen Wege zum Heil. Nachdem der gelähmte Jesuitenpater im Wagen verstaut war, fuhren sie hinunter zum alten Moana-Hotel, um dort unter einem Banyan-Baum zu sitzen, eisgekühlten Planter’s Punch zu trinken, gegrillte mahi-mahi zu essen und die Welt zurechtzurücken – oder auf den Kopf zu stellen –, je nachdem, in welcher Stimmung sie waren.
Für den fünfundsechzigjährigen Michael Aloysius Flanagan, der seit nunmehr zwanzig Jahren auf Hawaii lebte und seit fünf Jahren an den Rollstuhl gefesselt war, war die ganze Schöpfung heillos verpfuscht und der liebe Gott ein recht hilfloser Architekt, der versuchte, das Beste aus einer ziemlich mißlungenen Sache zu machen. Für Gunnar Thorkild war Pater Flanagan von der Gesellschaft Jesu der Mann, welcher der Figur eines Vaters, den er nie gekannt hatte, am ehesten gleicht – der Mann, der ihm Ohrfeigen verabreicht und ihm die Rotznase abgewischt hatte, sich zwischen ihn und die Älteren gestellt hatte, die ihn verhauen wollten, und ihn die Schönheiten der Logik und die Harmonie auch noch der widersprüchlichsten Ideen und Vorstellungen gelehrt hatte. Flanagan war längst zu einer höchst heiklen Schlußfolgerung gelangt: daß man die Welt nicht erlösen, sondern nur lieben könne. Als im Zölibat lebender Mann, der eine ziemlich hoffnungslose Sache vertrat, hatte er den letzten Rest seiner Liebe auf Gunnar Thorkild konzentriert. Eine Liebe, die, wie er behauptete, ihm erlaubte, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – ein Vorrecht, das er hemmungslos ausnutzte.
»Gunnar Thorkild, du bist ein unverbesserlicher Idiot.«
»Das bin ich, Pater.«
»Ausgerechnet in einem so kritischen Augenblick deiner Laufbahn hast du dich den Gottlosen nackt gezeigt.«
»Das habe ich getan, und ich bin mir dessen bewußt.«
»Und was haben sie getan?«
»Genau das, was zu erwarten war.«
»Du stehst also wie ein begossener Pudel da und weißt nicht mehr ein noch aus. Und was erwartest du jetzt von mir?«
»Nichts. Ich hab’ ja nur erzählt. Trinken Sie Ihren Punsch aus und lassen Sie uns noch einen bestellen.«
»Halt den Mund, Junge, und laß mich reden. James Neal Anderson ist ein guter Mann und hat dir zu Recht den Kopf zurechtgesetzt – wenn er auch ein knochentrockener Methodist ist, der keine Ahnung hat, was Freude überhaupt ist. Tja, und was willst du jetzt tun?«
»Entweder ich füge mich, oder ich suche mir einen Job zum Ananasschneiden bei der Dole Company.«
»Du könntest aber auch deine Klappe halten, alles Geld zusammenkratzen, das du hast, und ausziehen und beweisen, was du geschrieben hast. Wieviel Geld hast du übrigens?«
»Zehntausend Dollar auf der Bank.«
»Das ist mehr, als du verdienst, aber auch verdammt viel weniger, als du brauchst.«
»Woher wollen Sie denn wissen, was ich brauche?«
»Ich erledige schließlich meine Hausaufgaben – zu denen man dich prügeln mußte, Gunnar Thorkild. Wenn ich du wäre – was ich Gott sei Dank nicht bin, denn auf dich wird eine Menge Ungemach zukommen –, dann würde ich mir einen alten Kahn kaufen, ihn wieder seetüchtig machen, Vorräte an Bord nehmen und ihn bemannen und außerdem ein paar Gäste an Bord nehmen, damit sie helfen, die Rechnungen zu bezahlen und gleichzeitig die Zeugen für meine Errungenschaften abgeben. Dann würde ich meinen alten Großvater abholen und lostuckern – und nicht wieder zurückkehren, bis ich meine Insel gefunden hätte.«
»Und wenn Sie sie gefunden hätten?«
»Dann würde ich sie mir ansehen; und wenn sie mir gefiele, würde ich die Bodenventile meines Schiffes öffnen, es versenken und dort bleiben! Die Welt ist doch verrückt geworden, mein Junge! Bomben auf den Straßen und Terror in der Luft, und die ganze Politik ein Irrenhaus mit Dauerrednern. Deshalb würd’ ich dort bleiben!«
»Noch zwei Gläser«, sagte Gunnar Thorkild zu dem Kellner, der über ihn aufragte. »Und warten Sie mit dem Fisch. Ich sag’ Bescheid, wenn wir soweit sind.«
»Ich habe aber nicht die Absicht, mich zu betrinken«, sagte Michael Aloysius Flanagan. »Ich habe vor, dich in die schwarze Kunst der Gönnerschaft und der Beziehung einzuweihen.«
»Sie wissen, was Samuel Johnson über die Gönner gesagt hat, Pater?«
»Sam Johnson war ein aufgeblasener alter Esel und Protestant obendrein! Jeder junge Novize bei den Jesuiten, der noch nicht trocken hinter den Ohren ist, könnte ihn aufs Kreuz legen. Aber jetzt hör mir mal gut zu. Du brauchst ein Schiff. Und um das zu bekommen, brauchst du Geld, und auf diesen gesegneten Inseln gibt es Leute, die haben so viel Geld, daß sie nicht wissen, wohin damit ...«
»Und kein einziger Dollar davon ist mir je über den Weg gerollt.«
»Wozu auch? Du beziehst schließlich ein angemessenes Gehalt und hast auch noch Zeit genug, es zu genießen. Du schuldest keinem Menschen auch nur einen Zehner.«
»Wozu dann die Frage aufs Tapet bringen?«
»Ach, mein Junge, du könntest für jede Verrücktheit einen Geldgeber auftreiben – vom Sitzrekord-Aufstellen bis zur Bekehrung der Pinguine – du brauchst nur mal deinen Grips anzustrengen und deine Phantasie spielen zu lassen. Unterbrich mich nicht: Ich werde dir nämlich eine Predigt übers Geld halten und die Leute, die Geld machen ...«
... Aus welcher Predigt und mancherlei Kritzeleien auf Papierservietten hervorging, daß Michael Aloysius Flanagan S.J. etliche Freunde hatte, von denen jeder einzelne um gewisser kommerzieller Vorteile willen wie zum Beispiel der Weltrechte auf den Expeditionsbericht, der Film- und Fernsehrechte unter Umständen bereit sein könnte, eine neue Entdeckungsreise in die Südsee zu finanzieren. Wenn Gunnar Thorkild auch nur einen Funken Glauben übrig habe – was um drei Uhr an diesem Nachmittag, wo er sich dem Trunk ergäbe, nicht der Fall sei –, würde er eine Novene für die Hochheilige Jungfrau beten und den Rest seinem alten Freund Flanagan überlassen, der viel freie Zeit habe und außerdem eine ganze Liste von Geldgebern, bei denen er schon seit mindestens fünf Jahren nicht mehr angeklopft ...
Das war ein generöser Gedanke, und der alte Mann war so gut gelaunt, als hätte er das Geld bereits in der Tasche. Gunnar Thorkild hingegen war da wesentlich skeptischer. Früher hatte Flanagan Millionen aufgetrieben. Er hatte zwei Kirchen, ein Waisenhaus und ein Institut gebaut; aber jetzt, im Herbst seiner Tage, mußte er immer noch auf Gunnar Thorkild warten, damit dieser ihn zum Abendessen ausführte.
Nachdem er den alten Mann wohlbehalten im Jesuitenhaus abgeliefert und im Garten abgestellt hatte, damit er dort ein Nickerchen machen konnte, fuhr Thorkild zum Sunset Beach hinaus, wo die jungen Studenten auf den riesigen Wellen ritten, die vom Nordpazifik hereingerollt kamen. Er selber war für dieses Spiel mittlerweile zu alt und hätte sich bestimmt bald den Hals gebrochen oder einen Schädelbruch geholt; trotzdem sah er den Wellenreitern gern zu. Für ihn hatte Wellenreiten etwas Rituelles, wie Stierspringen oder das Schaukeln an einer Schlaufe am Fußgelenk von Bäumen herab, was äußerst gefährlich war und wovon man nichts weiter hatte als den Rhythmus der Übung selbst, das berauschende Hochgefühl, etwas Tollkühnes zu leisten, sowie hinterher das wohlige Gefühl, von den Eingeweihten bewundert zu werden.
Diese mächtigen Wogen, die von den Kurilen und den Aleuten herbeigerollt kamen, hatten etwas Düsteres und zugleich Erhabenes, wie sie langsam zu brodeln anfingen, ineinander übergingen und sich schließlich in einem Gebrodel von Schaum brachen. Der Anblick einer männlichen Gestalt, die auf schmalem Holzbrett balancierend den Abhang heruntergeglitten kam, während hinter ihr eine Wasserwand in sich zusammenbrach, war atemberaubend schön. Der Schrecken fuhr einem in die Glieder, wenn sie wie ein Gischtspritzer hoch in die Luft geschleudert wurde und das Wellenbrett um Haaresbreite an ihrem Schädel vorbeiflog, und sie dann im Gebrodel von Gischt und Schaum und Strandkies versank. Junge Männer und Frauen sahen wie Meeresgötter aus einer alten Legende aus, stolz und glücklich und doch irgendwie grausam, weil sie so allein und so rücksichtslos waren.
Ein junges Mädchen in einem formlosen muu-muu, dessen Farbe fast ganz verblichen war, kam den Strand heruntergetrottet und ließ sich neben Thorkild im Sand nieder. Ihr Blondhaar war zerzaust, ihr kindliches Gesicht gedunsen und ihre Lippen von Sonne und Wind aufgesprungen.
»Hallo, Prof!«
»Hallo, Jenny. Lange nicht gesehen.«
»Hm-hm.«
»Ich hab’ dich dieses Semester vermißt. Wo hast du dich denn rumgetrieben?«
»Irgendwo hier.«
»Abgegangen?«
»Ja.«
»Wo lebst du denn?«
»Irgendwo hier.«
»Und essen?«
»Genug für zwei – oder ist es Ihnen nicht aufgefallen?«
Sie strich den muu-muu über ihrem geschwollenen Bauch straff.
»Hübsch, nicht? Im fünften Monat.«
»Kenne ich den Vater?«
»Gekannt haben Sie ihn schon. Billy-Jo Spaulding. Ist abgehauen, als er es erfuhr. Papa hat ihn schleunigst nach New York expediert. Billy hat mir tausend Dollar und die Adresse eines Arztes geschickt, der das risikolos machen würde.«
»Aber das wolltest du nicht?«
»Ich wollte Billy-Jos Baby haben. Will ich auch jetzt noch. Verrückt, nicht?«
»Für mich nicht. Und wer bezahlt jetzt die Miete?«
»Ich!«
»Womit?«
»Ach, wissen Sie... Mein Vater glaubt immer noch, daß ich zu den Vorlesungen gehe, und dafür schickt er mir Geld. Außerdem tu’ ich so dies und das, mach’ Besorgungen, spiel’ Babysitter... paßt ja gut, nicht?«
»Irgendwie süchtig?«
»Kann ich mir nicht leisten... Ich hasch’ nur ab und zu mal.«
»Ich könnte dir einen Job und ein Zimmer besorgen.«
»Wirklich ...? Ich weiß nicht. Was für einen Job?«
»Komm mit, sehen wir’s uns mal an. Gefällt es dir nicht, paßt du eben. Wie steht’s?«
»Das ist sehr lieb von Ihnen, Prof, aber ...«
»’ne anständige Mahlzeit würde dir doch ganz gut tun, oder?«
»Sogar zwei.«
»Dann komm mit!«
Er zog sie hoch, bis sie stand, und dann gingen sie Hand in Hand zurück zum Wagen. Als sie die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, war er sicher, daß er einen Fehler gemacht hatte. Er hatte sich nie etwas aus ihr gemacht wie aus anderen Mädchen in seinen Vorlesungen und Seminaren. Sie war immer etwas plump und träge gewesen, wortkarg, ungreifbar und irritierend, dabei jedoch rührend, wie sie sich jedem anschloß, der ihr auch nur die geringste Aufmerksamkeit schenkte. Als Studentin hatte sie Eifer gezeigt, war mit ihren Arbeiten aber niemals besonders aufgefallen – eine von denen, für die das Studium wie das Leben immer eine Art von Puzzle war, in dem ständig irgendwelche Teile fehlten.
Er fragte sie: »Hast du das mit dem Baby schon deinen Eltern gesagt?«
»Um Gottes willen! Die haben selbst Schwierigkeiten genug. Mutter hat sich gerade von meinem Vater scheiden lassen, und er hat seine Sekretärin geheiratet, die ein Kind von ihm erwartet. Das ist viel zu kompliziert.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Wohin wollen wir denn, Prof?«
»Eine Freundin von mir besuchen. Unterwegs halten wir bei einem Supermarkt an und kaufen ein paar Sachen zum Abendessen. Leiberman’s hat sonntags, glaub’ ich, offen.«
»Ich glaub’ schon. Aber hören Sie, sieht das nicht ein bißchen komisch aus?«
»Was?«
»Ich mit diesem Bauch« – sie kicherte kindisch – »und Sie mit Ihrem Ruf?«
»Ich hab’ ja gar nicht gewußt, daß ich einen habe.«
Abermals kicherte sie.
»Ach, Professor! Sie wissen doch genau, was über Sie geredet wird. ›Gunnar Thorkild hat die größte Kanone auf der Insel und schießt sofort.‹ Das muß Ihnen doch zu Ohren gekommen sein. Deshalb sitzen doch so viele Mädchen in Ihren Vorlesungen. Ich jedenfalls hab’ sie deshalb belegt.«
»Ein Jammer, daß du nicht dabeigeblieben bist.«
»Sind Sie jetzt böse auf mich?«
»Nein. Ich denke bloß darüber nach, was sie womöglich sonst noch gesagt haben und ob sie sonst noch was gelernt haben außer den Einzelheiten über mein Sexualleben. Hast du jemals was gelernt bei mir, Jenny?«
»Sie meinen, über die Polynesier und ihre Fahrten und ihr Leben und all das? Etwas hab’ ich wohl gelernt, nehm’ ich an. Aber ich habe eigentlich nie gewußt, wozu das alles gut sein sollte.«
»Warum nicht?«
»Ach, wissen Sie... Was haben sie denn schon Großartiges geleistet? Was stellen sie denn heute schon dar? Die Inseln, auf denen sie leben, gehören ihnen ja nicht einmal. Hier und auf Samoa sitzen wir, auf Tahiti die Franzosen... Hier in Hawaii sind sie nichts... Kellner und Kraftprotze am Strand ...«
»Und was sind wir, Jenny, du und ich?«
»Nun ja, ich meine, wir sind jedenfalls zivilisiert. Wir haben Fortschritte gemacht. Wir... Ach, Himmel! Da bin ich Ihnen schön auf den Leim gegangen, was?«
»Ja, das bist du, Baby. Du hast den Mund aufgemacht und dein Gehirn verschlossen. Versuch’s doch gelegentlich mal andersherum.«
Daraufhin verfiel sie die ganze Fahrt in die Stadt zurück in brütendes Schweigen. In den Supermarkt wollte sie ihn nicht begleiten, sondern blieb zusammengekauert im Wagen sitzen, mit zerzaustem Haar und unförmig wie eine Stoffpuppe. Gunnar Thorkild kaufte wütend und bedenkenlos ein: Riesensteaks und Salat, Obst und Wein, Leberpastete und Nachtisch aus der Tiefkühltruhe. Er war ein großmäuliger Idiot, der es nicht lassen konnte, sich um anderer Leute Angelegenheiten zu kümmern. Warum er ausgerechnet diese lahme Ente aufgegabelt hatte, würde er nie begreifen; und was würde Martha Gilman sagen, wenn er am Sonntagabend mit Jenny in ihre Kürche reingeschneit kam ...? Als ob sie nicht selber Probleme genug hätte: einen Mann, der sich in Saigon mit chinesischem Heroin umgebracht hatte, einen verkorksten Lausejungen von elf Jahren, der gefüttert und erzogen werden mußte, die Figur einer Dreißigjährigen, die keinen Mann mehr groß in Entzücken geraten ließ, strähniges braunes Haar, ein Gassenjungengesicht, ewig mit Flecken von Ölfarbe oder Druckerschwärze beschmiert, ein Atelier mit tausend angefangenen Arbeiten – Applikationen auf schwarzem Samt für die Touristenläden, Prospekte für die Immobilienfirmen, Siebdrucke, Holzschnitte und Kohlezeichnungen – und einen Haufen Kunden, die sie wegen nicht abgelieferter Arbeiten übers Telefon anbrüllten... O ja, sie würde vor Freude überfließen, wenn er die auseinandergegangene schwangere Jenny auf ihrer Fußmatte ablegte!
Als sie vor dem alten Holzhaus in der schäbigen Straße ankamen, die von der Nuuanu Avenue abging, ging Thorkild voran wie der Abgesandte eines Stammes, der mit Geschenken beladen vor einen drohenden Oberhäuptling hintritt. Die Tür wurde von Mark geöffnet, dem Lausejungen, der sofort wieder kehrtmachte und lautstark Gunnar Thorkilds Ankunft verkündete.
»Hallo, Ma! Onkel Gunnar ist da mit einer Dame. Sie kommen zum Abendessen.«
Martha Gilman, der die Haare wie die Schlangen der Medusa vom Kopf abstanden und deren Kittel mit roter Farbe beschmiert war, als wäre es Blut, erschien am Ende der Halle. Sie war mit Palette und Farbenmesser bewaffnet und wollte, Böses ahnend, gleich wissen:
»Gunnar Thorkild, was zum Teufel soll das heißen? Ich arbeite am Wochenende wie an jedem anderen Tag! Wenn du uns besuchen willst, melde dich gefälligst telefonisch an. Ich kann es mir nicht leisten, die Zeit zu ...«
»Ich weiß, meine Süße.« Thorkild lächelte über den Sellerieblättern in ihr Medusenhaupt. »Deshalb bin ich ja auch gekommen, dir ein Abendessen zu machen. Martha, das hier ist Jenny. Wie du siehst, ist sie schwanger.«
»Von dir?«
»Diesmal nicht. Aber sie braucht einen Job und eine Schlafgelegenheit, und du brauchst jemand, der auf dieses kleine Ungeheuer achtgibt und dieses Chaos in Ordnung bringt, in dem du lebst. Wie wär’s, wenn ihr beiden euch hinsetztet und euch darüber unterhieltet, während ich das Abendessen mache?«
Seine Pakete wie einen Brustpanzer vor sich herschiebend, marschierte er in die Küche und verbarrikadierte sich darin, indem er einen Stuhl unter die Türklinke schob. Er dehnte seine Vorbereitungen auf eine Stunde aus und hängte dann zur Sicherheit noch zwanzig Minuten dran, überlegte sich, was die Ruhe draußen bedeuten mochte und wappnete sich innerlich gegen den Wirbelsturm, der ihm gewiß um die Ohren pfeifen würde, sobald er aus seinem Schlupfloch herauskäme. Als er endlich allen Mut zusammennahm und verkündete, das Essen sei fertig, stellte er fest, daß der Tisch gedeckt war, Jenny einen frischen muu-muu trug, ihr Haar mit einem Band gezähmt war und sie mit dem Lausejungen Dame spielte, während Martha Gilman einen Morgenrock und goldene Slipper angezogen hatte und die Kerzen anzündete. Während er, die Weinflaschen gepackt, mit offenem Mund dastand, sagte Martha honigsüß: »Warum gehst du nicht und machst dich ein bißchen frisch, Gunnar? Jenny und ich tragen inzwischen auf.«
Er war nicht dafür bekannt, besonders taktvoll zu sein, doch diesmal besaß er den Anstand, den Mund zu halten und schweigend dankbar zu sein. Erst nachdem das Essen vorüber war und – Wunder über Wunder – Jenny und Mark in der Küche das Geschirr spülten, sprach Martha die Worte der Absolution:
»Du bist ein Clown, Gunnar. Allerdings ein lieber Clown. Wenn sie will, behalt’ ich sie. Ich könnte jemand brauchen, der mir hilft, und sie braucht ja weiß Gott einen Platz, wo sie sich zunächst einmal zu Hause fühlen kann. Also, wir werden sehen... Und nun erzähl mal, was das mit deiner Berufung ist.«
»He, wessen Telefon hast du denn angezapft?«
»Das geht dich nichts an. Erzähl schon!«
»Sie haben mir eine Berufung als außerordentlicher Professor für eine Probezeit von drei Jahren angeboten. Aber feste Bestallung und Lehrstuhl – Pustekuchen! Anderson hat mir ein halbes Jahr Studienurlaub in Aussicht gestellt, damit ich meine These beweisen kann – und das ist phantastisch; aber bis jetzt hat mir noch niemand das nötige Kleingeld angeboten, das man braucht, um eine solche Expedition zu finanzieren.«
»Du bist eine Hure, Gunnar Thorkild.«
»Das finde ich aber gar nicht komisch.«
»Soll es auch nicht sein. Ich habe deine Arbeit gelesen, wie du weißt. Immerhin habe ich die Landkarten und die Illustrationen gezeichnet. Ich habe geglaubt, was du über deine Ahnen geschrieben hast: daß sie ohne Kompaß und ohne Karten losgesegelt und losgepaddelt sind; wie sie von Früchten und Fischen gelebt haben und auf winzigen Atollen und auf großen Inseln wie dieser hier gelandet sind. Ich habe an die Reisen geglaubt, die du mit deinem Großvater auf Loggern und Koprakähnen unternommen hast. Und was muß ich jetzt hören? Du redest von Geldgebern und Expeditionen und dem ganzen Mist, der zu so was gehört. Damals hat dir doch auch niemand das Geld gegeben. Wozu brauchst du es jetzt? Oder hast du keine Traute mehr ...? Hier in diesem Zimmer hast du gesessen, und ich habe Träume in den Kleinejungenaugen gesehen, als du erzähltest. Ich habe auch deine Studenten reden hören... selbst die arme Kleine hier, die bestimmt nicht besonders helle ist... wie du ihnen Horizonte eröffnet hast, von denen sie nie zuvor in ihrem Leben auch nur geträumt hatten. Und jetzt... was bist du denn überhaupt? Irgendein Sexsymbol für Jungsemester, jemand, der hochherzig redet und niedrig handelt und seine kleinen gönnerhaften Spielchen spielt wie heute nachmittag! Wo ist denn der große Mann geblieben – der Sohn der Tochter von Kaloni Kienga, dem heiligen Seefahrer? Wird er denn jetzt in seine Heimat zurückkehren, um seinen Großvater auf seine Reise zu der Insel unterm Passatwind vorzubereiten?«
Einen Moment lang war er von dem Schwung und dem Gift ihres Angriffs wie vor den Kopf gestoßen. Er hatte sie in turbulenten Szenen und Wutausbrüchen erlebt, und bisher war es ihm noch jedesmal gelungen, sie zu beschwichtigen und durch Schmeicheleien wieder zur Vernunft zu bringen; aber dies heute war kalte Wut, verächtlich und tödlich. Sie teilte Tiefschläge aus, hatte es auf sein Herz und seine Hauptschlagader abgesehen; aber er wollte ihr nicht die Genugtuung geben, sich auf ein Duell mit ihr einzulassen, und sagte daher nur kurz angebunden:
»Halt den Mund, Martha! Wenn du grad deine Tage hast, tut es mir leid. Wenn du Schwierigkeiten hast, werde ich versuchen, dir zu helfen. Aber fall bitte nicht über mich her wie eine Furie!«
»Du bist ein Bastard, Thorkild.«
»Das ist nichts Neues, Liebling! Das steht schon auf meiner Geburtsurkunde.«
»Du bist so verdammt verwöhnt. Du verschwendest so viel, für das andere Leute ihr Augenlicht hergeben würden – Talent, Gelegenheit, Freiheit!«
»Und seit wann habe ich dir oder irgendeinem Menschen gegenüber Rechenschaft über mein Leben abzulegen?«
»Weil du Verantwortung trägst... darum geht es doch. Heute zum Beispiel hast du aus einer Laune heraus drei Leben umgekrempelt: Jennys, meins und Marks... Ich bin nicht böse wegen dem, was ich getan habe. Ich glaube, es wird schon alles gut werden. Worum es mir geht, ist: daß du es gewesen bist, der diese Veränderung herbeigeführt hat, ohne daß man dich darum gebeten hätte. Du hast uns allen einfach eine neue Lage aufoktroyiert; und trotzdem wirst du, wenn du hier nichts mehr zu suchen hast, schlicht deinen Hut nehmen und einen Dixieland pfeifen, als ob nichts gewesen wäre. Genau das gleiche passiert in deinen Hörsälen. Jede Vorlesung, die du hältst, hat für irgendwen Konsequenzen. Jedesmal, wenn du irgendein neues Mädchen aufreißt, hat das irgendeine Konsequenz für sie. Aber dir scheint das völlig gleichgültig zu sein. Du bist... ich weiß nicht... du bist ...«
»Haphaole«, sagte Gunnar Thorkild ruhig. »Halb weiß und bindungslos. Das ist es doch, was du eigentlich sagen willst.«
»Nein.«
»Doch, Martha, jawohl!.. .Ach, ich weiß, das hat nichts mit Hautfarbe oder Rassenvorurteil zu tun. Aber immerhin hat es mit dem zu tun, was ich bin und was in deinen Augen auf einen Mangel an – wie heißt das Modewort dafür doch noch gleich? – Engagement hinausläuft. Ich bin ein Stammesmensch, kein Gruppenwesen. In einer Stammesgemeinschaft gibt es so etwas wie Engagement nicht. Man ist einfach in die Pflicht genommen, von der Geburt bis zum Tod, ist verpflichtet, zu teilen, zu lieben und zu leiden und Beziehungen zu unterhalten, die auf die alten Götter zurückgehen. Man fischt zusammen und teilt den Fang. Familien tauschen Kinder aus, und niemand leidet darunter, weder die Kinder noch die Ordnung der Dinge. In einer haole-Gruppe ist das was anderes. Die Familie ist zerstört oder krank. Man muß auf dem bestehen, was man ist, muß es sich selbst beweisen und dann mit allem oder einem Teil dessen, was man ist, bezahlen, sonst wird man nicht in die Gruppe aufgenommen. Ich bin nun mal kein Teamarbeiter, kein Universitätsmensch, kein Mann, der Teil einer bestimmten Firma ist. Ich weigere mich, mich anzupassen. Ich bin ganz einfach ich... Du haßt mich, weil ich eine Freiheit habe, die dir versagt ist. Aber du läßt mich kommen und gehen, weil ich keine Ansprüche an dich stelle und du mir genausogut die Tür vor der Nase zuknallen kannst. Meine Kollegen verdammen mich, weil sie sagen, daß es unbequem ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Die Wahrheit ist doch, daß ich keine Vergangenheit habe, die sie interessiert, sie mit mir zu teilen, und keine Zukunft, die ich für die Forderungen verpfänden möchte, die sie stellen. Folglich bin ich ein komischer Kauz... wie ein Schlemihl, der seinen Schatten verloren hat. Daran wird sich nie etwas ändern. Selbst dann nicht, wenn ich mich splitterfasernackt auszöge und wie Christus von Diamond Head bis Puku-Puku übers Wasser schritte ...«
Sie war den Tränen nahe, wollte sich aber nicht zum Schweigen bringen lassen. Verzweifelt rang sie mit ihm.
»Ich verstehe ja, was du sagst. Du kannst nicht zulassen, daß dein persönlicher Friede davon abhängt, was andere Leute von dir reden – was sie tratschen und ratschen. Aber hier geht es doch um etwas anderes. Deine Integrität als Gelehrter wird in Frage gestellt. Deine Autorität als Lehrer steht auf dem Spiel. Entweder du nimmst die Herausforderung an oder du dankst ab.«
»Was bedeutet, daß ich auf eine Expedition gehen muß, stimmt’s?«
»Richtig.«
»Was heißt: ein Schiff, eine Mannschaft und Proviant – mit anderen Worten: Geld.«
»Du hast doch Geld.«
»Zehntausend Dollar auf der Bank!«
»Und ein regelmäßiges Einkommen, ein Haus, eine wertvolle Bibliothek und einen Wagen ...«
»Und du meinst, ich sollte all das mit einem einzigen Unternehmen aufs Spiel setzen?«
»Ich glaube, dir bleibt gar nichts anderes übrig, sonst steht alles gegen dich, was du bisher geleistet hast. Dann bist du als Lehrer und Wissenschaftler erledigt; und hättest obendrein auch noch das Volk deiner Mutter unglaubwürdig gemacht.«
»Was, zum Teufel, schert dich das Volk meiner Mutter?«
»Weil ich dich lieb hab’ und Mark dich vergöttert – und weil ich gern wüßte, ob es in dieser Scheißwelt nicht doch einen Mann gibt, den wir beide achten können... Wirst du jetzt bitte nach Hause gehen? Ich glaube nicht, daß ich heute abend noch mehr ertrage.«
Am nächsten Morgen erwachte er mit rotgeränderten Augen und völlig zerschlagen an seinem Schreibtisch. Vor ihm lag ein Notizblock, den er mit Berechnungen vollgekritzelt hatte. Die Zahlen zeigten, daß er, wenn er seine Sicherheiten belieh, wohl auf vierzigtausend Dollar kommen würde – und dieses Darlehen zurückzuzahlen, würde ihn zehn Jahre kärgsten Lebens kosten. Seine erste Vorlesung begann nicht vor elf Uhr; folglich rasierte er sich und duschte, trank ein Glas Orangensaft und fuhr dann zu Red Mulligan’s Bootswerft in Ala Moana hinunter.
Red hatte früher bei der Marineinfanterie gedient und sich inzwischen einen Bierbauch angetrunken. Er besaß eine spitze Zunge, fluchte von morgens bis abends, hatte ein Auge für Leute, die nichts von Schiffen verstanden, und besaß die beste Bootswerft und die solideste Maklerfirma auf Hawaii. Seine Frau war eine äußerst betriebsame, rundliche Person, die sich um das Büro kümmerte, Maler, Decksleute und Schiffszimmerer auf Trab hielt und dafür sorgte, daß ihr Mann während der Geschäftszeit nüchtern blieb. Eigentlich paßten sie überhaupt nicht zusammen, gaben aber ein gutes Gespann ab, waren mit allen Wassern gewaschen, aber auch großzügig und stets auf dem laufenden, was die nicht zimperlichen Gerüchte im Hafenviertel betraf. Bei einem Becher Kaffee im Büro des Zimmermanns legte Gunnar Thorkild Red in großen Zügen vorsichtig seine Pläne auseinander.
»... ich weiß, was ich will, Red: so was Ähnliches wie einen kleinen Ostseefrachter oder Insellogger, dreihundert Tonnen etwa, nicht länger als dreißig Meter, mit drei Masten und einem Rahsegel, um die Passatwinde auszunutzen. Ich brauche eine niedrigtourige Maschine, eine von diesen alten Blubberdingern, die selbst noch unter Wasser weiterlaufen! Außerdem brauche ich einfachste Unterkunftsmöglichkeiten für dreißig Leute: Studenten und Crew. Und außerdem müssen Sie mir mit Ihrem Blut unterschreiben, daß der Rumpf keine Würmer hat und Masten und Takelage in Ordnung sind.«
»Sie reden von einem dieser soliden alten Kähne«, sagte Red Mulligan, »und wenn Sie einen haben wollen, der tipptopp in Ordnung ist, so daß Sie auch auf große Fahrt mit ihm gehen können, dann werden Sie dafür blechen müssen. Wieviel können Sie denn auf den Tisch legen?«
»Dreißigtausend – höchstens.«
Red Mulligan bedachte ihn mit jenem mitleidsvollen Blick, den die Iren für Betrunkene, heruntergekommene Priester und geborene Idioten übrig haben. Langsam wiegte er den Kopf von einer Seite auf die andere, während es in seinem Bauch aus Protest gegen solchen Wahnsinn vernehmlich rumorte. Zuletzt steckte er Baumstämmen gleich zwei Arme aus und legte Thorkild die Hände auf die Schultern. Seine Stimme verriet echte Rührung.
»Doc! Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, was Sie mit dreißigtausend Eiern machen können: Sie können in jedes Reisebüro gehen und sich zwei Erster-Klasse-Tickets für eine Weltreise kaufen. Außerdem können Sie Helen’s Mädchenagentur anrufen und sich aus fünfzig Prachtweibern jede aussuchen, die Sie mitnehmen wollen. Sie können sich für sechs Monate mit Unterkunft, Bettgenossin und Schnaps ausstatten lassen, und wenn Sie dann hinterher nach Hause kommen, haben Sie immer noch ein paar Scheine in Ihren Jeans. Aber einen Frachter – vergessen Sie’s! Haben Sie eine Ahnung, was ein solcher Kahn ist, Doc? Nichts weiter als ein Riesenloch im Meer, in das betuchte Landratten ihr Geld reinstecken und aus dem ausgebuffte Leute wie ich Geld rausholen können. Haben Sie das gefressen, Doc? Haben Sie mich kapiert?«
»Laut und deutlich«, sagte Gunnar Thorkild. »Aber Sie haben mir selbst gesagt, daß Schiffe den Besitzer wechseln wie Gebrauchtwagen. Die Eigner stellen fest, daß der Unterhalt sie zu teuer zu stehen kommt, und deshalb bieten Werften sie manchmal unbezahlter Rechnungen wegen zum Verkauf an. Warum gucken Sie sich nicht mal um und sehen, ob Sie nicht doch was für mich finden?«
»Es geht nicht darum, ein solches Schiff zu finden«, sagte Red Mulligan langsam. »Ich weiß sogar, wo Ihr Schiff in diesem Augenblick liegt.«
»Wo?«
»Zwei Meilen von hier, an der Reede von Mort Faraday.«
»Und wer ist der Eigner?«
»Carl Magnusson.«
»Der Konservenfritze?«
»Der Konservenfritze, der Frachtlinienfritze, der Hans-Dampf-in-allen-Gassen-Fritze, der Gott-mir-und-noch-mal-mir-Fritze... Ja, dieser Magnusson.«
»Wieviel verlangt er denn?«
»Zweihundertfünfundzwanzigtausend.«
»Und auf wieviel kann ich ihn runterhandeln?«
»Auf zweihundertfünfundzwanzigtausend.«
»Nichts zu machen, eh?«
»Das ist der hartgesottenste Fisch in unserem ganzen Gewerbe.«
»Ich würd’ mir den Kahn aber trotzdem gern mal ansehen.«
»Ich werde Mort Faraday anrufen. Wann wollen Sie hin?«
»Möglichst gleich.«
»Aber tun Sie mir einen Gefallen, Doc, ja? Tun Sie so, als hätten Sie das Geld und wären bloß verdammt vorsichtig, in was Sie es reinstecken wollen. Mort und ich haben geschäftlich viel miteinander zu tun, und ich möchte nicht eine schöne Freundschaft in die Brüche gehen sehen ...«
Eine Viertelstunde später stand Gunnar Thorkild an Deck der ›Frigate-Bird‹ – eines Dreihunderttonners mit der Takelage einer Schonerbark und einer MAN-Zwillingsdieselmaschine, ursprünglich ein Nordseefrachter, aus dem man ein Ausbildungsschiff der Navy gemacht hatte und der später für einen reichen Mann zur Jacht umgebaut worden war. Seine Decks bestanden aus Teakholz, die Beschläge waren blitzblank geputzt, die Segel makellos wie Tischleinen und das Tauwerk weiß wie an dem Tag, an dem es gekauft worden war. Der Maschinenraum sah aus wie ein Operationssaal, und das Ruderhaus mußte für einen Nautiker der reinste Himmel sein.
Für Gunnar Thorkild war es Liebe auf den ersten Blick – doch schon im nächsten Augenblick fiel er in tiefste Verzweiflung. Für den Preis – sofern man das Geld hatte – war das Schiff ein Geschenk. Es jedoch zu bemannen und in dieser jungfräulichen Pracht zu erhalten, bedurfte es eines weiteren Vermögens. Hoffnungsvoll meinte Mort Faraday, der Makler:
»Ein schönes Schiff, was?«
»Wer macht denn den Skipper für Magnusson?«
»Kapitän ist er selbst – zumindest war das so, ehe er krank wurde – und die Mannschaft holte er sich immer aus Leuten von der Insel und seinem Besitz auf Kauai zusammen.«
»Hat er es nie verchartert?«
»Niemals und unter keinen Umständen. Wir haben phantastische Angebote von großen Namen gehabt. Aber Magnusson würde Ihnen dieses Prachtschiff genausowenig vermieten wie seine Frau.«
»Warum will er es denn verkaufen?«
»Wie ich schon gesagt hab’, er ist vergangenes Jahr krank geworden – Schlaganfall. Zwar hat er sich wieder erholt, aber immerhin hat er ein lahmes Bein und einen Arm zurückbehalten, der auch nicht mehr so gut ist wie früher. Ich nehme an, er hat es sich überlegt; die ›Frigate-Bird‹ ist schlichtweg etwas, was er sich nicht mehr leisten kann.«
»Irgend ’ne Chance, daß er mit sich handeln läßt?«
»Würden Sie’s tun, wenn sie Ihnen gehörte?«
»Nein, vermutlich nicht.«
»Aber ich will Ihnen was sagen. Bei diesem Preis, für den sie ja geschenkt ist, könnte unsere Finanzierungsgesellschaft sich mit einem Fünfundsiebzig-Prozent-Darlehen bei einer Laufzeit von fünf Jahren beteiligen.
Wenn Sie sie kauften und dann vercharterten, könnten Sie das mit Leichtigkeit herausholen.«
»Lassen Sie mich darüber nachdenken. Ist Magnusson in der Stadt?«
»Soweit ich weiß, ja. Er verläßt sein Haus heutzutage kaum noch. Aber wenn Sie sich einbilden, Sie könnten mit ihm feilschen, sind Sie falsch gewickelt. Der frißt Sie auf wie Popcorn, falls Sie ihn überhaupt zu sehen kriegen, was gar nicht so einfach ist.«
»Vielen Dank für die Warnung. Wie lange braucht es, das Schiff seeklar zu machen?«
»Mann! Solange es Sie kostet, frischen Proviant zu kaufen und ihn an Bord zu bringen. Die Tanks sind voll, Trockenvorräte und tiefgekühltes Fleisch sind da, und außerdem sind die Lager voll mit Ersatzteilen und Austauschsystemen. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Anlasser zu drücken und von der Pier abzulegen. Ich schwöre Ihnen, ein so günstiges Angebot kriegen Sie nie wieder ...«
»Ich glaub’s Ihnen, Mort«, sagte Gunnar Thorkild liebenswürdig. »Ich komm’ wieder. Zunächst einmal: auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen, Professor. Sollte mir leid tun, wenn aus dem Verkauf nichts würde ...«
Während er durch das Getriebe des morgendlichen Verkehrs zur Universität fuhr, entwarf Gunnar Thorkild im Geiste bereits den Brief, den er noch am Abend desselben Tages durch einen Boten an Carl Magnusson schicken wollte.
Das Haus von Carl Magnusson war wie der Mann selbst: abseits gelegen, diskret, privilegiert, ein flacher Bungalow aus Teakholz und vulkanischem Gestein in einen tropischen Garten hineingebaut, dessen Rasenflächen und Sträucherrabatten sich bis ans Meer hinunterzogen. Es gab ein schmiedeeisernes Eingangstor und einen Pförtner, der aufmachte. Wer hier Eingang fand, dem wurde er gnädigst gewährt – ein Recht dazu hatte niemand. Das Wohnzimmer und die lanai-Veranda, die auf den Swimming-pool und den Horizont jenseits des Korallenriffs hinausgingen, waren Orte, an denen hohe Staats- und Wirtschaftsgeheimnisse besprochen wurden.
Carl Magnusson selbst war ein Mann von furchteinflößendem Ruf und einzigartigem persönlichem Charme. Er war großgewachsen, stark wie ein Baum, weißhaarig und rotgesichtig, sprach leise und erweckte stets den Eindruck, als sei er außerordentlich interessiert bei der Sache, selbst wenn seine Gäste das banalste Zeug von der Welt redeten. Seine Zornesausbrüche waren überwältigend und zeitigten bisweilen verheerende Folgen, niemals waren sie jedoch schrill oder hemmungslos. Man wußte, daß er zum viertenmal verheiratet war und sechs Kinder hatte. Die Kinder waren alle erwachsen und außer Haus. Seit seinem Schlaganfall lebte er mit seinen philippinischen Hausangestellten, seiner Frau und einer Privatsekretärin, die gleichfalls im Haus wohnte, ganz zurückgezogen. Er empfing Gunnar Thorkild auf der lanai, ließ ihn an einem Tisch Platz nehmen, auf dem Gunnars Brief sowie seine sämtlichen Veröffentlichungen lagen, wartete, bis der Kaffee serviert worden war, und meinte dann: »Thorkild, ich habe Ihren Brief und Ihre Publikationen gelesen. Außerdem habe ich mich über Ihre persönlichen Umstände sowie über Ihren akademischen Werdegang informiert. Ich bin beeindruckt, aber auch ein bißchen verwirrt.«
»Warum?«
»An einem kritischen Punkt Ihrer Karriere haben Sie einen Fehler gemacht – und zwar einen großen.«
»Das war kein Fehler. Es war vielmehr ein Akt des Glaubens – und zwar des Glaubens an einen großen Mann: meinen Großvater.«
»Ein Glaubensakt – interessant, das so zu sehen. Einer Ihrer ‘Kollegen, mit dem ich mich gestern unterhielt, beschrieb es als eine Kapitulation vor einem Märchen, einem Traum, der in den Bereich der Folklore gehört.«
»Es ist ein Traum, Mr. Magnusson – allerdings der Traum eines ganzen Volkes. In dieser oder jener Form treffen Sie im gesamten pazifischen Raum auf ihn, von der Gambier-Insel bis zu den Gilbert-Inseln. Der Kern ist immer der gleiche: Daß es eine Insel gibt, einen heiligen Ort, den die alii – die großen Häuptlinge und großen Seefahrer – aufsuchen, um dort zu sterben... Nun handelt es sich aber nicht um die belanglose Träumerei eines einzelnen Menschen, sondern um das, was Jung ›das große Träumern‹ genannt hat: um den Mythos einer über den größten Ozean unseres Planeten verstreuten Rasse. Hinter jedem ›großen Träumen‹ steht aber eine große Wahrheit – oder auch eine kleine, die grundsätzliche Bedeutung erlangt hat.«
»Und Sie glauben tatsächlich, daß es diese Insel gibt?«
»Ja.«
»Und glauben, Sie können sie finden?«
»Ich weiß, daß ich sie finden werde.«
»Woher wissen Sie das?«
»Mein Großvater wird es mir sagen. Das Wissen darum muß man an mich weitergeben, und er ist derjenige, der es weitergeben muß. So sind die Dinge nun einmal.«
»Nun mal langsam, Mr. Thorkild! ... Es muß geschehen, weil die Dinge nun einmal so sind! Das von einem Wissenschaftler zu hören ist ein bißchen viel.«
»Wie lange leben Sie schon auf diesen Inseln, Mr. Magnusson?«
»Meine Familie ist seit vier Generationen hier ansässig, Thorkild.«
»Dann sollten Sie sich eigentlich nicht darüber lustig machen – darüber, wie ›die Dinge nun mal sind‹, und daß diese Dinge weitergegeben werden.
Ein paar Meilen vom Pali-Paß entfernt gibt es heilige Stätten. Sie sind eigentlich schon seit Jahrhunderten vergessen, aber wenn Sie zufällig in die Gegend kommen, finden Sie sich plötzlich von Wächterfamilien umringt, die Sie warnen. Sie wissen, daß die Pflicht, diese Stätten zu schützen, und ihr Sinn auch heute noch weitergegeben werden – und falls Sie es nicht wissen, sollten Sie es wenigstens tun.«
»Ich weiß«, sagte Carl Magnusson und grinste. »Ich wollte bloß wissen, ob Sie es auch wüßten. Für jemand, der um einen Gefallen bittet, sind Sie verdammt kratzbürstig.«
»Ich bitte nicht um einen Gefallen. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen.«
»Was für eine Art Geschäft?«
»Ich möchte Ihre ›Frigate-Bird‹ chartern.«
»Sie steht zum Verkauf und nicht zum Verchartern.«
»Ich habe aber gehofft, Sie würden ein Charterangebot vielleicht doch in Erwägung ziehen.«
»Nein. Die ›Frigate-Bird‹ ist etwas, was ich liebe, nichts, womit ich Geld machen will.«
»Daß Sie sie lieben, verstehe ich«, sagte Gunnar Thorkild und verzog sein Gesicht. »Ich habe mich selbst in sie verliebt. Aber es hat keinen Sinn, so zu tun, als könnte ich sie mir leisten.«
»Angenommen, Sie könnten es doch. Was würden Sie tun?«
»Ich würde selbst das Kommando übernehmen, mir eine Mannschaft zusammensuchen und außerdem ein paar junge Männer und Frauen an Bord nehmen und mit ihnen nach Hiva Oa schippern. Dort würde ich meinen Großvater samt seinem Kanu an Bord nehmen und ihn die Führung übernehmen lassen, solange er will. Dann würde ich ihn in seinem eigenen Boot über Bord lassen und ihm auf Wiedersehen sagen. Danach würde ich eine Entscheidung treffen müssen ...«
»Was für eine Entscheidung?«
»Eine sehr schwere. Ich würde dann nämlich wissen, wie ich diese Insel erreichen kann. Ich könnte umkehren und das Wissen um diese Insel für mich behalten – oder weiterfahren und sie finden, sie kartographisch aufnehmen, wieder nach Hause kommen und meinen Ruf als Wissenschaftler verteidigen und bestätigen.«
»Und wie, meinen Sie, wird Ihre Wahl ausfallen?«
»Das ist ja gerade das Problem. Ich bin ein haphaole, verstehen Sie – zwei Menschen in einer Haut.«
»Es gibt auch noch eine dritte Wahl.«
»Auch über die habe ich nachgedacht«, sagte Gunnar Thorkild. »Sich aufmachen, den letzten unentdeckten Flecken Erde auf unserem Planeten finden und dort bleiben. Der Gedanke ist verlockend.«
»Ich könnte dieser Verlockung erliegen.«
»Sie könnten sich von all dem hier trennen?« Gunnar Thorkild war skeptisch.
»Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Thorkild. Wenn Sie flach auf dem Rücken liegen und sich weder rühren noch regen können und die Aasgeier bereits im Aufsichtsrat warten, Ihnen das Fleisch von den Knochen zu reißen, dann sehen Sie das Leben plötzlich ganz anders ...« Er sprach nicht weiter, sondern betrachtete lange die Leberflecke auf seinem Handrücken. Dann sagte er, ohne die Stimme zu heben:
»Es ist eine interessante Idee, aber man hat Sie ziemlich an die Wand gedrängt, stimmt’s? Verchartern tue ich sie nicht. Und sie zu kaufen können Sie sich nicht leisten. Was werden Sie jetzt tun?«
»Mich weiter nach einem Schiff umsehen, das ich mir leisten kann. Wenn ich bis Ende des Monats keins gefunden habe, pack’ ich meine Sachen und fahre zu meinem Großvater nach Hiva Oa. Ich habe das Gefühl, daß ihm die Zeit ausläuft. Ich muß da sein, um ihn auf seine letzte Reise vorzubereiten.«
»Ich möchte mal wissen«, sagte Carl Magnusson säuerlich, »ich möchte mal wissen, ob Ihre Enkel einmal genauso denken werden.« Gunnar Thorkild sagte nichts. Der alte Mann legte die Stirn in Falten: