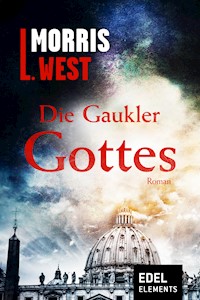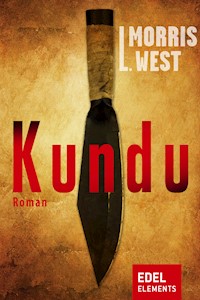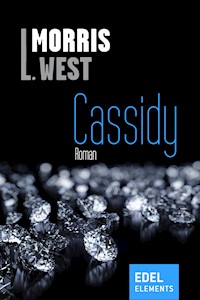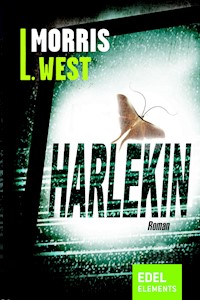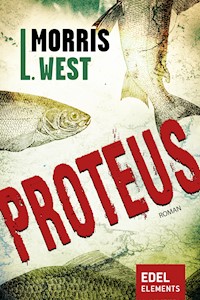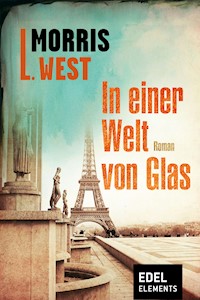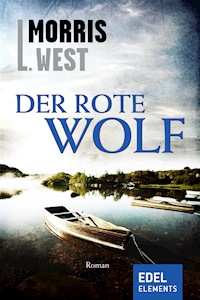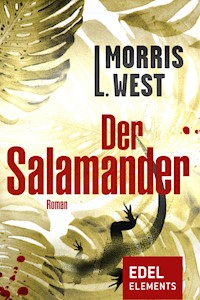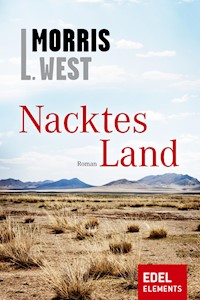
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser packende Weltbestseller von Morris L. West wurde fürs Kino verfilmt! Der australische Farmer Lance Dillon kommt zufällig dazu, als Eingeborene an einem einsamen Wasserloch seinen Zuchtbullen töten – sein einziges Kapital. Die Eingeborenen greifen ihn wütend an, da er sie bei einer religiösen Zeremonie gestört hat, und er kann sich, angeschossen, nur mit Mühe in den Busch retten. Nach qualvoller Flucht bleibt er schließlich hilflos und ohne Hoffnung in der erbarmungslosen Wildnis liegen... Seine Frau, die sich inzwischen mit dem Polizisten Neil Adams auf die Suche nach ihrem vermissten Mann begeben hat, verliebt sich in ihren Begleiter. Und schließlich sind sich beide nicht mehr sicher, ob sie den Gesuchten überhaupt noch lebend finden möchten...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Nacktes Land
Roman
Ins Deutsche übertragen von Margarete Längsfeld
Edel eBooks
Inhalt
Cover
Titelseite
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Impressum
1
Er war seit dem Morgengrauen unterwegs. Er ritt nach Osten, weg von der Farm, der aufgehenden Sonne entgegen. Zu seiner Linken floß der Fluß träge und lautlos dahin, vorbei an den Sümpfen, an den Lilienteichen und durch die Tiefebene, die mit wildem Reis grün übersät war. Rechts neben ihm begann der Niauliwald, und vor ihm erhoben sich die sanften Hügel, die das Stone Country begrenzten.
Er saß locker im Sattel, die Beine im Bügel weggestreckt, den Kopf wegen der blendenden Helle nach vorn gebeugt, und sein schwankender Körper wiegte sich im langsamen Gang des Ponys. Die Hitze knallte vom stahlblauen Himmel herunter, sie dörrte, ließ seine Lippen rissig werden, brannte in den Augen und trocknete seine braune gegerbte Haut. Doch unermüdlich und ruhig ritt er auf die roten Hügel zu, wo der Spinifex auf den nackten Steinen wuchs und die Steinpalmen ihre Wurzeln fest in die Spalten und Ritzen des porösen Sandsteins vergruben.
Er hieß Lance Dillon, und zusammen mit einer ländlichen Genossenschaft besaß er einen Anteil an Minardoo, der neuesten und kleinsten Bahnstation am südlichen Zipfel von Arnhem Land. Er war 37 Jahre alt. Für einen Mann höchste Zeit, in das Viehgeschäft einzusteigen, um es mit den großen Syndikaten und den alteingesessenen Familien, den Königen im Nordwesten Australiens aufzunehmen.
Zwanzig Meilen hinter ihm schwärmten die eingeborenen Viehhirten nach Norden, Süden und Westen aus und begannen mit dem Auftrieb, der alljährlich dem langen Treck zum Verladebahnhof vorausging. Sie versahen die neue Herde mit Brandzeichen, sonderten die Schlachtbullen und die minderwertigen zweitklassigen Tiere von unreiner Rasse aus, die vielleicht die Zucht verderben könnten, und trieben dann die Herde zur Farm zurück. Lance Dillon war der Boss, der Feldherr dieser groß angelegten Operation, aber heute überließ er sie den anderen und ritt davon, um sich mit einer ganz privaten Angelegenheit zu befassen.
Den Neuankömmling erwarteten im Land der Rinder fast nur Mühsal und Enttäuschung. Den Syndikaten gehörte der größte und beste Teil des Landes. Sie hatten den bequemsten Zugang zu den Häfen und Bahnhöfen und verfügten über genügend Laderaum auf Zügen und Schiffen. Sie waren reich an praktischer Erfahrung und waren Herren über ausreichend menschliche Arbeitskraft, und vor allem verfügten sie über Kapital, das nötige Geld für die beste Nutzung des Weidelands, für den Bau von Bewässerungsanlagen, für den Transport, für Schlachthöfe und Gefrieranlagen. Sie konnten ihre Rinder schlachten, tiefkühlen und anschließend gleich zu den Laderäumen der bereitstehenden Schiffe fliegen lassen, während der kleine Mann seine Ochsen hundertfünfzig Meilen weit treiben und dabei zusehen mußte, wie sein Gewinn mit jedem Pfund geringer wurde, das sie auf dem Treck abnahmen.
Es war ein Glücksspiel, und der Gewinn fiel demjenigen zu, der den längsten Atem hatte. Lance Dillon wußte das so gut wie jeder andere, und doch steckte er bis zum Hals in Schulden, um bei diesem Spiel überhaupt mitmachen zu können. Er hatte lange nachgedacht und war zu dem Schluß gekommen, daß es für den kleinen Mann ohne Vermögen nur eine einzige Chance gab: eine bessere Rasse zu züchten, die diesem Klima mit seinen Monsunwinden und der Dürrezeit im Sommer gewachsen war, die immun gegen Zecken und Parasiten war, die mehr Fleisch und weniger Sehnen hatte und so widerstandsfähig war, daß sie den strapaziösen Auftrieb zu den Verladebahnhöfen überstand, ohne an Gewicht zu verlieren.
Aus diesem Grunde ritt er nun zu der Hügelkette am Rande von Stone Country. Hinter dem ersten Hügel lag ein Tal, eine geschlossene Mulde mit einer Quelle, die das ganze Jahr hindurch aus dem Boden hervorsprudelte. Hier gab es schattenspendende Bäume und saftiges Gras, hier konnte sich eine neue, edlere Rasse in aller Ruhe fortpflanzen, ohne daß minderwertige Bullen die Zucht beeinträchtigten, ungestört von Dingos und unbelästigt von dem Ungeziefer, das in den Sumpfgebieten des Flusses zu Hause war. Hinter der roten Ziegelmauer lag sein ganzes Vermögen: Bullenblut, dreitausend Pfund wert, und fünfzig erstklassige Kühe, zum Kalben bereit. Wenn seine Rechnung aufging, war dies der erste Schimmer von Erfolg. Nur zwei Jahre noch, und er könnte den gierigen Geldgebern ins Gesicht spucken, die ihm die Kehle zudrückten.
Er zog die Zügel an, stieg vom Pferd und hakte den leinenen Wassersack vom Sattel los, nahm seinen Hut ab, füllte ihn halbvoll mit Wasser und hielt ihn dem Tier so lange vors Maul, bis es auch den letzten Tropfen getrunken hatte. Danach setzte er sich selbst den Sack an die Lippen, warf den Kopf zurück und trank einen langen, wohltuenden Schluck . . .
In diesem Augenblick erblickte er den Rauch, eine dünne Säule, die über dem Hügelkamm aufstieg. Er fluchte leise, stöpselte den Wassersack wieder zu, schwang sich in den Sattel und ritt in scharfem Galopp davon.
Der Rauch konnte nur eines bedeuten: die Myalls waren im Tal und er wollte sie so schnell wie möglich von dort vertreiben. Es war an sich nichts Außergewöhnliches oder Besorgniserregendes dabei, wenn sich Eingeborene im weißen Siedlungsgebiet aufhielten. Das ganze Land hatte einstmals ihnen gehört, und die Myalls, ein Nomadenstamm, der sich ungern in der Nähe weißer Siedlungen aufhielt, waren jahrhundertelang hier herumgezogen. Sie waren das primitivste Volk der Erde, hatten niemals ein Haus gebaut oder ein Rad angefertigt und wußten nichts über den Gebrauch von Kleidung. Ihre Waffen waren Speere und Keulen, Bumerangs und Werkzeuge aus Stein. Sie schliefen auf dem Boden, nackt wie sie Gott geschaffen hatte. Sie ernährten sich von Känguruhs und Büffeln, Reptilien und Raupen, Jam- und Lilienwurzeln sowie dem Honig wilder Bienen. Frei wie Tiere zogen sie durch ihre heimatlichen Gefilde, und die einzige Spur, die sie zurückließen, war die Asche ihrer Lagerfeuer, ein Stapel Zweige oder ein Toter, in Rinde eingehüllt und auf dem Ast eines Baumes abgelegt. Manchmal, wenn das Wild rar war, mochten sie wohl auch einen Stier oder einen Schlachtbullen aus den Herden der Weißen töten; aber das galt sozusagen als Mundraub, und es gab deswegen keine feindseligen Auseinandersetzungen.
Lance Dillon hatte Verständnis für die primitiven Rechte der Myalls und respektierte sie; doch dieses Tal war sein Reich, und er wollte, daß es ihm ganz allein gehörte. Er hatte das den Stammesältesten klargemacht, und bis jetzt hatten sie sich daran gehalten. Der über den Hügeln aufsteigende Rauch war eine Herausforderung, die ihm zu denken gab. Mehr noch, er bedeutete Gefahr. Ein Lagerfeuer konnte sich zu einem Grasbrand ausweiten und seine Weide in einer Nacht vernichten. Die Myalls kannten keinen Unterschied zwischen einem Zuchtbullen und einem wilden Büffel, seine Herde war jedoch zum Züchten da – und kein Fleisch für die Schwarzen.
Diese Gedanken gingen ihm durch den Sinn, als er das Pferd zu rasendem Galopp antrieb, so daß er in kürzester Zeit den Fuß der Sandsteinböschung erreichte, von welcher eine enge Schlucht in das Tal führte.
Dillons Stirn umwölkte sich, als er die heruntergerissene Holzschranke und den zur Seite gedrückten Dornbuschzaun erblickte. Nachdenklich ließ er das Pferd im Schritt durch das Unterholz gehen, dann durch die Mulde, von wo aus sich die Schlucht zu einem kleinen, grasbewachsenen Hügel zwanzig Fuß über dem Grund des Tales öffnete. Hier angekommen, hielt er an und überschaute mit vor Schrecken und Wut weitgeöffnetem Mund das Geschehen.
Acht oder zehn Myalls waren zu einem Jagdfest versammelt, kräftige nackte Burschen, mit Speeren, Keulen und Bumerangs bewaffnet. Drei von ihnen hatten die Kühe und Kälber vom Bullen getrennt und in einen entlegenen Winkel des Tales getrieben. Die übrigen standen im Kreis um den Bullen. Dieser, wohlgenährt und satt, betrachtete sie mit feindseligem Blick. Doch ehe Dillon noch einen Ton herausbringen konnte, steckten drei Speere in dem mächtigen Tier, und zwei Männer schlugen mit Keulen auf den Stier ein, um ihn zu töten.
Einen Augenblick lang saß Dillon wie erstarrt im Sattel, gelähmt vom Anblick dieser sinnlosen Schlachterei. Dann heulte er vor Wut auf, gab dem Pony die Sporen und jagte den Hang hinunter auf die Myalls zu. Noch während des Galoppierens riß er die Peitsche aus dem Sattel, ließ die lange Schnur durch die Luft sausen, um die Männer zu vertreiben. Wie er auf sie zukam, stoben sie auseinander, und sein Schwung ließ ihn mitten durch sie hindurch und an ihnen vorbeipreschen, während der sterbende Bulle brüllte und auf seine Vorderbeine zu kommen versuchte. Dillon schwenkte scharf herum und stürmte wieder los, hieb mit seiner Peitsche auf die Eingeborenen ein, doch er kam nur zwanzig Schritte weit, dann traf ihn ein Speer so, in die rechte Schulter, daß er die Peitsche fallen ließ und fast vom Sattel stürzte. Ein zweiter Speer flog über seinen Kopf, ein dritter riß ihm den Hut herunter. Drei andere Burschen kamen zur Verstärkung angelaufen, und er wußte, daß sie ihn töten würden, wenn er dablieb.
Stöhnend vor Schmerz riß er das Pferd herum und galoppierte zum Hohlweg zurück, noch das Gebrüll des sterbenden Bullen im Ohr. Aus der blutenden Wunde in seiner rechten Schulter baumelte der Schaft des Speeres.
Die Myalls rannten bis zur Mündung des Hohlwegs hinter ihm her, dann machten sie kehrt, um den mächtigen Bullen zu schlachten, für den Dillon dreitausend Pfund bezahlt hatte.
Während der ersten rasenden Minuten seiner Flucht war Dillon zu keinem zusammenhängenden Gedanken fähig. Wut, Schmerz und ein instinktiver tierischer Selbsterhaltungstrieb drängten ihn vorwärts durch die Schlucht, hinaus in den Schutz der Niaulibäume. Erst als das Tal eine Meile weit hinter ihm lag, ließ er die Zügel locker, so daß das abgetriebene Pferd seinen Kopf hängen lassen konnte, sank erschöpft im Sattel zusammen und versuchte, sich wieder in die Gewalt zu bekommen.
Als erstes mußte er sich um die Wunde in seiner Schulter kümmern. Sie war tief und schmerzhaft und blutete stark. Der Speer hatte sich mit seinen Widerhaken in die Muskeln gebohrt, und der herausragende Schaft zerrte höllisch in der Wunde. In diesem Zustand würde er in der Mittagssonne die zwanzig Meilen nach Hause nicht schaffen. Doch um den Speer zu entfernen, wäre eine Operation nötig gewesen, die schlimmer gewesen wäre als die Wunde selbst. Er selbst konnte ihn nicht herausziehen, weil die Widerhaken Muskeln und Sehnen zerreißen würden. Der Schaft mußte abgebrochen und die Spitze vorsichtig durch seinen Körper so weit vorgeschoben werden, bis er sie vorne herausziehen konnte. Beim bloßen Gedanken daran wurde ihm übel. Er schloß die Augen und senkte den Kopf so tief, daß er beinahe den Sattelknopf berührte. Er wartete, bis der Schwächeanfall vorüber war.
Abermals stand das Bild des Tales vor seinen Augen, und die Wut schien neue Kraft in seinen Körper zu pumpen. Mit dem Tod des Bullen waren all seine Hoffnungen und Pläne in nichts zerronnen. Er war fertig, geschlagen, dem Gerichtsvollzieher ausgeliefert . . . und das nur, weil eine Horde mordlustiger Myalls durch die Bezwingung des Herrn der Herde ihre Männlichkeit unter Beweis stellen wollte.
Da durchzuckte ihn ein neuer Gedanke. Sie waren ja überhaupt nicht auf Fleisch aus! In den Grasniederungen gab es Wild in Hülle und Fülle, Känguruhs mit ihren Jungen und verwilderte Rinder. Es gab Gänse auf den Teichen und Fische im Fluß. Selbst der größte Eingeborenenstamm brauchte nicht zu hungern.
Es steckte viel, viel mehr hinter dem Mord an dem König der Herde und dem Angriff auf ihn selbst. Das war reine Absicht gewesen – gerichtet gegen die Stammesältesten und gegen ihn. Ihm fiel ein, daß die Burschen alle jung gewesen waren, glatthäutig, leichtfüßig und angriffslustig. Die Alten respektierten die Regeln der Koexistenz mit den Weißen. Sie kannten die Macht der Polizisten im Nordwesten: alles Einzelgänger, zäh und unnachgiebig, Männer, die einen Mann monatelang verfolgten, um ihn für ein Vergehen zu bestrafen. Stammesmorde waren eine Sache, aber Gewalt gegen die Weißen, das war etwas ganz anderes, und damit wollten die Alten nichts zu tun haben.
Die Jungen dachten da anders. Sie verübelten den Alten ihre Autorität. Noch mehr brachte sie die Anwesenheit von Fremden in ihren angestammten Gebieten auf. Ihr Lebenswille pulste kräftig unter ihrer dunklen Haut, und sie mußten sich und ihren Frauen beweisen, daß sie die Männer waren, die eines Tages die Stammesversammlungen anführen würden. Sobald sich die erste Erregung gelegt hatte, würde ihnen klarwerden, was sie zum Unwillen ihrer Väter angerichtet hatten, und daß die Rache des weißen Mannes den ganzen Stamm treffen könnte. Sie würden deshalb ihre Untat listig zu verheimlichen suchen und würden versuchen, ihn zu töten und seine Leiche zu verstecken, damit niemand genau dahinterkäme, wie er gestorben wäre. Davon war Dillon überzeugt.
Wieder kroch Angst in ihm hoch, sein Magen verkrampfte sich und sein Herz zog sich in kaltem Schauder zusammen. Instinktiv blickte er zum Hügel zurück. Eine einzelne Gestalt stand als Silhouette gegen den Himmel. Der Mann hatte in der einen Hand ein Bündel Wurfspeere, und mit der anderen beschattete er die Augen, um so die weite Ebene unter sich besser beobachten zu können. Dillon drängte das Pony noch tiefer in den Schatten der Niaulibäume und blieb stehen, um die Situation zu überdenken.
Schon bald würden sie hinter ihm her sein und wie bei einem wilden Tier seine Spuren verfolgen: Hufabdrücke, Steinsplitter, einen gebrochenen Zweig und die Ameisen, die sich auf seinen Blutstropfen versammelten. Sie würden zwischen ihm und der Farm auftauchen, um ihm den Rückzug abzuschneiden, und wenn er ihnen zu entkommen versuchte, würden sie ihn nur um so schneller finden, denn ein ausgeruhter Buschmann konnte länger durchhalten als ein abgehetztes Pferd mit einem verwundeten, schwankenden Reiter im Sattel.
Der Fluß war seine einzige Hoffnung. Er konnte seine Spuren verwischen, sein Pferd tränken und seine Wunde säubern. Die tropischen Uferpflanzen konnten ihn während der Rast schützen, und wenn er Glück hatte und mit seinen Kräften haushielt, würde er vielleicht den Weg flußabwärts zur Farm zurück schaffen. Es war eine kleine Chance; aber seine Kräfte schwanden zunehmend, je mehr Blut er verlor. Jetzt oder nie, er mußte sich aufmachen und sich in weitem Bogen nach Süden wenden, damit die Bäume ihn so lange wie möglich schützten. Aber zuerst mußte er fünf Meilen weiter stromaufwärts reiten, denn er wagte es nicht, den kürzeren Weg über das offene Land zu nehmen. Er nahm einen langen Zug aus der Wasserflasche, straffte die Zügel mit der linken Hand, und mit dem immer noch erbarmungslos bohrenden Speer in seinem Rücken brach er auf, durch die grauen Bäume auf das ferne Wasser zu.
Mundaru, der Mann des Anaburu, hockte auf einem Felsvorsprung und beobachtete, wie der weiße Mann davonritt. Er konnte ihn nicht sehen, aber der Lauf seines Weges war deutlich gekennzeichnet durch seinen wandernden Schatten zwischen den Baumstämmen, durch eine auffliegende Schar Papageien, durch den erschreckten Sprung eines grauen Zwergkänguruhs zwischen den Bäumen hervor. Er kam langsam vorwärts und würde noch langsamer werden, aber die Richtung war klar: Er wollte zum Fluß.
Mundaru verfolgte das Geschehen ruhig, ohne Haß oder Freude, so wie er die Bewegungen eines Känguruhs oder eines wilden Truthahns beobachten würde. Er rechnete sich aus, wie lange der Mann noch bis zum Fluß und dann stromabwärts bis zu der Stelle brauchen würde, wo er ihn abfangen und töten konnte. Es lag keinerlei Bosheit in dieser Überlegung. Man mußte so rechnen, wenn man überleben wollte, genauso wie man Neugeborene erschlug, wenn eine Dürreperiode ausgebrochen war, und wie man eine Frau tötete, die es gewagt hatte, auf die Traumsymbole zu blicken, die nur ein Mann sehen durfte. Dillon hatte mit seiner Einschätzung von Mundaru und seinen Stammesbrüdern nur zu einem kleinen Teil recht, doch in Wirklichkeit verhielten sich die Dinge sehr viel anders. Daß sie in sein Tal eingedrungen waren, entsprang keiner bösen Absicht. Sie waren einfach an einen alten und heiligen Ort zurückgekehrt, wo die Geister wohnten. Eine Vorschrift, sich von diesem Ort fernzuhalten, konnte es für sie nicht geben. Es war ihr Ort; zu ihm gehörten sie. Das war keine Frage des Besitzes, sondern der Identität. Die Hügelkette, die Dillon einfach als ein Gehege für sein Vieh ansah, bestand aus einem Wabengebilde von Höhlen, deren Wände mit Totemzeichen bemalt waren, mit der großen Schlange, dem Känguruh, der Schildkröte, dem Krokodil und dem gewaltigen Büffel Anaburu. Dieser war Mundarus Totemzeichen, die Quelle seines Lebens, das Symbol seiner persönlichen Bindungen und der Verbindung mit seinem Stamm.
Daß sie den Bullen getötet hatten, war nicht aus Mutwillen geschehen, sondern war eine religiöse Handlung gewesen. In manchen Stämmen darf ein Mann auf keinen Fall sein Totemtier töten oder essen. In Mundarus Stamm jedoch hatten die Männer, die die Träume bewachten, ein anderes Gesetz aufgestellt. Das Totemtier mußte getötet und gegessen werden; denn aus dieser mystischen Verschmelzung strömten Stärke, Manneskraft und die Verheißung der Fruchtbarkeit auf den Menschen über. Mundaru hatte sich auf diesen Augenblick vorbereitet, hatte mit rötlicher und gelblicher Ockerfarbe, mit Holzkohle und Känguruhblut die Gestalt seines eigenen Büffels an eine Höhlenwand gemalt. Der weiße Mann hatte auf gewaltsame und gefährliche Weise ein religiöses Ritual unterbrochen, und das mußte gerächt werden, wenn Mundaru und seine Totembrüder nicht am eigenen Leibe Schaden erleiden wollten.
Mit den anderen Beweggründen hatte Dillon jedoch recht gehabt: Die Eingeborenen hatten Ärger mit den weißen Eindringlingen, Furcht vor den Alten und vor der erbarmungslosen Rache des Polizisten. Aber das waren zweitrangige und an den Haaren herbeigezogene Erwägungen, es waren nüchterne Überlegungen, wie sie Männer anstellen, die in zwei Welten leben; mit einem Fuß im zwanzigsten Jahrhundert und mit dem anderen im uralten Stammesgeschehen voll magischer Zeichen, Zauberei und geheimer Symbole.
Aus diesem Grund saß also Mundaru, Mann des Büffels, auf seinem hohen Felsen in der Sonne und plante Dillons Verfolgung und Ermordung.
Anfangs wollte er ins Tal hinuntergehen und mit von dem Fleisch des großen Bullen essen, den die anderen jetzt über dem Feuer rösteten. Anschließend wollte er sich niedersetzen, um sich von seinen Stammesbrüdern seinen Körper mit Totemzeichen bemalen zu lassen, wozu Ocker, Holzkohle und das Blut des Bullen verwendet werden sollten. Sie würden dann gemeinsam das Opfer Dillon jagen und ihm den Rückweg abschneiden. Mundaru hatte das Bild in der Höhle gezeichnet, und. Mundaru hatte auch den ersten Speer in die Flanke des großen Bullen geworfen, also durfte einzig Mundaru den Mann töten. Wenn er tot war, würden sie seine Leiche an einem geheimen Ort verstecken, wo ein Polizist sie niemals finden würde.
Bis hierher war für Mundaru alles einfach und klar; aber im Innern fühlte er Unsicherheit und eine leise Furcht aufkommen.
Der Angriff auf den weißen Mann war seine erste selbständige Tat außerhalb des Stammes gewesen, und dabei wurde er mit geheimen Gesetzen konfrontiert, die er nicht verstand. Er hatte schon einmal bei einer blutigen Stammesfehde getötet. Aber damals hatten die Alten ihn geführt und ihm geholfen. Sie hatten ihn an einen geheimen Ort gebracht und ihm den Stein mit dem Symbol des Opfers gezeigt, hatten ihm federgeschmückte Stiefel angezogen und ihn mit dem Speer, dem ein besonderer Zauber Kraft verlieh, zu seiner Mission gesandt. Nach vollbrachter Tat hatten sie ihn mit Ehren empfangen.
Doch hier ging es um eine Totemsache und keine Stammesangelegenheit. Die Alten würden darüber in Streit geraten. Keine Magie würde ihm helfen, denn Willinja, der Zauberer, war ein Mann des Känguruhs, und außerdem haßte Willinja Mundaru, weil jener seine jüngste Frau begehrte. Sicher würde er in der Versammlung gegen ihn sprechen, und wenn er die anderen Männer auf seine Seite brachte, könnte ein schrecklicher Zauber über ihn kommen, an den er kaum zu denken wagte. Doch es war nun einmal geschehen, und er konnte nicht mehr umkehren. So wenig wie der ausgeflogene Same in die Hülse, so wenig kehrt der Speer in die Hand des Werfers zurück. Er konnte nur das Blut des Bullen trinken und darauf bauen, daß es ihm Kraft und Sicherheit verlieh.
Weit im Süden sah er einen weißen Reiher flatternd und kreischend aufsteigen, und er wußte, daß der weiße Mann den Schutz der Bäume verlassen hatte und in das hohe Gras der Sümpfe übergewechselt war. Er stand auf, nahm seine Speere und die Keule und ging zum Lagerfeuer zurück, um mit von dem Fleisch des Bullen zu essen.
Lance Dillon taumelte weiter. Durch den heftigen, brennenden Schmerz wurde ihm zeitweilig schwarz vor den Augen. Sein Kopf dröhnte, und er hatte ein gellendes Kreischen in den Ohren. Der Staub trocknete seinen Mund aus, und eiserne Fesseln schienen seinen Brustkorb zu umklammern. Sein ganzer Körper war gefühllos, und er kam sich wie eine mit Sägemehl ausgestopfte Puppe vor. Er versuchte die Dunkelheit wegzuwischen, aber der Schmerz stieg wie eine große Flut in ihm hoch, und seine Glieder wollten ihm nicht gehorchen. Er fühlte nur noch, wie er von einer schwarzen Welle in die totale Finsternis geschwemmt wurde.
Eine Weile später öffnete er die Augen, tauchte aus der Ewigkeit wieder in Zeit und Raum zurück. Über sich erkannte er das grelle Blau des Himmels, um sich herum einen Wald von Grashalmen, aus dem er das Zirpen der Grillen und das Summen der Insekten vernahm. Das Brausen in seinem Kopf war einem leisen, ständigen Pochen gewichen, aber der Staub war noch immer in seinem Mund. Der Schmerz war nur wenige Zentimeter weit weg und durchfuhr ihn wie ein scharfes Messer, sobald er sich nur bewegte. Ruhig blieb er liegen, schloß die Augen und versuchte sich zu erinnern.
Er war aus den Bäumen ins Freie gelangt. Sein Pferd stapfte vorsichtig durch das mannshohe Gras zur Flußebene hin, als es sich plötzlich, von einer Schlange oder einem Insektenstich erschreckt, aufgebäumt und ihn abgeworfen hatte. Der Sturz, in hohem Bogen, fiel ihm ein und dann der schmerzliche Aufprall. Danach war nichts mehr. Er öffnete wieder die Augen, erkannte das flachgedrückte Gras, wo er hingefallen war, und die geknickten Halme, die das Tier niedergetreten hatte.
Vorsichtig streckte er erst das eine Bein aus, dann das andere. Kein Schmerz – die Knochen waren also noch heil. Seine linke Hand lag ausgespreizt im staubigen Gras. Er sah zu ihr hin, sie kam ihm merkwürdig weit weg vor. Vorsichtig probierte er, ob er sie bewegen konnte. Er beobachtete, wie sich die Finger krümmten, das Handgelenk abknickte, der Ellbogen sich abbog und wie sich dann der ganze Arm langsam bewegte und sich auf seinen Bauch legte.
Von diesem kleinen Erfolg ermutigt, ließ er die Hand weitertasten, zum Zwerchfell hinauf, über den Brustkorb hin bis zur rechten Schulter. Die Finger trafen auf einen klebrigen Blutklumpen, auf einen winzigen krabbelnden Haufen Ameisen und dann auf das gezackte Ende der Speerspitze. Er wußte jetzt, daß durch den Sturz der Schaft des Speers abgebrochen und die Spitze durch seine Schulter hindurch nach außen gedrungen war.
Schon von dem leichten Druck seiner Finger durchfuhr ihn ein stechender Schmerz, und die aufgestörten Ameisen spritzten ihr Gift in seine Haut. Er schloß die Augen und lag schwitzend auf dem Rücken, bis der Schmerz nachließ. Dann tastete er blindlings zwischen den Gräsern herum, bis er das abgebrochene Ende des Speeres fand, und zog es zu sich heran.
Mühsam, Zentimeter für Zentimeter, rollte er sich auf den Bauch, quälte sich auf die Knie und versuchte, mit dem Speerschaft als Stütze, sich auf die Füße hochzuziehen. Zweimal fiel er mit dem Gesicht wieder in das Gras. Mit Keuchen und Stöhnen schaffte er es beim dritten Mal. Er stand, benommen zwar, doch triumphierend, gestützt auf den Schaft. Langsam hob er den Kopf und begann vorsichtig, wie ein alter klappriger Mann an seinen Stock geklammert, durch das hohe Gras auf den Fluß zuzuhumpeln.
Die Entfernung zum Fluß betrug höchstens eine halbe Meile, aber er brauchte, bis er ihn erreichte, länger als zwei Stunden. Ein Dutzend Schritte, und schon mußte er sich wieder ausruhen. Sein Kopf schwirrte, das Herz klopfte, und sein Körper war schweißgebadet. Langsam sickerte das Blut aus der Wunde, wo die Speerspitze noch in seiner Schulter steckte. Jeder Schritt mußte genau bemessen werden, jeder Fuß mußte fest und sicher stehen, bevor er den anderen bewegen konnte. Wenn er noch einmal fiele, könnte er vielleicht nie wieder aufstehen. Der Flüssigkeitsverlust – Blut und Schweiß – hatte ihn ausgetrocknet, und der Durst begann ihn allmählich zu quälen. Noch immer klebten die Ameisen auf seiner Haut, und aus der Niederung stiegen die Insekten in Schwärmen auf und umschwirrten sein Gesicht. Er aber wagte es nicht, den Stock loszulassen, um sie zu verscheuchen.
Als er endlich den Fluß erreicht hatte, lag dieser zwanzig Fuß tief unter ihm, verborgen unter einem Gewirr von Büschen und den knolligen Wurzeln der Pandangpalmen. Erst als er fünfzig Fuß stromaufwärts gehinkt war, fand er eine kleine sandige Böschung, die direkt zum Ufer abfiel. Unter unendlichen Schmerzen setzte er sich so hin, daß seine Beine über die Böschung hingen, und stieß sich dann mit dem Stock so ab, daß er auf dem Hosenboden zum Wasser hinunterrutschte.
Gierig stürzte er sich auf das Wasser, schöpfte es mit der hohlen Hand und schlürfte wie ein Hund. Sobald er fühlte, wie seine Kraft langsam zurückkehrte, zog er unter Mühen sein Hemd aus, wusch es im Fluß aus und riß es dann mit den Zähnen und der linken Hand in lauter Streifen, die er sorgfältig neben sich auf eine Felsenplatte legte. Als er damit fertig war, nahm er wieder einen Schluck Wasser, um sich damit für das brutale Unternehmen zu stärken, die Speerspitze zu entfernen.
Jetzt oder nie mußte es geschehen, doch sein Körper war geschwächt, und sein Wille wehrte sich gegen einen neuen Schmerz. Doch schließlich raffte er sich auf. Er nahm all seinen Mut zusammen, umschloß das rauhe Holz mit beiden Händen und zog es mit einem kräftigen Ruck nach vorn heraus. Zu seiner Überraschung ging es ganz leicht, nur begleitet von einem leichten Blutschwall. Doch der sofort folgende Schmerz ließ ihn laut aufschreien. Sein erster Impuls war, die Speerspitze weit von sich ins Wasser zu werfen, aber er hielt sich sofort zurück, als er sich darauf besann, daß er ein Gejagter war, der keine Waffe außer dem abgebrochenen Schaft besaß. Er legte die gezackte Spitze neben sich auf den Felsen und ging daran, mit den aus dem Hemd gerissenen Streifen die Wunde auszuwaschen und zu säubern. Er überlegte, ob er nicht selbst im Fluß baden sollte, aber dann fielen ihm noch rechtzeitig die Krokodile ein, die es im Wasser gab und die von seinem Blut angelockt werden könnten. Plötzlich stieg eine erneute Angst in ihm auf: Blutvergiftung. Die Eingeborenenwaffe war bestimmt mit Bakterien verseucht, und er befand sich, krank und gehetzt, tageweit entfernt von ärztlicher Hilfe, falls er sie überhaupt jemals erreichen würde.
Lange saß er sinnend über diesen bitteren Gedanken, bis er sich an etwas aus früheren Tagen erinnerte. Er hatte beobachtet, wie die Eingeborenen auf der Farm Verletzungen mit Spinnenweben verkleistert hatten, und irgend jemand hatte von einem Zusammenhang zwischen diesem klebrigen Gewebe und Penicillin gesprochen. Er schaute sich um und entdeckte zwischen den Pandangwurzeln ein großes Netz mit einer riesigen schwarzen Spinne in der Mitte.
Mit dem Speerschaft in der Hand kroch er langsam die Böschung hinauf und stieß gegen das Netz. Die Spinne ließ sich an einem einzigen Faden herab und lief davon, Dillon wickelte das zerstörte Gebilde oben um seinen Stock und zog es zu sich heran. Die klebrigen Fäden rollte er zu einer Kugel und stopfte sie mit einem Stofftampon aus seinem Hemd in die Wunde. Nach langen vergeblichen Versuchen gelang es ihm schließlich, einen festen Verband über der Schulter und unter der rechten Achselhöhle anzulegen. Vielleicht hielt er lange genug, bis die Blutung gestillt und die Wunde mit Schorf bedeckt war.
Nachdem er das alles geschafft hatte, fühlte er sich schwach und hungrig und hoffnungslos allein. Er stand vor dem elementarsten aller Probleme – Überleben – und hatte kaum die leiseste Ahnung, wie das zu bewältigen wäre. Erst einmal mußte er essen, um seine erschöpften Kräfte zu erneuern. Wenn er schlafen wollte, mußte er sich wie ein Tier in einem sicheren Bau verkriechen. Er mußte seinen Verstand des 20. Jahrhunderts gegen die primitive Strategie der Jägernomaden ausspielen. Lauter einfache Aufgaben – bis er mit ihnen konfrontiert wurde.
Wohin schwärmten die Fische? Mit welchem Köder kriegte man sie an die Angel? Und wie konnte man sie ohne Angel und Köder fangen? Wie konnte jemand Wild jagen, während er selbst von Menschen gejagt wurde? Welche Pflanzen waren eßbar und welche giftig? Wo konnte man sich vor Männern verstecken, die Zeichen aus dem Staub und der abgeblätterten Rinde eines Baumstamms lesen konnten?
Da saß er nun, krank, schwindlig, zerschlagen, ließ die Hand im Wasser plätschern, und sein ganzes Elend wurde ihm richtig bewußt. Dieser ganze Landstrich gehörte ihm, aber von seiner Natur hatte er keine Ahnung. Die Geheimnisse der Gegend blieben ihm verborgen, und er ging herum wie ein Fremder. Alles schien ihm feindlich gesinnt zu sein, und er wußte, daß er inmitten dieses natürlichen Reichtums verhungern konnte.
Er bemühte sich verzweifelt, sich all das wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, was er von den eingeborenen Viehhirten und den alten Buschmännern aufgeschnappt hatte, die monatelang nach der Sitte der Eingeborenen gelebt hatten. Es gab eßbare Raupen an den Baumstämmen, Lilienwurzeln in den Lagunen, Jamwurzeln und Erdnüsse in der Flußebene. Die zirpenden Grillen könnte er zu einer Mahlzeit zubereiten, vorausgesetzt, daß sein Magen sich nicht gegen die fremde Kost auflehnte. Schlangenfleisch war weiß und schmeckte süßlich, eine Eidechse war dagegen tranig und schwer verdaulich. Der Eingeborene jagte nicht bei Nacht. Er fürchtete sich vor den Geistern, die auf Felsen und Bäumen und in jedem Loch und jeder Höhle der uralten Erde hausten.
Nur mühsam klaubte Dillon diese Erinnerungsfetzen zusammen, und mit Mühe hielt er sie fest.
Hier gab es wenigstens Hoffnung – ein Hinweis auf die mögliche Rettung. Wenn er ein bißchen Nahrung sammeln könnte und ein Schlupfloch für den Tag fände, dann käme er vielleicht so weit zu Kräften, um bei Nacht weiterwandern zu können, wenn sich die Myalls um ihre Lagerfeuer drängten. Der Fluß könnte seine Straße sein, die Dunkelheit sein Freund. Aber die Zeit arbeitete gegen ihn. Er mußte schnell handeln. Jetzt konnten jeden Augenblick die Jäger kommen: schwarze, nackte Männer, mit glatten Gesichtern und geknoteten Haaren und nimmermüden Füßen, die die todbringenden Speere bei sich trugen.
Als Mundaru und seine Myalls aus dem Tal heraustraten, sahen sie als erstes Dillons herrenloses Pferd friedlich zwischen wilden Reispflanzen am Rand des Sumpfes weiden. Zwei der Burschen liefen sofort mit wurfbereiten Speeren darauf zu, doch Mundaru rief sie zurück. Die Sache stände gut, erklärte er ihnen. Der weiße Mann war verwundet und hatte sein Pferd verloren. Kein Grund, sich im Gelände zu verteilen. Sie würden ihn bald finden und könnten ihn dann erledigen. Das Pferd würde allein zur Farm zurückfinden oder von einem Viehtreiber aufgelesen werden. Das würde den Tod des weißen Mannes als Unfall erscheinen lassen.
Sie grinsten anerkennend über seine Gerissenheit und folgten ihm, als er einen großen Bogen schlug, bis sie zu der Stelle kamen, wo das Pferd aus der Grasebene getreten war. Es war ein leichtes, seinen Weg bis zu der kleinen Lichtung zurückzuverfolgen, wo Dillon nach seinem Sturz gelegen hatte.