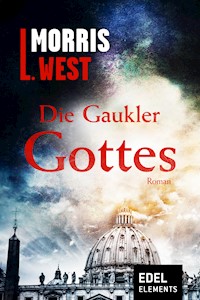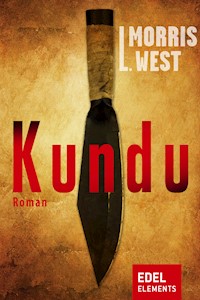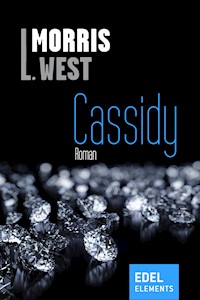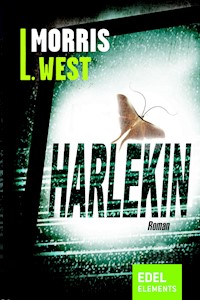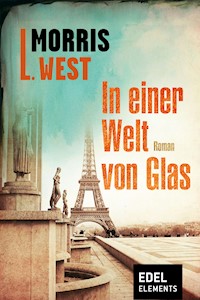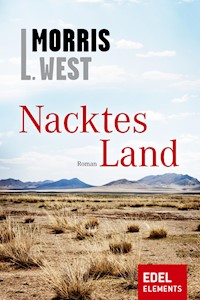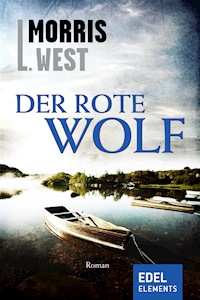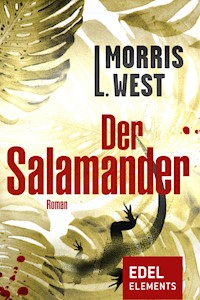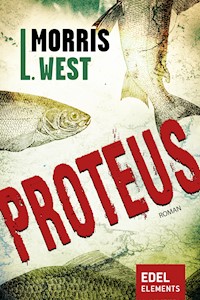
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Proteus - eine Geheimorganisation, die im Zeichen des Fisches politische Gefangene befreit. Proteus - die spannende Geschichte eines Mannes, der die ganze Welt herausfordert! Der mächtige Wirtschaftsboss John Spada ist Kopf der Geheimorganisation "Proteus", die sich weltweit für politische Gefangene einsetzt. Ihre Mitglieder sind einflußreiche Persönlichkeiten, die im Extremfall jedoch auch vor Mord zur Durchsetzung ihrer Ziele nicht zurückschrecken. Dann aber dringt die nackte Gewalt in Spadas unmittelbares Umfeld ein: Seine Tochter und ihr Mann werden in Argentinien verhaftet und gefoltert. Und ein deutscher Freund fällt auf den Stufen des Münchner Nationaltheaters einem Terroranschlag zum Opfer. Spada taucht unter, um aktiv an der Vergeltung der beiden Anschläge mitzuwirken. Aber die lateinamerikanischen Machthaber nehmen grausame Rache. Noch einmal wird Spada untertauchen - dann jedoch werden selbst seine engsten Freunde ihn nicht mehr verstehen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Proteus
Roman
Ins Deutsche übertragen von Gisela Stege
Edel eBooks
Gewidmet allen,
die wegen ihrer Gesinnung inhaftiert sind und
von denen es zu unserer Schande
viel zu viele gibt
»Wir brauchen einen tieferen Einblick in die Natur des Menschen, denn die einzige Gefahr, die droht, ist der Mensch selbst. Er ist die große Gefahr, der wir uns leider nicht bewußt sind. Wir wissen kaum etwas vom Menschen, viel zu wenig. Seine Psyche muß erforscht werden, da wir selbst die Ursache aller kommenden Übel sind.«
C. G. Jung
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Impressum
1
Er war ein Mann, der sehr viel reiste, und das höchst komfortabel; daher wirkte er auch kaum wie ein neugieriger Tourist, sondern mehr wie ein ungeduldiger Manager, der möglichst schnell seine Geschäfte abwickelt und gleich wieder abreist.
An diesem Ostersonntag in Rom jedoch war alles anders. Dies war ein Familienfest, ein Stammestreffen, für das alles andere – die uralte Pracht der Stadt, das Gedränge der Pilger, die päpstliche Messe in Sankt Peter, sogar der Segen urbi et orbi des Pontifex maximus – als geeignete Kulisse und Untermalung diente. An diesem besonderen Tag hätte er sich am liebsten in die Brust geworfen und lauf gerufen: »Seht mich an! Seht John Spada, der heute fünfundfünfzig Jahre alt wird und für jede einzelne Stunde seines Lebens dankbar ist! Seht meine Anna, die immer noch so schön ist wie an dem Tag, an dem ich sie kennenlernte! Seht meine Teresa und den Mann, den sie geheiratet hat – einen stattlichen Mann, einen guten Mann, der mir einen Enkel schenken wird, einen Erben des Spada-Imperiums. So stolz, so glücklich bin ich, daß ich die ganze verrückte, herrliche Welt umarmen könnte!«
Aber er sagte natürlich nichts davon; dafür war er viel zu beherrscht. Sogar hier, im Land seiner Väter, war er beinahe ein Fremder: John Spada aus New York, Präsident eines multinationalen Konzerns, ein König der Kaufleute inmitten des alten Adels und der neuen, ruhelosen Bürgerschicht dieser Stadt der Kaiser und Päpste. Doch Anna wußte, wie glücklich er war, auch ohne daß er es ausdrücklich sagte. Aufgeregt, mit geröteten Wangen klammerte sie sich an seinen Arm, während sie sich durch das Gedränge auf dem Petersplatz einen Weg zu der kleinen Straße hinter dem Borgo Santo Spirito bahnten, wo Onkel Andreas Chauffeur auf sie wartete.
Vor ihnen gingen Teresa und Rodolfo, die er voll Stolz und Liebe beobachtete. Teresa war klein und dunkel wie ihre Mutter. Rodolfo hochgewachsen und schlank, Sproß einer alten Rancher- und Pferdezüchterfamilie aus den Pampas Argentiniens. Er war zehn Jahre älter als Teresa, und Spada schätzte das, denn ein Mann sollte seine Karriere abgeschlossen haben, bevor er heiratet und eine Familie gründet. Mit seinen achtunddreißig Jahren war Rodolfo Vallenilla einer der hervorragendsten Chefredakteure von Buenos Aires, und seine Kommentare über die Politik in Südamerika wurden in der gesamten Welt mit großem Respekt gelesen.
Zu Spadas – nicht allzu großem – Bedauern und Annas tiefer Betrübnis lebten die beiden Familien weit voneinander entfernt: die Eltern in New York, die Kinder in Argentinien; doch heutzutage, im Zeitalter der Jets, des Telefons und des Fernschreibers, war die Entfernung nur noch ein nomineller Faktor. Wenn einmal Kinder kamen, konnte man einen regelmäßigeren Kontakt arrangieren. . . Außerdem war er der Meinung – die er aber, sobald Anna in der Nähe war, nur leise zu äußern wagte –, daß sich Teresa zunächst ein bißchen in den Pflichten einer Ehefrau üben sollte, bevor sie Mutter wurde. Er wollte nicht, daß sie zu früh durch Kinder gebunden würde.
Nun, das alles lag noch in der Zukunft: Das Heute war ausgefüllt und schön. Den Lunch würden sie bei Onkel Andrea in seiner Villa in Frascati einnehmen, um im warmen Frühlingssonnenschein träge und zufrieden über Familienangelegenheiten, Geschäfte und Politik zu plaudern. Das war es, was ihm in New York so fehlte: das Gefühl der Proportion, der Kontinuität; das Gefühl, daß alles außer der Familie absolut unwichtig war. Wenn man über die Knochen toter Legionen zum Büro ging, fiel es schwer, sich über den Dow-Jones-Index Gedanken zu machen.
Als sie den Tiber überquerten, bat Spada den Chauffeur, bis zu den Katakomben von San Callisto die Via Appia Antica zu nehmen und dann zur Via Ardeatina hinüberzufahren. Rodolfo sollte die Ruinen der alten Grabmäler sehen, und er selbst hatte noch eine kleine, pietätvolle Geste vor. Darum bat er zunächst den Fahrer, zu halten, damit er bei einem Blumenhändler am Straßenrand einen Veilchenstrauß kaufen könne. Die Blüten waren klein, ihr Duft schwach und der Preis, den er bezahlte, exorbitant. Teresa protestierte, doch Anna tätschelte ihr den Arm und tadelte sie lächelnd.
»Papa hat heute Geburtstag. Heute tut er, was er will.«
»Tut er das nicht immer?«
»Im Büro vielleicht«, erwiderte Anna gelassen. »Zu Hause gelten andere Sitten.«
»Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört.« Rodolfo Vallenilla lachte. »Meine Mutter sagte immer zu meinem Vater, er sei der beste Pferdetrainer von Argentinien, aber er solle seine Stallmanieren bitte nicht mit ins Haus bringen.«
»Heute«, erklärte John Spada daraufhin, »bin ich ein Heiliger. Ich habe gebeichtet, ich habe die Messe besucht, ich habe den Segen des Papstes empfangen. Ich verlange, respektvoll behandelt zu werden – vor allem von verheirateten Frauen.«
»Wer kommt noch zum Lunch bei Onkel Andrea?«
»Wer kommt nicht?« In Annas Ton schwang eine Spur römischer Bosheit mit. »Sobald sie erfahren, daß dein Vater kommt, trommeln sie Gäste zusammen. Es kommen immer Leute vom Quirinal, ein oder zwei Herren vom Vatikan, Carlo Magnoli aus Turin, unfehlbar Fonseca von der Banco di Roma. . . Wir müssen mindestens mit einem Dutzend rechnen, natürlich alle mit Familie. Puh!. . . Ich bin solche Einladungen nicht mehr gewöhnt!«
»Beruhige dich, Anna mia!« wehrte Spada ihren Vorwurf ab. »Laß deine Tochter einen Teil der Belastung tragen. Als Jungverheiratete muß sie doch in den Kreis der Matriarchinnen eingeführt werden.«
»Ich könnte dich mit Wonne ermorden, Papa!«
»Aber warum? Du bist lange genug eine abgebrühte berufstätige Frau gewesen. Jetzt mußt du dem Klub der Matronen Tribut zollen. Die Einladung heute ist eine gute Übung für dich.«
»Du redest wie ein männlicher Chauvinist! Ich bin Ärztin, keine Klatschtante.«
»Aber wenn du eine erfolgreiche Ärztin sein willst, mußt du dir die entsprechenden Manieren angewöhnen. Bei deinen Besuchen am Krankenbett käme dir ein bißchen Klatsch gut zustatten.«
»Rodo, du solltest deine Frau verteidigen.«
»Gegen den großen John Spada? Ich bin Chefredakteur, nicht Panzerkommandant!«
»Hier halten wir an.« Spada deutete zum Fenster hinaus auf das schwarze Tor, hinter dem die düsteren Fosse Ardeatine lagen, die Steinbruchhöhlen, in denen die Deutschen zur Vergeltung für einen Partisanenüberfall in der Via Rasella dreihundert Geiseln mit Maschinengewehren niedergemäht hatten.
»Ich warte im Wagen.« Anna Spada verkroch sich fröstelnd in die Ecke des Fonds.
»Ich bleibe bei Mama«, erklärte Teresa.
Mit dem Veilchenstrauß in der Hand betrat Spada, von Rodolfo Vallenilla begleitet, die Gedenkstätte. Er erklärte Vallenilla die Bedeutung des Mahnmals und führte ihn dann in den dämmrigen Raum, in dem Reihe an Reihe die dreihundert Sarkophage standen. Er sagte ruhig: »Ich war hier in Italien, als es passierte. Wir kämpften uns über die Abruzzenpässe nordwärts durch nach Rom. Damals wußte ich noch nicht, daß mein Onkel Eduardo, der Bruder meines Vaters, zu den Opfern gehörte. Als ich Verbindung mit seiner Familie aufnahm und davon hörte, mußte ich es meinem Vater schreiben. . . Ihm brach fast das Herz. Bevor er starb, versprach ich ihm, jedesmal, wenn ich nach Rom komme, das Grab meines Onkels aufzusuchen. . .«
Er legte die Veilchen auf die Steinplatte des Sarkophags und blieb eine Weile mit geneigtem Kopf in stummem Gedenken stehen. Dann richtete er sich auf, wandte sich zu seinem Schwiegersohn um und sagte nüchtern: »Ich habe Angst, Rodo. Ich bin ein alter Seefahrer und rieche den Wind. So etwas wie dies hier kann durchaus wieder geschehen. Nicht genauso, aber dennoch, es könnte geschehen.«
»Ich weiß.« Vallenilla nickte. »Es hat bereits angefangen.«
»Ich wollte mit dir sprechen. Wir hatten leider nicht viel Zeit, und ich wollte den Frauen den Tag nicht verderben.«
»Im Grunde kennen wir einander nicht sehr gut, nicht wahr, John?«
»Gerade das möchte ich ändern, Rodo. Wenn ich das nächste Mal nach Buenos Aires runterkomme, setzen wir uns mal privat zusammen, ja?«
»Es wird mir ein Vergnügen sein.«
»Ich weiß, du bist nicht ganz einverstanden mit mir und der Art, wie ich meine Geschäfte führe. . .«
»Teresa liebt dich sehr, das weiß ich.« Vallenilla gab sich merkwürdig formell. »Und ich habe Respekt vor dir, großen Respekt. Das ist ein guter Anfang. Das Verstehen wird sich schon einstellen. Hier, an diesem Ort, beginne ich bereits zu verstehen.«
»Du bist ein Denker«, sagte John Spada. »Ich bin ein Macher. Ich hole Erze aus der Erde. Ich mache Dinge und verkaufe Dinge. Ich handle mit Geld, Waren und politischen Realitäten. . . Je größer der Umfang, desto einfacher wird alles.«
»Oder sieht es nur einfach aus? Wie etwa, wenn man eine Handgranate abzieht – oder dreihundert Geiseln mit Maschinengewehren erschießt?«
»Vielleicht hast du recht; aber urteile nicht zu voreilig, Rodo. Wir müssen ein wenig Geduld miteinander haben, ja?«
»Natürlich.« Grinsend zuckte Vallenilla die Achseln. »Alles Gute zum Geburtstag, Schwiegervater!«
Er legte John Spada die Hand auf den Arm und führte ihn ins Sonnenlicht hinaus. Ehe sie das Tor erreichten, blieb Spada noch einmal stehen und deutete auf die Eingänge der Höhlen, in denen man die Toten gefunden hatte.
»Früher habe ich von ihnen geträumt, und von dem, was da drinnen geschehen ist. Aber komisch, ich habe niemals direkt daran teilgenommen. Ich stand immer da oben auf dem Rand des Steinbruchs und blickte hinab. Ich sah die deutschen Lastwagen kommen, die Gefangenen, die auf die Höhlenöffnungen zugetrieben wurden. Und im nächsten Moment stand ich hier unten, an dieser Stelle, schaute hinein und sah die Soldaten anlegen und schießen, die Geiseln fallen. . . Gesprochen habe ich nie, mich nie bewegt. Niemals hat mich jemand gesehen. Ich war noch da, als die Höhlen verschlossen wurden und der letzte Deutsche abmarschierte. . . Jedesmal schämte ich mich zutiefst, als läge die Schuld an dem Gemetzel an mir. . . Jetzt habe ich diesen Traum schon lange nicht mehr gehabt.«
»Du hast deine Teufel also ausgetrieben.«
»Oder ich habe mich an sie gewöhnt«, gab Spada ihm mit schiefem Grinsen freimütig zur Antwort.
»Das habe ich auch schon erlebt.« Vallenilla war plötzlich gereizt. In seiner Stimme lag ein zorniger Unterton. »Schön ist es nicht. Es ist, als. . . als spielten blinde Kinder in einem Schlachthof!«
Spada erschrak über die Heftigkeit, mit der Vallenilla sprach. Er warf ihm einen langen, forschenden Blick zu und sagte ruhig: »Vielleicht sollten wir uns jetzt unterhalten.«
»Jetzt ist keine Zeit dazu.« Vallenilla sagte es mit Entschiedenheit. »Wenn wir jetzt zu diskutieren anfangen, werden wir uns zweifellos streiten. Außerdem darfst du die Party nicht verderben. Teresa und ich fliegen morgen früh. Ich werde dir schreiben, werde versuchen, dir eine ausgewogene Schilderung der Lage zu geben und der Rolle, die Amerika darin spielt. Wenn sich die Situation verschlechtert, würde ich gern den Fernschreiber des Spada-Büros in Buenos Aires benutzen.«
»Jederzeit. Wir sind ja jetzt eine Familie.«
»Ich weiß. Und ich müßte. . . Ich bin dankbar.«
Eine Entschuldigung lag ihm auf der Zunge, doch Spada schnitt ihm brüsk und humorvoll das Wort ab: »In dieser Familie brauchst du nicht immer höflich zu sein. Aber jetzt müssen wir gehen, unsere Frauen werden sonst ungeduldig.«
Vierzig Minuten später wurden sie mit allen Stammesehren in der Villa Onkel Andreas empfangen, der mit seinen fünfundsiebzig Jahren der anerkannte Patriarch des Spada-Clans war, ein Vater von zehn Kindern, Großvater von zweiundzwanzig Enkeln, ehemaliger Justizminister, immer noch Mitglied des Jagdklubs, Liebhaber von Orchideen und schönen Frauen. Außerdem war er ein allseits anerkannter Vermittler, und die Villa, abgelegen zwischen Weingärten und Olivenhainen, war der Schauplatz so manchen klassischen Manövers zwischen der Linken und dem Zentrum gewesen. Bei der Festlichkeit drehte sich diesmal alles um die Familie, eine dichtgeschlossene Phalanx ältlicher Tanten, junger Vettern und Kusinen mit ihren Kindern, die alle wiedererkannt, umarmt und mit Komplimenten bedacht werden wollten und denen man versichern mußte, daß sie von ihren amerikanischen Verwandten geliebt und verehrt wurden. Dann mußte der neue Schwiegersohn vorgestellt und im Hinblick auf Abstammung, Manieren und Männlichkeit beurteilt werden, während man seine junge Frau verstohlen auf Zeichen einer Schwangerschaft musterte. Spada und Onkel Andrea beobachteten die Zeremonie mit fast boshafter Belustigung; schließlich grinste der alte Mann und nickte anerkennend.
»Gut! Er hat Feuer in den Lenden und Grips im Kopf. Ich finde, du kannst dich glücklich schätzen.«
»Ich bin glücklich, Onkel. Aber ich habe auch Angst.«
»Vor ihm?«
»Um ihn und um Teresa. Hast du verfolgt, was in Südamerika vorgeht?«
»Ich verfolge alles, Giovanni. . . Wieviel Uhr ist es?«
»Gleich zwei. Warum?«
»Ich hielt es für das beste, zunächst den Familienkram hinter uns zu bringen, deshalb habe ich unsere anderen Gäste für zwei Uhr fünfzehn eingeladen. Wir essen um drei. Anschließend können wir uns dann in der Bibliothek unterhalten.«
»Wer kommt noch?«
»Magnoli, Frantisek, Fonseca. . . alles Namen, die du kennst. Aber diesmal kommen noch zwei Neue.« Er zögerte einen Moment, dann fügte er beinahe entschuldigend hinzu: »Die Zeiten ändern sich. Wir müssen uns anpassen. Der eine ist Castagna von der P. C. I. Er steht Berlinguer sehr nahe.«
»Und der andere?«
»Hugo von Kalbach.«
»Wieso der?«
»Weil er einer der großen Denker unserer Zeit ist. Er ist gerade dabei, ein größeres Werk mit dem Titel ›Phänomene und Epidemiologie der Gewalt‹ zu beenden. Ich glaube, er kann etwas beitragen, was für uns alle von Nutzen ist.«
»Und Castagna?«
»Die Kommunisten haben bei der letzten Wahl achtunddreißig Prozent der Stimmen bekommen. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, wenn das Land regierbar bleiben soll. Castagna ist ein Skeptiker und fürchtet sich vor Fanatikern. . . Wobei mir einfällt« – er deutete auf Vallenilla, der mit Charme und Geduld der ältesten Tante den Hof machte – »hast du ihm schon was gesagt?«
»Noch nicht.«
»Bist du seiner sicher?«
»Ja.«
»Dann bring ihn mit. Wir werden bald merken, aus welchem Holz er geschnitzt ist – und ob wir von ihm was lernen können.«
In diesem Moment kam Anna herüber – lächelnd, aber entschlossen. »Jetzt kommt, ihr beiden! Keine Politik vor dem Lunch! Gesellt euch wieder zur menschlichen Rasse. Die Familie möchte mit dir reden, John! Und du, Onkel, solltest Rodo retten. Ich glaube, er hat genug gelitten.« Sie hakte die beiden Herren unter und zog sie mit sich die Treppe hinunter in den terrassenförmig angelegten Garten, wo die Bediensteten den Kindern Limonade, den Erwachsenen Champagner servierten.
Als Spada kam, wurde er von den Damen umringt wie ein Händler auf dem Dorfplatz von den Bauern. Sie verlangten Neuigkeiten, Beachtung, Teilnahme von diesem Spada, der so ungeheuer erfolgreich war. Sie verlangten Protektion für ihre Kinder, eine Zusicherung der Fürsorge in schlechten Zeiten, die nach einhelliger Meinung unmittelbar vor der Tür standen. Tante Lisa, mit ihren achtundsiebzig Jahren faltig und runzlig wie ein Winterapfel, faßte es in ihrem harten römischen Akzent zusammen: ». . . Sie haben jetzt Listen von Kandidaten für Entführungen. An den Straßenecken lauern junge Burschen einem Mann auf und erschießen ihn, wenn er sich eine Zeitung kaufen geht. . . Ob es Rechte oder Linke sind, was spielt das für eine Rolle? Das Ergebnis bleibt gleich: Mißtrauen, Chaos, Verlust des Selbstvertrauens. Wir sind zurückgefallen in die Zeiten der Banditen und Condottieri!. . . Ich weiß es; dein Onkel Andrea weiß es. Wir haben zwei Kriege überstanden und die lange Zeit der Faschistenherrschaft. . . Jetzt sind die gleichen Zeichen wieder vorhanden. Wir stehen kurz vor dem Zusammenbruch. . .«
Spada legte ihr den Arm um die mageren Schultern und versuchte sie zu beruhigen.
»Komm, Tante Lisa! Ganz so schlimm ist es nicht.«
»Du hast leicht reden. Du lebst nicht hier.«
»Nein. Aber ich habe geschäftlich viel hier zu tun. Ich weiß, wie das System funktioniert. Die Extremisten machen viel Lärm; die Regierung wird gestürzt; eine neue kommt; aber es gibt immer noch Brot und Wein auf dem Tisch. Es ist so eine Art Magie, ein Zaubertrick.«
»Aber das Publikum hat die politischen Tricks satt. Es verläßt den Saal. Es sucht sich ein anderes Theater. Es will ein Stück mit einem Helden sehen – und will hinterher durch sichere Straßen nach Hause gehen. . .« Sie sah zu den Umstehenden hinüber. »Das ist die neue Generation. Frag sie, was sie denken!«
Lächelnd schüttelte Spada den Kopf.
»Nicht vor dem Lunch. Nicht an meinem Geburtstag!. . . Sag mal, was hältst du von Rodo?«
Die jüngeren Frauen kicherten und tauschten beredte Blicke. Tante Lisa stieß ein hohes, wieherndes Lachen aus.
»Nicht schlecht für einen Ausländer! Aber den wirst du nicht so leicht zähmen können.«
»Ich will ihn nicht zähmen. Ich brauche einen Mann in meinem Haus.«
»Dann wollen wir hoffen, daß er seine Sache gut macht. . . und daß deine Teresa gern Kinder haben will.«
»Warum sollte sie das nicht wollen?«
»Ha! Diese modernen Frauen mit ihrem Beruf und ihren Ideen von Befreiung!«
»Teresa ist eine sehr gute Ärztin.«
»Jetzt ist sie verheiratet. Sie muß sich um ihren Mann kümmern. Der will, wenn er nach Hause kommt, bestimmt keine müde Frau vorfinden, die nach Äther und nach Jod riecht! Das habe ich ihr auch gesagt.«
»Ich bin überzeugt, daß sie mit allem fertig werden wird, Tante Lisa.«
»Das muß sie auch; deine Anna hatte es nicht leicht mit dir.«
»Hast du sie je klagen hören?«
»Nein, aber du bist ein Spada – und die halten besser durch als die meisten Männer!«
»Du hast eine schmutzige Phantasie, Tante Lisa!«
»Das hilft auch, mein Junge.« Sanft schob sie ihn von sich. »Die anderen Gäste kommen. Geh lieber zu Onkel Andrea.«
Der Lunch wurde auf der sonnigen Terrasse serviert, wo Onkel Andrea, der Gesellschaftsstratege, seine Gäste jeweils zu sechst an die Tische placiert hatte, damit die Unterhaltung ungezwungen und frei geführt werden konnte und die Außenseiter sich nicht beim Familienklatsch zu langweilen brauchten. Spada saß zusammen mit Hugo von Kalbach, Luigi Castagna, Tante Lisa und zwei der intelligenteren jungen Ehefrauen, denen Onkel Andrea widerstrebend das Lob erteilt hatte: »Sie sind zwar nicht die hübschesten, aber sie plappern wenigstens kein dummes Zeug und können auch Wörter mit drei Silben lesen.«
Von Kalbach war die eindrucksvollste Gestalt der Gruppe, ein Riese mit gebeugten Schultern, einer schneeweißen Mähne und einem Lächeln, so rein und unschuldig wie das eines Kindes. Sein Italienisch klang gestelzt; aber er war ein aufmerksamer Zuhörer und an jedem Detail interessiert. Castagna, der P. C. I.-Mann, war aus anderem Holz geschnitzt: schlank, dunkelhaarig und finster dreinblickend, bot er das Bild des eiskalten Verstandesmenschen mit glatter Logik, dem alle Voraussetzungen klar sind und der alle Regeln kennt. Bevor sie noch mit der Pasta fertig waren, begann Tante Lisa schon, seine Verteidigungskünste zu testen:
»Florentiner, nicht wahr?«
»Mütterlicherseits. Mein Vater stammte aus Arezzo.«
»Und was hat Ihr Vater gemacht?«
»Er war Steinmetz, Signora. Auf Grabsteine spezialisiert.«
»Und Sie?«
»Ich hab’s weiter gebracht, Signora – von Grabsprüchen zu politischen Streitschriften.«
»Sie werden feststellen, daß Grabsprüche dauerhafter sind.«
Castagna brach in schallendes Gelächter aus, dessen Heiterkeit bei einem so ernsthaften Mann erstaunlich wirkte. Spada tätschelte der alten Dame kichernd die Hand.
»Deiner wird bestimmt noch lange nicht geschrieben, Tante Lisa. Und jetzt benimm dich! Wenn die Revolution kommt, wirst du alle Freunde brauchen, die du kriegen kannst.«
»Es ist interessant.« Von Kalbach gab sich große Mühe, in seinem sorgfältigen, korrekten Italienisch humorvoll zu sein. »Wir sind eine sehr gemischte Gesellschaft: ein amerikanischer Großkapitalist, ein kommunistischer Abgeordneter, ein Bischof aus dem Vatikan, ein Bankier, ein Automobilfabrikant, ein liberaler Chefredakteur, ein bankrotter Philosoph . . . und alle eingeladen von einem Christdemokraten, der wie ein Fürst lebt!«
»Andrea hat Sinn für Humor«, erklärte Tante Lisa knapp.
»Und eine Begabung für vernünftige Kompromisse«, entgegnete Castagna ruhig. »So etwas brauchen wir in diesen Zeiten.«
»Richtig.« Von Kalbach wurde auf einmal gesprächig und munter. »Die Absolutisten sind es, von denen uns jetzt Gefahr droht – der Terrorist, der die Geschichte mit einer Bombe zurückdrehen will, der Tyrann, der die Gegenwart, in der es ihm gutgeht, festzuhalten sucht.«
»Ist das nicht eine zu einfache Unterscheidung?« Castagnas Ton war sanft. »Vergessen Sie nicht die Organisationen, die den Terror fördern, und jene, die die Tyrannei zu ihrem eigenen Vorteil stützen?«
»Wie zum Beispiel Ihre eigene Partei?« So leicht ließ sich Tante Lisa nicht zum Schweigen bringen.
Castagnas Antwort war höflich, aber eindeutig.
»Oder vielleicht der Spada-Konzern, der Pinochet in Chile zur Macht verholfen hat und anderswo ähnliche Regime unterstützt.«
Alle Augen richteten sich auf Spada, der diese Anschuldigung schweigend verarbeitete und zweifellos wußte, daß er ebenfalls getestet wurde. Castagna war zu klug, um sich von einer gerissenen alten Dame in einen Streit verwickeln zu lassen. Und er selbst sollte ebenfalls klug genug sein, nicht in die Falle zu gehen. Er überlegte noch einen Moment, dann sagte er ruhig:
»Ist das nicht ebenfalls ein absolutistisches Urteil? Im Geschäftsleben akzeptiert man die Fakten; man sucht sich anzupassen an das, was geschieht. Es ist wie bei den alten Karawanenherren. Die mußten mit den Stämmen entlang der Route Verträge abschließen und an den Stadttoren dem König Tribut zahlen. Sonst wäre der Handel zusammengebrochen.«
»Und manchmal bezahlten sie auch die Verschwörer, die einem neuen König an die Macht verhalfen – oder sie kämpften mit den Mannen des Königs gegen die Stämme.«
»Aber können wir, die wir nicht dabei waren, sie richtig beurteilen?«
»Ein gutes Argument, mein Freund.« Castagna lächelte und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich bitte um Verzeihung für meine schlechten Manieren. Später können wir uns vielleicht über die Gegenwart unterhalten.«
»Mit Vergnügen.« Spada wandte sich an von Kalbach. »Onkel Andrea sagte mir, daß Sie an einem neuen Werk über die Phänomene der Gewalt schreiben.«
»Es ist fast fertig.« Der alte Gelehrte war merklich bedrückt. »Ich weiß nicht recht, wie ich es beenden soll, oder ob mir überhaupt die Zeit bleibt, es zu beenden.«
»Warum nicht, Professor?« Die Frage kam von einer der jungen Frauen. »Nun. . .«, von Kalbach machte eine Pause, während der er versuchte, die Antwort auf Italienisch zu formulieren. »Wir sind alle vertraut mit den Phänomenen, den Dingen, die geschehen: Morde, Entführungen, Bombenexplosionen; wir kennen die Brutalität, die von Polizei, Sicherheitsbeamten und professionellen Folterern ausgeübt wird. Was in Frage steht, sind unsere Reaktionen. Wie weit können wir gehen? Welche Moral ist anzuwenden?«
»Und wie lautet Ihre Antwort, Professor?« erkundigte sich John Spada. »Ich habe keine.« Der alte Herr sagte es bedrückt. »Wie ich mich auch drehe und wende, immer stecke ich in einem Dilemma. Als Christ kann ich mich für passiven Widerstand entscheiden. Aber darf ich danebenstehen, während ein anderer Gewalttätigkeit erleidet? Ich habe keine Lösung gefunden, sondern eine Art Rätsel: ›Handele ich, so werde ich zu einem von ihnen. Handele ich nicht, dann mache ich mich zu ihrem Sklaven.‹«
»Ich finde, Sie müssen handeln«, erklärte Tante Lisa fest. »Das ist Ihr Recht und Ihre Pflicht als Mann.«
»Wirklich, meine Dame?« Von Kalbach wandte sich ihr zu. »Dann darf ich Ihnen vielleicht sagen, daß ich in meiner Heimat auf der Todesliste der Baader-Meinhof-Bande stehe, weil man behauptet, ich sei ein Werkzeug der Reaktion. In Rußland wurde ein hervorragender Kollege ins Irrenhaus gesteckt und mit Drogen in eine dahinvegetierende Kreatur verwandelt, weil er gegen die Verletzung der Menschenrechte in seiner Heimat protestiert hatte. Vielleicht wird man uns beide bald töten. Was wollen Sie dagegen unternehmen, Signora? Oder Sie, Mr. Spada? Oder Sie, meine jungen Damen: Was werden Sie Ihren Kindern sagen, was sie tun sollen?«
»Die Damen werden gar nichts tun«, entgegnete Castagna ruhig. »Weil sie nämlich Einzelmenschen sind, wehrlos gegen Organisationen. Und Spada wird nichts unternehmen, was seinem Prestige oder seinem Profit schaden könnte.«
»Und Sie, Castagna?«
»Ich habe Glück.« Es lag mehr als nur eine Andeutung von Selbstironie in seiner Antwort. »Ich hole mir eine Parteidirektive und tue, was man mir sagt. Das ist ebenso bequem, wie einen Beichtvater zu haben.«
»Ich würde Ihnen ja gern glauben.« Spada grinste. »Aber ich fürchte, es juckt Sie ebenso wie uns alle, und Sie kratzen sich ebenso heftig wie wir. . . Sie sollten Tante Lisa bitten, uns die Geschichte von ihrem unbekannten Soldaten zu erzählen.«
»Wie bitte?« Castagnas Miene war verwirrt.
Tante Lisa wieherte wieder. Spada erklärte: »Während des Rückzugs der Deutschen wurde hier in der Villa eine Abteilung der SS einquartiert. Einer der Männer war ein brutaler Säufer, der ständig die Frauen im Haus terrorisierte. Eines abends ging er fort und wurde nie wieder gesehen. Am Fuß eines entfernt gelegenen Weinbergs gab es einen alten Brunnen. Jetzt ist er zugemauert. Der Mann liegt immer noch da unten.«
»Der Brunnen war sehr tief«, erklärte Tante Lisa. »Und die Quelle war ausgetrocknet. Also verloren wir keine Trinkwasserquelle.«
»Und Sie, Signora, haben ihn getötet?«
»So heißt es«, antwortete Tante Lisa gelassen. »Ich habe es nie für notwendig gehalten, das Gerücht zu bestätigen oder zurückzuweisen.«
»Sie sehen also«, beendete John Spada das Thema, »es ist sehr schwer vorauszusagen, wie die Menschen handeln werden, oder hinterher zu beurteilen, ob sie richtig oder falsch gehandelt haben. Aber sprechen wir lieber von etwas anderem.«
Nach dem Essen führte Onkel Andrea die Ehrengäste in die Bibliothek. Ein Diener servierte Kaffee und Liköre und zog sich dann wieder zurück. Onkel Andrea gab eine kurze, zwanglose Einführung.
»Für drei von Ihnen ist dies der erste Besuch in meinem Haus. Wie ich Ihnen vor dem Essen unter vier Augen erklärt habe, sollen Sie aufgefordert werden, sich an einem Projekt zu beteiligen, an dem wir bereits seit geraumer Zeit arbeiten. Sie haben mir Ihr Wort als Gentlemen gegeben, daß Sie alles, was heute hier vorgeht, geheimhalten werden, ob Sie sich uns anschließen oder nicht. Ist das abgemacht?«
Vallenilla, Castagna und von Kalbach murmelten ihre Zustimmung. Onkel Andrea nickte John Spada zu, der ein schwarzes Notizbuch aus der Tasche zog, die gewünschte Seite suchte und sich sodann an die kleine Versammlung wandte.
»Einigen von Ihnen ist bekannt, daß das Unternehmen, das mir heute gehört, in diesem Zimmer seinen Anfang genommen hat, und zwar bei einer ganz ähnlichen Zusammenkunft wie dieser hier. Damals wie heute war Onkel Andrea der Gastgeber, waren Carlo Magnoli und Freddie Fonseca dabei. Bischof Frantisek war nicht hier, denn er war damals noch Pfarrer in Philadelphia. Und ich? Ich war ein junger Mann aus New York mit einem Kopf voller Ideen und fünfhundert Dollar auf der Bank. . . Nun, Onkel Andrea und seine Freunde glaubten an mich und halfen mir aufzubauen, was wir heute besitzen. Und sie taten noch mehr. Sie schenkten mir schließlich die Freiheit. Dafür werde ich ihnen dankbar sein bis ans Ende meiner Tage. . .«
Er unterbrach sich, ergriff mit einer altmodischen Geste die Hand seines Onkels und drückte sie an seine Lippen. Onkel Andrea ermahnte ihn freundlich:
»Erzähl ihnen den Rest.«
»Als das Unternehmen wuchs, fand ich mich plötzlich in einem Kerker gefangen, den ich mir selber errichtet hatte. Erfolg baut Mauern um einen Menschen. Er gewöhnt sich so sehr daran, Bilanzen und Geschäftsberichte zu lesen, daß er darüber den Mann, der barfuß gehen muß, ebenso vergißt wie die Mutter, die keine Milch für ihr Kind hat. Aber er hat stets eine einwandfreie Entschuldigung für seine Sünden. Ohne sein Kapital wäre die Fabrik nicht gebaut worden, und es gäbe keine Arbeitsplätze. Weil es die Fabrik gibt oder das Bergwerk oder das Ölfeld, gibt es eine Stadt, eine Schule, ein Krankenhaus, die sonst niemals gebaut worden wären. Weil er ein Realist ist, hat er die Möglichkeit, dafür zu sorgen, daß die Politiker halbwegs ehrlich bleiben und die Bankiers sich auf neue Unternehmungen einlassen. Es ist also nicht alles einfach schwarz-weiß wie auf einem Reklameplakat. Obwohl Konzerne wie der meine zuweilen, etwa in Chile, Korea, im Iran oder in Brasilien, Huren sind, die im Bett des Tyrannen schlafen und sich im Schutz seiner Polizei sonnen. Und wieder ist es sehr leicht, diese Huren zu verdammen. Weniger einfach ist es nachzuvollziehen, warum eine anständige Frau zur Hure geworden ist, oder was geschehen mag, wenn sie sich entschließt, zu bereuen und tugendhaft zu werden. Außer ihrem Bettgenossen gibt es noch viele andere, die von dem profitieren, was sie tut. . .« Lachend hob er mit einer Gebärde der Kapitulation die Arme. »Sehen Sie? Selbst hier rede ich wie ein Anwalt der Verteidigung! Was ich damit sagen will, ist, daß man nicht einfach ein riesiges Unternehmen auflösen kann, nur um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen! Sondern daß man am besten die Macht, die einem ein solches Unternehmen verleiht, dazu benutzt, das zu bauen, was Onkel Andrea einmal als ›Brücken der Barmherzigkeit‹ bezeichnet hat – und zwar nicht nur zwischen den Reichen und den Bedürftigen, sondern auch zwischen denen, die ohne Vermittler Feinde bleiben würden, zwischen Freunden, die aus Angst vor dem Protokoll nicht miteinander sprechen können, zwischen Menschen guten Willens also, die durch Grenzen oder Ideologien getrennt sind. Diese Gruppe ist eine solche Brücke. Überall auf der Welt bestehen weitere Gruppen, im Iran, in Korea und in vielen anderen Ländern. Alle sind geheim und erkennen einander an einem gemeinsamen Symbol. . . In diesem Raum befinden sich drei Männer, die das Symbol nicht kennen, weil sie noch nicht vollständig eingeweiht sind. Und ehe ich fortfahre, muß ich sie fragen, ob sie mehr wissen wollen, oder ob sie sich lieber zurückziehen möchten?« Einen langen Augenblick herrschte Schweigen; dann stellte Rodolfo Vallenilla eine unverblümte Frage.
»Ich bin mit deiner Tochter verheiratet, und dennoch konfrontierst du mich ohne jede Vorwarnung mit dieser Gruppe. Warum?«
»Weil ich keine Befehlsgewalt über sie habe. Alle Mitglieder müssen sich mit dir einverstanden erklären, wie sie sich auch mit jedem anderen Vorschlag einverstanden erklären müssen.«
»Finanzierst du die Gruppen?«
»Nur zum Teil. Die anderen Mitglieder steuern je nach ihren Mitteln etwas bei. Die Gelder werden in jedem Kreis gemeinsam kontrolliert.«
»Wie wird diese Kontrolle ausgeübt?«
»Durch Mehrheitsbeschluß.«
»Dann ist also jede Gruppe autonom?«
»Ja.«
»Ist aber auch jedes Mitglied autonom? Nehmen wir zum Beispiel Bischof Frantisek: Spricht er für sich oder für den Vatikan?«
»Einzig und allein für mich selbst«, sagte Frantisek nachdrücklich. »Ich bin verpflichtet, ausschließlich nach meinem Gewissen zu handeln.«
»Aber wenn die Abstimmung gegen Ihr Gewissen ausfällt?«
»Enthalte ich mich jeglicher Aktion. Vielleicht ziehe ich mich sogar ganz von der Gruppe zurück. Bisher ist es noch nie nötig gewesen, das eine oder das andere zu tun.«
Luigi Castagna mischte sich ein. »Ich bin hier, weil mir das Bild von den Brücken der Barmherzigkeit gefällt. Mir wäre allerdings wohler, wenn ich etwas darüber erfahren könnte, was bisher erreicht worden ist.«
Diesmal antwortete Onkel Andrea.
»Vorige Woche wurden in Chile vier altgediente Mitglieder der Allende-Partei aus dem Gefängnis entlassen und durften ausreisen. Es ist außerdem gelungen, die Macht der DINA, des örtlichen Sicherheitsdienstes, drastisch zu beschneiden. Dafür waren mein Neffe und verschiedene seiner Kollegen verantwortlich.«
»Inwiefern?«
»Sie weigerten sich, weitere Bankkredite an Chile zu decken, ehe das geschehen sei. Die Diplomaten in Washington und die Bankiers in New York mußten sehr hart verhandeln, zum Schluß aber bekamen sie die notwendige Unterstützung.«
»Gestern«, erklärte Carlo Magnoli, »traf der Führer der Christlichen Protestbewegung von Südkorea in Tokio ein. Unsere Gruppe in Seoul hatte ihn aus dem Land geschleust, kurz ehe Präsident Parks Geheimpolizei zuschlug.«
»Vor drei Monaten«, meldete sich der Bankier Fonseca zu Wort, »wurde ein bekannter südafrikanischer Chefredakteur unter Hausarrest gestellt. Eine unserer Gruppen schmuggelte ihn ins Ausland und von dort weiter nach England.«
»Man könnte uns als Menschenräuber bezeichnen.« Spada sah seinen Schwiegersohn grinsend an. »Oder wenn dir ein historischer Vergleich lieber ist, als Loskäufer, wie die Donkeymen des Mittelalters, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Gefangenen der Mauren zu befreien.«
»Es würde mich interessieren«, sagte Castagna ruhig, »wer Ihnen das Mandat für Ihre Arbeit gegeben hat.«
»Das habe ich vorausgesetzt«, erklärte Spada offen. »Ich brauchte kein Mandat, um Kupfer aus dem Boden zu holen oder ein Drogenforschungsprogramm zu initiieren. Warum sollte ich dann eines brauchen, um ein Menschenleben zu retten oder jemandem zu seiner Freiheit zu verhelfen?«
»Wie werden solche Unternehmungen durchgeführt?« erkundigte sich Vallenilla.
»Wir setzen alle verfügbaren Mittel ein: diplomatische Unterredungen, Handelsverträge, Bestechung, Erpressung, manchmal sogar. . .«
»Manchmal was?«
»Sagen wir«, erwiderte John Spada jovial, »daß man in diesem Geschäft ungeheuer flexibel sein muß. Bist du interessiert an dem Projekt, Rodo?«
»Möglicherweise.« Vallenilla gab sich vorsichtig und reserviert. »Aber ich möchte mehr wissen. Zum Beispiel: Seid ihr auch in Argentinien und Brasilien tätig?«
»Ja.«
»Ich habe nie etwas davon gehört.«
»Das ist ein Kompliment für unsere Diskretion. Aber wir brauchen weitere Mitglieder. Zuverlässige sind schwer zu finden; das ist der Grund, warum du zu dieser Sitzung eingeladen wurdest.«
»Wie wählt ihr die Personen aus, denen ihr helft?«
»Uns werden Fälle empfohlen.« Onkel Andrea hatte die Antwort übernommen. »Professor von Kalbach, zum Beispiel, bat uns, den Fall seines Kollegen Lermontov ins Auge zu fassen, der in der Nähe von Moskau in einer psychiatrischen Klinik festgehalten wird. Daran arbeiten wir gerade. Castagna möchte, daß wir uns um einen Studenten kümmern, der unter der falschen Anklage, vor sechs Monaten eine Bombe gelegt zu haben, in Mailand in Untersuchungshaft sitzt.«
Vallenilla schwieg. Spada half ihm ein bißchen nach.
»Das Mandat beunruhigt dich, nicht wahr?«
»In gewisser Weise, ja.«
»Dann stelle dir selbst die Frage, wessen Vollmacht du für deine Leitartikel und für die Stories hast, die du veröffentlichst. Von einer Regierung oder einer Partei bekommst du sie sicher nicht.«
»Nein, für mich ist das eine Gewissensfrage.«
»Und versuchst du in deinen Lesern ebenfalls das Gewissen wachzurufen?«
»Ganz recht.«
»Das versuchen wir auch«, sagte Onkel Andrea. »Warum sollten unsere Beweggründe suspekter sein als die deinen?«
Castagna stieß ein kleines, ironisches Kichern aus; dann fügte er ein wenig spöttisch hinzu:
»Ich habe in der gleichen Klemme gesteckt, mein Freund. Schwer zu glauben, daß das Kapital ein soziales Gewissen besitzt.«
»Und die Kirche Abscheu vor der Tyrannei«, ergänzte Bischof Frantisek.
»Wir alle tragen die Schuld der Geschichte auf unseren Schultern.«
»Und die Schande der Gegenwart«, sagte von Kalbach. »Die Anarchisten, die mich bedrohen, arbeiten mit einer sehr simplen Prämisse: Gegen die Mißstände in unserem System ist kein Kraut gewachsen – es gibt nur totale Zerstörung und radikalen Neuanfang. Wir müssen Zeugnis ablegen für die Möglichkeit von Protest und Reform.«
»Eine Frage habe ich noch an meinen Schwiegervater.«
»Heraus damit!« sagte John Spada.
»Im Verlauf dieser. . . dieser Arbeit – hast du da jemals einen Menschen getötet?«
»Das habe ich. Und würde es wieder tun.«
»Und Sie, Bischof Frantisek, was sagen Sie dazu?«
»Gar nichts«, erwiderte der Bischof. »Ich bin noch nie mit der Not des Augenblicks konfrontiert worden. Ich kann nicht sagen, was ich tun würde. John Spada hat mir nie sein Gewissen offenbart. Ich habe weder die Möglichkeit noch das Recht, über ihn zu urteilen.«
»Aber Sie sind dennoch bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten?«
»Ja.«
»Ich nicht«, erklärte Rodolfo Vallenilla. »Tut mir leid, John. Aber ich kann nicht in der Gesellschaft von Mördern verkehren.«
»Ich respektiere deine Entscheidung«, sagte Spada. »Und hoffe, du wirst das Versprechen halten, das du dieser Versammlung gegeben hast.«
»Mußt du das fragen?«
»Ja.« Spadas Ton war hart. »Weil mein Leben, unser aller Leben auf dem Spiel steht!«
»Von mir habt ihr nichts zu befürchten«, versicherte Rodolfo Vallenilla. »Entschuldigen Sie mich, Gentlemen.«
Er stand auf, machte eine kurze, steife Verbeugung und ging hinaus. Die Tür fiel mit einem lauten, harten Geräusch hinter ihm ins Schloß. Lange blieb alles still; dann erkundigte sich Onkel Andrea freundlich:
»War das nötig, Giovanni?«
»Es war nötig«, antwortete Spada ernst. »Und jetzt zu Ihnen, Professor von Kalbach. Wo stehen Sie?«
»Wenn ich Ihnen helfen kann, werde ich es tun. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit«, sagte der alte Gelehrte. »Die kann ich nicht wie ein Kind im Sandkasten verspielen.«
»Und Sie, Castagna?«
»Ich habe die besten Jahre meines Lebens der Partei geopfert. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sie tatsächlich die richtige Lösung für alle Probleme hat. Deshalb behalte ich mir einen Teil meines Ichs für mich zurück. Ja, Sie können auf mich zählen.«
»Danke«, antwortete John Spada. »Und jetzt möchte ich ein kleines Spiel mit Ihnen spielen.« Er entwarf auf seinem Notizblock eine grobe Zeichnung, riß das Blatt heraus und hielt es hoch, damit alle es sehen konnten.
»Dies ist das Symbol unserer Organisation. Können Sie seine Bedeutung entschlüsseln?«
Das Bild zeigte ein offenes Quadrat mit einem Fisch in der Mitte. Das Ganze sah ungefähr so aus:
Castagna und von Kalbach betrachteten die Zeichnung lange und gaben sich geschlagen. Spada erklärte mit ungewohnter Beredsamkeit:
»Die rechteckige Figur ist eine der ältesten Formen des Buchstabens ›P‹. Der Fisch ist nichts weiter als ein Fisch. Das ganze Symbol bezeichnet den Meeresgott Proteus, den Hüter und Beschützer aller Kreaturen, die in der Tiefe leben: von Seehunden und Delphinen über Thunfische und Makrelen bis hin zu den kleinen Elritzen. Poseidon verlieh ihm das Wissen um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und außerdem die Macht, sich in jede nur denkbare Gestalt zu verwandeln: in eine Flamme, einen Löwen, eine Blume, eine Schlange oder in einen Eber. . .« Er brach ab, lächelte ein wenig verlegen über seine eigene Rhetorik und erklärte: »Sie erkennen also die Relevanz des Symbols für das, was wir tun. Wir sind die Beschützer derjenigen, die in einem fremden Element leben, die abgeschnitten sind von menschlicher Fürsorge. Wir verfügen über Kenntnisse und Informationen aus der ganzen Welt. Wir können eine Vielzahl von Identitäten und Funktionen annehmen. Wenn wir bedroht werden, können wir uns in die unterseeischen Meereshöhlen zurückziehen und in anderer Gestalt wieder auftauchen. Wenn ein Fisch gefangen wird, nehmen andere seinen Platz ein. Gegenwärtig bin ich Proteus, weil ich die Möglichkeit habe, mich freier zu bewegen, ungehinderter zu handeln als die meisten unserer Mitarbeiter. Sollte John Spada jedoch etwas zustoßen, wird ein neuer Mann meinen Titel und meine Funktion übernehmen. Sämtliche Codes, die wir benutzen, basieren auf den Namen von Meerestieren. Und wir erkennen einander an diesem Symbol, das sogar ein Kind zeichnen könnte.«
»Eine amüsante Vorstellung«, sagte Luigi Castagna.
»Ich finde sie eher rührend«, widersprach Hugo von Kalbach. »Mir gefiel besonders Ihr Satz über jene, die von menschlicher Fürsorge abgeschnitten sind. Wie viele Mitglieder gibt es insgesamt?«
»Danach fragen wir nicht«, sagte Onkel Andrea. »Wenn wir Mitarbeiter in anderen Ländern brauchen, setzen wir uns mit Giovanni in New York in Verbindung. Er stellt den entsprechenden Kontakt her. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, die auf normalen Geheimdienstmethoden basiert.«
»Aber jemand muß doch die Gesamtliste haben!«
»Eine solche Liste existiert«, gab John Spada zögernd zu. »Und ich bin der einzige, der weiß, wo sie ist und was sie enthält. Im Fall meines Todes oder meiner Handlungsunfähigkeit geht sie in die Hände einer von zwei Personen über, die bestimmt sind, meine Arbeit fortzusetzen.«
»Interessant«, sagte Luigi Castagna trocken. »Um Gefangene zu befreien, errichten wir eine Diktatur.«
»Es gibt aber noch einen anderen Blickwinkel«, widersprach Fonseca, der Bankier. »John Spada war der erste, der einen verlassenen Pflug in die Hand nahm. Bisher hat er eine schnurgerade Furche über einen sehr steinigen Boden gezogen. Wir haben gelernt, ihm zu vertrauen.«
»Ich lerne langsam«, sagte Luigi Castagna. »Ich hoffe, Sie werden Geduld mit mir haben.«
»In einer Welt voller Gefahren lohnt es sich, vorsichtig zu sein.« Spada streckte die Hand aus, um den Pakt zu besiegeln. »Und jetzt zum Geschäft. Zunächst einmal möchte ich Sie, Professor, einladen, nach New York zu kommen und. . .«
Als sie in der langen Abenddämmerung nach Rom zurückfuhren, war Rodolfo Vallenilla still und in sich gekehrt. Nach einer Weile fragte ihn Teresa in ihrer erfrischend offenen Art rundheraus: »Irgend etwas ist heute zwischen dir und Papa vorgefallen. Was war los?«
»Eine Privatangelegenheit«, erwiderte John Spada kurz. »Nichts, was dich angeht.«
»Wir werden uns im Hotel darüber unterhalten.« Anna deutete verstohlen auf den Chauffeur. »Dies ist weder die Zeit noch der Ort dafür.«
»Rodo und ich reisen morgen ab.« Teresa ließ sich nicht abweisen. »Wir wollen keine Familienprobleme mitschleppen.«
»Es gibt keine Probleme«, erklärte Vallenilla fest. »Dein Vater hat mir einen Vorschlag gemacht, und ich habe ihn abgelehnt, wie es mein gutes Recht war. Die Angelegenheit ist erledigt.«
Spada schloß die Augen und lehnte sich in die Polster zurück. »Eine der schwersten Aufgaben einer Ehe besteht darin, dem Partner sein Privatleben zu lassen. Also hör auf, Teresa mia! Rodo und ich, wir verstehen einander.«
»Er versteht.« Vallenilla machte einen höflichen Versuch, belustigt zu wirken. »Ich suche immer noch nach dem Sinn. Aber er hat recht. Gib Ruhe, liebes Weib!«
»Das ist es, was ich an Italien so hasse! Man braucht bloß nach der Tageszeit zu fragen, und schon ist man in eine Verschwörung verwickelt.«
»Frag in Manhattan danach, und die Leute glauben, es sei ein Überfall«, konterte Anna. »Mir gefällt es, wenn Kleinigkeiten wichtig genommen werden. Sobald es um große und komplizierte Dinge geht, ziehe ich mir die Decke über den Kopf und schlafe.«
»Ich gebe auf.« Teresa seufzte ergeben. »Ich werde eine nette, pflichtbewußte, langweilige italienische Ehefrau sein und die fabelhaften Männer mit ihren großen Affären in Ruhe lassen.«
»Wunderbar!« Spada stieß einen theatralischen Erleichterungsseufzer aus. »Jetzt können wir ruhig sein, Anna, Liebste: Unser Töchterchen ist zur Frau geworden!«
»Geh doch zum Teufel, Papa!«
»Aber mit Freuden, Bambina! Da sind doch all die hübschen Mädchen!« So ging der erste peinliche Moment vorüber; aber es sollte noch einer kommen, ehe der Tag zu Ende ging. Es war zehn Uhr abends. Anna und Spada waren gerade mit dem Essen fertig und wollten zu Bett gehen, als Vallenilla von seinem Zimmer aus anrief und einen Spaziergang vor dem Schlafengehen vorschlug. Spada war müde wie ein Lastesel, aber er sagte zu. Sie trafen sich im Foyer und schlenderten die Via Bissolati in Richtung Via Veneto entlang. Vallenilla erklärte ihm unverblümt: »Du hast mir heute eine schlimme Kränkung zugefügt, John.«
»Wieso?«
»Ich hatte dir mein Wort gegeben, euer Geheimnis nicht zu verraten. Zwischen Gentlemen hätte das genügen müssen.«
»Du hast mich als Mörder bezeichnet. War das keine häßliche Bezeichnung?«
»Doch, das war es. Ich bitte dich um Verzeihung.«
»Ich wollte dich nicht kränken, als ich dich bat, dein Versprechen zu wiederholen. Es tut mir leid, daß ich dir weh getan habe, aber ich wollte, daß du diesen Moment sehr deutlich im Gedächtnis behältst.«
»Warum?«
»Hast du dir jemals überlegt, was geschehen könnte, wenn du nach Buenos Aires zurückkehrst und weiterhin gegen die Regierung schreibst?«
»Sehr oft sogar. Ich würde verschwinden, wie so viele andere.«
»Und das würde bedeuten?«
»Daß man mich umbringen würde – was nicht mal so schlimm wäre; oder daß man mich ins Gefängnis stecken und foltern würde – was wesentlich schlimmer wäre.«
»Und zum Schluß würdest du alles sagen, was du weißt.«
»Zweifellos.«
»Was immer es also auch sei, das dir hilft, einen Tag, eine Stunde länger durchzuhalten, würde für dich ein Geschenk sein, und keine Kränkung, nicht wahr?«
»Ja.«
»Genau das habe ich dir heute zu geben versucht: einen Augenblick, an den du dich erinnern kannst.«
»So habe ich es noch nicht gesehen.«
»Du hast auch nie an das gedacht, was Frantisek als ›die Not des Augenblicks‹ bezeichnete – des Augenblicks, in dem dir keine andere Wahl bleibt, als einen Menschen zu töten.«
»Ich bin hundertprozentig gegen das Töten, überhaupt gegen jede Gewalttätigkeit. Einmal muß die soziale Vendetta ein Ende haben.«
»Du machst es dir leicht. Nur zu! Schwenk die weiße Fahne. Ergib dich. Häng deine Harfe auf an den Wassern von Babylon und weine.«
»Du weißt genau, daß das keine Lösung ist.«
»Dann erklär mir deine, Rodo! Erkläre mir, was ich tun soll, wenn Teresa anruft und mir mitteilt, daß du verschwunden bist!«
»Du fährst hin und nimmst sie mit nach Hause.«
»Und was soll ich antworten, wenn sie nicht mitgehen will, sondern mich bittet, mich für dich zu verwenden? Wie weit soll ich gehen? An welchem Punkt soll ich aufgeben?«
»Du hast achtzig Millionen Dollar in Buenos Aires investiert und hast fünfhundert Arbeiter und Angestellte – allesamt Geiseln des Regimes. Die darfst du nicht gefährden. Außerdem kommt es wahrscheinlich nie soweit.«
»Aber wenn es soweit kommt?«
»Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht.«
»Dann solltest du dich endlich entscheiden, verdammt noch mal!« Spada war geradezu wütend. »Wenn du dich an den Schreibtisch setzt und Leitartikel verfaßt, bist du kein weißhaariger Gelehrter, der für die Nachwelt schreibt, sondern du fabrizierst Zeitbomben wie jeder verfluchte Terrorist in einem Hinterzimmer in München. Genau wie er mußt du die Kosten abwägen, die Wirkung einschätzen, die Verantwortung tragen. . . Ich sage ja nicht, daß du aufgeben und davonlaufen sollst – weit gefehlt! Aber mach dir nichts vor, mein Sohn! Du bist in ein Duell mit tödlichen Waffen verwickelt. Sei also nicht überrascht, wenn du Blut auf dem Fußboden entdeckst.«
»Das war eine schöne Rede«, sagte Vallenilla. »Die möchte ich drucken.«
»Schreib sie dir in die Handfläche. Lies sie jeden Tag. Und lies sie deiner Frau im Bett vor.«
»Ich glaube, Teresa hat sie schon öfter gehört.«
»Herrgott im Himmel!« Spadas Zorn erlosch so plötzlich wie ein ersticktes Feuer. »Laß uns nicht streiten. Ich liebe Teresa mehr als mein Leben, beinahe so sehr wie meine Anna. Ich denke, sie hat einen guten Mann bekommen. Aber sei vorsichtig, ja? Und wenn einmal jemand zu dir kommt und dir die Losung Proteus gibt, oder dir das Bild eines Fisches in einem Quadrat zeigt, dann hör auf ihn, ja?«
»Proteus und ein Fisch im Quadrat. Ich werd’s mir merken. Und danke, daß du mir soweit vertraust.«
»Ich habe gegen die Regeln verstoßen«, erwiderte Spada. »Aber du mußt wissen, daß ich dir vertraue, sonst werden wir einander womöglich noch hassen.«
»Danke, daß du mir das sagst. Es hilft mir mehr, als du ahnst. . . Aber da ist noch etwas.«
»Was denn?«
»Heute sah ich einen anderen Menschen in John Spada. Zuerst mochte ich ihn nicht, weil mich der Gebrauch nackter Gewalt immer abstößt. Aber jetzt wird mir klar, daß ich zuweilen eifersüchtig auf diese Macht bin und daher das bißchen davon, das ich selbst habe, mißbrauchen könnte.«
»Mit dem Spiel der Macht ist es wie mit dem Golf«, erklärte ihm John Spada freundlich. »Man braucht Übung. Man macht viele Fehler. Ich habe gelernt, mit den meisten zu leben; ich möchte nicht mitansehen, wie du für die deinen stirbst.«
»Darauf wollen wir trinken! Komm, wir nehmen einen Brandy, bevor wir ins Hotel zurückkehren.«
Nach südländischer Art hakten sie sich unter und gingen mit schnellen Schritten auf das hellerleuchtete Lokal in der Via Veneto zu. Noch nie waren sie einander so nahe gekommen, und trotz all seiner Befürchtungen, trotz allem, was er wußte und ahnte, entschied John Spada bei sich, daß es kein schlechtes Osterfest gewesen sei.
2
Die schlechten Tage kamen unmittelbar bei der Ankunft in New York. Sie begannen wie gewöhnlich mit einer Reihe unbedeutender Ärgernisse.
Anna war müde und gereizt; sie machte sich Sorgen um ihre Tochter, die so weit entfernt leben mußte, und um die Enkelkinder, die zwar noch nicht einmal in Aussicht waren, deren Schicksal sie aber heute schon beklagte, da die Ärmsten in »eine Familie von Pferdenarren am Ende der Welt« hineingeboren würden. Sie kreisten eine geschlagene Stunde über dem Kennedy-Flughafen, weil es durch verspätete Maschinen zu Stauungen im Landeplan gekommen war. Ein übereifriger Zollbeamter bestand darauf, jeden einzelnen von Annas Koffern zu öffnen, und hielt sie weitere zwanzig Minuten auf, während er umständlich eine Gebühr von dreißig Dollar errechnete. Als sie den Zoll endlich hinter sich hatten, mußten sie kochend vor Wut eine weitere halbe Stunde warten, weil die Spada-Limousine auf der Autobahn eine Panne gehabt hatte. Zu Hause fanden sie den Diener Carlos mit Grippe im Bett, und seine Frau war in Panik geraten, weil das Hausmädchen sich beim Einkaufen verspätet hatte.
Spada rang verzweifelt die Hände und überließ Anna der häuslichen Krise, während er unter die Dusche ging und sich dann in die vergleichsweise friedliche Atmosphäre seines Arbeitszimmers zurückzog. Aber er konnte die Ruhe nicht lange genießen. Kurz vor halb sechs kam ein Anruf von Kitty Cowan. Ihre Begrüßung war eine Spur zu fröhlich für den Anlaß: »Herzlich willkommen daheim, Chef! Und wie geht’s dem letzten Tycoon?«
»Mäßig bis saumäßig.«
»Das mit der Panne am Flughafen war Pech.«
»Das war ja nicht das einzige! Heute bin ich wahrhaftig von Gott verlassen. Was macht der Laden?«
»Nun ja. . .« Er spürte, wie sie sich auf die Explosion gefaßt machte.
»Wie hätten Sie’s denn gern, Mr. Spada, Sir? Pur oder on the rocks?«
»Lieber pur, Schätzchen.«
»Maury Feldman ist hier. Am besten berichtet er dir alles. Ich werde hinterher die Scherben aufkehren.«
Sie hatten immer miteinander gescherzt, diese drei. Kitty Cowan, der langbeinige Rotschopf, hatte die allerersten Rechnungen für die erste Spada-Firma getippt, und nun führte sie das Regiment hoch oben im Glasturm am Central Park West. Maury Feldman, der koboldhafte, weltgewandte Anwalt, der meisterhaft Klavier spielte und Bilder des Cinquecento sammelte, war aus einem Büro von Schuhkartongröße in der Mott Street zu einer der größten Körperschaftspraxen in Manhattan emporgeklettert. Mit einem tiefen Seufzer kam Maury an den Apparat. »Die Bezahlung ist gut, aber die Arbeitszeit ist schrecklich – und die Neuigkeiten sind noch schlimmer.«
»Die Ouvertüre habe ich bereits gehört, Maury. Sing mir jetzt bitte die Oper selbst.«
»Ich hoffe, du sitzt«, sagte Feldman munter. »Erinnerst du dich an den Reaktor, den wir für die Central and Western gebaut haben?«
»Natürlich.«
»Im Mantel von Atommeiler zwei ist ein Riß entstanden. Er könnte sich zu einer ernsten Gefahr entwickeln. Wir haben sofort Peters und Dubrowski aus Detroit hinuntergeschickt; sie sollen mit dem Team dort zusammenarbeiten und uns ihren Bericht senden. Kitty hat um Kopien der Spezifikationen und des Abnehmerzertifikates gebeten. Die günstigsten Prognosen lauten: geringfügiger Schaden, örtliche Proteste und schlechte Publicity. Die schlimmsten: ernsthafter Schaden, ernsthaftes Risiko und ein saftiges Verfahren wegen Fahrlässigkeit.«
»Was meinst du, soll ich runterfahren?«
»Auf gar keinen Fall!« antwortete Maury Feldman energisch. »Du hältst dich raus. Vertragspartner ist Spada Nucleonics. Soll deren Management die Suppe auslöffeln. Die Muttergesellschaft bleibt im Hintergrund. Das wäre der erste Punkt. . .«
»Großer Gott! Sag ja nicht, daß noch mehr kommt!«
»Es kommt noch mehr. Waxman von der Bank in San Diego hat angerufen. Sie haben einen Fehlbetrag von einer halben Million in ihren Büchern.«
»Eine hübsche runde Summe. Wo ist das Geld geblieben?«
»Der zweite Buchhalter hat mit dem Computer gespielt – und das auch noch in Las Vegas. Im Moment weint er sich in Waxmans Büro die Augen aus. Was willst du unternehmen?«
»Zeig ihn an«, erwiderte Spada kurz.
»Waxman sagt, er hat eine kranke Frau und ein behindertes Kind.«
»Wo bleiben die Geigen und die Gnadenpredigt? Wie groß ist die Chance, das Geld wiederzubekommen?«
»Null. Unmöglich.«
»Wenn wir alles durchgesprochen haben, dann besorg mir eine Verbindung mit Waxman. Ich muß mich erst ein bißchen abreagieren. Ist das jetzt alles?«
»Ein paar kleinere Leckerbissen habe ich noch. Du hast mir erzählt, du hättest den Streik in der Oxford-Fabrik in England beigelegt.«
»Ja. Als ich abreiste, wurden gerade die Vereinbarungen fixiert.«
»Und jetzt sind sie wieder auf dem Nullpunkt. Die Regierung behauptet, die Vereinbarungen verstoßen gegen die Richtlinien für Lohnabkommen.«
»Wir sind im Unrecht, wenn wir’s tun, und wir sind im Unrecht, wenn wir’s nicht tun!« fuhr Spada auf. »Und inzwischen lassen sie uns weißbluten.«
»Eimerweise zapfen sie uns das Blut ab, mein Freund. Kannst du noch ’was verkraften?«
»Ich komme mir vor wie Prometheus, an dessen Leber die Aasgeier fressen.«
»Während deiner Abwesenheit ist Carl Channing gestorben.«
»Das habe ich gehört. Wir haben ein Beileidstelegramm geschickt.«
»Was du aber nicht gehört hast, das ist der Inhalt seines Testaments. Seine Frau bekommt die Hälfte des Nachlasses. Die andere Hälfte – und zu der gehören die Spada-Aktien – kommt in einen Treuhandfonds für Sohn und Tochter.«
»Und?«
»Die Treuhänder sind Hoffman & Liebowitz.«
»Allmächtiger! Und ich hielt Channing für meinen Freund!«
»Du wolltest es nicht einsehen, mein Lieber«, entgegnete Feldman ruhig. »Aber Carl Channing war ein überaus neidischer Mensch. Er war immer eifersüchtig auf dich.«
»Das bedeutet, daß Hoffman & Liebowitz das Stimmrecht über die Aktien ausüben dürfen.«
»Sie werden es ausüben, Johnny-boy! Und liebevoll zugetan sind sie dir auch nicht, weil du Max Liebowitz einmal einen kurzsichtigen Fanatiker genannt hast. Damit fehlen dir von jetzt an zwei Prozent an der Mehrheit, und am Horizont zieht drohend ein erbitterter Kampf der Stimmberechtigten herauf.«
Spada blieb die Antwort schuldig.
»Bist du noch da, John?« fragte Feldman.
»Ich denke nach. Wieviel Zeit haben wir noch bis zur Aktionärsversammlung?«
»Drei Monate. Das ist nicht viel.«
»Ich weiß. Setzen wir uns morgen zusammen und legen die Strategie fest. Aber zunächst werden wir mal den Kauf jeder einzelnen Aktie veranlassen, die auf den Markt kommt.«
»Damit werden die rechnen. Und den Preis in die Höhe treiben.«
»Dann werden wir sehen, wie gut ihre Nerven sind. Und jetzt erzähl mir mal was Gutes!«
»Wir können Anteile der Raymond Serum Laboratories kaufen.«
»Wieviel davon?«
»Siebzig Prozent – und das schließt die europäischen Tochtergesellschaften ein.«
»Was müssen wir dafür ausspucken?«
»Fünfzehn Dollar pro Aktie.«
»Bedingungen?«
»Der Alte will sich zur Ruhe setzen. Der Sohn bekommt einen Fünfjahresvertrag als Leiter der Forschungsabteilung.«
»Das ist zu billig. Wo ist der Haken?«
»Sie haben ihre Kredite fast ausgeschöpft. Der Alte ist müde. Er hat einen Herzanfall hinter sich. Er will nur noch angeln.«
»Und der Sohn?«
»Ist Biologe, weiter nichts. Er haßt Geschäfte. Er möchte mit einem beruhigenden, persönlichen Investment im Rücken weiterforschen.«
»Ein kluger Mann«, meinte John Spada düster. »Er wird vermutlich mit neunzig als glücklicher Mann mit dem Nobelpreis in der Tasche sterben. Okay, Maury, wir kaufen. Leite bitte alles in die Wege. Wir sehen uns dann morgen um zehn.«
»Sagen wir lieber halb elf«, entgegnete Maury Feldman munter. »Ich muß mir vorher noch ein Bild ansehen. Der Mann schwört, daß es sich um einen Andrea del Sarto handelt. Ich fürchte zwar, es ist nur Schund, aber wer weiß, vielleicht habe ich Glück.«
»Wie kannst du dir nur diesen Luxus leisten?«
»Ich habe ein paar sehr großzügige Klienten. Dieses Bild werde ich aus dem Raymond-Abschluß finanzieren.«
»Du Schuft!. . . Gib mir noch mal Kitty. Ich muß ihr ein paar Memos diktieren.«
»Ich wollte sie gerade zum Essen ausführen.«
»Sie ist meine Angestellte. Such dir deine eigenen Frauen!«
»Ich liebe dich auch, Johnny-boy. Schlaf dich schön aus.«
Kitty Cowan kam wieder an den Apparat. Diesmal war sie bedrückt und beunruhigt.
»Laß mich die Sache mit San Diego machen, John.«
»Was schlägst du vor?«
»Zeig ihn nicht an, wenigstens jetzt noch nicht. Waxman hat sein Geständnis. Laß ihn ein Dokument unterschreiben: eine freiwillige Bitte um psychiatrische Beobachtung in einer anerkannten Nervenklinik. Außerdem würde ich Waxman anweisen, der Frau und dem Kind weiterhin Unterstützung zu zahlen, bis wir genau wissen, was los ist.«
»Das hab ich gern!« Spada unterdrückte ein Lachen. »Wir werden um eine halbe Million betrogen und reagieren darauf mit kostenloser psychiatrischer Behandlung und Unterstützung für die Familie des Bösewichts!«
»Das Geld kriegen wir doch nicht zurück, warum also nicht ein bißchen kostenlose Reklame für die Menschlichkeit des Spada-Konzerns?«
»Und ich dachte schon, du gießt die Milch der frommen Denkungsart über die Ärmsten aus!«
»Das tue ich, aber du stellst Milch und Krug zur Verfügung. Ich dachte, ich müßte die bittere Pille ein bißchen versüßen. Was meinst du, Chef?«
»Tu, was du nicht lassen kannst. Und jetzt notier bitte: Gib Kaufaufträge für alle Spada-Aktien raus, die auf den freien Markt kommen, besorg mir eingehende persönliche und finanzielle Informationen über Max Liebowitz, seine Geschäftspartner und seine engere Familie. . . An Professor Hugo von Kalbach schickst du eine offizielle Einladung; er soll nächsten Monat bei unserer Management-Konferenz in New York als Hauptredner auftreten. Ruf ihn drüben in München an und besprich die Einzelheiten der Reise mit ihm. Biete ihm fünfzehntausend Dollar Honorar. Frag ihn, wie und wo er das Geld in Empfang nehmen möchte. Und schließlich brauche ich morgen früh als erstes eine vollständige Liste der Spada-Aktionäre.«
»Außerdem werde ich dir den Hope-Diamanten und eine Kiste voll Mondgestein besorgen. Beruhige dich, Chef!. . . Ich bin’s, Kitty, hast du das vergessen? Für Unmögliches brauche ich ein bis zwei Stunden länger, aber wir werden’s schon schaffen. Sonst noch was?«
»Ja. Frag Maury, wo wir Henson und den Scarecrow Man finden.«
Einen Augenblick herrschte Schweigen; dann fragte Kitty leise:
»Gehst du auf Jagd?«
»Könnte sein. Mach dir einen schönen Abend.«
»Und du ruh dich aus. Und grüße Anna von mir.«
»Ciao, Caterina.«
»Shalom, John. Schlaf gut.«
»Alle wollen, daß ich schlafe«, murmelte John Spada verstimmt vor sich hin. »Darum streuen sie Dornen in mein Bett und Juckpulver in meinen Schlafanzug.«
Später, Anna war längst eingeschlafen, richtete er sich auf: hellwach vor Anspannung versuchte er, die neue Gefahr auszuloten, die ihn bedrohte. Eine große, internationale Firma war eine Art Imperium, dessen Stabilität von allen möglichen Verträgen und Bündnissen abhing, einige schriftlich niedergelegt, viele andere nicht ratifiziert, alle jedoch auf gegenseitiges Vertrauen, gemeinsame Interessen, eine labile Ausgewogenheit von Situationen und Persönlichkeiten gegründet. Jede einzelne Expansion, jedes neue spekulative Unternehmen bedeutete die Hinzunahme neuer Geldmittel, neuer Interessen, eine zusätzliche Belastung der ursprünglichen Verbündeten. Freunde starben. Familienrivalitäten wirkten sich aus. Parteien verloren die Gunst der Wähler. Rivalen erstarkten. Alte Feindseligkeiten, lange begraben, flammten wieder auf wie ein Feuer im Sägemehlhaufen. Aktionäre, immer auf größeren Profit bedacht, wurden ungeduldig und fielen auf Schwindler mit leeren Versprechungen herein.
John Spada kannte jeden Schachzug in diesem Spiel – oder zumindest glaubte er das. Mit Hilfe von Verwandten und Freunden auf dem Kontinent hatte er sich fünfundzwanzig Jahre im Sattel gehalten, die Zügel der Macht nie aus den Händen gegeben. Und jetzt drohte ihm plötzlich Gefahr, weil ein Mann, der es im Leben niemals gewagt hätte, sich gegen ihn zu stellen, ihn aus dem Grab heraus verhöhnte.
Als Carl Channings Bank damals in Schwierigkeiten geriet, hatte ihn John Spadas Geld vor der Verhaftung und seine Aktien vor dem Bankrott bewahrt. Die Transaktion hatte den praktisch ruinierten Channing über Nacht zum reichen Mann gemacht. Aber offenbar gewann man einen Menschen nicht dadurch zum Freund, daß man ihm zum Reichtum verhalf. Es war nicht Spadas Hilfe, an die Channing sich erinnerte, sondern die Demütigung, seinen altehrwürdigen Namen mit dem eines italienischen Emporkömmlings aus Rom verbinden zu müssen. Also hatte er sich mit Max Liebowitz zusammengetan, der die Spada Consolidated in den Tagen ihrer Gründung als ein windiges und womöglich von der Mafia finanziertes Unternehmen abgetan hatte, und der sich seitdem am liebsten geohrfeigt hätte.
Und doch war Spada der Sinn der Sache nicht klar. Denn selbst wenn Liebowitz den Abstimmungskampf gewinnen sollte, müßte er immer noch ein der jetzigen Firmenleitung überlegenes Management präsentieren, und bisher war kein passender Kandidat in Sicht. Der richtige Mann müßte Diplomat, Finanzier, Politiker und Verwaltungstalent in einer Person sein – und überdies noch eine Spur vom Abenteurer mitbringen. Spada, der selbst keinen Sohn hatte, war ständig auf der Suche nach solchen Talenten und wußte, wie dünn sie gesät waren.
So schien es also, als hätte er noch eine kleine Atempause, ehe zur großen Schlacht geblasen wurde. Aber er mußte jeden Moment dieser Pause ausnutzen, jeden Verbündeten testen und aufmerksam Ausschau halten nach dem geringsten Zeichen von Verrat in den Reihen seiner Gefolgsleute. Und auch aus anderen Gründen mußte er vorsichtig sein. Denn er führte ein Doppelleben: nach außen hin als Präsident des Spada-Konzerns, im verborgenen als Proteus, Kopf einer geheimen Organisation, die in das dunkle, gefährliche Spiel der Untergrundpolitik verstrickt war. Der kleinste Hinweis auf seine heimlichen Aktivitäten würde ihn in den Augen seiner Aktionäre, die in ihm den Treuhänder ihrer finanziellen Interessen sahen und von denen er keinerlei Mandat für einen privaten Kreuzzug hatte, völlig unmöglich machen. Sie würden es begrüßen, wenn er eine Stiftung förderte, ein Ballett finanzierte, der Krebsforschung half; daß er sich aber mit moralischen Fragen, mit politischem Aktivismus beschäftigte – unvorstellbar!