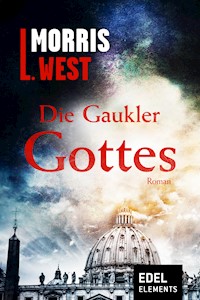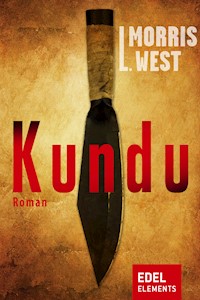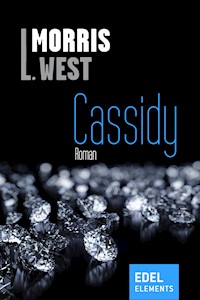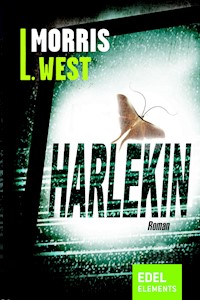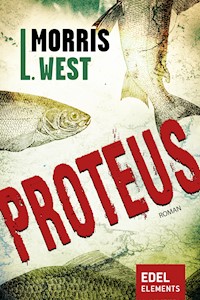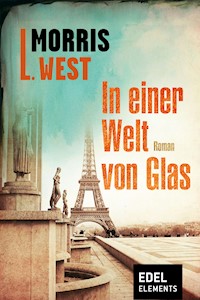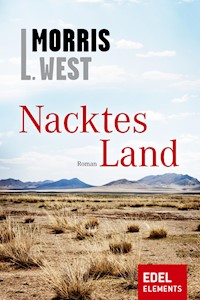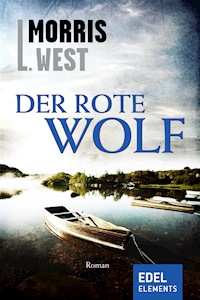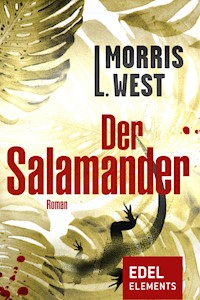Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der legendäre Weltbestseller, der zu einem Hollywood-Filmklassiker wurde – mit Anthony Quinn in der Hauptrolle! Ein neuer Papst wird gewählt: Kiryll Lakota, der erste Russe auf Petri Stuhl. Der Mann mit der Narbe im Gesicht, die aus seiner langen Haftzeit in sibirischen Lagern stammt. "Der Papst aus der Steppe", der der Welt und der Kirche gleichermaßen Rätsel aufgibt. Ist dieser Papst ein Märtyrer, ein Begnadeter oder lediglich ein naiver, weltfremder Träumer? Wird er ein starker Papst sein oder ein unzulänglicher und schwacher, ein zorniger oder ein versöhnlicher? Eines wird jedenfalls bald deutlich: Er ist ein Mann der Reformen; ein Mensch, in dem sich Urchristliches und sehr Modernes mischen. Die New York Herald Tribune schrieb hymnisch über diesen Roman von Morris L. West: "Dies ist eine kühne und erregende Dichtung, das geistige Drama eines Mannes in seiner Beziehung zu Gott, das gleichzeitig die wichtigsten Probleme der heutigen Welt umschließt, geschrieben mit seherischem Weitblick..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
In den Schuhen des Fischers
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ursula Wiese
Edel eBooks
VORBEMERKUNG
Rom ist eine Stadt, älter als die katholische Kirche. Alles, was sich ereignen konnte, hat sich hier ereignet und wird sich sicherlich wieder ereignen. Dieses Buch spielt in einer frei erfundenen Zeit und ist bevölkert von frei erfundenen Figuren; es nimmt keinerlei Bezug auf irgendwelche lebenden Personen, sei es innerhalb oder außerhalb der Kirche.
Ich kann von meinen Freunden nicht erwarten, daß sie die Verantwortung für meine Meinungen übernehmen. Deshalb müssen diejenigen, die mir bei diesem Buch geholfen haben, anonym bleiben.
Denen, die ihre Geschichte beigetragen, denen, die mir ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben, und jenen, denen ich die Wohltat des Glaubens verdanke, spreche ich hiermit meinen aufrichtigen Dank aus.
Dank schulde ich auch Pater Pedro A. Gonzalez vom Orden der Dominikaner für eine Stelle aus seiner Dissertation über Miguel de Unamuno, die ich in den Text des Buches ohne Quellenangabe eingefügt habe.
M. L. W.
I
Der Papst war tot. Der Kämmerer hatte es verkündet. Die Zeremonienmeister, Notare und Ärzte hatten seinen Heimgang mit ihrer Unterschrift bestätigt. Sein Ring und seine Siegel waren zerbrochen worden. In der ganzen Stadt hatten die Glocken geläutet. Der Leichnam des Papstes war einbalsamiert worden, damit ihm die Gläubigen ihre Verehrung bezeugen konnten. Jetzt lag er zwischen weißen Kerzen in der Sixtinischen Kapelle, wo die Nobelgarde unter Michelangelos Fresko vom Jüngsten Gericht die Totenwache hielt.
Der Papst war tot. Morgen sollte er in der Capella Sancta Sanctorum aufgebahrt werden, wo das Volk von ihm Abschied nehmen konnte. Am dritten Tag sollte er beerdigt werden, bekleidet mit dem päpstlichen Gewand, mit einer Mitra auf dem Kopf, einem roten Schleier über dem Gesicht und einer roten Hermelindecke. Mit ihm würden die Medaillen und Münzen, die er geprägt hatte, begraben werden, so daß noch tausend Jahre später zu erkennen ist, wer hier beigesetzt worden war. Drei Särge sollten ihn umschließen, einer aus Zypressenholz und einer aus Blei, der vor Feuchtigkeit schützte und der sein Wappen und den Totenschein enthielt; der dritte aber war aus Ulmenholz, und somit glich der Papst nun allen anderen Menschen, die man in einem Holzschrein zur letzten Ruhe bettete.
Der Papst war tot. Man würde für ihn beten wie für jeden anderen: »Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, o Herr. Erlöse ihn vom ewigen Tod.« Dann würde man ihn in dem Gewölbe unter dem Hochaltar beisetzen, wo er vielleicht — aber eben nur vielleicht — in Staub zerfallen würde mit dem Staub Petri; und ein Maurer würde die Gruft zumauern und eine Marmortafel anbringen mit dem Namen des Papstes, seinem Titel, dem Datum seiner Geburt und dem Tag seines Todes.
Der Papst war tot. Neun Tage sollte er betrauert werden, in denen neun Messen zelebriert und ihm die Absolutionen erteilt werden sollten, deren er, da er im Leben höher gestanden hatte als andere Menschen, nach dem Tode vielleicht um so mehr bedurfte. Dann würde man beginnen, ihn zu vergessen; der Stuhl Petri war leer, das Leben der Kirche lag in Ohnmacht, und der Allmächtige hatte keinen Statthalter auf diesem unruhigen Planeten.
Der Stuhl Petri war leer. Die Kardinäle des Heiligen Kollegiums übernahmen die Verwaltung, doch fehlte ihnen die Macht, die Autorität des Fischers auszuüben. Die Macht lag nicht in ihren Händen, sondern in Christo, und niemand konnte sie gewinnen außer durch gesetzliche Übertragung und Wahl.
Der Stuhl Petri war leer. Es wurden zwei Medaillen geprägt, eine für den Camerlengo, die einen großen Schirm über gekreuzten Schlüsseln zeigte: Unter dem Schirm war niemand, und das diente auch dem Unwissendsten als Zeichen, daß niemand den Apostolischen Stuhl innehatte und daß alles, was getan wurde, nur provisorisch war. Die zweite Münze war für den Konklavemarschall bestimmt, der die Kardinäle versammeln mußte, sie in den Zellen des Konklaves einschloß und sie dort festhielt, bis sie einen neuen Papst gewählt hatten. Jede neugeprägte Münze in der Vatikanstadt, jede der eigens hergestellten Briefmarken trug die Worte sede vacante, deren Bedeutung — »während der Stuhl leer ist« — auch dem Lateinunkundigen verständlich war. Die Zeitung des Vatikans wies die gleiche Inschrift auf, außerdem einen Trauerrand, bis der neue Papst gewählt war.
Das Pressebüro des Vatikans wurde von Vertretern aller Nachrichtendienste der Welt belagert; und aus allen Windrichtungen kamen Greise, gebeugt von der Bürde der Jahre oder ihrer Gebrechlichkeit, um das Scharlachrot der Fürsten anzulegen und sich für die Wahl eines neuen Pontifex ins Konklave zu begeben. Da war der Amerikaner Carlin, der Syrer Rahamani, der Chinese Hsien und der Ire Hanna aus Australien. Da war Councha aus Brasilien und da Costa aus Portugal. Da war Morand aus Paris, Lavigne aus Brüssel, Lambertini aus Venedig und Brandon aus London. Da gab es einen Polen und zwei Deutsche, des weiteren einen Ukrainer, den niemand kannte, weil der verstorbene Papst seinen Namen in seinem Herzen bewahrt und erst einige Tage vor dem Tode geweiht hatte. Im ganzen waren es fünfundachtzig Männer; der älteste zweiundneunzig und der jüngste, der Ukrainer, fünfzig Jahre. Jeder stellte sich nach der Ankunft in Rom dem formsicheren und freundlichen Valerio Rinaldi, dem Kardinalkämmerer der römischen Kirche, vor und überreichte ihm sein Beglaubigungsschreiben.
Rinaldi reichte jedem die schlanke, trockene Hand und begrüßte ihn mit mild-ironischem Lächeln. Jedem nahm er den Konklave-Eid ab: daß er die in der Apostolischen Konstitution von 1945 festgelegten Wahlregeln kenne und streng befolgen werde, daß er bei Strafe der Exkommunikation das Wahlgeheimnis wahren werde, daß er mit seiner Stimme nicht den Interessen einer weltlichen Macht dienen werde und daß er, wenn er selbst zum Papst gewählt würde, auf die weltlichen Rechte des Heiligen Stuhles, die für seine Unabhängigkeit notwendig sein könnten, nicht verzichten werde.
Keiner verweigerte den Eid; Rinaldi, der Sinn für Humor hatte, fragte sich mitunter, warum es eigentlich nötig war, ihn überhaupt abzunehmen — doch wohl, weil die Kirche eine gesunde Skepsis gegenüber den Tugenden ihrer Fürsten hegte. Alte Männer waren manchmal allzu leicht anfällig. Deshalb legte Valerio Rinaldi, wenn er den Eid vorsprach, sanften Nachdruck auf den Rat der Apostolischen Konstitution, die gesamte Wahl durchzuführen in »Klugheit, Nächstenliebe und besonderer Ruhe«.
Seine Vorsicht war nicht unbegründet. Die Geschichte der Papstwahlen war stürmisch und mitunter turbulent verlaufen. Als der Spanier Damasus im vierten Jahrhundert gewählt wurde, hatte es blutige Gemetzel gegeben. Leo V. wurde eingekerkert, gemartert und ermordet; und danach wurde die Kirche fast ein Jahrhundert lang von Marionetten regiert, nach dem Willen der ehrgeizigen, sittenlosen Weiber Theodora und Marozia. Im Konklave von 1623 starben acht Kardinäle und vierzig Gehilfen an Malaria, und über der Wahl des heiligen Pius X. kam es zu heftigen Szenen und harten Worten.
Alles in allem, folgerte Rinaldi, der freilich klug genug war, diese Folgerung für sich zu behalten, war es sicherer, die grämlichen Stimmungen und die verdrängte Eitelkeit alter Männer in Rechnung zu stellen. Dieser Gedanke führte ihn wiederum zu dem Problem, fünfundachtzig Kardinäle mitsamt Dienern und Gehilfen unterzubringen und zu beköstigen, bis die Wahl beendet war. Einige mußten, wie es schien, die Quartiere der Schweizergarde beziehen. Keiner durfte allzu weit von Badezimmer oder Toilette entfernt sein, und alle erforderten ein beträchtliches Aufgebot an Ärzten, Köchen, Kellnern, Dienern, Sekretären, Schreinern, Spenglern, Feuerwehrmännern (falls ein müder Prälat mit einer Zigarette in der Hand einnickte!). Sofern ein Kardinal (Gott verhüte es!) unter Anklage oder im Gefängnis war, mußte er zum Konklave transportiert werden und seine Funktion unter militärischer Bewachung ausüben.
Doch es saß keiner im Gefängnis — außer Krizanic, der um des Glaubens willen in Jugoslawien in Haft gehalten wurde, und das war ein anderer Fall. Im übrigen hatte der verstorbene Papst die Verwaltungsgeschäfte so vortrefflich geleitet, daß Valerio Kardinal Rinaldi nun sogar Zeit blieb, mit seinem Kollegen Leone, dem Dekan des Heiligen Kollegiums, zusammenzukommen. Leone machte seinem Namen alle Ehre. Er hatte eine weiße Löwenmähne und ein knurriges Temperament. Im übrigen war er ein gebürtiger Römer vom alten Schlag. Für ihn bildete Rom den Mittelpunkt der Welt, und die Doktrin der Zentralisation fand er fast ebenso unantastbar wie die der Dreieinigkeit. Mit seiner großen Adlernase und dem Doppelkinn sah er aus wie ein römischer Senator, und seine blassen Augen betrachteten das Treiben der Welt mit frostiger Mißbilligung.
Neuerungen schienen für ihn der erste Schritt zur Ketzerei zu sein, und er saß im Kollegium wie ein alter Wachhund, dessen Fell sich beim ersten verdächtigen Laut sträuben würde. Einer seiner französischen Kollegen hatte von ihm mit mehr Witz als Güte gesagt: »Leone riecht nach Feuer.« Im allgemeinen aber stand er in dem Ruf, daß er eher die eigene Hand ins Feuer legen als seine Unterschrift unter die kleinste Abweichung vom Herkömmlichen setzen würde.
Rinaldi achtete ihn, aber es war ihm niemals möglich gewesen, ihn zu lieben; und so hatte sich ihr Umgang auf die Verbindlichkeiten ihres gemeinsamen Berufs beschränkt. Doch heute schien der alte Löwe in sanfterer Stimmung und gesprächiger zu sein. In den fahlen, aufmerksamen Augen blitzte vorübergehende Belustigung auf.
»Ich bin zweiundachtzig, mein Freund, und ich habe drei Päpste begraben. Ich fühle mich allmählich einsam.«
»Wenn wir diesmal keinen Jüngeren bekommen«, sagte Rinaldi gehalten, »können Sie gut noch einen vierten begraben.«
Leone warf ihm, unter seinen struppigen Brauen hervor, einen schnellen Blick zu. »Was soll das heißen?«
Rinaldi zuckte die Schultern und spreizte seine feingeformten Hände mit römischer Gebärde. »Genau, was ich sagte. Wir sind alle zu alt. Unter uns ist höchstens ein halbes Dutzend, das der Kirche das geben kann, was sie jetzt braucht: eine starke Persönlichkeit, entschiedene Politik — und Zeit und Kontinuität, damit diese Politik sich auswirken kann.«
»Halten Sie sich für einen von diesem halben Dutzend?«
Rinaldi lächelte mit leisem Spott. »Ich weiß, daß ich keiner von ihnen bin. Wenn der neue Mann gewählt ist — wer es auch sein mag —, will ich meinen Rücktritt einreichen und um Erlaubnis bitten, mich aufs Land zurückzuziehen. Fünfzehn Jahre habe ich gebraucht, um mir zu Hause einen Garten anzulegen. Ich würde ihn gern noch eine kleine Weile genießen.«
»Glauben Sie, daß ich bei der Wahl Aussicht hätte?« fragte Leone unumwunden.
»Hoffentlich nicht«, antwortete Rinaldi.
Leone warf die dichte Mähne zurück und lachte. »Keine Sorge, ich weiß, daß meine Aussichten gering sind. Man braucht einen ganz anderen Menschen — einen Menschen …« Zögernd suchte er nach Worten, »… einen, der Erbarmen hat mit der Menge und sie so sieht wie Christus — als Schafe ohne Hirten. So bin ich nicht. Ich wünschte, ich wäre es.«
Leone stemmte seinen massigen Körper aus dem Sessel und ging zu dem großen Tisch, wo ein alter Globus zwischen verstreuten Büchern stand. Er ließ den Globus langsam kreisen, so daß bald das eine Land, bald das andere ins Licht geriet.
»Schauen Sie sich das an, mein Freund! Die Welt, unser Weinberg … Einst kolonisierten wir sie im Namen Christi. Nicht immer rechtmäßig, nicht immer weise, aber das Kreuz war da, und die Sakramente waren da; und wie ein Mensch auch leben mochte — in Purpur oder in Ketten —, es bestand immer Aussicht für ihn, als ein Kind Gottes zu sterben. Jetzt …? Jetzt sind wir überall im Rückzug begriffen. China ist verloren für uns, ganz Asien und ganz Rußland. Afrika wird vielleicht bald dahinsein, und Südamerika kann als nächstes folgen. Sie wissen es. Ich weiß es. Unser Mißerfolg ist daran zu messen, daß wir in all diesen Jahren in Rom gesessen und untätig zugesehen haben.« Mit unsicherer Hand hielt er den kreisenden Globus an, dann drehte er sich um und legte seinem Besucher eine neue Frage vor. »Was würden Sie mit Ihrem Leben anfangen, Rinaldi, wenn Sie noch einmal von vorn anfangen könnten?«
Rinaldi blickte mit dem abbittenden Lächeln auf, das ihn so anziehend machte. »Wahrscheinlich würde ich wieder die gleichen Dinge tun. Nicht daß ich sehr stolz darauf wäre; aber zufällig sind es die einzigen Dinge, die mir liegen. Ich komme mit den Menschen gut aus, weil ich ihnen keine sehr tiefen Gefühle entgegenbringen kann. Infolgedessen bin ich wohl ein Diplomat von Natur. Ich streite nicht gern. Noch weniger schätze ich es, gefühlsmäßig verstrickt zu werden. Ich liebe die Abgeschlossenheit, und ich genieße das Studium. So bin ich ein guter Kanonist, ein vernünftiger Historiker und angemessen sprachenkundig. Ich hatte nie sehr starke Leidenschaften. Böswillige könnten mich kalt nennen. Infolgedessen habe ich mir den Ruf guter Führung erworben, ohne daran Mühe wenden zu müssen. Alles in allem war mein Leben sehr befriedigend — befriedigend für mich natürlich. Wie es der buchführende Engel ansieht, ist eine andere Frage.«
»Unterschätzen sie sich nicht, Mann«, erwiderte Leone griesgrämig. »Sie haben viel mehr geleistet, als Sie zugeben wollen!«
»Ich brauche Zeit und Überlegung, um mit meiner Seele ins reine zu kommen«, sagte Rinaldi ruhig. »Darf ich bei meinem Rücktritt auf Ihre Hilfe rechnen?«
»Selbstverständlich.«
»Besten Dank. Nun soll der Inquisitor seine eigene Frage beantworten. Was würden Sie tun, wenn Sie noch einmal von vorn anfangen könnten?«
»Darüber habe ich oft nachgedacht«, gab Leone ernst zurück. »Falls ich nicht heiraten würde — ich bin nicht sicher, ob ich nicht gerade das brauchte, um ein wenig menschlicher zu werden —, ich würde Landpfarrer werden — ein Landpfarrer, der theologisch genügend Latein kann, um die Messe zu zelebrieren und die sakramentalen Formeln zu beherrschen. Aber mit so viel Herz, daß ich wüßte, was andere Menschen zutiefst bewegt, was sie in ihren Nächten weinen läßt. Ich würde an einem Sommerabend vor meiner Kirche sitzen, mein Stundengebet lesen, über das Wetter und die Ernte sprechen und lernen, freundlich mit den Armen zu sein und demütig mit den Unglücklichen. Wissen Sie, was ich jetzt bin? Ein wandelndes Lexikon des Dogmas und der theologischen Kontroversen. Ich kann einen Irrtum schneller riechen als ein Dominikaner. Und was hat das zu bedeuten? Nichts. Wen kümmert die Theologie außer den Theologen? Wir sind notwendig, aber wir sind weniger wichtig, als wir meinen. Die Kirche ist Christus — Christus und das Volk. Und das Volk will lediglich wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, in welcher Beziehung Er zu den Menschen steht, und wie sie zu Ihm zurückkehren können, wenn sie abgeirrt sind.«
»Große Fragen«, bemerkte Rinaldi freundlich, »von kleinen Geistern nicht zu beantworten — und auch nicht von großen.«
Leone schüttelte eigensinnig die Löwenmähne. »Für das Volk laufen sie auf ganz einfache Dinge hinaus. Warum darf ich meines Nächsten Weib nicht begehren? Wer nimmt die Rache, die mir verboten ist? Und wen kümmert es, wenn ich krank und elend bin und in einer Dachkammer sterbe? Ich kann den Menschen die Antworten eines Theologen geben. Aber wem sonst glauben sie als dem Manne, der die Antworten in seinem Herzen fühlt und die Narben ihrer Konsequenzen am eigenen Fleisch trägt? Wo sind solche. Männer? Ist ein einziger dieser Art unter uns, die wir den Roten Hut tragen? Ach …« Sein grimmiger Mund verzog sich zu einem verlegenen Lächeln, und er breitete die Arme in einer Geste der Verzweiflung aus. »Wir sind, wie wir sind, und Gott muß sogar den Theologen die halbe Verantwortung abnehmen. Nun sagen Sie mir: Wo sollen wir unseren Papst suchen?«
Rinaldi antwortete entschieden: »Diesmal sollten wir ihn fürs Volk wählen und nicht für uns.«
»Wir werden fünfundachtzig im Konklave sein. Wie viele werden in der Frage übereinstimmen, was für das Volk am besten ist?«
Rinaldi betrachtete seine gepflegten Fingernägel. Er sagte leise: »Wenn wir ihnen den Mann erst einmal zeigen, können wir vielleicht ihre Zustimmung erlangen.«
Leones Antwort kam schnell und nachdrücklich: »Sie müßten ihn erst einmal mir zeigen.«
»Und wenn Sie einverstanden wären?«
»Dann erhebt sich eine andere Frage«, erklärte Leone. »Wie viele unserer Brüder werden so denken wie wir?«
Die Frage war subtiler, als es schien, und beide wußten es. Hier lag die ganze Problematik einer Papstwahl, das ganze Paradox des Papsttums. Der Mann, der den Ring des Fischers trug, war der Stellvertreter Christi, der Statthalter des Allmächtigen. Sein Reich war geistiger Art und allumfassend. Er war der Diener aller Diener Gottes, auch jener, die ihn nicht anerkannten.
Andererseits war er Bischof von Rom, Metropolit einer italienischen Kirchenprovinz. Auf Grund geschichtlicher Überlieferung forderten die Römer seine Anwesenheit und seine Dienste. Auch Fragen des Arbeitsmarktes hingen von ihm ab, des Fremdenverkehrs, der Stützung ihrer Wirtschaft durch Aufträge aus dem Vatikan, der Erhaltung ihrer historischen Denkmäler und nationaler Vorrechte. Sein Hof hatte italienischen Charakter; die Angestellten im Haushalt und in der Verwaltung waren Italiener Wenn er sich mit ihnen nicht in ihrer Muttersprache verständigen konnte, war er Palastintrigen und allen möglichen Gruppeninteressen wehrlos ausgesetzt.
In früheren Zeiten hatte Rom im geistlichen Leben eine führende Stellung eingenommen. Das Numen des alten römischen Imperiums war immer noch spürbar gewesen und die Erinnerung an die Pax Romana noch nicht aus dem Bewußtsein Europas geschwunden. Aber später hatte sich das verflüchtigt. Das römische Imperium hatte weder Rußland noch Asien je unterworfen, und die Eroberer Südamerikas hatten nicht Frieden gebracht, sondern das Schwert. Längst hatte England sich aufgelehnt, wie einst gegen die Legionen der römischen Besatzung. So gab es stichhaltige Argumente dafür, einen Nichtitaliener auf den päpstlichen Thron zu erheben — wie es auch stichhaltige Gründe für die Annahme gab, daß ein Nichtitaliener allzuleicht eine Marionette seiner Diener oder das Opfer ihrer Begabung für Intrigen werden könnte.
Die Fortdauer der Kirche war ein Glaubensartikel; aber ihre Verluste und Entartungen, ihre Gefährdungen durch Torheiten ihrer Mitglieder gehörten zum geschichtlichen Kanon. Es gab vielerlei Ursache zu Skepsis — doch immer wieder wurden die Skeptiker durch die ungeheure Fähigkeit der Kirche und des Papsttums zur Selbsterneuerung beschämt. Die Skeptiker brachten dafür ihre eigenen Erklärungen vor. Die Gläubigen schrieben es dem Beistand des Heiligen Geistes zu. In jedem Falle war es ein beunruhigendes Geheimnis, wie im Chaos der Geschichte trotz allem das Dogma so unerschüttert fortbestehen konnte, oder warum sich der allmächtige Gott eines so verworrenen Verfahrens bediente, um festen Stand zu behalten im Herzen seiner Geschöpfe.
So begann jedes Konklave mit der Anrufung des Heiligen Geistes. Am Tage der Einmauerung führte Rinaldi die alten Männer und deren Gehilfen in den Petersdom. Dann kam Leone, angetan mit scharlachrotem Meßgewand, begleitet von seinen Diakonen und Subdiakonen, um die Messe vom Heiligen Geist zu zelebrieren. Während Rinaldi den Zelebranten, der die Last der Prachtgewänder trug, beim Opferritual betrachtete, empfand er Mitleid mit ihm und plötzliches Verständnis.
Sie saßen alle in derselben Galeere, diese Kirchenfürsten, und er selbst mit ihnen. Sie waren Männer ohne Leibeserben, die sich »um der Liebe Gottes willen zu Eunuchen gemacht« hatten. Lange war es her, seit sie sich mit mehr oder weniger Begeisterung dem Dienst des verborgenen Gottes und dem unbeweisbaren Geheimnis geweiht hatten. Durch die Macht der Kirche war ihnen Ehre zuteil geworden, vielleicht mehr Ehre, als manche von ihnen in weltlichem Stande erreicht hätten; aber alle unterlagen der gemeinsamen Bürde des Alters und der nachlassenden Kräfte, der Einsamkeit der Eminenzen und der Furcht vor jenem göttlichen Gericht, vor dem sie als bankrotte Schuldner stehen könnten.
Er dachte auch an den Plan, den er mit Leone gefaßt hatte: einen Kandidaten einzuführen, der den meisten Stimmberechtigten noch ein Fremder war, und ihn zu befürworten, ohne daß die Apostolische Konstitution verletzt wurde, deren Erhaltung sie beeidigt hatten. Er fragte sich, ob dies nicht ein anmaßender Versucht sei, die Vorsehung zu hintergehen, die sie gerade in diesem Augenblick anriefen. Wenn es aber Gott gefiel — wie der Glaube lehrte —, den Menschen als freies Instrument für einen göttlichen Plan zu benutzen, wie konnte man dann anders handeln? Man durfte ein so wichtiges Ereignis wie eine Papstwahl nicht zu einem Glücksspiel werden lassen. Klugheit war allen auferlegt — Vorbereitung im Gebet, dann wohlüberlegtes Handeln, danach Gehorsam und Unterwerfung. Aber wie klug man auch planen mochte, man konnte sich des unheimlichen Gefühls nicht erwehren, unbedacht und ungeläutert auf geheiligtem Boden zu schreiten.
Die Hitze, das Flackern der Kerzen, der Chorgesang und die hypnotische Abgemessenheit des Rituals machten ihn schläfrig; er warf einen heimlichen Blick auf seine Kollegen, um sich zu vergewissern, daß keiner von ihnen sein Einnicken bemerkt hatte. Wie zwei Chöre uralter Erzengel saßen sie zu beiden Seiten des Hochaltars; auf ihrer Brust hingen goldene Kreuze, an den gefalteten Händen glänzten die fürstlichen Siegel, und die Gesichter waren gezeichnet von den Jahren und vom Wissen um die Macht.
Da war Rahamani von Antiochien mit dem Vollbart, den buschigen Brauen und den strahlenden, halb-mystischen Augen. Da war Benedetti, rund, mit rosigen Wangen und seidigen Haaren, der die Vatikanbank leitete. Neben ihm saß der Pole Potocki, der Kardinal mit dem hohen kahlen Schädel, dem leidenden Mund und den klugen, abwägenden Augen. Der Japaner Tatsue bedurfte nur der gelben Robe, um wie ein buddhistisches Bildnis auszusehen; und Hsien, der exilierte Chinese, saß zwischen Ragambwe, dem Schwarzen aus Kenia, und Pallenberg, dem hageren Asketen aus München.
Rinaldis scharfsichtige Augen schweiften über die Chorstühle; er zählte jedem seine Tugenden und Nachteile vor, erprobte an jedem den klassischen Ausdruck Papabile: Anwärter auf den päpstlichen Thron. Zwar trug jedes Mitglied des Konklaves diesen Titel, doch praktisch kamen nur sehr wenige in engere Wahl. Bei einigen bildete das Alter ein Hindernis, bei anderen fehlte es an der rechten Fähigkeit, am Temperament oder Ruf. Eine wichtige Rolle spielte die Nationalität. Einen Amerikaner konnte man nicht wählen, ohne Osten und Westen noch tiefer zu trennen. Ein Negerpapst mochte ein anschauliches Sinnbild neuer Freiheit darstellen, ein Japaner als wertvolles Bindeglied zwischen Asien und Europa erscheinen. Aber die Kirchenfürsten waren Greise und hüteten sich vor spektakulären Gesten. Ein deutscher Papst hätte wahrscheinlich die Sympathie jener verscherzt, die im Zweiten Weltkrieg gelitten hatten. Ein Franzose würde alte Erinnerungen an Avignon und an Rebellionen jenseits der Alpen erwecken. Solange in Spanien und Portugal Diktaturen herrschten, konnte die Wahl eines iberischen Papstes als diplomatische Taktlosigkeit betrachtet werden. Der Mailänder Gonfalone stand im Ruf, ein Heiliger zu sein, aber er wurde immer einsiedlerischer; und es erhob sich die Frage, ob er sich für ein so öffentliches Amt eignete. Leone war ein Autokrat, durchaus imstande, das Feuer des Eiferers mit der Flamme des Mitleids zu verwechseln.
Aus der Apostelgeschichte wurde nun vorgetragen: »Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, daß er ist verordnet von Gott, ein Richter der Lebendigen und der Toten …« Der Chor sang: Veni, Sancte Spiritus … »Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen.« Dann begann Leone, mit seiner kraftvollen, hartnäckigen Stimme den Bibeltext für den Tag des Konklaves vorzulesen: »Wer nicht zur Tür hineingehet in den Schafstall, sondern steiget anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingehet, der ist ein Hirte der Schafe.«
Rinaldi neigte das Haupt in die Hände und betete, daß der Mann, den er vorzuschlagen gedachte, in Wahrheit ein Hirte sein und daß das Konklave ihm den Krummstab und den Ring reichen möge.
Nach der Messe zog sich der Zelebrant in die Sakristei zurück, um sein Gewand abzulegen; und die Kardinäle nahmen in den Kirchenstühlen eine entspanntere Haltung ein. Einige flüsterten miteinander, zwei nickten müde, und einer stärkte sich heimlich mit einer Prise Schnupftabak. Im nächsten Teil der Zeremonie sollte ein Prälat eine Predigt in Latein halten, in der noch einmal auf die Bedeutung der Wahl hingewiesen wurde, vor allem auf die moralische Verpflichtung, sie in vorschriftsmäßiger und aufrichtiger Weise durchzuführen. Nach altem Brauch pflegte man den Prälaten nach der Reinheit seines Lateins zu wählen, doch diesmal hatte der Kämmerer andere Vorkehrungen getroffen.
Erstauntes Geraune ging rings durch die Versammelten, als sie sahen, daß Rinaldi seinen Platz verließ und zum fernen Ende der Kirchenstühle auf der Evangelienseite des Altars schritt. Er bot seine Hand einem großen hageren Kardinal und führte ihn zur Kanzel. Als dieser Mann erhöht im vollen Lichterschein stand, erkannten sie in ihm den jüngsten von allen. Sein Haar war schwarz, ebenso sein viereckiger Bart, und über seine linke Wange verlief eine lange auffällige Narbe. Auf der Brust hatte er neben dem Kreuz ein Ikonenschild, das eine byzantinische Madonna mit dem Kind darstellte. Beim Bekreuzigen machte er das Zeichen auf slawische Weise von rechts nach links; doch als er zu sprechen begann, bediente er sich nicht des Lateinischen, sondern sprach in reinem und melodiösem Toskanisch. Über das Kirchenschiff hinweg lächelte Leone wie mit grimmigem Beifall Rinaldi zu; dann überließen sich beide wie ihre Kollegen der schlichten Beredsamkeit des Fremden:
»Mein Name ist Kyrill Lakota, ich bin als der Letzte und der Geringste in dieses Heilige Kollegium gekommen. Ich spreche heute auf Einladung unseres Bruders, des Kardinalkämmerers, zu Ihnen. Den meisten von Ihnen bin ich unbekannt, da meine Landsleute verstreut sind und ich die vergangenen siebzehn Jahre im Gefängnis verbracht habe. Wenn ich überhaupt ein Recht oder ein Verdienst unter Ihnen habe, so lassen Sie dies die Grundlage sein — daß ich für die Verlorenen spreche, für jene, die in Dunkelheit und im Schattental des Todes wandeln. Für sie und nicht für uns gehen wir ins Konklave. Für sie und nicht für uns müssen wir einen Papst wählen. Der erste, der dieses Amt innehatte, war ein Mann, welcher mit Christo wandelte und wie der Herr gekreuzigt wurde. Die besten Diener der Kirche und der Gläubigen sind jene, die Christo und den Menschen, welche das Ebenbild Christi sind, am nächsten gekommen sind. Große Macht ist in unsere Hände gegeben, meine Brüder; und wir werden dem Manne, den wir wählen, noch größere Macht in die Hand legen; aber wir müssen diese Macht als Knechte und nicht als Herren benutzen. Wir müssen bedenken, daß wir Priester und Bischöfe geworden sind, weil wir uns den Menschen, der Herde Christi, geweiht haben. Was wir besitzen, bis zu den Kleidern, die wir am Leibe tragen, haben wir durch die Barmherzigkeit erhalten. Das gesamte Baumaterial der Kirche wurde Stein um Stein aufgebracht, Gold durch Geldopfer, durch den Schweiß der Gläubigen, und sie haben es uns zur Verwaltung übergeben. Sie haben uns ausbilden lassen, auf daß wir sie und ihre Kinder belehren. In Demut neigen sie sich vor unserer Priesterschaft wie vor der göttlichen Priesterschaft Christi. Für sie üben wir die sakramentale Macht, die uns in der Salbung und Handauflegung verliehen ist. Wenn wir in unseren Überlegungen einer anderen Sache dienen als dieser, dann üben wir Verrat. Es wird von uns nicht gefordert, daß wir darin übereinstimmen, was für die Kirche am besten ist, sondern nur, daß wir in Liebe und Demut überlegen und am Ende dem Manne gehorsam sind, der von der Mehrheit gewählt worden ist. Es wird von uns gefordert, schnell zu handeln, damit die Kirche nicht lange ohne Oberhaupt bleibe. Bei all dem müssen wir letztlich so sein, wie unser Papst es von sich verkünden wird — Diener der Diener Gottes. Geben wir uns in diesen wichtigen Augenblicken als willige Werkzeuge in Seine Hände. Amen.«
Das wurde so einfach gesagt, als sei es die herkömmliche Formel; aber dieser Mann, mit seinem vernarbten Gesicht, der kräftigen Stimme und den verkrümmten sprechenden Händen, verlieh den Worten unerwartetes Gewicht. Lange herrschte Stille, während er die Kanzel verließ und auf seinen Platz zurückkehrte. Leone nickte beifällig mit dem Löwenhaupt, und Rinaldi hauchte ein stilles Dankgebet. Dann waltete der Zeremonienmeister seines Amtes und führte die Kardinäle mit ihren Gehilfen und Dienern, dem Beichtvater, dem Arzt, dem Architekten des Konklaves und den Handwerkern, aus der Basilika in die Sperrzone des Vatikans.
In der Sixtinischen Kapelle wurden sie abermals vereidigt. Hierauf gab Leone Befehl, die Glocken zu läuten, damit alle, die nicht dem Konklave angehörten, die Sperrzone sogleich verließen. Jeder Kardinal wurde von einem Diener zu seiner Zelle geleitet. Der Präfekt der Zeremonienmeister und der Architekt des Konklaves begannen mit der überlieferten Durchsuchung der Sperrzone. Sie gingen von Raum zu Raum, zogen Vorhänge beiseite, beleuchteten dunkle Winkel und öffneten Schränke, bis jeder Fleck frei von Eindringlingen erklärt wurde.
Beim Zugang zu der großen Treppe Pius’ XI. blieben sie stehen; die Nobelgarde räumte das Konklavegebiet, nach ihr der Konklavemarschall mit seinen Gehilfen. Die große Tür wurde abgeschlossen. Der Konklavemarschall drehte auf der Außenseite seinen Schlüssel um, der Kardinalkämmerer von innen. Der Marschall gab Befehl, seine Flagge über dem Vatikan zu hissen, und von diesem Augenblick an durfte niemand das Sperrgebiet verlassen oder betreten oder eine Nachricht übermitteln — bis der neue Papst gewählt und genannt war.
Allein in seiner Zelle, ging Kyrill Kardinal Lakota durch ein besonderes Fegefeuer. Es war ein immer wiederkehrender Zustand, dessen Symptome er gut kannte: Kalter Schweiß brach ihm im Gesicht und an den Händen aus, die Glieder zitterten, die verletzten Gesichtsnerven zuckten, und panische Angst ergriff ihn, der Raum könnte ihn erdrücken. Zweimal in seinem Leben war er im Bunker eines unterirdischen Gefängnisses eingeschlossen worden. Vier Monate im ganzen hatte er die Schrecken der Dunkelheit, hatte er Kälte, Einsamkeit und Hunger erduldet, und die Säulen seiner Vernunft schienen zu bersten unter dieser Anspannung. Nichts in seinem jahrelangen sibirischen Exil hatte ihn so entsetzt, nichts seiner Erinnerung so tiefe Wunden geschlagen. Und nichts hatte ihn der Abtrünnigkeit, der Abschwörung so nahegebracht.
Er war oft geschlagen worden, aber das verletzte Gewebe heilte die Zeit. Er war verhört worden, bis jeder Nerv zu schreien schien und sein Denken in barmherzige Verwirrung sank. Auch daraus war er gestärkt im Glauben und Denken hervorgegangen. Aber die Angst vor dem Eingeschlossensein sollte ihm bis zum Tode bleiben. Kamenew hatte sein Wort wahr gemacht. »Sie werden mich nie vergessen können. Wohin Sie gehen, da werde ich sein.« Auch hier, in den Grenzen der neutralen Vatikanstadt, war Kamenew, der Quälgeist, bei ihm. Es gab nur ein Entrinnen vor ihm, jenes, das er im Bunker gelernt hatte — den gemarterten Geist in die Arme des Allmächtigen werfen. Er kniete nieder, vergrub das Gesicht in den Händen und bemühte sich, mit jeder Fiber der Seele und des Körpers in Selbstvergessenheit zu versinken.
Seine Lippen beherrschten keine Worte, aber der Geist fand zu der Klage Christi in Gethsemane. »Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.«
Er wußte, daß er schließlich vorübergehen würde, doch zuvor mußte die Todesangst ertragen werden. Die Mauern bedrängten ihn. Die Decke lastete auf ihm mit bleierner Schwere. Die Dunkelheit drückte auf seine Augäpfel und verdichtete sich in seinem Kopf. Jeder Muskel verkrampfte sich schmerzhaft, und seine Zähne klapperten wie im Fieber.
Dann wurde er todeskalt und todesruhig, und geduldig wartete er auf das innere Licht, das der Beginn des Friedens war und das Ende der Einsamkeit.
Das Licht war wie eine Morgendämmerung, von einem hohen Berg aus gesehen; rasch überflutete es jede Falte der Landschaft, und die Inbilder ihrer Geschichte offenbarten sich auf einen Blick. Die Straße seiner eigenen Pilgerfahrt war ein rotes Band, das sich von Lwow in der Ukraine sechstausend Kilometer weit hinzog, bis nach Nikolajewsk am Ochotskischen Meer.
Als der Krieg mit den Deutschen vorüber war, wurde er trotz seiner Jugend zum Metropoliten von Lwow ernannt, zum Nachfolger des großen Andreas Szeptyckyj, des Hauptes der ruthenischen Katholiken. Kurz darauf wurde er mit sechs anderen Bischöfen verhaftet und an die östliche Grenze Sibiriens deportiert. Die sechs anderen starben; er blieb allein zurück, Hirte einer verlorenen Herde, der das Kreuz auf den eigenen Schultern tragen mußte.
Siebzehn Jahre lang war er im Gefängnis oder im Arbeitslager gewesen. In dieser ganzen Zeit konnte er nur ein einziges Mal die Messe zelebrieren, mit einem Fingerhut voll Wein und einer Weißbrotkruste. Gebete und sakramentale Formeln standen ihm nur zur Verfügung, soweit sie in seinem Gedächtnis aufbewahrt waren. Was er seinen Mitgefangenen an Kraft und Mitleid zu spenden suchte, mußte er aus sich selbst und aus dem Born der göttlichen Gnade schöpfen. Doch sein von den Torturen geschwächter Körper erstarkte wundersamerweise wieder bei der Sklavenarbeit in den Minen und beim Straßenbau. Selbst Kamenew machte sich nicht mehr über ihn lustig und staunte über sein Durchkommen.
Denn Kamenew, sein Quälgeist bei den ersten Verhören, kehrte immer wieder; und jedesmal, wenn er kam, war er in der marxistischen Rangordnung etwas höher gestiegen. Und jedesmal schien er etwas freundlicher zu sein, als ob er sich der Achtung vor seinem Opfer langsam ergäbe.
Selbst vom Berggipfel der Kontemplation sah er immer noch Kamenew, wie er kalt und höhnisch nach dem kleinsten Zeichen der Schwäche, den geringsten Andeutungen der Niederlage suchte. Anfangs hatte er sich zwingen müssen, für seinen Kerkermeister zu beten. Mit der Zeit war zwischen ihnen eine gewisse freudlose Brüderschaft entstanden, auch als der eine höher stieg und der andere in Gemeinschaft mit den sibirischen Sklaven immer tiefer zu sinken schien. Und schließlich hatte Kamenew höchstpersönlich seine Flucht in die Wege geleitet und ihn zum letztenmal mit Spott bedacht, als er ihn mit der Identität eines Toten versah.
»Sie sollen frei sein«, hatte Kamenew gesagt, »weil ich Sie als freien Menschen brauche. Aber Sie werden immer in meiner Schuld stehen, weil ich einen Mann getötet habe, um Ihnen einen Namen zu geben. Eines Tages werde ich von Ihnen Bezahlung fordern, und dann werden Sie bezahlen, wie hoch der Preis auch sein mag.«
Es war, als hätte der Kerkermeister eine Weissagung ausgesprochen. Denn Kyrill Lakota flüchtete und schlug sich nach Rom durch, wo ihn ein sterbender Papst zum Kardinal ernannte.
Bis zu diesem Punkt war der Weg in der Rückschau deutlich. In jeder Tragödie versuchte er, die Verheißung zukünftiger Gnade zu erkennen. Für jeden der Bischöfe, die für ihren Glauben gestorben waren, hatte ein Mann in seinen Armen im Lager das Leben ausgehaucht, dem Allmächtigen dankend für die Absolution. Die verstreute Herde würde nicht ganz den Glauben verlieren, um dessentwillen sie gelitten hatten. Einige würden bleiben, um den Glauben weiterzugeben, ein kleines Licht, an dem sich eines Tages vielleicht tausend Fackeln entzünden könnten. Bei der erniedrigenden Straßenarbeit hatte er gesehen, wie die merkwürdigsten Männer menschliche Würde bewahrten. Er hatte Kinder mit ein wenig schmutzigem Wasser getauft und erlebt, daß sie ungezeichnet vom Elend der Welt starben.
Er selbst lernte Demut, Dankbarkeit und die Tapferkeit, an eine Allmacht zu glauben, die sich in machtvoller Entwicklung schließlich doch zum Guten auswirkte. Er lernte Mitleid und Liebe und begriff den Sinn der nächtlichen Tränen. Er lernte hoffen, daß er ein Werkzeug für Kamenew werden könnte, wenn nicht zur letztlichen Erleuchtung, dann wenigstens zur letztlichen Absolution. Aber all dies gehörte der Vergangenheit an. Der Pilgerweg führte über Rom hinaus in eine unergründliche Zukunft. Doch selbst das Licht der Betrachtung reichte nur bis Rom. Dann senkte sich ein Schleier. Dies war die Grenze, die der barmherzige Gott dem Vorherwissen gesetzt hatte.
Das Licht wandelte sich nun; die Steppenlandschaft wurde zum wogenden Meer, über das eine Gestalt in altertümlichem Gewand auf ihn zuschritt, mit leuchtendem Gesicht, die durchbohrten Hände wie zum Gruße erhoben. Kyrill Kardinal Lakota wich zurück und wollte sich verbergen, aber es gab kein Entrinnen. Als die Hände ihn berührten und das strahlende Antlitz sich neigte, ihn zu umarmen, fühlte er sich durchdrungen von unerträglicher Freude und unerträglichem Schmerz. Dann trat er ein in den Augenblick des Friedens.
Der Diener, der für ihn zu sorgen hatte, kam herein und fand ihn auf den Knien, erstarrt, mit ausgestreckten Armen in der Gebärde der Kreuzigung. Auch Rinaldi, der bei den Kardinälen im Konklave die Runde machte, traf ihn so an und versuchte vergeblich, ihn zu wecken. Dann entfernte sich auch Rinaldi, erschüttert und in Demut, um sich mit Leone und anderen Kollegen zu beraten.
George Faber, der grauhaarige Doyen des römischen Pressekorps, seit fünfzehn Jahren italienischer Korrespondent der New Yorker Zeitung Monitor, schrieb in seinem vollgestopften, unordentlichen Büro seinen Kommentar zur bevorstehenden Papstwahl.
»Außerhalb der kleinen mittelalterlichen Enklave des Vatikans herrscht eine Krisenatmosphäre in der Welt. Veränderliche Winde wehen, und bald da, bald dort wird Sturmwarnung gegeben. Der Rüstungswettlauf zwischen Amerika und Rußland geht unvermindert weiter. Jeden Monat finden neue Vorstöße in den Weltraum statt. In Indien ist Hungersnot, und auf den südlichen Halbinseln Asiens werden Guerillakämpfe ausgefochten. Über Afrika wetterleuchtet es, und in den Hauptstädten Südamerikas erheben sich die zerfetzten Fahnen der Revolution. Die Sandwüsten Nordafrikas sind von Blut getränkt, und in Europa findet der Kampf um das wirtschaftliche Überleben hinter den geschlossenen Türen der Sitzungssäle von Banken und Aufsichtsräten statt. Hoch über dem Stillen Ozean kreisen Kampfflugzeuge, um die Verseuchung der Luft durch tödliche Atompartikeln zu untersuchen. In China mühen sich die neuen Dynastien, hungrigen Millionen den Magen zu füllen, während ihr Geist an die starre Orthodoxie der marxistischen Philosophie gekettet bleibt. In den nebligen Himalajatälern, wo die Gebetsfähnchen flattern und die Teepflücker über die Terrassen stapfen, ereignen sich Überfälle und Übergriffe von Tibet bis Sinkiang. An den Grenzen der Äußeren Mongolei wird das unsichere Freundschaftsband zwischen Rußland und China auf die Zerreißprobe gestellt. Polizeiboote durchforschen die Mangrovensümpfe und Buchten von Neuguinea, während die Bergstämme mit einem einzigen Satz vom Steinzeitalter ins zwanzigste Jahrhundert zu springen versuchen.
Überall sind sich die Menschen bewußt geworden, daß sie vergängliche Geschöpfe sind; und sie kämpfen verzweifelt, um für die kurze Zeit ihres Erdendaseins den bestmöglichen Platz in der Welt zu erringen. Der Nepalese, gejagt von Bergdämonen, der erschöpfte Kuli, mit überanstrengtem Herzen zwischen den Stangen einer Rikscha, der an allen Grenzen belagerte Israeli, ein jeder in dieser Welt erhebt seinen Anspruch auf Individualität; und jeder leiht sein Ohr einem Propheten, der sie ihm verheißt.«
Er nahm die Finger von den Tasten, zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, um dem soeben niedergeschriebenen Gedanken — »Anspruch auf Individualität« — nachzusinnen. Seltsam. Jeder mußte ihn früher oder später erheben. Seltsam, wie lange man es anscheinend gleichmütig hinnahm, als die Persönlichkeit zu gelten, die man nach außen zu sein schien, und ebenso den Status, in den man im Leben anscheinend eingesetzt war. Dann wurde die Individualität ganz plötzlich in Frage gestellt. Seine eigene zum Beispiel. George Faber, eingefleischter Junggeselle, anerkannter Fachmann für italienische Fragen und Vatikanpolitik. Warum wurde er so spät im Leben zu der Frage gezwungen, wer er eigentlich war und womit er sich bisher zufriedengegeben hatte? Warum nun diese ruhelose Unzufriedenheit mit dem Bild, das die Öffentlichkeit von ihm hatte? Warum dieser Zweifel, ob er so weiterleben konnte wie bisher, ohne ergänzende Bindung? Natürlich stak eine Frau dahinter. In seinem Leben hatte es stets Frauen gegeben, aber Chiara war etwas Neues und Besonderes. Der Gedanke an sie störte ihn. Er versuchte, ihn wegzuschieben, und beugte sich wieder über seine Schreibmaschine.
»Überall trachtet der Mensch danach, zu überleben; aber da die Ironie der Schöpfung will, daß der Mensch unweigerlich sterben muß, sind die Machthaber, die ihn physisch oder geistig beherrschen wollen, gezwungen, ihm eine Ausweitung seiner Existenzspanne ins scheinbare Unendliche zu versprechen: Die Marxisten verheißen ihm Einssein mit den Arbeitern der Welt; die Nationalisten bieten ihm eine Fahne, eine Grenze und lokale Selbsterhöhung. Die Demokraten bieten ihm Freiheit durch Wahlurnen, mahnen ihn jedoch, daß er unter Umständen sterben muß, um die Freiheit zu bewahren.
Aber für den Menschen und für alle Propheten, die er ernennt, ist der letzte Feind die Zeit; und Zeit ist eine relative Dimension, begrenzt durch die Fähigkeit des Menschen, sie zu nutzen. Die modernen Massenkommunikationsmittel, die blitzschnelle Verbindungen herstellen, haben die Zeit zwischen einer menschlichen Handlung und ihren Folgen auf ein Minimum herabgemindert. Ein in Berlin abgefeuerter Schuß kann die Welt binnen Minuten zur Explosion bringen. Eine Seuche auf den Philippinen kann Australien im Verlauf eines Tages infizieren. Ein Mann, der in einem Moskauer Zirkus vom Trapez stürzt, kann in seinem Todeskampf von London und New York aus beobachtet werden.
So wird jeder Mensch jeden Augenblick von den Folgen seiner eigenen Sünden und der aller seiner Mitmenschen bedrängt. So wird auch jeder Prophet und jeder Scheinwissende vom schnellen Schritt der Zeit gehetzt und von der Einsicht, daß er für falsche Voraussagen und unerfüllte Versprechungen schneller zur Rechenschaft gezogen werden kann als je zuvor in der Geschichte. Hierin liegt die Ursache der Krise. Hier entstehen die Winde und Wogen; hier werden die Blitze geschmiedet, die jede Woche, jeden Monat unter einem Himmel mit schwarzen Pilzwolken um die Erde fahren können.
Die Männer im Vatikan sind sich der Zeit bewußt, wenn auch manche von ihnen nicht mehr in dem Maße, wie es notwendig wäre.«
Zeit! Er wußte um diese schwindende Dimension des Daseins. Er war Mitte der Vierzig. Seit mehr als einem Jahr bemühte er sich, Chiaras Antrag auf Nichtigerklärung ihrer Ehe durch die Rota zu steuern, damit sie von Corrado Calitri frei wurde und ihn heiraten konnte. Aber der Fall wurde mit hoffnungsloser Langsamkeit behandelt, und Faber war, obwohl katholisch, dazu gelangt, das unpersönliche System der römischen Kongregationen und die Einstellung der verantwortlichen Männer erbittert abzulehnen.
Eifrig tippte er weiter, mit professioneller Sicherheit:
»Wie die meisten alten Männer haben sie sich daran gewöhnt, die Zeit als einen Blitz zwischen zwei Ewigkeiten zu betrachten, statt als eine zugemessene Frist, die jedem Menschen zur Verfügung steht, um seine Gottesanschauung reifen zu lassen.
Sie befassen sich auch mit der Individualität des Menschen, die sie ihm als einem Kind Gottes zuerkennen müssen. Doch hier droht ihnen eine andere Fallgrube: Bisweilen billigen sie ihm diese Individualität zu, ohne sie recht zu verstehen, ohne zu wissen, wie er in dem Garten, in den er gepflanzt worden ist, wachsen muß, ob der Boden süß oder sauer, ob die Luft mild oder stürmisch ist. Menschen wachsen wie Bäume in verschiedener Gestalt, krumm oder gerade, je nach dem Klima ihres Nährbodens. Aber solange der Saft fließt und die Blätter sprießen, sollte es über die Gestalt des Menschen oder des Baumes keinen Streit geben.
Die Männer im Vatikan beschäftigen sich gleichfalls mit der Ewigkeit und Unsterblichkeit. Sie kennen das menschliche Bedürfnis nach Bewahrung des eigenen Ichs über die Grenze der flüchtigen Jahre hinaus. Ihrem Glauben gemäß bestätigen sie die Fortdauer der Seele in ewiger Vereinigung mit dem Schöpfer oder ihre Verbannung von Seinem Antlitz. Sie gehen sogar noch weiter: Sie verheißen dem Menschen die Erhaltung seiner Individualität und am Ende den Sieg über den Schrecken des physischen Todes. Hingegen haben sie häufig zuwenig Verständnis dafür, daß Unsterblichkeit schon in der Zeit und beizeiten beginnen muß und daß dem Menschen auch die physischen Hilfsmittel gegeben werden müssen, deren er zum Überleben bedarf, bevor sein Geist zu dem Wunsch nach mehr als körperlichem Weiterleben heranreifen kann —«
Chiara war ihm so lebensnotwendig geworden wie die Luft zum Atmen. Ohne ihre Jugend und Leidenschaft, so schien es ihm, würde er schnell absinken in Alter und Enttäuschung. Sie war jetzt seit fast sechs Monaten seine Geliebte; aber er wurde von der Angst geplagt, daß er sie irgendwann an einen jüngeren Mann verlieren würde und daß es ihm dann versagt wäre, in seinen Kindern weiterzuleben. Er hatte gute Freunde im Vatikan. Männer, die in der Kirche einen großen Namen besaßen, waren ihm leicht zugänglich; doch sie unterstanden dem Gesetz und dem System und konnten ihm nicht helfen. Er schrieb gefühlsbetont:
»Für diese alten und reiflich erwägenden Männer gilt die Paradoxie aller fürstlichen Rangordnung: Je höher man steigt, desto mehr sieht man von der Welt, aber um so weniger erfährt man von den kleinen bestimmenden Faktoren des Menschendaseins. Daß ein Mann ohne Schuhe unter Umständen verhungert, weil er nicht zu einer Arbeitsstätte gehen kann. Daß ein übellauniger Steuereinzieher vielleicht eine örtliche Revolution entfesselt. Daß hoher Blutdruck einen edlen Menschen in Schwermut und Verzweiflung stürzen kann. Daß sich eine Frau für Geld verkauft, weil sie sich einem bestimmten Mann nicht in Liebe hingeben kann. Alle Herrscher sind in Gefahr zu glauben, Geschichte sei das Ergebnis großer Allgemeinheiten, statt der Summe von Millionen kleiner Besonderheiten wie schlechter Kanalisation, sexueller Besessenheit und der Mücke, die Malaria überträgt …«
Das war nicht der Artikel, den er zu schreiben beabsichtigt hatte, sondern mehr oder weniger eine Darstellung seiner persönlichen Gefühle im Hinblick auf das bevorstehende Ereignis. Aber mochte es nur stehenbleiben! Mochten die Redakteure in New York Gefallen daran finden oder es in den Papierkorb werfen … Die Tür öffnete sich, und Chiara kam herein. Er nahm sie in die Arme und küßte sie. Er verwünschte Chiaras Mann, die Kirche und seine Zeitung und verließ sein Büro, um mit ihr in der Via Veneto zu essen.
Der erste Tag des Konklaves stand den Kardinälen zur freien Verfügung, so daß sie unter sich Besprechungen abhalten und einer des anderen Beweggründe, Vorurteile und Privatinteressen abtasten konnten. Deshalb mischten sich Rinaldi und Leone unter sie und benutzten die Gelegenheit, den endgültigen Vorschlag sorgsam vorzubereiten. War die Wahl erst einmal im Gange, hatten sie erst einmal offen Partei ergriffen, so ließ sich eine Übereinstimmung viel schwerer erzielen.
Nicht alle Gespräche drehten sich um ewige Wahrheiten. Oft ging es dabei schlicht und unverblümt zu, so auch bei Rinaldis Unterhaltung mit dem Amerikaner bei einer Tasse amerikanischen Kaffees (gebraut vom Diener Seiner Eminenz, weil er den italienischen Kaffee nicht vertrug).
Seine Eminenz, Charles Corbert Carlin, Kardinal, Erzbischof von New York, war ein großer Mann mit frischer Gesichtsfarbe, scharfen, nüchternen Augen und aufgeschlossenem Wesen. Er brachte seine Ansicht so knapp wie ein Bankbeamter vor, der ein überzogenes Konto beanstandet:
»Wir wollen keinen Diplomaten, und wir wollen keinen Vertreter der Kurie, der die Welt durch eine römische Brille betrachtet. Einen vielgereisten Mann, ja, aber einen, der Seelsorger gewesen ist und unsere Probleme begreift.«
»Ich würde gern hören, wie Eure Eminenz sie definieren.« Rinaldi gab sich von seiner gewinnendsten Seite.
»Wir verlieren unsere Gewalt über die Menschen«, erklärte Carlin unumwunden. »Sie verlieren ihre Treue zu uns. Ich glaube, die Schuld liegt größtenteils bei uns.«
Rinaldi war bestürzt. Carlin stand im Ruf, ein glänzender Geschäftsführer der Kirche zu sein und die Überzeugung zu hegen, alle Übel der Welt könnten durch ein gutdotiertes Schulsystem und durch allsonntägliche aufrüttelnde Predigten behoben werden. Ihn so unumwunden von den Schattenseiten seines Bereiches sprechen zu hören, war ebenso erfrischend wie beunruhigend.
Rinaldi fragte: »Warum verlieren wir unsere Gewalt?«
»In Amerika? Aus zwei Gründen: Wohlstand und Ansehen. Wir werden nicht mehr verfolgt. Wir bezahlen alles, was wir brauchen. Wir können den Glauben wie ein Rotarierabzeichen tragen — und mit ebenso geringen gesellschaftlichen Konsequenzen. Wir sammeln unsere Beiträge wie ein Klub, wettern gegen die Kommunisten und leisten für den Peterspfennig den höchsten Beitrag in der Welt. Aber das genügt nicht. Das alles hat nicht — nicht genug Herz für viele Katholiken. Die Jugend entzieht sich unserem Einfluß. Sie glaubt, uns nicht so zu brauchen, wie sie sollte. Sie vertraut uns nicht mehr so wie früher.« Ernst fügte er hinzu: »Das ist, glaube ich, teilweise meine Schuld.«
»Keiner von uns hat viel Grund, besonders stolz auf sich zu sein«, sagte Rinaldi ruhig. »Blicken Sie nach Frankreich — schauen Sie das Blutvergießen in Algerien. Und dieses Land ist zur Hälfte katholisch. Wo bleibt unsere Autorität in dieser ungeheuerlichen Lage? Ein Drittel der katholischen Weltbevölkerung lebt in Südamerika, doch was für einen Einfluß haben wir dort? Welchen Eindruck rufen wir bei den gleichgültigen Reichen und den unterdrückten Armen hervor, die in Gott keine Hoffnung mehr sehen und noch weniger in denjenigen, die Ihn vertreten? Wo sollen wir mit den Änderungen beginnen?«
»Ich habe Fehler gemacht«, antwortete Carlin düster, »große Fehler. Ich kann nicht einmal damit anfangen, alle wiedergutzumachen. Mein Vater war Gärtner, ein guter Gärtner. Er sagte immer, das beste, was man für einen Baum tun könnte, bestehe darin, ihn vor der Kälte zu schützen, ihn einmal im Jahr zu stutzen und das übrige Gott zu überlassen. Von jeher setzte ich meinen Stolz darein, ebenso praktisch wie er zu sein — Sie verstehen? Die Kirche errichten, dann die Schule. Die Nonnen berufen, dann die Brüder. Das Seminar aufbauen, die Priester ausbilden und dafür zu sorgen, daß stets Geld hereinströmt. Danach, glaubte ich, stand alles beim Allmächtigen.« Zum erstenmal lächelte er; und Rinaldi, der ihn viele Jahre nicht sehr gern gehabt hatte, begann, sich für ihn zu erwärmen. Carlin fuhr leichthin fort: »Die Römer und die Iren! Wir sind große Pläneschmiede und große Baumeister, aber wir verlieren das Gefühl für die innere Bedeutung der Dinge schneller als alle anderen. Halte an der Bibel fest! Kein Fleisch am Freitag, keine Liebelei mit des Nächsten Weib — und die Geheimnisse überlaß den Theologen! Das genügt nicht. Gott helfe uns, es genügt nicht!«
»Sie fordern einen Heiligen? Ich bezweifle, daß wir gerade jetzt viele auf der Liste haben.«
»Keinen Heiligen.« Carlin sprach wieder mit Nachdruck. »Einen Mann aus dem Volk für das Volk, wie es Sarto war. Einen Mann, der für die Menschen sein Blut geben könnte, der sie schilt und sie stets spüren läßt, daß er sie liebt. Einen Mann, der aus diesem vergoldeten Garten ausbrechen und ein zweiter Petrus werden könnte.«
»Dann würde er natürlich auch gekreuzigt werden«, warf Rinaldi ein.
»Vielleicht brauchen wir gerade das?« sagte die Eminenz aus New York.
Worauf Rinaldi, der Diplomat, den Zeitpunkt für gekommen hielt, von dem bärtigen Ukrainer Kyrill Lakota als papabile zu sprechen.
In einer etwas kleineren Zelle des Konklaves sprach Leone über denselben Kandidaten mit Hugh Kardinal Brandon von London. Brandon, ein typischer Engländer, hegte keine Illusionen und begeisterte sich selten. Er schürzte die schmalen grauen Lippen, spielte mit seinem Brustkreuz und legte seinen Standpunkt in korrektem, wenn auch etwas gestelztem Italienisch dar:
»Nach unserer Ansicht wäre ein Italiener immer noch die beste Wahl. Das läßt uns Bewegungsfreiheit; wenn Sie verstehen, was ich meine. Eine neue Einstellung oder eine neue politische Linie käme nicht in Betracht. Die Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Republik Italien würden nicht gestört. Das Papsttum wäre weiterhin eine wirksame Schranke gegen das Wachstum des italienischen Kommunismus.« Er erlaubte sich einen kleinen trockenen Scherz: »Wir könnten weiterhin mit der Sympathie der englischen Romantiker für das romantische Italien rechnen.« Leone, Veteran vieler subtiler Streitgespräche, nickte zustimmend und bemerkte fast beiläufig: »Sie würden also unseren Neuankömmling nicht in Betracht ziehen, den Mann, der heute morgen zu uns sprach?«
»Scheint mir zweifelhaft. Wie alle fand ich ihn auf der Kanzel sehr eindrucksvoll. Aber Rednertalent ist kaum eine vollwertige Qualifikation. Nicht wahr? Außerdem bestünde die Frage der Riten. Meines Wissens ist dieser Mann Ukrainer und gehört dem ruthenischen Ritus an.«
»Wenn er gewählt würde, müßte er automatisch den lateinischen Ritus pflegen.«
Die Eminenz von London lächelte dünn. »Manche Leute könnten sich an dem Bart stoßen. Sieht allzu byzantinisch aus. Finden Sie nicht auch? Wir haben lange Zeit keinen bärtigen Papst gehabt.«
»Sicher würde er sich den Bart abnehmen lassen.«
»Würde er die Ikone weiterhin tragen?«
»Man könnte ihn überreden, darauf zu verzichten.«
»Dann hätten wir das Muster eines Römers. Warum also nicht gleich einen Italiener wählen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie etwas anderes wollen.«
»Doch, glauben Sie mir. Ich möchte Ihnen jetzt sagen, daß ich meine Stimme dem Ukrainer geben werde.«
»Leider kann ich Ihnen da meine Stimme nicht versprechen. Die Engländer und die Russen, wissen Sie … Wir sind in der Geschichte nie besonders gut miteinander ausgekommen — nie.«
Der Syrer Rahamani sagte in seinem geschmeidigen, höflichen Tone: »Immer sucht man einen Mann mit der einen notwendigen Gabe — der Gabe, mit Gott zusammenzuarbeiten. Auch bei guten Menschen ist diese Gabe selten. Die meisten von uns verbringen zwar das Leben damit, sich möglichst dem Willen Gottes zu beugen, aber selbst dann müssen wir oft durch gnädige Gewalt gebeugt werden —. Die anderen, die seltenen, wollen instinktiv das Werkzeug in den Händen des Schöpfers sein. Wenn dieser neue Mann so ist, dann ist er der, den wir brauchen.«
»Und wie sollen wir das wissen?« fragte Leone trocken.
»Wir überlassen ihn Gott«, antwortete der Syrer. »Wir bitten Gott, ihn zu beurteilen, und wir dürfen auf das Ergebnis vertrauen.«
»Wir können nur für ihn stimmen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.«
»Doch, die Apostolische Konstitution kennt noch eine andere Möglichkeit: die Inspiration. Jedes Konklavemitglied kann den Mann öffentlich proklamieren, der seiner Ansicht nach gewählt werden sollte, im Vertrauen darauf, daß Gott die anderen Kardinäle inspirieren werde, ihn anzuerkennen, wenn der Kandidat Gott wohlgefällig ist. Das ist ein gültiges Wahlverfahren.«
»Dazu gehört Mut — und ein starker Glaube.«
»Wenn uns Kirchenfürsten der starke Glaube fehlt, welche Hoffnung besteht dann für das Volk?«
»Ich nehme den Tadel an«, sagte der Dekan des Heiligen Kollegiums. »Es wird Zeit, daß ich mit der Stimmenwerbung aufhöre und zu beten beginne.«
Früh am folgenden Morgen versammelten sich die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle zum ersten Wahlgang. Für jeden stand dort ein Thron mit seidenem Baldachin. Die Thronsessel reihten sich an den Wänden der Kapelle, und vor jedem befand sich ein Tischchen mit dem Wappen und dem lateinisch geschriebenen Namen des Kardinals. Das Altartuch war mit einer Darstellung der ersten Apostel bestickt, die den Heiligen Geist empfingen. Vor dem Altar stand ein großer Tisch mit goldenem Kelch und kleiner Goldschale, neben dem Tisch ein schlichter dickbäuchiger Ofen, dessen Rohr durch ein kleines Fenster auf den Petersplatz hinausragte.
Bei der Abstimmung pflegte jeder Kardinal den Namen seines Kandidaten auf ein Formular zu schreiben, das er erst auf die goldene Schale und dann in den Kelch legte, um die Vollziehung einer heiligen Handlung kundzutun. Nach der Stimmenzählung wurden die Stimmzettel in dem Ofen verbrannt, so daß Rauch durch das Rohr zum Petersplatz hinausdrang. Zwei Drittel und eine der abgegebenen Stimmen waren erforderlich, um einen Papst zu wählen.
Wenn die erforderliche Mehrheit nicht bestand, wurden die Stimmzettel zusammen mit feuchtem Stroh verbrannt, so daß dunkler, qualmiger Rauch aufstieg. Nach erfolgreicher Wahl verbrannte man die Stimmzettel ohne das Stroh; die wartende Menge ersah dann aus dem weißen Rauch, daß sie einen neuen Papst hatte. Es war eine altertümliche und umständliche Zeremonie im Zeitalter des Rundfunks und des Fernsehens; doch sie diente dazu, den dramatischen Augenblick ebenso zu betonen wie die Kontinuität der zweitausendjährigen Geschichte des Papsttums.
Als alle Kardinäle Platz genommen hatten, machte der Zeremonienmeister die Runde und händigte jedem einen Stimmzettel aus. Hierauf verließ er die Kapelle, und die Tür wurde abgeschlossen; die Kirchenfürsten blieben allein zurück, den Nachfolger Petri zu wählen.
Das war der Augenblick, auf den Leone und Rinaldi gewartet hatten. Leone erhob sich, warf die weiße Mähne zurück und sprach zum Konklave:
»Meine Brüder, ich berufe mich auf ein Recht nach der Apostolischen Konstitution. Ich verkünde meine Überzeugung, daß unter uns ein Mann ist, den Gott bereits auserwählt hat für den Stuhl Petri. Wie der erste Apostel hat er um des Glaubens willen Gefängnis und Schläge erlitten; Gottes Hand führte ihn aus der Knechtschaft zu uns, auf daß er am Konklave teilnehme. Ich verkünde ihn als meinen Kandidaten und leihe ihm meine Stimme und meinen Gehorsam — Kyrill Kardinal Lakota.«
Es herrschte Totenstille, nur unterbrochen von einem schweren Atemzug aus Lakotas Mund.
Dann stand der Syrer Rahamani auf und sagte fest: »Auch ich verkünde ihn.«
Zu zweit und zu dritt erhoben sich alte Männer mit derselben Erklärung, bis alle außer neun Kardinälen unter den Baldachinen standen, während Kyrill Kardinal Lakota mit blassem Gesicht starr auf seinem Thron saß.
»Ich auch«, sagte Carlin, der Amerikaner.
»Und ich«, fiel Valerio Rinaldi ein.
Rinaldi trat vor und richtete das Wort an die Wähler: »Bestreitet jemand, daß diese Wahl gültig ist und daß eine Mehrheit von über zwei Dritteln unseren Bruder Kyrill gewählt hat?« — Niemand antwortete. »Bitte setzen Sie sich«, sagte Valerio Rinaldi. Nachdem sich die Kardinäle gesetzt hatten, zog jeder an einer Kordel, so daß der Baldachin über seinem Kopf zurückklappte; nur über dem Sessel des Gewählten blieb der Baldachin. Der Kämmerer läutete eine kleine Glocke und schritt zur Kapellentür, die er aufschloß. Sogleich traten der Sekretär des Konklaves, der Zeremonienmeister und der Sakristan des Vatikans ein. Diese drei Prälaten traten zusammen mit Leone und Rinaldi feierlich zum Thron des Ukrainers.
Mit lauter Stimme fragte ihn Leone: »Acceptasne electionem—? Nehmen Sie die Wahl an?«
Aller Augen ruhten auf dem großen, hageren Fremden mit dem vernarbten Gesicht und den entrückten schmerzerfüllten Augen. Die Sekunden verstrichen langsam, dann hörten sie ihn tonlos antworten: »Accepto —. Miserere mei Deus —! Ich nehme an —. Erbarme dich meiner, Gott!«
AUSZUGAUSDEMGEHEIMEN TAGEBUCHVON KYRILLI., PONT. MAX.
Kein Herrscher entgeht dem Urteil der Geschichte, aber ein Herrscher, der ein Tagebuch führt, setzt sich der Gefahr aus, von den Sachverständigen hart behandelt zu werden. Ich wäre ungern wie Pius II., dessen Erinnerungen seinem Sekretär zugeschrieben und von seinen Verwandten bearbeitet wurden, worauf zwei amerikanische Blaustrümpfe fünfhundert Jahre später alle seine Indiskretionen wieder einfügten. Doch ich kann sein Dilemma nachfühlen, das wohl jeder, der auf dem Stuhl Petri sitzt, durchmachen muß. Ein Papst kann nie völlig offen reden außer mit Gott oder mit sich selbst — und ein Papst, der Selbstgespräche führt, kann leicht überspannt wirken, wie die Geschichte einiger meiner Vorgänger gezeigt hat.
Meine Schwäche besteht darin, mich vor Einsamkeit und Abgeschiedenheit zu fürchten. So werde ich Sicherheitsventile benötigen — zunächst einmal das Tagebuch, das ein Kompromiß ist zwischen Selbstbeschwichtigung auf dem Papier und der Übermittlung von Tatsachen an die Nachwelt, die der eigenen Generation vorenthalten werden müssen. Natürlich hat das seine Schwierigkeit. Was tut man mit einem päpstlichen Tagebuch? Der Vatikanischen Bibliothek überlassen? Oder es im dreifachen Sarg mit dem eigenen Leichnam begraben? Besser vielleicht, es überhaupt nicht zu beginnen; wie sonst aber läßt sich in diesem noblen Gefängnis, zu dem ich verurteilt bin, ein wenig Heimlichkeit und Humor verbürgen?
Vor vierundzwanzig Stunden wäre mir der Gedanke an meine Wahl als Ausgeburt ungezügelter Phantasie erschienen. Auch jetzt kann ich nicht verstehen, warum ich sie angenommen habe. Ich hätte ablehnen können. Das tat ich nicht. Warum —?
Wenn ich denke, was ich bin: Kyrill I., Bischof von Rom, Statthalter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, oberster Pontifex der Universalkirche, Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Metropolit der römischen Kirchenprovinz, Souverän des Staates der Vatikanstadt — natürlich glorreich regierend —!
Doch das ist erst der Anfang. Das Pontifikaljahrbuch wird eine zwei Seiten lange Liste der mir unterstehenden Abteien und Präfekturen veröffentlichen, auch der Orden, Kongregationen, Mönchs- und Nonnenklöster, die ich zu »beschützen« habe. Die übrigen zweitausend Seiten werden ein wahres Grundbuch sein, das meine Diener und Untertanen, meine Instrumente der Regierung, Erziehung und Verbesserung aufführt.
Mein Amt bringt es mit sich, daß ich mehrsprachig sein muß, obwohl sich der Heilige Geist mir gegenüber bei der Verleihung der Sprachbegabung weniger großzügig erwiesen hat als dem ersten Mann, der an meinem Platz stand. Meine Muttersprache ist Russisch, meine Amtssprache das Latein der Gelehrten, sozusagen ein Mandarin-Idiom, das die sublimste Definition der Wahrheit auf wundersame Weise wie ein Insekt im Bernstein bewahren soll. Mit meinen Amtsbrüdern muß ich Italienisch sprechen und allen gegenüber das hochtrabende »Wir« anwenden, das geheime Zwiesprache zwischen Gott und mir andeutet, auch wenn es sich um so weltliche Dinge handelt wie der Kaffee, den »Wir« zum Frühstück trinken, und die Benzinmarke, die »Wir« für die Autos der Vatikanstadt benutzen werden.
Das aber ist überlieferte Sitte, und ich darf mich nicht zu sehr dagegen auflehnen. Valerio Rinaldi gab mir einen guten Rat, als er mir heute vormittag eine Stunde nach der Wahl seine Treue entbot und gleichzeitig seinen Rücktritt verkündete. »Eure Heiligkeit sollten nicht versuchen, die Römer zu ändern, sich ihnen entgegenzustellen oder sie zu bekehren. In den letzten neunzehnhundert Jahren sind sie stets mit Päpsten fertig geworden, und sie werden eher Eurer Heiligkeit den Hals brechen, als daß es Eurer Heiligkeit gelänge, sie zu beugen. Doch mit sanftem Auftreten, freundlichen Worten und Zurückhaltung der eigenen Meinung werden Eure Heiligkeit sie zum Schluß wie Grashalme um den Finger wickeln können.«
Es ist wahrlich noch zu früh, vorauszusehen, ob sich die Beziehung zwischen Rom und mir erfolgreich gestalten wird; aber Rom ist nicht mehr die Welt, und so mache ich mir keine allzu großen Sorgen — zumal ich mir die Erfahrung jener, die mir als Kardinalfürsten der Kirche den Eid geleistet haben, zunutze machen kann. Zu einigen habe ich starkes Vertrauen. Andere sind da … Aber ich darf nicht vorschnell urteilen. Nicht alle können wie Rinaldi sein, der weise und gütig ist, Sinn für Humor hat und seine eigenen Grenzen kennt. Vorläufig muß ich nach Möglichkeit Lächeln und gute Laune bewahren, während ich mir den Weg durch den Irrgarten des Vatikans ertaste. Und ich muß meine Gedanken einem Tagebuch anvertrauen, ehe ich sie vor der Kurie oder dem Konsistorium äußere …
Einen Vorteil habe ich freilich insofern, als niemand weiß, welche Richtung ich einschlagen werde — ich weiß es nicht einmal selbst. Ich bin der erste Slawe auf dem Stuhl Petri, der erste Nichtitaliener seit viereinhalb Jahrhunderten. Die Kurie wird vor mir auf der Hut sein. Vielleicht wurden sie inspiriert, mich zu wählen; aber fragen sie sich nicht schon, was für einen Tataren sie sich da eingefangen haben? Schon werden sie erwägen, wie ich ihre Ernennungen und Einflußgebiete neu mischen werde. Wie können sie wissen, wie sehr ich bange und an mir selbst zweifle? Hoffentlich denken einige daran, für mich zu beten.