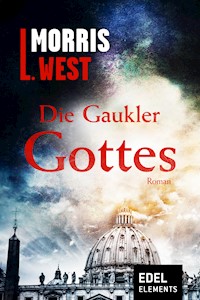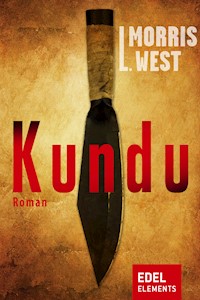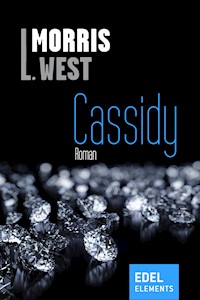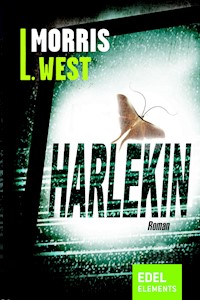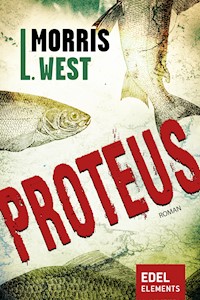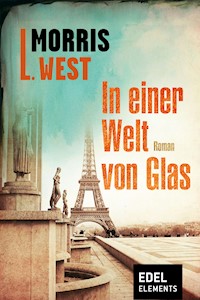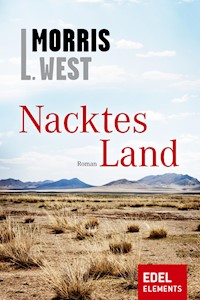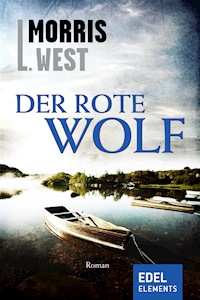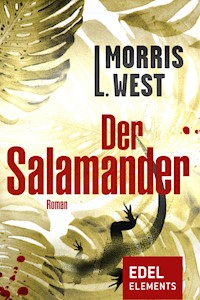Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein hochgradig spannender Thriller über die gefährlichste Region der Welt – von einem der erfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten! Das Pulverfass Naher Osten scheint kurz vor der Explosion zu stehen. Jakov Baratz, Chef des israelischen Geheimdienstes, fragt sich, ob sein Land nach 41 Sabotageakten in zwölf Monaten noch weitere Provokationen hinnehmen kann. Der Traum seines gefährlichen Gegners Safreddin, der den syrischen Geheimdienst leitet, ist es, die Juden ins Meer zu jagen und die arabischen Staaten unter einem neuen Islam zu vereinigen. Diesen Plan zu vereiteln ist wiederum das Ziel von Adam Ronen, der in Damaskus — als Händler Selim Fathalla getarnt – für Baratz ein breites Spionagenetz ausgeworfen hat. Beide Seiten riskieren mit höchstem Einsatz ein grausames Spiel aus Aktionen, Gegenaktionen und Intrigen, die alle auf den Tag X zielen – an dem jeder seine todbringenden Pläne realisieren will...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Morris L. West
Der Turm von Babel
Roman
Ins Deutsche übertragen von Erika Nosbüsch
Edel eBooks
Zum Buch
Einundvierzig Sabotageakte in zwölf Monaten: Kann Israel es weiterhin mit seinem Selbstgefühl vereinbaren, oder sollte es zum Gegenschlag ausholen? Nicht nur dieses Problem lastet schwer auf Jakov Baratz, dem Chef des israelischen Geheimdienstes. Wird es seinem Agenten Adom Ronen, der in Damaskus unter einem Tarnnamen ein weitverzweigtes Spionagenetz aufgebaut hat, gelingen, seinen gefährlichsten Gegner, den syrischen Geheimdienstchef Safreddin, zu täuschen? Safreddins ehrgeiziger Traum ist es, die Juden ins Meer zu jagen und unter einem neuen lebendigen Islam die arabischen Staaten zu vereinigen.
Und sie sprachen, wohlauf, laßt uns… einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche…Da fuhr der Herr hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen…Wohlauf lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß keiner des anderen Sprache verstehe…Daher heißt ihr Name Babel, daß der Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder Sprache…
Genesis 11/12
Inhalt
Erstes Kapitel
Sha’ar Hagolan
Tel Aviv
Damaskus
Alexandria
Beirut
Auf See
Zweites Kapitel
Jerusalem
Damaskus
Beirut
Zürich
Jerusalem
Drittes Kapitel
Beirut
Jerusalem
Damaskus
Zürich
Damaskus
Viertes Kapitel
Tel Aviv
Damaskus
Beirut
Damaskus
Tel Aviv
Fünftes Kapitel
Damaskus
Beirut
Tel Aviv
Damaskus
Damaskus
Sechstes Kapitel
Tel Aviv
Rumtha
Damaskus
Amman
Damaskus
Amman
Damaskus
Siebtes Kapitel
Tel Aviv – Jerusalem
Damaskus
Beirut
Jerusalem – Jordanien
Jerusalem – Israel
Achtes Kapitel
Jerusalem-Jordanien
Beirut
Damaskus
Neuntes Kapitel
Jerusalem – Jordanien
Beirut
Jerusalem – Israel
Damaskus
Jerusalem – Jordanien
Zehntes Kapitel
Beirut
Hebron – Jordanien
Damaskus
Jerusalem – Israel
Elftes Kapitel
Beirut
Hebron – Jordanien
Damaskus
Beirut
Zwölftes Kapitel
Damaskus
Hebron
Jerusalem – Israel
Dreizehntes Kapitel
Tel Aviv
Libanon
Jerusalem – Israel
Masada – Januar 1967
Impressum
Erstes Kapitel
Sha’ar Hagolan
Der Beobachter auf der Hügelkuppe lehnte sich gegen den knorrigen Stamm eines Olivenbaums, prüfte sein Funkgerät, öffnete die Kartenmappe auf seinen Knien, stellte das Fernglas ein und begann mit einer langsamen, peinlich genauen Betrachtung des Geländes vom südlichen Zipfel des Sees Genezareth bis zu den Ausläufern des Sha’ar Hagolan, wo der Yarmuk nach Südwesten biegt und in den Jordan mündet. Es war elf Uhr vormittags. Der Himmel war klar, die Luft nach den ersten herbstlichen Regengüssen frisch und rein.
Er betrachtete zuerst die östliche Hügelkette, die von Norden nach Süden die Grenze zwischen Syrien und der entmilitarisierten Zone von Israel bildet. Die Berge erhoben sich kahl und braun. Es waren keine Hirten zu sehen. Keine Schafe, keine Ziegen. Das Dorf, das wie ein Haufen weißer Steinklötze an der Bergflanke lag, war ausgestorben. Er verharrte lange bei den Ruinen unterhalb des Dorfes, weil die Syrer dort gelegentlich Soldaten postierten, die das Tal beim geringsten Anlaß mit Maschinengewehrfeuer bestrichen. Heute waren auch die Ruinen leer. Daneben lagen die Schützengräben – eine langgezogene Zickzacklinie von Narben im südlichen Abhang, die die Australier im Krieg von 1918 gegraben hatten. Die Gräben lagen auf israelischem Gebiet, aber manchmal benutzten Plünderer sie als Ausgangsstellung für die nächtlichen Raubzüge gegen den Kibbuz. Eine kleine Herde Damwild äste friedlich zwischen den oberen und unteren Schützengräben. Er beobachtete sie längere Zeit; es waren sehr scheue Tiere, die eine Bewegung oder ein Laut sofort verschreckte. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit den Weingärten am Südende des Tals zu. Die Rebstöcke standen braun und dürr in der späten Herbstsonne. Sie boten keinen Schutz für Mensch und Tier.
Nördlich von den Weingärten lagen die beiden langgestreckten Äcker, die durch einen schmalen Streifen Grasland voneinander getrennt waren. Der bräunliche Grasstreifen konnte nicht gepflügt werden, weil die Kartographen und Zeichner der Waffenstillstandskommission ihn aus irgendeinem idiotischen Grund nicht als bebaubares Land bezeichnet hatten. Es hieß daher, sich dem Feuer der unsichtbaren Schützen auf der syrischen Seite aussetzen, wollte man auf dem Grasstreifen graben oder gar ihn überqueren. Yigael arbeitete gerade auf dem ersten Acker; er fuhr einen neuen Traktor, und die Egge wirbelte eine hohe graue Staubwolke in die Luft. Yigael war sein Bruder, und mittags würde er die Wache übernehmen, während ein anderer Mann den Traktor fuhr. Weiter nördlich lagen die Bananenplantagen, die sich grün und üppig fast bis ans Ufer des Sees erstreckten. Nachts waren sie ein gefährliches Gebiet, weil sie guten Schutz boten, aber tagsüber waren die Hügel dahinter auch den verwegensten Guerillas zu nackt und ungeschützt. Es sah ganz so aus, als würde es wieder einmal ein ruhiger Tag im Tal von Sha’ar Hagolan. Er trank einen großen Schluck aus der Wasserflasche, schaltete dann das Funkgerät ein und gab einen Bericht an den Militärposten gleich hinter der entmilitarisierten Zone.
Der Traktor überquerte das Feld, drehte um, fuhr bis zum anderen Ende und drehte wieder um. Das Tal widerhallte vom Dröhnen des Motors, und die Staubwolke flimmerte wie Bodennebel in der Sonne. Die letzte Furche brachte den Traktor nahe an den Grasstreifen. Beim Wenden kippte er seitlich in einen Graben, und einen Augenblick lang sah es aus, als würde er umfallen. Aber Yigael war ein guter Traktorfahrer. Er gab Gas, riß das Steuer herum und richtete den Traktor wieder auf, indem er ihn direkt über den Grasstreifen fuhr. Der Beobachter sprang auf und wartete mit angehaltenem Atem auf das MG-Feuer. Es kam keins. Yigael fuhr den Traktor mit Vollgas über den schmalen Streifen zum zweiten Acker. Immer noch keine Schüsse. In fünf Sekunden war er gerettet.
Dann explodierte die Mine; der Benzintank ging hoch, und Yigael wurde wie eine Stoffpuppe mit brennenden Haaren und Kleidern in die Luft geschleudert.
Tel Aviv
In seinem großen kahlen Büro im vierten Stock des Dienstgebäudes saß Brigadegeneral Jakov Baratz, Leiter des militärischen Geheimdienstes, an seinem Schreibtisch und las den Bericht über den Zwischenfall, der gerade hereingekommen war. Er teilte seinem Adjutanten die Koordinaten mit. Der junge Soldat markierte die Stelle auf der Landkarte mit einem kleinen roten Kreuz in einem Kreis und machte dann eine Eintragung in die Liste, die er in der Hand hielt.
»Das ist der vierte Zwischenfall im Revaya-Sha’ar-Hagolan-Gebiet. Zerstörung einer Pipeline, Zerstörung einer Pumpstation. Vernichtung von drei Wohnhäusern und einer Wasserpumpe, und jetzt dies.«
»Vier Zwischenfälle in neun Monaten«, fuhr der Brigadegeneral fort. »Lauter Ärgernisse, die uns zu militärischer Aktion in einer entmilitarisierten Zone provozieren sollen.«
»Was machen wir jetzt?«
»Wir? Nichts.« Aus Baratz’ Stimme klang bittere Ironie. »Kaplan in Tiberias hat der UNO-Waffenstillstandskommission bereits telefonisch und schriftlich Bericht erstattet. Morgen wird das Memorandum bestätigt werden, und die Waffenstillstandskommission wird eine formelle Untersuchung anordnen. In vier bis sechs Wochen wird die Kommission einen formellen Bericht vorlegen. Darin wird festgestellt werden, daß eine oder mehrere unbekannte Personen auf einem Stück Land im Sha’ar-Hagolan-Gebiet, das die Bezeichnung ›Grüner Finger‹ trägt, eine Mine unbekannter Herkunft legten. Man wird ferner feststellen, daß ein israelischer Traktor auf das obenerwähnte Stück Land fuhr und explodierte. Schlußfolgerung: Eine oder mehrere unbekannte Personen haben sich durch Minenlegen in einer entmilitarisierten Zone eines illegalen Aktes schuldig gemacht; ein Israeli, der bedauerlicherweise dabei den Tod fand, beging einen illegalen Akt, indem er mit einem Traktor auf das obenerwähnte Stück Land vordrang. Erforderliche Aktion: keine.«
»Aber wir tragen mal wieder die ganze Schuld, wie üblich.«
»Wie üblich«, sagte Baratz sarkastisch. »Aber streng juristisch gesehen – und die Waffenstillstandskommission ist eine Organisation, die sich strikt an die Gesetze hält –, sind wir die einzigen, die identifiziert werden können. Wir haben einen toten Mann auf der Türschwelle liegen.« Er machte eine Pause und fügte dann ruhig hinzu: »Die Liste wird immer länger. Von August letzten Jahres bis Oktober dieses Jahres hatten wir siebenundvierzig Sabotageversuche. Wir haben aber auch eine neue Regelung in Jerusalem. Sehr bald wird jemand anfangen, nach Vergeltung zu schreien. Ich kann nicht sagen, daß ich es ihm übelnehmen würde. Aber jetzt nicht, noch nicht.«
»Wann?«
Baratz hatte Mitleid mit ihm. Er war sehr jung, sehr ungeduldig und immer noch ein Neuling im kalten Geschäft des militärischen Geheimdienstes und der politischen Manöver.
»Wann? Das entscheiden nicht wir. Das entscheidet der Premierminister in Jerusalem mit dem Kabinett und den Stabschefs. Wir liefern Informationen, Beurteilungen, Ansichten über mögliche Konsequenzen. Und wir hoffen zu Gott, daß wir wenigstens zur Hälfte recht haben. Aber wenn Sie mich fragen, was uns zu Gegenmaßnahmen zwingen könnte, dann würde ich sagen: alles, was zum Beispiel hier passiert…« Sein knochiger Finger zeigte auf den breiten Landkeil zwischen der südlichen Grenze Libanons und der östlichen Grenze Syriens. Er war dicht mit Kreuzen und Kreisen bedeckt, die von Metulla aus nach Süden den Jordan entlangliefen. »… oder hier, in der Ebene von Sharon, oder in der Shefelah oder am Toten Meer zwischen Ein Gedi und Arad. Es ist das Ganze, an das wir denken müssen, immer – das Ganze!«
»Heute morgen wurde ein Mann getötet, ein friedlicher Bauer. Ist er nicht auch ein Teil des Ganzen?«
»Wir haben sechs Millionen Menschen in Vernichtungslagern verloren. Israel ist auf ihrer Asche erbaut. Vergessen Sie das nicht.« Dann fragte er etwas freundlicher: »Haben wir Nachricht von Fathalla?«
»Noch nicht. Seit einer Woche ist kein Funkspruch von ihm gekommen, und wir konnten ihn auch nicht erreichen.«
»Ich weiß«, sagte Baratz bedrückt. »Ich mache mir Sorgen um ihn. Geben Sie mir Bescheid, sobald Sie mit ihm Kontakt haben. Das ist alles.«
Der junge Mann salutierte, ging hinaus und schloß die Tür hinter sich. Baratz betrachtete die Landkarte mit den roten Flecken, die wie Blutspritzer aussahen, und den geheimnisvollen militärischen Zeichen, die die Geschichte des täglichen Kampfes ums Überleben erzählten.
Die Landkarte war ihm vertraut wie seine eigene Haut, und er reagierte sofort auf jedes Jucken und Brennen, das sie befiel. In seinen unruhigen Träumen war diese Karte manchmal wirklich eine Haut, eine lebendige menschliche Haut, straff gespannt über das schmale Stück Land zwischen Ägypten und Jordanien, Syrien, Libanon und dem Meer. Auf dieser Haut bildeten sich plötzlich Schwellungen und Beulen, aus denen Legionen von Soldaten-Ameisen brachen, die die Haut bald völlig bedeckten und sich durch sie hindurchfraßen bis auf den Grund. Dann waren die Ameisen verschwunden, der Boden blieb mit Knochen bedeckt zurück, und darüber tönte die Stimme des alten Propheten:
Und des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geiste des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich allenthalben da durch, und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld und siehe, es war sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du auch, daß diese Gebeine wieder lebendig werden…
Dann wurde es still in seinem Traum, und er wartete auf die Verheißung, die dem Klagelied folgte. Aber zu der Verheißung kam es nie, und er erwachte schweißgebadet und erschrocken, denn er wußte: wenn die Ameisen über das Land herfielen, würde es nie mehr eine Wiederauferstehung geben, und das Haus Israel wäre für immer ausgelöscht.
Laut und schrill läutete das Telefon. Er ging hastig zum Schreibtisch.
»Hier Baratz.«
»Jakov, hier ist Franz Liebermann. Ich war gerade bei Hannah.«
Eine kalte Hand krampfte sich um sein Herz. Er spürte, wie er zitterte. Er packte einen Bleistift, um das Zittern zu unterdrücken, und der Bleistift brach in seiner Hand entzwei.
»Wie geht es ihr? Was meinst du, Franz?«
»Ich glaube, du solltest sie eine Weile bei uns lassen, Jakov.«
»Wie lange?«
»Einen Monat. Vielleicht auch zwei oder drei. Sie ist diesmal auf einer langen Reise. Wir werden versuchen, ihr zu folgen und sie zurückzubringen, wenn sie bereit ist zu kommen.«
»Kannst du nichts machen?«
»O doch! Es gibt natürlich Möglichkeiten, sie zu behandeln, aber garantieren läßt sich nichts. Das weißt du.«
»Ich weiß es. Sei gut zu ihr, Franz.«
»Wie zu meiner eigenen Frau«, sagte Franz Liebermann.
»Wann kann ich sie besuchen?«
»Ich werde dich anrufen. Hab Vertrauen zu mir, Jakov.«
»Ja, wem sonst sollte ich vertrauen.«
Er legte den Hörer auf und starrte lange auf seine Handflächen, als könnte er aus ihnen die Zukunft seiner Frau, seine eigene und die Zukunft all derer lesen, für die er in einer zwielichtigen Welt einsam Wache hielt. Aber das Weissagen aus den Handlinien war eine magische Kunst, und an Magie glaubte er genausowenig wie an den Gott seiner Väter, der gelassen in seinem Himmel sitzen konnte, während sechs Millionen seiner Auserwählten auf entsetzliche Weise den Tod fanden. Es war die Ironie seiner Situation, daß in ihm, einem Treuhänder der Kontinuität Israels, diese Kontinuität bereits gebrochen war. Die Hände, die vor ihm auf dem Tisch lagen, waren für kein Priesteramt gesalbt. Keine Prophezeiungen waren in ihre lederartigen Innenflächen geschrieben. Sie erflehten keinen Segen von einem schweigenden Himmel. Es waren Handwerkerhände, die Holz und Metall bearbeiten konnten. Es waren Soldatenhände, die ein Gewehr zerlegen und schneller wieder zusammenzusetzen vermochten als die meisten anderen. Es waren Liebhaberhände, die Hannah einst zu triumphierender Ekstase erweckt hatten, aber jetzt nicht die Kraft hatten, sie vor der quälenden Rückkehr in die Vergangenheit zu bewahren. Einen Augenblick lang überkam ihn tiefe Verzweiflung, doch dann kehrte langsam die Disziplin zurück, die er ein Leben lang geübt hatte, und er begann wieder klar zu denken.
Fathalla war seine größte Sorge: Selim Fathalla, dessen arabischer Name Geschenk Gottes bedeutete, der in Damaskus ein Import-Export-Geschäft betrieb, mit Syrern in hohen Stellungen befreundet war, und der täglich sein Leben riskierte, weil er in Wirklichkeit Adom Ronen hieß und ein israelischer Spion war. Jede Woche schickte er auf dem einen oder anderen Weg einen Bericht aus erster Hand. Die Wege waren sehr unterschiedlich. Jeden Tag nahm Fathalla zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Wellenlängen per Funk Kontakt mit Tel Aviv auf. Manchmal brachte ein israelischer Pilot von Zypern einen verschlüsselten Brief mit. Ein anderes Mal überraschte der Fahrer eines Konsulats, der täglich durch das Mandelbaumtor fuhr, seine Freundin in Jerusalem mit einem Geschenk aus Jordanien. Gelegentlich kam der Bericht aus Rom oder Athen, denn Fathalla war ein erfinderischer Mann mit Sinn für Humor, und seine ganze Sorge galt der Sicherheit seines Netzwerks. Seit zehn Tagen hatten sie nichts mehr von ihm gehört, und Baratz machte sich Sorgen.
Damaskus
Er konnte sich nicht erinnern, wie lange er krank gewesen war. Die Zeit war eine unberechenbare Dimension geworden, die ihn eine Weile festhielt, ehe er wieder zurückglitt in die ruhelose Ewigkeit von Fieber, namenloser Angst und verworrenen Träumen. Die Zeit war das Sonnenlicht, das durch das geschnitzte Gitterwerk der Läden fiel, der Umriß der Tamariske draußen vor dem offenen Feuer und das Minarett der Moschee dahinter. Die Zeit war ein weißer Mond am blutroten Himmel. Die Zeit war das Gesicht einer Frau und die Berührung ihrer Hand und der Duft von Rosenwasser. Aber die Symbole waren ungenau. Wenn er versuchte, die Bilder festzuhalten, verschwammen sie vor seinen Augen und gerieten in Unordnung. Bis jetzt – bis zu diesem Augenblick, da er angstvoll, aber ruhig dalag und spürte, wie die Welt um ihn sich festigte.
Als erstes wurde ihm sein Körper bewußt. Er war kühl und trocken. Er spürte keine Schmerzen, nur eine eher angenehme Schwäche. Die Bettdecke fühlte sich frisch an. Das Kopfkissen war weich. Als er die Augen öffnete, sah er zuerst die große gepunzte Kupferlampe, die in der weißen Wölbung der Decke hing. Jedes Ornament, jede Figur war ihm aus hundert Nächten vertraut, in denen er wach gelegen und nachgedacht hatte. Es war also ausgeschlossen, daß er sich täuschte. Wenn die Lampe da war, war er auch da.
Direkt dem Bett gegenüber lag die Fensternische mit den Seidenvorhängen, in der ein Diwan und ein mit Perlmutt eingelegtes Taburett standen. Die Läden waren heruntergelassen, und das hölzerne Schnitzwerk hob sich dunkel vom blauen Himmel ab. Links von der Fensternische hing in der Mitte der weißen Wand die große blaue Fayenceplatte, die er aus Isfahan mitgebracht hatte. Alles war da, war bekannt und beruhigend, die Buchara-Teppiche, die glänzenden Kacheln, die auf Elfenbein gemalten Miniaturen, der Krummsäbel in der goldenen Scheide, den er bei Ali, dem Schwertmacher, gekauft hatte. Dann hörte er schwach, aber deutlich den Ruf des Bonbonverkäufers und danach das jammernde Wehklagen des Muezzins, das die Lautsprecher auf dem Minarett verzerrten. Plötzlich war Selim Fathalla kindlich glücklich, denn er lebte und lag in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Haus in Damaskus.
Es war seltsam, wie sehr er an der Persönlichkeit hing, die er darstellte, wie er sich an ihr erfreute, wie fleißig er darum bemüht war, sie zu stärken. Sie war keine Maske, alles stimmte an ihr, sie war ein in sich abgeschlossenes Ich, ohne das er sich verloren und einsam gefühlt hätte wie ein Bruder, der seines Zwillings beraubt ist. Das andere Ich – mit Namen Adom Ronen – war ebenso abgeschlossen in sich selbst. Sogar ihr Zwillingsverhältnis war vollkommen, und wenn die Interessen des einen die Ruhe oder die Sicherheit des anderen bedrohten, kam es zwischen ihnen zu brüderlichem Streit. Ihre Auseinandersetzung war ein Spiegelgespräch, bei dem immer die Angst zugegen war, daß der Spiegelmann eines Tages verschwinden könnte oder daß der Mann vor dem Spiegel weggehen und sein Ebenbild für immer in die Glasplatte gebannt zurücklassen könnte. Und beide hatten sie das gleiche Problem: Mit jedem Monat wurde es schwieriger festzustellen, wer das Ebenbild war und wer der Mann.
In dieser schäbigen, unlauteren Stadt war nur Selim Fathalla wirklich: Selim Fathalla, der Verschwörer aus Bagdad, der in Damaskus auftauchte, als die Baath-Partei im Irak unterdrückt wurde, und bei seinen syrischen Kameraden um Asyl bat. Er trug Briefe bei sich von Parteiführern, die sich, wie man wußte, versteckt hielten, und von alten Freunden an der amerikanischen Universität von Beirut. Er brachte auch Geld mit – ein großes Guthaben bei der Phönizischen Bank. Er besaß einige Kenntnisse des Import-Export-Geschäftes, die er sich auf der Rashid Street im alten Bagdad erworben hatte. Wegen der Briefe und des Geldes wurde er, wenn nicht mit Wärme, so doch wenigstens ohne allzu großes Mißtrauen aufgenommen. Da er liebenswürdig und großzügig war, schuf er sich schnell Freunde. Da er ein wagemutiger Kaufmann und obendrein ein linientreuer Baathist war, erwies er sich bald als nützlich für die Regierung, die die Industrie enteignet, die Landwirtschaft sozialisiert und den Kaufmannsstand abgeschafft hatte, und die nun vor dem Problem stand, ihre nationalen Produkte auf dem freien Markt zu verkaufen.
Selim Fathalla trug seinen Erfolg nicht auffällig zur Schau. Er wußte, daß man als Gast bescheiden sein mußte, wollte man nicht den Neid des Gastgebers erwecken. Deshalb kaufte er sich im alten Teil von Damaskus in der Nähe des Bazars ein Haus, hinter dessen schmucklosen Wänden er in unauffälligem Luxus lebte und Freunde aus der Partei und der Armee und Diplomaten aus Moskau, Prag und Sofia zu Gast hatte. Letztere schätzten ihn als gutunterrichteten Bekannten und kundigen Führer durch die Hintertreppenpolitik der arabischen Welt. Er war ein guter Moslem – wenn auch nicht übertrieben fromm. Aber man sah ihn oft genug in der Moschee, und er hatte genügend Freunde im Ulema, die an seiner Strenggläubigkeit keine Zweifel aufkommen ließen.
Er verliebte sich in seine Sekretärin und machte sie zu seiner Geliebten. Heiraten würde er sie allerdings nicht, da sie halb Französin war und außerdem Christin. Eine Ehe mit ihr hätte bei allen Anstoß erregt, die seinen guten Geschmack bei Frauen lobten. Er liebte den Handel und machte gern Geschäfte – welcher Iraker tat das nicht? –, aber er war nicht so habgierig, daß er sich Feinde machte, und nicht so dumm, die Regierung zu betrügen. So kam es, daß schließlich sogar der gefürchtete Safreddin, der Leiter des syrischen Geheimdienstes und Chefpräsident des Militärgerichtshofes, Vertrauen zu ihm hatte.
Adom Ronen, der Spiegel-Zwilling, befand sich in einer gänzlich anderen Lage. Er war weder froh noch zufrieden und fand es gelegentlich schwer, sich selbst zu respektieren.
Er war ein Gefangener in diesem weißgekalkten Zimmer. Eigentlich war er auf einen weit kleineren Raum beschränkt, auf eine winzige Kammer, kaum größer als ein Kleiderschrank, die hinter der Fayenceplatte versteckt lag: Hier schrieb er seine Berichte, fotografierte Dokumente und bewahrte die belastenden Geräte auf, mit denen er arbeitete. Von hier aus betrachtete er spöttisch die wilden Paarungen des Selim Fathalla und dachte an seine Frau und sein Kind in Jerusalem. Hier erlebte er jeden Tag die Tragödie der Spaltung: ja, er war gespalten und geteilt, und der eine Teil war des anderen Feind.
Adom Ronen war ein Gettojude aus Bagdad, der den Exodus seiner Landsleute organisiert hatte, selbst jedoch nie dazugekommen war, weil er nie ganz sicher war, wie weit er ihn wünschte. Er war ein Zionist, der das Haus Israel zu langweilig fand, um darin zu leben, sich aber dem Wagnis verpflichtete, es zu beschützen. Er war ein Abenteurer, geschlagen mit missionarischer Inbrunst, ein Zyniker, den Schuldgefühle plagten wie verborgener Aussatz.
Er war es, der Selim Fathalla erschaffen hatte und mit der amoralischen Gelassenheit beschenkte, die ihm half, alles zu ertragen. Er war es, der insgeheim Pläne entwarf und Ränke schmiedete, während Fathalla seine syrische Geliebte streichelte oder mit Safreddin im Namen Allahs Geschäfte besiegelte. Und trotz allem liebte er Fathalla, und Fathalla liebte ihn. Aus Gründen der Vernunft und des schlichten Überlebens waren sie aufeinander angewiesen. Wenn Adom Ronen die Belastung unerträglich fand, verführte Fathalla ihn zu satirischem Zeitvertreib. Wenn Fathalla ruhig schlafen konnte, dann nur, weil Adom Ronen über seine Gedanken und seine unbedachte Zunge wachte. Aber Selim Fathalla war in Damaskus an Malaria erkrankt und hatte acht Tage im Delirium gelegen, so daß keiner von ihnen wußte, was er gesagt hatte und wer es gehört haben könnte.
Er schob die Bettdecke zur Seite und setzte sich auf. Er fühlte sich benommen, aber kräftiger, als er erwartet hatte. Er stand auf und lehnte sich an die Wand. Als er sicher war, daß er nicht das Gleichgewicht verlieren würde, ging er langsam zum Fenster, öffnete die Läden, setzte sich auf den Diwan und blickte in den Garten hinaus.
Die Blätter der Tamariske hingen schlaff in der stillen Mittagsluft. Vor den grauen Mauern blühten die Geranien in Feuerfarben. Der Rosenstrauch vor dem Fenster stand schon zur Hälfte in Blüte. Aus dem Maul des Kreuzfahrerlöwen floß ein dünner Wasserstrahl in das Steinbecken. In der Mitte der kleinen Rasenfläche kniete Hassan der Gärtner wie auf einem Gebetsteppich, zupfte Unkraut aus und schnitt das Gras mit einer Schere. Der Straßenlärm und das Geschrei vom nahe gelegenen Markt drang nur schwach herüber. Der häusliche Friede war zumindest noch unversehrt.
Als er den schwachen Rosenduft einatmete, dachte er an Emilie Ayub und wünschte, sie wäre bei ihm, würde ihn baden und massieren und seinem ausgebrannten Körper die Leidenschaft zurückgeben. Aber sie kam erst, wenn er sie rief, denn das war die Rolle, die er ihr zugewiesen hatte. Sie war die verschwiegene und immer bereite Geliebte, die nur für ihren Mann da war und sein Ansehen unter seinen Moslembrüdern wahrte. Die Rolle schien sie zufriedenzustellen, während sie für ihn alles andere als befriedigend war. Aber er wagte es nicht, ihr eine größere Rolle anzuvertrauen, denn es war besser, die geistige Einsamkeit zu ertragen, als das Geheimnis der Zwillinge mit jemandem zu teilen und damit den Hals zu riskieren.
Das Klopfen an der Tür schreckte ihn auf. Er brauchte eine Weile, bis er wieder ruhig war, und dann rief er: »Herein!«
Die schwere Tür öffnete sich knarrend, und die alte Farida ließ Dr. Bitar in das Schlafzimmer. Bitar war ein großer geschmeidiger Mann, der ihn immer an ein Bambusrohr erinnerte, das sich im Wind bog. Sein Gesicht war lang und schmal und weich wie das einer Frau. Seine Hände waren zart und ausdrucksvoll und immer sehr gepflegt. Seine Stimme paßte eigentlich nicht zu seiner Erscheinung; er hatte einen lauttönenden tiefen Baß, der besser zu einem Opernsänger gepaßt hätte als zu einem Arzt. Sein Eintreten hatte etwas Theatralisches. Er schickte die alte Frau mit einer großen Geste aus dem Zimmer und blieb dann mit gespreizten Beinen stehen, um seinen Patienten prüfend zu betrachten.
»So, wir fühlen uns heute besser! Wir haben kein Fieber mehr! Wir glauben, wir seien vollkommen wiederhergestellt!«
Fathalla sah ihn lächelnd an und antwortete: »Ich fühle mich sehr schwach – und ich stinke wie ein Bettler aus dem Bazar.«
»Nehmen Sie ein Bad, mein Freund, Essen Sie nur leichte Sachen und trinken Sie viel. In zwei Tagen sind Sie ein neuer Mensch.« Mit der gleichen dramatischen Berechnung betrat er den Alkoven und ließ sich Fathalla gegenüber nieder. Er ergriff sein Handgelenk, fühlte den Puls und nickte weise. »Gut! Etwas schnell, aber gut. Sie wissen natürlich, daß Sie für immer infiziert sind. Wenn Sie weitere Anfälle vermeiden wollen, müssen Sie ständig Paludrintabletten nehmen. Ich hab’ Ihrem Mädchen das Rezept gegeben. Sie bringt sie Ihnen heute abend mit.«
»Wann kann ich wieder an die Arbeit?«
Bitar zuckte die Schultern. »In ein paar Tagen – es sei denn, Ihre Leber hat was abbekommen, aber das glaube ich nicht.« Dann sagte er etwas gedämpfter: »Sie reden im Schlaf, mein Freund. Das ist gefährlich.«
Fathalla blickte erschrocken auf. »Was habe ich gesagt?«
»Sie nannten Namen – Jakov Baratz und Safreddin und andere, die wir beide kennen, aber lieber nicht hören. Sie sprachen von der Ermordung eines Königs und von einem Mann auf Zypern, der Botschaften schickt, und noch von anderen Sachen.«
»Hat mich sonst noch jemand gehört?«
»Ihre Frau, Emilie Ayub. Sie war während des Fiebers Tag und Nacht bei Ihnen.«
»Wieviel hat sie verstanden?«
»Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gefragt, und sie hat nichts dazu gesagt. Es steht fest, daß sie Sie liebt, vielleicht ist das genug.«
»Habe ich von – anderen Frauen gesprochen?«
»Ich habe nichts gehört. Und sie? Ich hoffe nicht.«
»Ich habe Angst«, sagte Selim Fathalla.
»Gut!« sagte Dr. Bitar. »Wenn es Sie vorsichtig macht – gut!«
»Haben Sie noch andere Neuigkeiten?«
»Nicht direkt. Sechs Zeitungen griffen König Hussein an und nannten ihn ein Werkzeug in den Händen ausländischer Imperialisten. Angesichts dessen, was wir bereits wissen, ist der Zeitpunkt bedeutsam. Außerdem hat Safreddin mich zweimal angerufen und nach Ihrem Gesundheitszustand gefragt. Ich habe ihm gesagt, ich würde ihm sofort Bescheid geben, sobald Sie imstande sind, Besucher zu empfangen.«
»Soll ich ihn anrufen?«
Bitar überlegte einen Augenblick, dann spreizte er in einer Geste, die Gleichgültigkeit ausdrückte, seine weichen Hände. »Wie Sie wollen. Es wäre eine Gefälligkeit, die Ihnen eine kleine Information einbringen könnte.«
»Dann wollen wir es gleich tun«, erwiderte Fathalla.
Er ging leicht schwankend zum Telefon und wählte die Privatnummer des Leiters des Zivilen Geheimdienstes. Ein paar Sekunden später hörte er die bekannte monotone Stimme.
»Hier Safreddin.«
»Hier ist Selim Fathalla.«
»Ja, wie geht es Ihnen!« Safreddin wurde sofort herzlich. »Sie waren sehr krank. Doktor Bitar hat es mir erzählt. Wie fühlen Sie sich?«
»Etwas schwach. Aber das Fieber ist vorbei. Sie müssen in diesem Land wirklich mal was gegen die Malaria unternehmen.«
Es war ein schlechter Scherz, aber offenbar gefiel er Safreddin. Er lachte und antwortete freundlich: »Ich studiere gerade das neue Programm. Ich werde eine Fußnote hinzufügen, daß wir es uns nicht leisten können, gute Freunde wie Sie zu verlieren.«
»Doktor Bitar hat mir befohlen, noch ein paar Tage im Haus zu bleiben. Ich überlege, ob Sie vielleicht vorbeikommen und eine Tasse Kaffee mit mir trinken könnten.«
»Natürlich, ja. Sagen wir morgen vormittag gegen zehn.«
»Ich werde Sie erwarten.«
Dann kam eine lange Pause, und das Krachen in der Leitung klang gedämpft, als hätte sich eine Hand über die Muschel des Telefons gelegt. Schließlich wurde die Hand weggenommen, und Safreddin sprach wieder.
»Da wäre eine Sache, über die ich Sie bitten möchte nachzudenken, mein Freund. Vielleicht können Sie uns helfen.«
»Gern«, sagte Selim Fathalla ungezwungen. »Was kann ich für Sie tun?«
»Wann schicken Sie Ihre nächste Lieferung nach Amman?«
»Da muß ich nachsehen, aber ich glaube, am Mittwoch, dem fünfundzwanzigsten. Weshalb?«
»Wir möchten, daß Sie etwas von uns mitschicken.«
»Und was ist dieses Etwas?«
»Waffen«, sagte Safreddin freundlich. »Gewehre, Handgranaten und Plastiksprengstoff.«
»Oh…!« Fathallas Überraschung war echt, aber er betonte sie noch besonders. »Wir können weiße Elefanten mitnehmen, wenn Sie wollen – und falls Sie unsere Abfertigung an der jordanischen Grenze arrangieren.«
»In diesem Fall…« Safreddin beließ es einen Augenblick bei dem begonnenen Satz, als wolle er sich an den Schluß nicht binden. »In diesem Fall, mein Freund, sind wir unter Umständen bereit, von einer Zollabfertigung abzusehen.«
»Oh!« sagte Selim Fathalla wieder. »Dann sollten wir die Sache zusammen planen. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Ich will versuchen, mir bis morgen ein paar Vorschläge für Sie zu überlegen.«
»Sie sind ein guter Freund«, sagte Safreddin höflich. »Ich möchte Ihnen sagen, daß wir sehr viel Vertrauen zu Ihnen haben.«
»Ich bin entzückt, das zu hören«, antwortete Fathalla.
Als er den Hörer auflegte, merkte er, daß seine Hände zitterten und klebriger Schweiß auf seiner Stirn stand. Als er Bitar erzählte, was Safreddin von ihm wollte, pfiff der Arzt leise durch die Zähne. Dann schwieg er. Fathalla sagte:
»Es stinkt. Die Sache stinkt wie ein Misthaufen.«
»Ich weiß«, sagte Dr. Bitar. »Es gibt mindestens hundert Möglichkeiten, Waffen nach Jordanien zu schmuggeln, ohne die Grenzbehörden einzuschalten. Safreddin hat sie alle schon mal benutzt. Weshalb braucht er Sie dazu? Und weshalb redet er so offen darüber?«
Alexandria
In der Westkurve der Grande Corniche von Alexandria, in der Nähe des Palasts von Ras-el-Tin, lag eine Villa in einem Garten mit Palmen, Rasenflächen und Blumenbeeten. Auf den ersten Blick machte das alles noch immer den Eindruck von Reichtum und Luxus, obwohl die Glanzzeit der Villa vorüber war, seit ihr griechischer Besitzer sein Vertrauen in Nassers Regime verloren und beschlossen hatte, sein dezimiertes ägyptisches Kapital im Stich zu lassen und in Europa von seinen Papieren zu leben. Der Garten begann jetzt zu verwildern, die weißen Gartenmöbel verrosteten, die Markisen waren ausgeblichen, den Rasen durchwucherte Unkraut, und abgefallene Datteln verfaulten in der Sonne.
Am Tag nach dem Zwischenfall von Sha’ar Hagolan gingen zwei Männer durch den Garten. Der eine war ein kleiner wendiger Bursche mit arglosem Gesicht und milden Augen; er sah aus wie ein Bankier oder ein höherer Beamter. Sein Name war Idris Jarrah. Und er war auch wirklich etwas wie ein Beamter, nämlich Leiter der Operationsabteilung der Palästinensischen Befreiungsorganisation. Seine Nationalität war unbestimmt. Er war Palästinaaraber, in Jaffa geboren. Seine Heimat war jetzt von einem Volk besetzt, das er haßte, von einer Nation, die von Rechts wegen, wie er meinte, keine Existenzberechtigung besaß und deren Vernichtung er sich zum Ziel gesetzt hatte. Auch urkundlich war er eine zweifelhafte Person, denn er besaß mehrere Pässe: einen ägyptischen, einen griechischen, einen syrischen, einen libanesischen, einen jordanischen und einen italienischen. Sein Begleiter war ein großer grauhaariger Mann Anfang Fünfzig, dessen Name sorgfältig geheimgehalten wurde. Er war das Oberhaupt des Planungsstabs der gleichen Organisation.
Der Tag war warm und angenehm. Aus Afrika blies ein lauer stetiger Wind, der einen beißenden Geruch nach Sand und den modrigen Ausdünstungen des Maryut-Sumpfes mit sich trug. Die Palmzweige knackten, und als die beiden Männer über den Kiesweg gingen, wirbelten die welken Blätter zu ihren Füßen in kleinen staubigen Strudeln dahin. Der ältere Mann sprach sehr nachdrücklich und unterstrich seine Worte mit heftigen Handbewegungen. Idris Jarrah redete leise und ohne jede Gestik. Er war ein Mann, der ein Dutzend verschiedene Existenzen führte und gelernt hatte, was Anonymität und Beherrschung waren. Der Namenlose sagte:
»Diese Sache in Galiläa war ein Blödsinn! Eine sinnlose Provokation, die nur die öffentliche Meinung in Israel verhärtet und Syrien zu einem Zeitpunkt ins Scheinwerferlicht rückt, zu dem wir es dort nicht haben wollen.«
»Stimmt«, sagte Idris Jarrah freundlich. »Aber solche Sachen passieren. Die Mine lag wahrscheinlich schon seit Monaten dort.«
»Wenn Sie nach Damaskus kommen, sprechen Sie mit Safreddin darüber. Erinnern Sie ihn nachdrücklich an unsere Abmachungen. Alle Zwischenfälle müssen in Zukunft auf die jordanische Grenze beschränkt bleiben. Machen Sie ihm klar, daß Ägypten nach dem gegenseitigen Beistandsabkommen keine Schritte unternehmen muß, wenn Syrien einen israelischen Angriff provoziert.«
»Ich werde das tun. Das neue Programm erfordert sowieso eine Konzentration unserer Kräfte in Nablos, Hebron und am Toten Meer. Wir werden dort alle Hände voll zu tun haben. Safreddin wird vollauf mit der anderen Sache beschäftigt sein.«
»Wann will er anfangen?«
»In zwei Wochen. Er wartet darauf, daß ich das Geld nach Jordanien bringe.«
»Ist Khalil vorbereitet?«
»Safreddin sagt ja. Aber ich werde selbst alles überprüfen, bevor ich das Geld aushändige.«
»Diesmal muß es funktionieren«, sagte der Namenlose in plötzlichem Ärger. »Eine weitere Säuberungsaktion in der jordanischen Armee würde uns ein ganzes Jahr zurückwerfen – wenn nicht mehr.«
»Ich weiß«, sagte Idris Jarrah. »Wenn Khalils Plan irgendwelche schwachen Punkte aufweist, bin ich ermächtigt, die ganze Aktion zu verschieben. Ist das richtig?«
»Richtig. Und jetzt zum Geld. Wir haben zweihunderttausend Pfund Sterling bei der Pan-Arabischen Bank in Beirut auf ein Konto unter Ihrem Namen deponiert.«
Idris Jarrah blickte überrascht auf.
»Bei der Pan-Arabischen Bank? Wir haben doch sonst immer mit Chakry gearbeitet.«
Sein Begleiter lächelte dünn und humorlos.
»Ich weiß. Wir haben beschlossen, andere Arrangements zu treffen. Ihr derzeitiges Guthaben bei Chakry beträgt siebenundfünfzigtausend US-Dollar. Wenn Sie in Beirut sind, heben Sie das Geld sofort ab und zahlen es auf das neue Konto ein.«
»Gibt es dafür einen Grund?«
»Viele. Erstens ist Chakry für seine Schuhnummer zu groß geworden, und zweitens müssen die Libanesen lernen, daß sie nicht weiterhin Profite machen können, während wir anderen die Risiken tragen.«
»Und siebenundfünfzigtausend Dollar sollen ihnen das beibringen?«
»Kaum. Aber vielleicht fünfzig Millionen.«
»Das scheint ein interessanter Monat zu werden«, sagte Idris Jarrah mit schwachem Lächeln.
»Ich hoffe, Sie bleiben so lange am Leben, daß Sie auch was davon haben. Wann reisen Sie ab?«
»Heute nachmittag drei Uhr. Das Schiff liegt im Hafen. Ich werde morgen vormittag um elf Uhr in Beirut sein.«
»Amüsieren Sie sich gut«, sagte der Namenlose gleichgültig.
»Inshallah«, sagte der mondgesichtige Beamte.
Beirut
Wenn Nuri Chakry gut gelaunt war – und Zuversicht und Humor waren seine gewinnbringendsten Eigenschaften –, sprach er gern von sich.
»… so was wie Glück gibt es nicht. Charakter ist Schicksal. Wir handeln, wie wir sind. Wir bekommen, was wir verdienen. Ich zum Beispiel bin Phönizier. Ich liebe das Geld. Ich liebe den Handel. Feilschen ist für mich ein amüsantes Spiel, das Risiko so berauschend wie Haschisch. Wenn ich früher gelebt hätte, hätte ich unten am Hafen in einem kleinen Schuppen gesessen und Gold gegen Silber, Kamelhäute gegen Eisenäxte und Öl gegen die Linsen der Pharaonen eingetauscht. Ich bin ein Händler. Für mich gibt es nur einen Grundsatz: Mache nie Geschäfte mit einem Händler, der gerissener ist als du.«
Was er sagte, stimmte. Alles, was Chakry sagte, stimmte, denn er hatte es sich zur Regel gemacht, in geschäftlichen Dingen nie zu lügen. Das Problem für die, die mit ihm zu tun hatten, war, zwischen der poetischen und der eigentlichen Wahrheit zu unterscheiden und immer daran zu denken, daß das, was ungesagt blieb, manchmal wichtiger war als das, was er lebhaft und überzeugend vorbrachte.
Chakry war Phönizier insofern, als er in einer Stadt lebte, die einmal phönizisch gewesen war. Doch wer tief genug in den Akten grub, erfuhr, daß Chakry ein in Acre geborener Palästinaaraber war, der das Land 1948 beim Einzug der Israelis verlassen hatte.
Es gab manche, die behaupteten, noch tiefer gegraben und entdeckt zu haben, daß er in Wirklichkeit ein abtrünniger Jude sei, der an den Börsenberichten mehr Gefallen gefunden habe als am Talmud und der es vorziehe, auf dem freien Markt zu schachern, statt sich dem bürgerlichen Sozialismus des neuen jüdischen Staates zu unterwerfen. Aber selbst seine Feinde neigten dazu, das als Verleumdung zu betrachten, von Leuten ausgestreut, die er bei seinem schnellen spektakulären Aufstieg von der Leiter gestoßen hatte.
Daß er das Geld liebte, stand außer Zweifel. Daß er den Handel liebte, war ebenfalls eine feststehende Tatsache. Als er nach Beirut kam, besaß er so gut wie nichts, aber mit Betteln, Borgen und Bluffen gelang es ihm, sich in einer Seitengasse in der Nähe der Hafenanlagen als Geldwechsler niederzulassen. Das Geschäft ging Tag und Nacht. Seine ersten Kunden waren Seeleute, Zuhälter, Prostituierte, Hotelportiers, Nachtklubschlepper, Schmuggler, Hehler und Verkäufer von zweifelhaften Antiquitäten. Keine Währung war so schlecht, daß er nicht noch einen Profit herauszuschlagen wußte, kein Geschäft so unbedeutend, daß er nicht als Zwischenhändler aufgetreten wäre – vorausgesetzt, die Provision war angemessen und wurde von beiden Seiten bezahlt.
Er kaufte alte Münzen von den Bauern, die sie auf ihren Feldern gefunden hatten, und von den Arbeitern bei den Ausgrabungen in Baalbek und Byblos. Er säuberte sie und verkaufte sie über internationale Sammlerzeitschriften zu hohen Preisen. Er entwickelte einen hervorragenden Blick für Antiquitäten und ihren begrenzten, aber einträglichen Markt. Er war in der Tat ein Händler – mit viel Sinn für das angenehme Leben und intuitiver Kenntnis der Mittel, mit denen die Macht arbeitet.
Als erstes lernte er, daß schnelle Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Eine phönizische Goldmünze war auf dem Samtkissen eines Händlers in Byblos vielleicht hundert Dollar wert. In New York würde sie den vierfachen Preis erzielen. Thaibahts standen in Beirut unter pari, aber in Bangkok konnte man damit Rubine, Saphire und Gürtel aus gewebtem Gold kaufen. Eine Pfundnote aus Ostafrika konnte man auf dem europäischen Markt mit fünf, manchmal sogar mit zehn Prozent Rabatt kaufen, aber wenn man sie nach Kenia zurückbrachte, bekam man den vollen Wert in Sterling. Daher saß Nuri Chakry in seinem schäbigen Büro und träumte von Schiffen und Fluglinien, von Telefonkabeln und Fernschreiben – und einem ganzen Spinnennetz von Verbindungen, über das er jeden Tag mit allen Märkten der Welt verhandeln könnte.
Er erfuhr bald, daß Geld und Furcht zusammengehören: Wer Geld hat, hat auch Angst. Die Reichen leben in ständiger Angst vor Steuereintreibern, Sozialreformen, Revolutionären, Politikern und verlassenen Frauen. Für diese verängstigten Millionäre, für die Ölscheichs aus Kuwait und Saudi-Arabien, die syrischen Kaufleute mit ihrer Furcht vor Enteignung, für die griechischen Reeder und texanischen Millionäre war Beirut ein Paradies.
Daher schloß Nuri Chakry eines Tages sein Büro am Hafen, steckte seine Träume in die Brusttasche eines neuen Anzugs und gründete die Phönizische Bank. Da er tüchtig war und mutig und bereit, den reichen Männern dabei zu helfen, in Ruhe ihren Lastern zu frönen, gedieh sein Unternehmen schnell. Die reichen Männer wurden einer nach dem anderen seine Kunden und vertrauten ihm ihr Vermögen an. Um ihr Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten zu bestärken, war er gewillt, Phantastisches zu leisten. In dem maurischen Pavillon neben seinem Büro, in dem er seine saudischen und kuwaitischen Fürsten zu unterhalten pflegte, stapelte er einmal Goldbarren einen halben Meter hoch auf den Tisch und bedeckte sie mit Pfandbriefen und Banknoten, um zu beweisen, daß das Geld seiner Kunden jederzeit flüssig war und daß es nirgendwo auf der Welt einen vertrauenswürdigeren Treuhänder gab als Nuri Chakry.
Als er fünfzig war – ein schlanker, schwarzhaariger, lebhafter Fünfziger –, hatte er sich ein Imperium aufgebaut, das von Beirut bis zur Fifth Avenue und von Brasilien bis Nigeria und Qatar reichte und das er von seinem Adlerhorst aus verwaltete – eine große Wohnung aus Glas und Beton, die im Westen auf das Mittelmeer und im Osten auf die Berge blickte, hinter denen die ölschwere Wüste lag.
Im ganzen Libanon gab es niemanden, der ihn an Macht und Ansehen gleichkam, und die goldenen Fäden seines Netzwerks waren mit einer Vielzahl von Unternehmen verknüpft. Seine Kunden und Arbeitnehmer stellten ein Zehntel aller Wahlberechtigten des ganzen Landes, und zwanzig Prozent des staatlichen Betriebskapitals lag in den Tresoren der Phönizischen Bank.
Auf seinem Schreibtisch lag in einer durchsichtigen Plastikschachtel sein Symbol und Glücksbringer – eine Goldmünze von Alexander dem Großen, die auf der einen Seite den Eroberer als Gott Ammon zeigte und auf der anderen die Göttin Athene. Vielleicht mochte ihn das als eitlen Menschen kennzeichnen, doch er war keinesfalls dumm. Er wußte, daß seinem Imperium engere Grenzen gesetzt waren als dem Reich Alexanders. Er wußte, daß seine Geldmittel die gewagten und riskanten Investitionen nur mangelhaft fundierten. Aber wenn er lange genug durchhielt, würde sich ihr Wert verdoppeln und verdreifachen. Wenn er allerdings in der Zwischenzeit gezwungen würde zu liquidieren, so wäre das, als verliere er seinen rechten Arm. Er wußte, daß seine Verbindungen unzuverlässiger wurden, je weiter er sie ausdehnte; und er wußte auch, daß allein schon seine Existenz von der gefährlichen Unausgeglichenheit der politischen Kräfte im Nahen Osten abhing. Je stärker die linksgerichteten Baathisten in Syrien wurden, desto mehr fürchteten die Kuwaitis und Saudis um die Zukunft ihrer reichen Autokratien. Je größer ihre Sorgen wurden, desto stärker verlangten sie danach, ihr Risiko mit Hilfe dieses zuvorkommenden Buchmachers Nuri Chakry zu verringern. Je heftiger sich Ägypten in den Jemenkrieg verstrickte, desto tiefer geriet es in die Schuld der Russen und um so dringlicher brauchte es einen freundlichen Bankier, der die Wechsel diskontierte. Mit jedem Zusammenstoß an der israelischen Grenze floß neues Angstgeld in den Libanon, um gegen europäische Sicherheiten eingetauscht zu werden. Sogar die Russen hatten die hübsche Summe von sechs Millionen Dollar deponiert, was ihre Schaukelpartner, die Amerikaner, dazu zwingen würde, etwas Ähnliches zu tun.
Aber um das Schaukelspiel zu spielen, brauchte man starke Nerven und eine geschmeidige Zunge und einen scharfen Blick für jedes fallende Blatt, das den Waagebalken verschieben könnte. An diesem Morgen segelten mehrere Blätter durch die Luft, und Nuri Chakry stand nachdenklich am Fenster seines Büros, blickte hinaus aufs Meer und überlegte, wo sie hinfallen würden. Nach ein paar Minuten kehrte er an seinen Schreibtisch zurück und schaltete die Sprechanlage ein.
»Mark? Ich habe jetzt Zeit für Sie. Kommen Sie bitte herein.«
Einen Augenblick später öffneten sich die elektrischen Türen des Büros geräuschlos, und Mark Matheson trat mit einer großen Ledermappe unter dem Arm ein. Er war ein dicklicher Mann Mitte Vierzig mit kurzgeschnittenem Haar und einem auffallend jungen Gesicht. Er war Amerikaner, der seinen Beruf bei den Rockefellers in New York erlernt und den Chakry nach Beirut gelockt hatte, wo er als sein Stellvertreter und Unterhändler für Europa arbeitete. Viele seiner Freunde hatten ihm davon abgeraten, das Angebot anzunehmen, aber Chakry zahlte sehr gut, und sein Vertrauen schmeichelte ihm, und so hatte er angenommen.
Bis jetzt hatte er noch keinen Anlaß gehabt, diesen Entschluß zu bedauern. Zuerst hatten ihn die verworrenen Manipulationen Nuri Chakrys erschreckt, aber die Bücher waren offen, die Akten in Ordnung, und Chakry ließ es nie an Respekt fehlen, wenn man ihm einen Rat gab, auch wenn er ihn nicht annahm. Wem er vertraute, zu dem war er offen und geradeheraus, und seine gelegentlichen Wutausbrüche wurden wettgemacht durch seine außerordentliche Großzügigkeit. Er bedeutete Mark, sich zu setzen, und kam sofort zur Sache.
»Wie stehen wir diesen Monat, Mark?«
»Wir sind knapp bei Kasse«, sagte Mark Matheson. »Knapper als sonst. Am Freitag brauchen wir die üblichen zehn Millionen für den Gehaltsscheck der Regierung. Die haben wir. In der nächsten Woche sind wir immer noch flüssig, es sei denn, daß größere Summen abgehoben werden. Am dreißigsten des Monats werden wir allerdings Hilfe brauchen.«
»Wieviel?«
»Sechs Millionen. Vielleicht kommen wir auch mit fünf aus.«
»Ich werde das organisieren«, sagte Chakry entschlossen. »Ich esse morgen mit dem Präsidenten. Wir werden die Zentralbank dazu bekommen, daß sie uns deckt. Und nun…« Er deutete auf die Zeitungen, die säuberlich aufgestapelt vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. »Das gibt Ärger: Vier Zeitungen haben heute Angriffe auf König Feisal gebracht. Das wird ihm gar nicht gefallen.«
Matheson zuckte die Schultern. »Das ist doch die alte ägyptische Masche. Die Zeitungen werden mit Nassers Geld finanziert. Feisal wird das wissen.«
»Natürlich weiß er das«, sagte Chakry scharf. »Aber die Zeitungen erscheinen im Libanon. Für Feisal stellen sie einen beträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung in diesem Lande dar. Deshalb…« Er brach ab.
»Deshalb?« nahm Matheson den Satz auf.
»Wenn ich Feisal wäre – und ich kenne ihn recht gut –, würde ich mich fragen, weshalb ich fünfzehn Millionen von meinem Geld im Libanon lassen soll, wo man mich jeden Tag in der Presse beleidigt, wenn ich das Geld auch nach London transferieren kann und dort von der chemischen Industrie acht Prozent Zinsen dafür bekomme.«
»Eine gute Frage«, sagte Mark Matheson.
»Eine gefährliche Frage – für uns«, sagte Nuri Chakry. »Jetzt etwas anderes. Heute morgen rief mich Ibrahim von der Pan-Arabischen Bank an.«
»Aha! Nun, wie gefällt ihm sein neuer Job?«
Chakry zuckte die Schultern. »Überhaupt nicht, aber solange wir ihn dafür bezahlen, wird er es ertragen. Er erzählte mir, daß die PLO bei der Pan-Arab auf das Konto von Idris Jarrah zweihunderttausend Pfund Sterling eingezahlt hat.«
»Auf Jarrahs Konto?« Matheson war bestürzt. »Er ist doch seit drei Jahren unser Kunde. Er hat doch eine beträchtliche Summe bei uns deponiert.«
»Ich weiß. Ich vermute, daß er in ein oder zwei Tagen hier erscheinen wird, um das Geld abzuheben und sein Konto zu löschen.«
»Und das bedeutet?«
Chakry nahm die kleine Plastikschachtel, die seinen Talisman umschloß, und schob sie von einer Hand in die andere. »Das bedeutet, daß die Ägypter ihr Mißfallen über die libanesische Politik ausdrücken. Sie wollen uns mehr arabisch sehen und weniger phönizisch. Sie wollen, daß wir gegen Israel aktiver werden. Sie wollen, daß wir die Jordanier und die Kuwaitis auf die Seite der VAR bringen.« Er hielt die Schachtel gegen das Licht und betrachtete sie eingehend, als sei sie ein Kristall. »Und wenn die Ägypter unangenehm werden, werden die Syrer noch unangenehmer, und die Russen werden uns gewaltig eins aufs Haupt geben. Zweihunderttausend Pfund sind eine Menge Geld – viel mehr, als Jarrah für Grenzsabotage braucht. Daher ist anzunehmen, daß sehr bald etwas Großes geschieht.«
»Mit zweihunderttausend kann er jeden Palästinaflüchtling westlich des Jordans kaufen – und obendrein noch einen Teil von Husseins Armee.«
»Vielleicht versucht er es«, sagte Chakry. »Sagen Sie, Mark, angenommen, wir brauchten schnellstens Deckung, woher könnten wir sie bekommen?«
»Wie hoch soll der Betrag sein – und bis wann wollen Sie ihn haben?«
»Fünfzig Millionen – in dreißig Tagen.«
»Großer Gott!« Mark Matheson war entsetzt. »Bei der derzeitigen Marktlage könnten Sie genausogut eine Scheibe vom Mond verlangen. Wenn ICI für eine Anleihe von vierundzwanzig Millionen acht Prozent bieten muß, dann heißt das, daß das Geld verdammt knapp ist.«
Chakry sah ihn mit einem spöttischen Lächeln an. »Angst, Mark?«
Matheson fand das nicht komisch. »Richtig, ich habe Angst. Wir sind zu dreieinhalb Prozent flüssig – was überall ein strafrechtliches Delikt wäre, bloß in Beirut nicht. Und Sie erzählen mir, daß eine Reihe größerer Kunden ihr Geld abheben will. Fünfzig Millionen in dreißig Tagen! Woher sollen wir das nehmen? In London kleben sie Tesafilm über den Riß im Pfund. In Zürich und bei den Rockefellers stehen wir in der Kreide. Also bleiben uns nur Mortimer auf der einen und der jüdische Markt auf der anderen Seite. Mortimer könnte uns mit einem Telefonanruf abdecken, aber Sie wissen, was er dafür verlangen wird.«
»Die Fluggesellschaft – und die bekommt er nur über meine Leiche.«
»Genau! Und damit bleibt Ihnen nur der jüdische Markt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Juden große Lust haben, die Arabische Liga zu finanzieren, können Sie sich das vorstellen?« »Ich bin nicht so sicher«, sagte Chakry gelassen. »Geld kennt keine Rassenunterschiede. Und die Juden haben Sinn für Ironie. Ja! Ich könnte mir eine Situation vorstellen, in der eine starke jüdische Gruppe ganz gern mit der Phönizischen Bank zusammenarbeiten würde.«
Matheson starrte ihn voll skeptischer Bewunderung an. »Ich glaube wirklich, Sie haben die Unverfrorenheit, es zu versuchen.« »Das ist keine Frage der Unverfrorenheit, sondern eine Frage des Überlebens, und wenn ich, um zu überleben, mit Shaitan persönlich verhandeln muß, so werde ich das tun. Und jetzt wollen wir uns ein paar Notizen machen.«
Auf See
Idris Jarrah, der Terrorist mit den milden Augen, war ein Mann, der begriffen hatte, was gespielt wurde. Er wußte um die Zusammenhänge, um die persönlichen und um die politischen. Und er wußte auch, wie sehr sich das alles widersprach und einander entgegenstand.
Die politischen Zusammenhänge waren noch am einfachsten. Idris Jarrah war ein staatenloser Araber. Ein staatenloser Araber besaß weder Identität noch Zukunft. Wenn er ein Zuhause wollte, konnte er es bei den Flüchtlingen im Gazastreifen haben oder in den Barackenstädten westlich des Jordans. Wenn er arbeiten wollte, konnte er auch das haben: als Straßenkehrer oder Hausierer oder als Schnitzer von Souvenirs für die Touristen. Aber wenn er eine Identität haben wollte, eine offizielle Bestätigung, daß er eine Person war und nicht ein namenloses Stück Strandgut, dann mußte er sich einen Markt suchen, wo er eine kaufen konnte zu einem Preis, den er bezahlen konnte.
Idris Jarrah hatte einen solchen Markt in der Palästinensischen Befreiungsorganisation gefunden – dieser Familie vertriebener Zeloten, die sich geschworen hatten, die Juden ins Meer zu treiben, die alten Grenzen von Palästina wiederherzustellen und eine arabische Hegemonie zu errichten. Was den Preis betraf, so war Idris Jarrah imstande, mit harter Münze zu zahlen. Er hatte für die alte palästinensische Polizei zuerst als Spitzel und später als Geheimpolizist gearbeitet. Er kannte alle Spionagetricks und Terrormethoden, und von den Briten hatte er gelernt, was System und Methode wert waren.
Da er keine Illusionen hatte und seine ganze Hoffnung auf die Organisation setzte, arbeitete er mit erstaunlicher Tüchtigkeit. Da er nie mehr versprach, als er halten konnte, fiel seine Tätigkeit immer zufriedenstellend aus. Und da er weder an Gott glaubte noch an die Politiker, sondern nur an Idris Jarrah, war er vor Versuchung sicher – wenn auch nicht unempfänglich für persönliche Vorteile. Er sagte seine Meinung, nahm die Befehle entgegen, lieferte einen nächtlichen Überfall oder eine Bombenexplosion, ließ sich bezahlen und schlief zufrieden und glücklich mit irgendeiner Frau, während größere Männer sich in Alpträumen der Enttäuschung wälzten oder in der Phantasie ungeheure Reiche gründeten.
Die politischen Zusammenhänge waren ihm genauso klar. Soweit es die arabische Welt betraf, war es mit dem Staat Israel wie mit Gott: Wenn es ihn nicht gäbe, müßte man ihn erfinden – als Brennpunkt für die Unzufriedenheit und als Mittel der Sammlung einer peinlich entzweiten Moslemwelt. Wo fände man, wenn es die Juden nicht gäbe, einen Sündenbock für das Elend der Slumbewohner in Alexandria, für die Bettler, die im Vorhof der heiligen Stätte saßen und ihre Wunden kratzten, für die arbeitslosen Männer in Damaskus und für die zehntausend Menschen, die zwischen der Wüste und dem Meer in der Nähe der Stadt Samson kampierten? Wie ließ sich, ohne die Juden, eine leicht faßliche Erklärung finden für die reichen Libanesen, die Kuwaitis und die beduinischen Stammesgenossen, für den Haschemitenkönig und den marxistischen Syrer und für den ägyptischen Kameraden, der im Jemen einen sinnlosen Krieg führte? Arabische Einheit konnte sich nur auf negative Weise ausdrücken: Vernichtet die Juden! Und ohne die Juden konnte sie sich so gut wie gar nicht ausdrücken. Was aber die Wiederherstellung Palästinas betraf, so wußte Jarrah besser als die meisten, daß es, wenn es wirklich wiederhergestellt wäre, über Nacht von seinen neidischen Nachbarn zerstückelt werden würde.
Die Organisation hatte sich demnach einem Phantasiegebilde verschrieben, aber Phantasiegebilde waren das Arbeitsmaterial der Politiker; und sie zahlten große Summen, um es zu behalten und Männer wie Idris Jarrah zu finden, die für ihre rivalisierenden Ziele kämpften.
Und er wußte auch das: Die Ägypter wollten Israel zerstören, aber ihnen fehlten Geld und Hilfsmittel, um das zu tun. Die syrischen Sozialisten wollten den kleinen König von Jordanien loswerden, der ein Freund der Briten und ein Symbol für die überholte Stammesmonarchie war. Die Jordanier wollten eine Straße zum Meer und einen Hafen am Mittelmeer. Die Libanesen wollten Geld und Handel, und die Russen wollten Sozialismus von Bagdad bis zu den Säulen des Herkules. Die palästinensische Befreiungsorganisation hatte für alle einen bestimmten Wert. Sie mochten sie öffentlich loben und insgeheim verdammen, aber sie zahlten alle großzügig, um sie am Leben zu erhalten.
An einem strahlenden Herbstmorgen stand Idris Jarrah halb zehn an Deck der Surriento, die mit ihren zehntausend Tonnen zwischen Genua, Alexandria, Beirut und Limassol verkehrte, und betrachtete die Höhenzüge des Libanongebirges und die goldene Stadt Beirut, die in der Morgensonne immer näher kam. Er hatte eine angenehme Nacht verbracht – mit einer Barsängerin von mäßiger Schönheit und beträchtlichem Temperament – und freute sich jetzt seines Wohlbefindens und der Sicherheit, ein gesuchter Mann zu sein.
Nach der Eintönigkeit Alexandrias und den strapaziösen Verhandlungen mit den Ägyptern – einem fiebernden, arroganten und unglücklichen Volk, das er von Herzen verachtete – war die Aussicht auf zwei Tage im Libanon sehr reizvoll. Er würde im St. George wohnen, einem hübschen Hotel mit Blick auf das Meer und einem Portier, der seinen Geschmack kannte und gern bereit war, seine Wünsche zu erfüllen. Er würde zur Phönizischen Bank gehen, das Geld abheben und es bei der Pan-Arabischen Bank deponieren. Er würde sich kurz mit Freunden und Agenten besprechen und dann in aller Ruhe nach Merjayoun fahren, um den Leutnant aufzusuchen, der die Sabotagetätigkeit im Gebiet von Hasbani leitete. Vorerst würde es dort nicht viel zu tun geben, da geplant war, die libanesische Grenze in Ruhe zu lassen, während die Angriffe von Jordanien entlang dem Korridor von Jerusalem verstärkt wurden. Er würde das Geld übergeben und für die Verteilung der Waffen sorgen, die im Bauch der Surriento in Plastikröhren lagen, die später an einen Bauunternehmer für Kanalisationsanlagen verkauft wurden. Danach würde er sich einen Abend amüsieren und am nächsten Morgen nach Damaskus fliegen, um mit Safreddin zu verhandeln. Dort würde es Schwierigkeiten geben, denn Safreddin spielte viele Spiele gleichzeitig und hätte Idris Jarrah gern in alle verwickelt gesehen.
Oberst Safreddin war ein Soldat, der mit den Politikern ein Abkommen getroffen hatte. Solange man ihm genug Macht gab, die Armee zu kontrollieren, sorgte er dafür, daß sie sich loyal verhielt. Er bildete ein Offizierskorps heran, das nach den Doktrinen der Baath – der »Arabischen Sozialistischen Wiederauferstehungspartei« – geschult war und eine Waffe zur Durchsetzung der politischen und wirtschaftlichen Ziele des Einparteienstaats darstellte. Er brachte die Unzufriedenen, die immer noch nach Nasser und den Ägyptern schielten, zum Schweigen und hatte ein wachsames Auge auf die Großgrundbesitzer und Kaufleute, die versuchten, ihr Kapital aus Syrien in den Libanon und die Mittelmeerländer zu transferieren. Er hielt die Russen bei Laune und unterdrückte gleichzeitig alle revolutionären Bestrebungen oder leitete sie in den Schmelztiegel des syrischen arabischen Sozialismus.
Seine persönlichen Ambitionen waren beträchtlich. Er wollte, daß Syrien und nicht Ägypten die führende Macht der arabischen Welt würde. Er wollte Israel von der Landkarte streichen. Er wollte die Ägypter und Jordanier so bald wie möglich in einen totalen Krieg gegen die »usurpatorischen Zionisten« verwickelt sehen. Er wollte, daß der Haschemitenkönig beseitigt und eine sozialistische Regierung errichtet würde, damit die Grenzblockade zu einer regulären Belagerung ausgeweitet werden könnte. Und Idris Jarrah war der ideale Mann, um das große Schießen zu inszenieren.
Idris Jarrah würde Saboteure von Jordanien nach Israel schicken; und wenn die Israelis Vergeltung übten – dann gegen Jordanien und nicht gegen Syrien. Die Grenzbevölkerung würde König Hussein die Schuld zuschieben und nach einer neuen Regierung verlangen, die sie vor der israelischen Armee schützte. Gleichzeitig würde Idris Jarrah Geld auszahlen, um die Palastrevolution in Amman zu finanzieren. Idris Jarrah würde für die entscheidende Aktion verantwortlich sein – wenn sie fehlschlug, hätte er als bezahlter Agitator, der illegal innerhalb der Grenzen eines souveränen Staats operierte, die Verantwortung zu tragen.
Aber Idris Jarrah war ein Mann, der wußte, was gespielt wurde, und er hatte nicht die Absicht, sich selbst eine Schlinge um den Hals zu legen. Während er geschmeidig und unschuldsvoll wie eine Katze in der Sonne lag und zusah, wie das Libanongebirge immer deutlicher aus dem Meer aufragte, begann er, eine Versicherungspolice auszuarbeiten und über diejenigen nachzudenken, die sie für ihn unterzeichnen könnten.
Die ersten Unterzeichner wären die Mitglieder seiner Organisation im Libanon, in Jordanien und im Gazastreifen. Sein Geld gab ihnen Brot, seine Waffen verliehen ihnen ein Gefühl von Macht und Würde. Seine Versprechungen, daß sie in ihre Heimat zurückkehren würden, schenkten ihnen Hoffnung. Selbst die Gefahren, denen er sie bei den Sabotageaktionen aussetzte, verliehen ihrem sonst sinnlosen Leben Zweck und Glanz. Sie waren keineswegs alle Helden. Manche waren ausgemachte Feiglinge, die man überreden oder zwingen mußte, die verabredeten Maßnahmen auch durchzuführen. Aber es waren auch Patrioten darunter, die von ihrer Hoffnung auf die verlorene Heimat lebten; würden ihr Stolz und ihre Zuversicht vernichtet, dann waren sie verloren – für ihn und für sich selbst. Ohne sie war er machtlos; mit ihnen war er eine Art König – wenngleich in einem Reich von Söldnern und Ausgestoßenen.
Deshalb brauchte er andere und stärkere Hintermänner. Er brauchte ein Netz, das ihn auffing, wenn er stolperte und von dem straffgespannten Seil zwischen Syrien und Ägypten stürzte. Er dachte an Nuri Chakry, der auch auf einem Seil jonglierte und der möglicherweise bereit war, ein privates Geschäft mit ihm zu machen, das für beide Seiten von Vorteil sein konnte.
Zweites Kapitel
Jerusalem
Achtundvierzig Stunden nach dem Zwischenfall bei Sha’ar Hagolan wurde Brigadegeneral Jakov Baratz zu einer Besprechung in das Büro des Premierministers in Jerusalem geladen. Die Besprechung war für 15 Uhr angesetzt. Eine gemütliche Fahrt von Tel Aviv nach Jerusalem dauerte höchstens zwei Stunden, aber Baratz beschloß, schon bei Sonnenaufgang zu fahren. Für seinen gähnenden und mürrischen Fahrer war es eine Strafe, für Baratz das reinste seiner spartanischen Vergnügen.
In der Morgendämmerung hatte das Meer die Farbe von Opalglas, und der Nebel zog in dünnen Schwaden über das Wasser. Die Luft war kühl und frisch und noch nicht von Benzindämpfen und Staub verunreinigt. Die Stadt lag noch im Schlaf, und die wenigen Fußgänger wirkten schwerfällig und ländlich, als wären sie nicht ganz am Platz in dieser betriebsamen, lauten Stadt, die wie ein Pilz aus den Sandhügeln nördlich des alten Jaffa emporgeschossen war.
Auf dem flachen Ackerland lag noch der Tau. Es roch nach Orangenblüten und gepflügter Erde. Die Strahlen der aufgehenden Sonne färbten die Blätter der Obstbäume grün, vergoldeten die Stoppelfelder und ließen das Kalkgestein, das zwischen fruchtbarer Erde zutage trat, rosa und weiß und bräunlich leuchten. Die Pinien in den Tälern im Osten waren noch dunkel und düster, aber auf den Bergkuppen funkelten sie rot in der Sonne, wie die Speere marschierender Heere.
Für Jakov Baratz war dies das wahre Antlitz des Gelobten Landes. Er war als Kind in dieses Land gekommen, als Sohn eines Kaufmanns aus dem Baltikum, und er hatte die Herrlichkeit seiner Ankunft nie vergessen: die strahlende Sonnenglut, den blendenden Himmel, das zerklüftete Gebirge, die Wüste, über der die Luft tanzte und Städte und Palmenhaine hervorzauberte, die im nächsten Augenblick wieder verschwunden waren. In seiner Jugend hatte er das Land bebaut, hatte mit bloßen Händen Felsmauern errichtet, körbeweise Erde angeschleppt und Weinstöcke und Zitronenbäume gepflanzt. Als Mann hatte er die militärische Ausbildung, die die Briten ihm gegeben hatten, dazu benutzt, um dieses Land zu kämpfen; und er hatte jeden blutigen Kilometer von Lydda bis Ramie und Abu Ghosh gezählt, bis er endlich auf dem Berg Zion stand. Seine Liebe zu diesem Land war vielgestaltig. Eine starke Leidenschaft band ihn enger an diese Erde, als er je an den Körper einer Frau gebunden war. Er war eifersüchtig wie jeder Liebhaber, denn er konnte seines Besitzes nie sicher sein, und niemand wußte besser als er, wie sehr dieser Besitz bedroht war.
Rechtlich gesehen – wenn es so etwas wie Rechtsbegriffe in den Auseinandersetzungen zwischen Nationen gab –, hatte Israel nicht einmal eine Grenze. Seine Grenzen waren Waffenstillstandslinien, die erst ein formaler Friedensvertrag anerkennen konnte – und der schien zur Zeit ferner als die Landung auf dem Mond. Selbst die Waffenstillstandslinien waren an vielen Stellen durch die Existenz entmilitarisierter Zonen gefährdet, in denen niemand eine Waffe tragen durfte, um Frau und Kinder und die Arbeiter auf dem Feld zu schützen. Der israelische Außenhandel wurde durch Sanktionen der arabischen Staaten behindert. Der Suezkanal war für israelische Schiffe gesperrt. Die Straße von Acre nach Sidon war versperrt durch Minenfelder, Stacheldraht und bewaffnete Soldaten, und es war nicht möglich, von einem Teil Jerusalems aus mit dem anderen Teil zu telefonieren.
Trotz alledem war Israel gediehen, und es würde weiter gedeihen. Aber zur Zeit hatte es etwas weniger Fett unter der Haut,