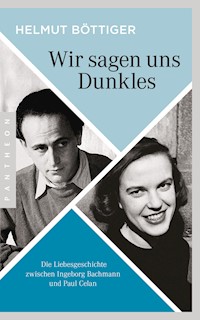Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Helmut Böttiger begibt sich auf eine literarische Reise in die wilde Landschaft der Bretagne – auf den Spuren einer großen Dichterliebe und des Echos dieser geheimnisvollen Gegend in den Gedichten Paul Celans. Von der Bretagne erzählt dieses Buch und von der Liebe – der Liebe zwischen einem mittellosen deutschsprachigen Ostjuden und einer Tochter aus dem französischen Hochadel. Und es erzählt auch über die Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, über höchstes Glück und existenzielle Gefährdung. Gisèle Celan-Lestrange, die Frau des Lyrikers Paul Celan, bat ihren Mann im Jahr 1960, zusammen mit ihr Paris für mindestens ein Jahr zu verlassen und in die Bretagne zu gehen. Nach Trébabu, einem Ort außerhalb der Zeit. Man weiß von diesem Aufenthalt nicht viel. Die Bretagne muss für Celan eine seltene Zuflucht gewesen sein. Helmut Böttiger reist, fast 50 Jahre später, auf Celans Spuren in die Bretagne und spürt der spröden Schönheit dieser Gegend und ihren jahrtausendealten Geheimnissen nach. Er fährt an die Küsten, zu den rätselhaften Menhiren und trifft auf verschlossene Bewohner, die, wenn sie ernsthaftes Interesse wahrnehmen, plötzlich doch ins Erzählen kommen. Die Geheimnisse werden dadurch nicht zum Verschwinden gebracht, aber umso konturenschärfer erhellt. Böttigers 2006 erstmals erschienenes Buch, für diese Ausgabe überarbeitet und aktualisiert, ist ein gewichtiger Beitrag zum Verständnis der Biographie Celans und eine Anleitung, wie man Gedichte und Landschaften liest.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Helmut Böttiger
Celan am Meer
1
Den Weg gab es nicht. Die Mühle von Kerléac musste etwas mit jenem »Kerléac« zu tun haben, das man auf der Karte entdecken konnte, einer großen Karte im Maßstab von 1:25 000, das Äußerste, was zu kriegen war. Dick eingezeichnet erschien der Ort »Trébabu«, mit einem roten zerfließenden Punkt, der Ort, von dem eigentlich alles ausging. Aber er bestand vor allem aus Rändern und kleinen Gehöften: Kervan, Kersac, Kermergant. Überall flossen Bäche, wucherte es im Grün. Die Mühle von Kerléac gehörte zu Trébabu. Doch von der Straße aus waren alle Gehöfte unkenntlich. Ab und zu bogen kleine Seitenpfade von der Landstraße ab, die ins Nirgendwo zu führen schienen, manchmal war ein kleines Schild zu erkennen, das ein Ziel dieses Seitenpfads angab – aber das Wort, das auf diesen Schildern stand, fand sich in den seltensten Fällen auf der Karte wieder.
Wir näherten uns Trébabu von hinten, von der gelb eingezeichneten Straße, auf die man von Brest aus kommt und die Brest auf ihre Weise fortsetzt: eine formale Behauptung. Der Bahnhof von Brest erinnert an frühere Heldengedenktage, an große weiße Denkmäler mit gereckten Armen und waffenstarrendem, pathetischem Blick. Alles ist Neubau, alles ist von einer Moderne, die in Beton zerfranst. Der Hafen besteht aus großen Kränen, die über mehrere, im Halbrund aufgereihte halbhohe Silos kreisen. Hier gibt es keine Geschichte, sie wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten ausgelöscht. Brest war ein militärisches Hauptquartier der Deutschen. Der Park am Bahnhof ist leer. Und der Wirt der Restauration am Bahnhof, der während des Sprechens mit offenem Mund die Zähigkeit seines Weißbrots zur Schau stellt, weiß von nichts.
In der gelben Straße lief Brest aus, hier waren die letzten Sendboten der Moderne dabei, zu versanden. Uneinsehbare Schneisen führten ins Nichts. Es war Zufall, dass wir nach einer weit geschwungenen Kurve plötzlich ein verrostetes Schild entdeckten, auf dem kaum kenntlich »Kerléac« geschrieben war, in kleinen, dahindämmernden Lettern. Der Weg, in den wir dann einbogen, führte nach einem Kilometer in einen Bauernhof, mündete in einen mit Pflastersteinen und Gräsern gebildeten Halbkreis und ließ die Wahl zwischen zwei, drei kleinen Gebäuden. Sie waren alle leer. An einer Stalltür hing ein verwitterter Anschlag der Gemeinde Trébabu, der auf Probleme der Wasserversorgung hinwies. Kein Hund bellte. Und von einer Mühle war nichts zu sehen. Wir entschieden, auf die gelbe Straße zurückzufahren und den Bach zu suchen, der unterhalb dieses Hofes »Kerléac« eingezeichnet war. Die Mühle musste an diesem Bach stehen. Die nächste Abzweigung führte nach Kerlovan, wir fuhren an einem langgestreckten Bauernhof vorbei, an dessen verwitternden Außenmauern große, weiße Blüten standen – ihre großen Kelche, ihre Feierlichkeit warf ein Licht zurück auf die Steine, an denen sie sich emporrankten. Dann ging es bergab, in einem Hohlweg, an den Seiten sah man zwei Meter hoch die massige, feuchte bretonische Erde, und an einer Biegung stand eine alte Kirche, die unerwartet groß über das enge Tal sah. Sie setzte sich aus den grauen Steinquadern zusammen, die hier für Wind und Wetter stehen, und wirkte verloren inmitten der verstreuten kleinen Behausungen, der großen Hänge mit dichten hochgewachsenen Bäumen, der kleinen Straße, auf der niemand fuhr.
Das Haus neben der Kirche war abgedeckt. Zwischen manchen Fenstern hingen noch zersplitterte Glasscheiben. Das Gelände war groß, aber aufgegeben. Die Straße ging in einen Fahrweg mit Mittelstreifen über, auf dem das Gras immer höher wuchs, die Fahrrillen wurden enger und morastiger, und an einer Wegbiegung stand ein großer schwarzer Hund, von dem nicht zu ahnen war, wohin er gehörte. Wir fuhren weiter. Ein Stall war zu sehen, aus dem das Gestein herausbröckelte, kleine Verwerfungen ohne Sinn. Wald, Gras, Geröll, es wurde eng. Doch dann begannen die Bäume zierlicher zu werden, und der Weg zog sich filigran durch helleres Gelände. Ein neues, einstöckiges Haus stand am Ende, direkt am Bach. Als wir dort hielten, kam eine Frau aus dem Haus und begrüßte uns, als hätte sie uns erwartet. Wir waren da.
2
Dass Trébabu klein sein würde, hatten wir geahnt. Es setzt sich aus lauter winzigen Punkten zusammen, windschiefen Häusern aus Granit. Sie sind eingezwängt in die vielen unnachvollziehbaren Täler, an deren Rändern es steil und abrupt hochgeht, mit einem wilden Baumbestand. Dazwischen ein leichter, unwiderstehlicher Geruch nach Meer. Das Grau scheint daher zu rühren, die Frische in der Luft. Trébabu hat aber auch einen Kern: da ist ein Friedhof, eine kleine Kirche und eine schwungvolle Senke. Die Straße führt steil hinunter, in ein Talkesselchen, man sieht die verwitterten, alten Grabsteine um die Kirche, ringsherum heftig auflodernde, alte und hohe Bäume, dann geht es wieder nach oben: an einem Brunnen vorbei, an dessen Stein sich dunkles Moos festgesetzt hat, grüne Schlieren verlieren sich im Wasser. Links zwei, drei Häuser, rechts eine große Mauer, und dann ist man wieder auf der Hochebene, der Weg führt hinaus auf die Landstraße nach Le Conquet. Der »Relais du Trébabu« steht mit großem Parkplatz an der Seite, es scheint ein Geheimtipp für Lastwagenfahrer zu sein. Die Inneneinrichtung ist austauschbar und mischt in Beige und Braun die siebziger Jahre mit Attributen des Jetzt. Dann kommt schon nichts mehr. Links diffuses Feld, rechts der große Wald, vorn die Kurve hinunter zum Meer. Trébabu besteht aus Friedhof und Kirche, sonst ist die Mitte leer.
Celan wohnte hier auf dem Gelände des Schlosses »Kermorvan«. Das ist alles, was wir wissen. Das Rathaus befindet sich dem dunklen grünen Brunnen gegenüber, eines der Häuser auf der linken Seite der Straße, ein heller gesichtsloser Neubau. Ein provisorisches Schild zeigt den »Presbytère« an. Der Briefkasten des Priesters liegt auf einer rostigen Metallplatte, die von losen Granitsteinen gehalten wird, das Rohr für die Zeitung ist schräg dazwischengeklemmt.
Das Schloss muss im Wald sein, der direkt an der Kirche beginnt, hinter den hohen Bäumen. An der Straße zieht sich eine Steinmauer entlang, die etwas verbirgt. Aber sie hat zwei schmale Durchlässe: eine unten in der Senke, der Kirche gegenüber, mit dem Schild »Warnung vor dem Hund«, von Friedhof und Kirche ist das Terrain durch einen hohen Metallzaun getrennt. Der Weg, der neben dem Schild in das Innere führt, macht ein paar Meter weiter oben eine scharfe Biegung nach links und verschwindet im undurchsichtigen Gelände. Der andere Durchlass ist in der Richtung, aus der wir gekommen sind, auf der Höhe, er ist fast verdeckt von einem großen Steinkreuz am Rand der Straße. Da zieht sich ein Weg geradeaus in den Wald, man kann ihn hundert Meter lang sehen.
Das Kreuz ist katholisch alt. Wo es schwärzlich wird und Flechten ansetzt, liegt der Westen, kommen Böen vom Meer. Doch an der Vorderseite schaut Jesus ernst und starr, grau und weiß und steinern, ein Pathos aus tiefen christlichen Jahrhunderten. Hier, in der Senke von Trébabu, an den Mauern, an den Gräbern und vor dem Wald, steht die Zeit still. Von der engen Straße oben, zwischen krummen Obstbäumen und heillos wucherndem Gebüsch, könnten Pferdefuhrwerke kommen, und aufgeschossene, verbeulte und abrupt puffende Renaults aus den dreißiger Jahren genauso wie der elegant geschwungene DS von Citroën aus den Fünfzigern. Jesus am Kreuz ist ein Schwarzweißfoto, die Mauer zwischen Berg und Wald auch.
Die zwei Durchlässe, unten an den Gräbern und oben am Kreuz, bewegen sich offenkundig auf ein geheimes Zentrum zu. Sie treffen sich an einem Ort, den man nicht sieht. Er muss zwischen den Bäumen versteckt sein, in einer Lichtung vermutlich, etwas Erhabenes und in sich Ruhendes. Als wir langsam die Mauer entlanggehen, sehen wir an einer Stelle zwischen den Baumwipfeln ein rotes Dach aufblitzen. Dies ist das Schloss.
3
Hier war das andere Ende. Hier lief der Westen aus. Wenn man vom östlichsten Rand Europas kommt, findet man hier vielleicht ein Gegengewicht. »Finistère«, das Ende der Welt: die Bretagne bildet einen Gegenpol. Celan war in Czernowitz aufgewachsen, im äußersten Osten der unüberschaubaren Weiten des alten Habsburgerreiches, der nacheinander in den rumänischen Nationalismus, in die Naziherrschaft und in die Sowjetunion überging. Ende 1947 floh er zuerst nach Wien, siebenundzwanzigjährig, als »displaced person«, als Überlebender des Mords an den Juden. Ein halbes Jahr später zog er nach Paris weiter, vom äußersten Osten immer weiter nach Westen – mittellos, heimatlos, ein Jude mit deutscher Muttersprache. Um den 7. November 1951 lernte er Gisèle de Lestrange kennen, im Café Royal Saint-Germain, am Boulevard Saint-Germain 149. Danach ging es ins Tanzlokal Le Bal nègre. Gisèle stammte aus der französischen Hocharistokratie, und dass ihre Familie Celan ablehnte, war von Anfang an klar. 1952 heirateten sie, gegen den heftigen Widerstand von Gisèles Mutter und gegen den Einspruch ihrer Schwestern. 1954 legte die Mutter, Marquise Odette de Lestrange, das Armutsgelübde ab und ging als Schwester Marie Edmond in das Kloster der Congrégation des Servantes de l’Agneau de Dieu in Brest. Ihr Mann war gestorben, er hieß Edmond.
Es gibt ein Hochzeitsbild, vom 23. Dezember 1952, aufgenommen vor dem Pantheon. Das Rathaus des fünften Arrondissements, der Ort der Trauung, liegt am selben Platz. Celan hat die Augen niedergeschlagen, aber er lächelt verschmitzt. Er hält Gisèle locker im Arm, die andere Hand lässig in die Tasche geschoben. Der Mantel ist offen und lässt einen Blick auf den Anzug erahnen. Gisèle wendet sich Celan zu, hat ein offenes, glückliches Gesicht. Ihr Haar ist straff nach hinten gekämmt, mit einem strengen Seitenscheitel. Die Familie fehlt. Bei der Hochzeit sind nur noch zwei Freundinnen Gisèles dabei, Yolande de Mitry und Elisabeth Dujarric de la Rivière. Eigentlich sollen auch zwei Freunde Celans Zeugen sein, aber sie sind verhindert.
Celan war 1954 zum ersten Mal in der Bretagne, kurz bevor seine Schwiegermutter in Brest in das katholische Kloster eintrat. Es war eine Reise von elf Tagen, mit sehr vielen Stationen. Die Orte, die Celan und seine Frau vom 29. August bis zum 9. September besuchten, sind genauestens protokolliert: Port-Navalo, Concarneau, Saint-Guénolé, Pointe du Raz, Baie des Trépassés, Douarnenez, Plage des Dames, Camaret, Brest, Pointe de Pen-Hir, Les Tas de Pois, Pointe du Toulinguet, Manoir de Coecilian, Camaret, Le Fret, Brest, Le Conquet, Brest, Le Pouldu, Josselin. Die nächste Bretagne-Reise folgte knapp drei Jahre später, sie stand im Zeichen der Schwiegermutter im Kloster: Vom 26. April bis zum 1. Mai 1957 hielt sich die Familie in Brest auf.
In Trébabu verbrachten Celan, Gisèle und der 1955 geborene Sohn Eric zwei Wochen im Juli 1960 und zwei Monate im Sommer 1961. Diese beiden Jahre bilden einen entscheidenden Wendepunkt in Celans Leben. Zwei Stränge laufen parallel: 1960 erhielt er den Georg-Büchner-Preis, den wichtigsten deutschen Literaturpreis, und gleichzeitig erreichten die Intrigen von Claire Goll gegen Celan ihren Höhepunkt. Sie behauptete, Celan hätte aus Gedichten ihres Mannes Yvan Goll abgeschrieben, mit den erahnbaren Folgen – in der Öffentlichkeit hinterlässt alles Wirkung, was nach einem Skandal aussehen könnte. Dass es sich eher umgekehrt verhielt und Claire Goll Gedichte ihres Mannes nachträglich manipuliert hatte, stellte sich erst allmählich heraus. Irgendein Ruch bleibt immer haften, »es bleibt etwas hängen«. Für Celan verband sich das mit den antisemitischen Tendenzen, denen er in der Bundesrepublik begegnete und die er höchst sensibel wahrnahm; er wurde sich seiner Identität als Jude immer stärker bewusst. Celans Verletzlichkeit wuchs. Dass seine Eltern in einem ukrainischen Straflager von den Nazis umgebracht wurden, war ihm eingeschrieben. Er zog sich selbst von guten Freunden zurück, wenn er das Gefühl hatte, sie würden ihn nicht rückhaltlos unterstützen.
Celans psychische Krankheit brach erst später offen aus, nach diesen beiden Jahren mit den Aufenthalten in Trébabu. Ende Dezember 1962, während der Skiferien der Familie bei Saint-Michel-de-Maurienne im Departement Savoie, kam es zu ersten Wahnzuständen: Er beschuldigte einen zufälligen Passanten, an der Goll-Affäre beteiligt zu sein, und attackierte ihn. Die erste stationäre psychiatrische Behandlung erfolgte Anfang 1963 in Épinay-sur-Seine.
Die Goll-Affäre war der Auslöser. Alles war von ihr beeinflusst. Trotz des Büchnerpreises, trotz mehrerer Verteidigungen durch seine Freunde war Celan von der Rufmordkampagne tief erschüttert und getroffen. Bereits Ende der fünfziger Jahre elektrisierte ihn jede Nachricht, die ihn in Paris durch Zeitungen und durch die Post erreichte, und obwohl die »positiven« Kritiken seiner Bücher deutlich überwogen, trafen ihn einige verständnislose Bemerkungen im Innersten. Da machte ihm seine Frau, es war im Januar 1961, nach dem ersten Aufenthalt in Trébabu, einen Vorschlag. Sie sollten Paris für mindestens ein Jahr verlassen, an einen entlegenen Ort ziehen, an dem ihn die Nachrichten des Literaturbetriebs nicht so leicht erreichten, an dem er weitgehend ungestört von den Medien sein konnte. Dieser Ort war für sie Trébabu.
Die zwei Wochen vom 10.–24. Juli 1960, der erste Aufenthalt dort, müssen eine Zuflucht gewesen sein. Denn dass Gisèle im Januar darauf konkret an diesen Ort in der Bretagne denkt, als eine Möglichkeit abseits der Zeit, lässt Trébabu in einem seltenen Licht erstrahlen. 1961 verbringen sie hier lange Ferien, von Anfang Juli bis zum 5. September. Celan schreibt in dieser Zeit mehrere Gedichte, die fast den gesamten dritten Zyklus des Bands Die Niemandsrose einnehmen und die fast nie im Zentrum der Interpretation standen. Sie lassen sich in sein Gesamtwerk nicht so leicht einordnen.
Gisèle muss etwas gespürt haben. Trébabu, das war von den Orten, die sie erlebt hatte, wohl derjenige, an dem Celan am ehesten bei sich selbst sein konnte, in einer, wenn auch prekären, Balance, in einem Gleichgewicht zwischen sich und der Welt – der äußerste Westen als Ergänzung des heimatlichen, äußersten europäischen Ostens, ausgesetzt und fern. Das Extreme als Halt.
Die Tage in Trébabu bleiben im Dunkeln. Auch in den beiden Wochen des Jahres 1960, an die Gisèle denkt, war Celan tief verstrickt in die Goll-Affäre. Er schrieb in dieser Zeit unter anderem fünf Fassungen eines Briefes an den Feuilletonchef der Zeit, Paul Hühnerfeld, weil dieser in den Goll-Anwürfen offenkundig ein »Thema« witterte. Auch die höhnische, antisemitische Kritik von Günter Blöcker im Westberliner »Tagesspiegel« vom 11. Oktober 1959 hielt ihn immer noch in Atem. Aber einmal leuchtet etwas auf. Es gibt einen Brief an Nelly Sachs vom 20. Juli 1960 aus Trébabu, der von etwas ganz Anderem spricht. Da vernehmen wir einen Ton, den wir von Celan kaum kennen:
Wir sind seit acht Tagen in der Bretagne, unter heiteren Himmeln, in einem kleinen Häuschen am Rande eines riesigen und auf das menschen- weil hasenfreundlichste verwilderten Parks. Das Meer ist nahe, die Menschen, denen wir begegnen, einfach und freundlich. Wir denken, wie jeden Tag, zu Dir hinüber.
Und Du? Du kannst sicher nicht so gut radfahren wie Eric – das können nur wenige! –, also mußt Du wohl Gedichte schreiben. Was, wie ich Dir nicht verschweigen kann, bei weitem nicht so schwer ist. Weil man dabei bekanntlich nicht selbst fährt, weil da immer irgendeiner mithilft, besonders wenn’s bergauf geht, und weil’s da ja auch nicht zwei, sondern gleich mehrere Räder – für gewöhnlich fünf – gibt. Ob man dabei auch in entlegene Gehöfte gelangt, wo’s soeben zur Welt gekommene Ferkelchen zu sehen gibt? – Manchmal, sagst Du? Aber doch wohl nur ausnahmsweise – in Schaltjahren zum Beispiel … Wie? Wir haben gerade ein solches? Nun ja, dann – laß es eben dauern, schalte da nicht um! Wir tun dann dasselbe bzw. wir verlassen uns auf Dich! Denn daß wir uns auf Dich verlassen können und dürfen, das wissen wir.
Mit Heidekraut und Tausendgüldenkraut, mit Geißblatt und Fingerhut sowie einigem noch blühenden (Besen-, nicht Stech-)Ginster
Dein Paul
Vier Tage später wird Celan bestätigt bekommen, was er bereits ahnt: dass Nelly Sachs einen psychischen Zusammenbruch erlitten hat, eine Aktualisierung des Traumas, das von den Nazis herrührt – genau das, womit auch Celan jetzt gerade kämpft. Er kennt Nelly Sachs sehr gut. Es überdeckt sich vieles in diesen Tagen in Trébabu, es liegt vieles nebeneinander. Es ist da etwas verborgen.
4
Mit zwei, drei abrupten Wendungen geht es abwärts, der Wald blitzt links, der Wald blitzt rechts, und dazwischen ahnt man eine unvorhersehbare Helligkeit. Auf den Matsch, den man auf Meereshöhe erreicht, ist man nicht gefasst. Es ist ein illustrer Matsch, etwas Unbeständiges, Flirrendes: das sieht man schon, wenn man noch nicht begreift. Ebbe und Flut. Hier ist das Meer, auch wenn es nicht da ist. Verlorene Segelboote liegen im Schlick. Es ist eine bloße Vorstellung, dass sie in derselben Lage auch auf dem Wasser schaukeln könnten, unsichtbar verankert. Ein schmaler Streifen Meer tut sich auf, wenn man von der Höhe herunterkommt, da zieht nichts breit bedeutend hin – ein kleiner Einblick, eine dunkle Vorstellung, nichts von Elegien und von Weiten. Wir fahren die Straße lang, an Tankstellen vorbei, recht schüchtern wirkenden Angeboten, rechts vom Schlick ein paar wichtigtuende Häuser in Halbhöhenlage. Zwischen Pinien, die schnell verrauschen.
Es gibt keine Silhouette von Le Conquet. »Konk Leon« steht klein darunter auf dem Ortsschild, eine pittoreske Zweisprachigkeit, hier genügen einfache Verwaltungsmaßnahmen. Merkwürdig ist das Licht. Etwas Gleißendes liegt über der Bucht, auch wenn kein Wasser da ist, auch so stellt der Meeresgrund seine Entrücktheit aus. Eine leichte Steigung, die Bucht ist verdeckt durch zweckmäßige Einfamilienhäuser und nur bedingt effektive Geschäftsbauten, dann kommt die Kirche, ein Parkplatz, ein »Spar«-Markt, der vor kurzem noch »Casino« hieß oder gar »Les Mosquetaires«. Aber man kann sein Auto auch einfach auf der Straße abstellen.
Die Straße führt in einen kleinen Ortskern. An seinen Rändern gehen kleine, kaum einsehbare Wege zum Meer hinunter, sie heißen »Impasse« oder »Venelle«. Es gibt einen kleinen Platz, an dem dienstags auch ein Markt stattfindet, drum herum kleine Häuser. In einem Eckhaus zählt eine alte Frau in einer neuen Einrichtung sorgsam die Briefmarken ab, zieht sie aus merkwürdig zeitlosen Plastikmappen. Sie sagt immer noch »Francs« zu den Euros, die Centimes sind eh dieselben. In ihrem Laden gibt es Ansichtskarten und Souvenirs, davor stehen kleine Ständer mit austauschbaren Utensilien. Gegenüber ist die »Bar le Pen ar Bed«. Es handelt sich um alte bretonische Vokabeln, die hier immer wiederkehren, in Ortsnamen, in Hofbezeichnungen, in Aushängeschildern: »Pen« bedeutet »Kap«, »Bed« die Erde. »Pen ar Bed« bedeutet also dasselbe wie »Finistère« und finis terrae: das Ende des Landes. Die Bar hat offenkundig etwas Ländlich-Freakiges, wir sehen einen mittelalten Mann mit schütterem, aber zotteligem Haupthaar herauskommen, mit markanter Stimme und einer Kleiderordnung aus den siebziger Jahren.
Auf dem Platz stehen Autos, sie fallen nicht sonderlich auf. Viel Platz ist freigelassen für Fußgänger und die verschiedensten Fahrzeuge, die sich durch die angrenzenden Gassen winden, ab und zu schießt eines heraus. Wer aus dem Pen-Ar-Bed kommt, hat meist die ganze Straße für sich. Nur im Hochsommer ist es anders, in der Ferienzeit, das ist in Frankreich exakt ausgemessen. Dann quillt es von allen Seiten, dann herrschen Sondergesetze. Aber das ist von einem Tag auf den andern wieder vorbei. Der Alltag ist überschaubar. An der Rampe, die steil zum Hafen hinunterführt, gibt es noch eine Kneipe, die flächendeckend mit Pferdewetten wirbt, einen Lebensmittelladen, einen Bäcker, einen Metzger, ein Fischgeschäft und die Maison de la Presse, die stolz darauf ist, in der Provinz zu sein.