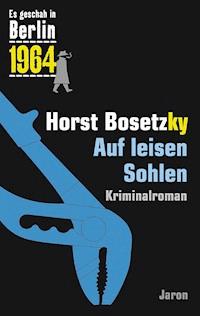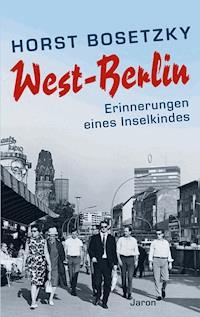3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mit Herz und Schnauze: Nach seinen Erfolgsromanen ›Brennholz für Kartoffelschalen‹ und ›Capri und Kartoffelpuffer‹ schildert Horst Bosetzky die weiteren Abenteuer seines beliebten jungen Helden Manfred Matuschewski als Lehrling bei Siemens und Student an der Uni in der Zeit zwischen Mauerbau und Studentenrevolte. Ein lebendiger und humorvoller Familienroman und eine Liebeserklärung an die Stadt Berlin. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Ähnliche
Horst Bosetzky
Champagner und Kartoffelchips
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Jean Paul, Die unsichtbare Loge
Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Manfred Matuschewski knipste die Nachttischlampe an und sah auf den Wecker. Es war kurz vor halb vier, und eigentlich hätte er noch zwei Stunden schlafen können, doch er konnte eben nicht. Überall juckte es, und er schwitzte wie ein Fieberkranker. Als er sich die Bettdecke vom Körper wegriß, schien der Schweiß, der seine Haut bedeckte, im Nu zu Eis zu erstarren, so daß er mächtig fror und sich schon mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus sah. Lies noch ein bißchen, bis du wieder müde wirst. Er ließ das Licht also an und versuchte es mit dem Grundriß der Betriebswirtschaft von Findeisen/Großmann. Bis zur Seite 19 hatte er sich schon vorgekämpft, nun kam das Kapitel »Die Kräfte des Betriebes«.
»Jeder Betriebsangehörige hat durch seine Arbeitsleistung zum Betriebserfolg beizutragen. Dazu muß er die für den Beruf erforderlichen Anlagen und Fähigkeiten haben.«
Die aber, da war Manfred sich schon nach einer Woche Siemens ziemlich sicher, hatte er nicht.
Manfred Matuschewski, hiermit verurteile ich dich zu drei Jahren Siemens.
Da saß er im Gefängnis, und an Flucht war nicht zu denken.
Er löschte das Licht und warf sich immer wieder herum, von links nach rechts, von rechts nach links, und hoffte, durch diese Anstrengung müde zu werden. Vergebens. Es wurde bestenfalls ein unruhiges Dahindämmern, von Traumfetzen zerrissen.
Als der Wecker dann klingelte, kurz vor halb sechs, war es wie eine Erlösung. Doch als Manfred im Badezimmer stand und sich die Zähne putzte, wurde ihm derart schwindlig, daß er sich am Waschbecken festhalten mußte. Er fühlte sich so zerschlagen und schwach wie nach einer schweren Grippe. Und dabei war es erst sein dritter Tag bei Siemens … 1092 andere galt es noch zu überstehen. Er glaubte nicht, daß er das schaffen konnte.
Es war, wie der RIAS-Sprecher zu Beginn der Nachrichten verlauten ließ, Mittwoch, der 3. April 1957. Beim Duschen dachte Manfred intensiv an Bibi Johns, und als seine Mutter ihn aus dem Bad kommen sah, freute sie sich, wie fröhlich er seine Lehre als Industriekaufmann doch anging.
»Wenn ich da noch an meine ersten Tage bei Tengelmann denke«, sagte sie. »Als ich abends nach Hause gekommen bin, habe ich in der Küche auf’m Stuhl gesessen und geweint. ›Mutti‹, habe ich gesagt, ›wozu lebe ich überhaupt?‹«
Eine gute Frage, wie Manfred fand. Ohne jeden Appetit schlang er sein Frühstück hinunter, zwei Scheiben Graubrot mit Quark. Egal, was er aß, er bekam eh Magenschmerzen davon. Voller Neid dachte er an seine Klassenkameraden aus der Albert-Schweitzer-Schule, die ein Studium begonnen hatten. Die lagen noch im Bett und schliefen. Auch sein Freund Dirk Kollmannsperger, der als Sitzenbleiber erst jetzt die 13. Klasse und das Abitur in Angriff nehmen durfte, hatte es wesentlich besser als er. So sehr er noch vor wenigen Wochen seine alte Schule, die Penne, verflucht hatte, so sehr sehnte er sich nun nach ihr zurück, nach ihrer Wärme, ihrer Geborgenheit. Wie sagte Dirk Kollmannsperger immer: »Alles ist relativ, nur der Müggelsee ist flach.« Schon wieder hatte er seinen Schlips bekleckert, den »Kulturstrick«, und er mußte ins Badezimmer laufen, um den Quark rauszuwaschen.
Danach blieb er gleich im Flur, um sein Sakko anzuziehen, seine Zwangsjacke. Sie war braun und grau, »gemuschelt«, wie seine Mutter das nannte. Als sie dieses Sakko bei Brummer in der Karl-Marx-Straße gekauft hatten (Um jedermann gut anzuziehn, ist Brummer fünfmal in Berlin), hatte er sich bei seinen Eltern mit einem Kuß auf die Wange bedankt. Sie waren stolz auf ihren Sohn.
Manfred zog den dunkelgrünen Mantel über, griff sich seine dunkelbraune Aktentasche, verabschiedete sich von den Eltern, die kauend in der Küche standen, und verließ die Wohnung. Als er wenig später die Treptower Straße in Richtung Sonnenallee hinunterging, fühlte er sich nicht wie 19, sondern wie 91. Müde, alt und krank, dem Sterben nahe. Und er haßte die Leute, die schon an der Haltestelle standen und drängelnd auf den Fahrdamm quollen, als die 94 kam. Bis zum Kottbusser Tor mußte er die Straßenbahn benutzen, dann fuhr er mit der Hoch- und Untergrundbahn, der grünen B I, bis zur Station Deutsches Opernhaus. Mit Wehmut dachte er an die Tage zurück, wo er leise gejauchzt hatte, wenn die 94 in Gestalt eines Triebwagens der Serie T 33 U herangerollt war, »Stube und Küche« genannt, weil halb Raucher, halb Nichtraucher. Jetzt aber war er ohne jedes Gefühl, innerlich abgestorben, völlig leer. Er lebte nicht mehr, er ließ das Leben nur noch über sich ergehen.
Zwar war er Siemens-Lehrling, doch die ersten beiden Monate seiner dreijährigen Lehrzeit sollte er nicht in einem der vielen Werke in Siemensstadt oder in der Zweigniederlassung, der ZN, in der Schöneberger Straße verbringen, sondern in einem anderen Betrieb, bei Nora nämlich. Nora war bis vor kurzem eine eigenständige Firma gewesen, hatte sich aber mit ihren Radio- und Fernsehgeräten nicht behaupten können und war von Siemens übernommen worden. Die Konkurrenz, so hatte es Manfred am ersten Tag hinter vorgehaltener Hand zu hören bekommen, Grundig und Blaupunkt vor allem, die bei Siemens viele Bauteile kaufte, hatte es nicht gern, wenn ihr Siemens mit eigenen Geräten die Kunden wegnahm. Deshalb hatte man weitere Einkäufe bei Siemens von dem Zugeständnis abhängig gemacht, daß man sich dort langsam vom Fernsehmarkt zurückzog. So war die Münchener Zentrale auf die Idee gekommen, Nora zu kaufen, und Manfred war nun in die Nora-Geschäftsstelle in der Wilmersdorfer Straße abkommandiert worden. Das war sein Pech, denn in der kleinen Klitsche war es mit Sicherheit viel miefiger als draußen in Siemensstadt.
Schon in der U-Bahn stand einer dieser fürchterlichen Nora-Spießer hinter ihm, Ackermann mit Namen. Er war kaum älter als er, hatte ein teigiges Kinderschändergesicht und sabberte mit wulstigen Lippen vor sich hin. Er fühlte sich Manfred maßlos überlegen, da er längst ausgelernt hatte und als kaufmännischer Angestellter gutes Geld verdiente. Herr Ackermann belehrte ihn dahin gehend, daß Gutschriften, in der Hauptsache Bank- und Postschecks sowie Tz-Verträge, in rote Mappen kämen, Belastungen – also Rechnungen – dagegen in gelbe Mappen. »Was Sie gestern falsch gemacht haben. Ja, ja, die Abiturienten …«
Eine halbe Stunde später saß Manfred an seinem Arbeitsplatz in der Verkaufsabteilung des Nora-Vertriebs. Vier Schreibtische waren zu einem Block zusammengeschoben. Ihm gegenüber hatte sich Frau Scholz häuslich eingerichtet. Sie war so dick wie die Herrscherin einer polynesischen Insel und schwitzte entsprechend. Auf die Fünfzig ging sie zu, und da ihre beiden Kinder aus dem Haus waren, nutzte sie die Gelegenheit, Manfred ein wenig zu bemuttern. Neben ihr, von Manfred aus gesehen rechts am Fenster, erledigte Fräulein Strich die Korrespondenz der Abteilung. Sie war zierlich und apart und überprüfte mehrmals in der Stunde ihr Makeup. Immer trug sie Pumps und sehr enge Pullover und Röcke, und Manfred hoffte, daß sie Nymphomanin war und ihn irgendwann verführte. Ihr Nachname schien in dieser Hinsicht einiges zu versprechen, ihr Vorname – Elvira – weit weniger. Rechts von ihm, also vis-à-vis von Fräulein Strich, hatte Herr Kucharski, ihr Gruppenleiter, seinen Platz. Sein Drehstuhl war um einiges größer und teurer als ihrer. Da sein Gesäß sehr schmal geraten war und die anthrazitfarbene Sitzfläche bei weitem nicht füllte, bot er Frau Scholz öfter den Stuhltausch an, denn bei ihr quoll seitlich etliches Fleisch aus der Schale heraus. Doch sie lehnte immer wieder dankend ab. Auch wenn Herr Kucharski fehlte, ließ sie die Finger von seinem Stuhl, weil ihr Gefühl für Rang und Würde diese Inbesitznahme nicht zuließ. Dabei war Herr Kucharski öfter nicht zugegen, weil er eine schwere Kopf- und Hirnverletzung hatte und immer, wenn die Schmerzen unerträglich wurden und die Erinnerung kam, zur Flasche griff. Bei der Landung der Alliierten in der Normandie war es passiert: Vor seinem Schützengraben war plötzlich ein Amerikaner erschienen, und Herr Kucharski hatte geistesgegenwärtig den Karabiner fallen gelassen und die Hände hochgerissen, doch der junge GI hatte die Nerven verloren und den Abzug seiner MP durchgezogen. Herr Kucharski hatte überlebt, aber manchmal war es nicht mehr zum Aushalten. Niemand nahm es sich heraus, über ihn zu lästern.
Manfreds Tätigkeit bestand darin, die Gerätenummern der Fernseh- und der Radioapparate sowie der Musiktruhen, die auf den Lieferscheinen standen, mit denen auf den Rechnungen und den Lagerbestandslisten zu vergleichen. Zudem hatte er den Klammeraffen zu bedienen und Schriftstücke zu lochen und sauber abzulegen.
»Herr Matuschewski«, mahnte Frau Scholz, »erst kommt oe, dann ö, also Roeder immer vor Röder.«
»Ja, Entschuldigung.«
Schon um neun Uhr war er völlig durchgeschwitzt. Das Jackett abzulegen schickte sich nicht. Zumindest nicht, bevor Herr Kucharski dies getan hatte, und der zögerte immer, weil er zu kurze Arme oder aber zu lange Hemden hatte, sich jedenfalls immer Gummibänder um die Oberarme wickeln mußte, was nicht eben elegant aussah. Besonders aber litt Manfred darunter, daß seine Füße in den engen Schuhen zu kochen begannen. Auch kämpfte er mit dem Schlaf. Was ihn wachhielt, war der Gedanke, es mit Fräulein Strich im Fahrstuhl zu treiben. Als Frau Scholz plötzlich aufschrie, weil ihr ein Berg von Ordnern zu entgleiten drohte, und er schnell aufspringen mußte, um ihr zu Hilfe zu eilen, hatte er erhebliche Mühe, seine Erektion zu verbergen.
»Haben Sie etwas an der Schulter? Sie gehen ja so krumm.«
Als er die Monotonie nicht länger ertragen konnte, flüchtete er sich ins Lager, um Gerätenummern zu recherchieren. Allein in dem Labyrinth aus aufgestapelten Kisten, fiel er auf einen ausrangierten Stuhl und begann, einen Brief an Renate zu schreiben, die ehemalige Klassenkameradin, die nach Westdeutschland gezogen war, aber zur Abiturfeier in die Aula gekommen war, seinetwegen.
O du loses, leidigliebes Mädchen,
Sag mir an, womit hab’ ich’s verschuldet,
Daß du mich auf diese Folter spannest,
Daß du dein gegeben Wort gebrochen?
Liebe Renate, geliebte Renate,
dies ist das Gedicht »Morgenklagen« von Goethe, und auch ich klage an diesem Morgen bei mir in der Firma: Warum bist Du nicht hier? Hier im Lager wäre ein Lager für uns. Ich denke andauernd an Dich, aber Du hast mich sicher schon vergessen. Das »erste Mal« mit Dir, ich kann es nicht vergessen, und ich habe gedacht, daß es unsere Verlobung war. Für Dich aber war es scheinbar nicht mehr, als wenn wir nach der Schule zusammen ein Eis bei »Giuseppe« gegessen hätten. Ich weiß, ich bin nur Lehrling, aber immerhin Stammhauslehrling bei Siemens und nicht Ladenschwengel in einer kleinen Klitsche. Wenn sie sagen, daß wir den Marschallstab im Tornister haben, dann stimmt das schon. Es gibt also eine Zukunft für mich – aber nur mit Dir. Bitte, bitte, melde Dich. Du kannst Dir denken, wie mir zumute ist, wenn ich daran denke, wie Du im durchsichtigen Nachthemd zum Fenster gehst und …
Weiter kam er nicht, denn die Tür ging auf, und jemand kam herein. Am typischen Zigarrengeruch erkannte er sofort, daß es Herr Gehrke war, der Leiter der Kassenstelle. Schnell ließ er den halbfertigen Brief unter seinen Papieren verschwinden. Gleich am ersten Tag waren er, der Stammhauslehrling mit Abitur, und die beiden gewöhnlichen Lehrlinge von Fräulein Schiller, der Chefsekretärin, durch die Firma geführt und allen vorgestellt worden. An den Kassierer konnte er sich gut erinnern. Einmal der Zigarre wegen und zum anderen, weil er Werner Forßmann, dem Nobelpreisträger für Medizin, ziemlich ähnlich sah. Der hatte sich – alle sprachen davon – im Eigenversuch einen Katheter ins Herz geschoben. Weil Bimbo, Manfreds Schulfreund, in einem Aufsatz geschrieben hatte, Forßmann hätte das mit einem Katheder getan (Randbemerkung von Frau Hünicke: »… dem aus der Aula womöglich …?«), und die Klasse sich daraufhin halbtot gelacht hatte, war ihm das gut in Erinnerung geblieben.
»Ah, unser neuer Lehrling!« rief Herr Gehrke, und sein breites Bernhardinergesicht glänzte vor Wohlwollen. »Du könntest mir einmal einen kleinen Gefallen tun …«
Da Herr Gehrkes rechte Hand bei diesen Worten tief in der Hosentasche steckte, um dort wild herumzufummeln, zuckte Manfred zusammen und sah sich verstohlen nach einem Fluchtweg um.
»Ja, aber …«
»Kein Aber, das ist die Pflicht aller Lehrlinge.« Herr Gehrke kam näher, die Hand noch immer in der Tasche rotierend.
Manfred brach der Schweiß aus allen Poren. Er wich zurück.
»Du holst mir bitte mal eine Kiste Zigarren von draußen …« Endlich hatte Herr Gehrke den Zwanzigmarkschein in den Tiefen seiner Hosentasche ausfindig gemacht und herausgezogen.
Manfred atmete auf. »Ja, gerne …«
Als er dann draußen auf der Wilmersdorfer Straße nach dem Zigarrenladen suchte, überkam ihn wieder die Mutlosigkeit. Ein Ausspruch seiner Kohlenoma ging ihm durch den Kopf: Gestern noch auf hohen Rossen, heute durch die Brust geschossen. Und er dachte: Tiefer kann man nicht mehr sinken. Wenn es wenigstens für den Chef gewesen wäre. Aber nun mußte er sogar für einen kleinen Angestellten private Botengänge erledigen. Und wenn er nein gesagt hätte? Hatte er nicht, ging wohl auch nicht, denn überall war es ja zu hören, so feierlich und schauerlich wie im Chor einer altgriechischen Tragödie: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Eine Straßenbahn rollte vorüber, ein Verbundtriebwagen der Linie 44. Was in aller Welt hinderte ihn, sich in diese Bahn zu setzen und zu flüchten. Aber was dann? Er hatte kein Geld, keine eigene Wohnung, keine Arbeit, er wußte nicht, was er sonst machen oder studieren sollte. Draußen war er verloren, im Knast aber konnte er in einer warmen Zelle überleben. Also holte er die Zigarren, also ging er zu Nora und Siemens zurück.
Im Büro fauchte Fräulein Strich ihn an. »Sie haben das Kohlepapier falsch rum eingelegt, so daß der Text hinten auf dem Original drauf ist und nicht auf dem Durchschlag hier. Mein Gott! Sie setzen sich jetzt an die Maschine und tippen das neu ab. Ich geh’ inzwischen essen. Mahlzeit!«
Manfred machte sich an seine Strafarbeit. Gottergeben wie ein Sklave auf den Baumwollfeldern. Augen zu und durch.
Stumpf und schwitzend quälte er sich herum, bis auch er zum Mittagessen gehen durfte. Die Kantine befand sich oben unter dem Dachboden, und er stieg die Treppe hinauf, obwohl er das Gefühl hatte, jeden Augenblick einem Schwächeanfall erliegen zu müssen. Sein Herz raste, ein Geschmack von langer Krankheit und Grünspan lag ihm auf der Zunge. Er beneidete die anderen Lehrlinge, die zu dritt oder zu viert in den Berliner Siemenswerken steckten und immer jemanden hatten, mit dem man sich aussprechen konnte … bei Nora war er mutterseelenallein. Das Selbstmitleid trieb ihm Tränen in die Augen. Gott, warum hatte er seinen Eltern nicht gesagt, es sei sein großer Wunsch, Jura zu studieren! Dann könnte er jetzt zu Hause im Bett liegen und warten, bis das Semester losging.
So aber stand er verloren in der Nora-Kantine und nestelte seine Essensmarke heraus. Königsberger Klopse gab es, mit Quetschkartoffeln. Die Frau des Kantinenwirts fischte den Klops aus der Kapernsoße. Nachdem sie den kleinen Fleischball aufgespießt hatte, klemmte sie ihn mit dem Daumen fest und schnippte ihn auf seinen Teller. Beim zweiten Klops aber mißglückte das Manöver, und das leichengraue Gebilde rutschte weg. Doch ihr Mann hatte aufgepaßt und stieß den Klops mit seinem dicken Bauch wie eine Billardkugel zur Mitte des Tisches zurück. Das wäre ja noch angegangen, wenn diesen Bauch nicht eine furchtbar schmutzige Kantinenpächterschürze geziert hätte. Seinen Klops aber mußte Manfred essen. Ihn zu verschmähen, durfte er nicht wagen: Am Nebentisch nämlich saß Herr Gosch, der Chef, und der hatte ihn fest ihm Auge.
Nachmittags wurde Manfred mit den beiden anderen Lehrlingen zum Prokuristen gerufen. Die Chefsekretärin, Fräulein Schiller, wies sie an, im Vorzimmer Platz zu nehmen und zu warten. Herr Gosch sei in einer Besprechung. Manfred wurde der Stuhl direkt vor ihrem Schreibtisch zugewiesen. Hinter einer gepolsterten Tür erklangen gedämpfte Stimmen. Er bekam feuchte Hände und fühlte sich zu Däumlingsgröße schrumpfen. Jetzt wußte er, was gemeint war, wenn irgendwo zu lesen stand, der Generaldirektor sei von einer Aura der Macht umgeben. Zugleich überkam ihn eine beträchtliche Erregung, denn Fräulein Schiller war attraktiver als all die Sekretärinnen, die er je im Film gesehen hatte. Mit ihrem engen Rock, den hohen Pumps und Beinen wie aus einer Strumpfreklame brachte sie seinen Hormonhaushalt ordentlich durcheinander.
Endlich wurden sie vorgelassen. Auch Herr Gosch schien nicht echt zu sein, sondern ein Schauspieler aus einem Film mit Theo Lingen, Heinz Erhardt und Peter Frankenfeld. Er wies in der Tat eine gewisse Ähnlichkeit mit Gunther Philipp auf, nur daß er schon grau- bis weißhaarig war.
Es war das größte Zimmer im Haus. Ganz hinten in der Ecke stand der Schreibtisch, ein Gebilde aus dunklem Edelholz und von einer Größe, wie Manfred sie auch nur aus Filmen kannte, breit und lang wie eine Tischtennisplatte. So leer wie er war, hätte er sich auch bestens für ein kleines Spiel geeignet.
Er machte eine tiefe Verbeugung, als er Herrn Gosch die Hand geben durfte. Die Sklaven in Onkel Toms Hütte hatten sich ihrem Massa wohl nicht anders genähert: unterwürfig und ängstlich. Ein Wort von ihm, und es war aus mit ihnen. Ein Wort von Herrn Gosch, und Manfred stand auf der Straße. Dabei wünschte er sich nichts sehnlicher, als auf der Straße zu stehen und wieder frei zu sein … Dieser Widerspruch war unerträglich. Zum Glück durften sie sich setzen, und Fräulein Schiller stellte eine Büchse mit Keksen auf den Besuchertisch. Herr Gosch verblieb auf seinem Thron, während sie, die drei Lehrlinge, sich in Sesseln niederlassen mußten, die sie noch kleiner machten, als sie ohnehin schon waren. Neben Manfred waren es zwei Siebzehnjährige: ein O-beiniger Fußballer, den die kaufmännische Lehre wenig kümmerte, da er sicher war, bald Karriere bei Hertha BSC oder Tennis Borussia zu machen, und eine geborene Hausfrau und Mutter, die schon den Mann gefunden hatte, der ihr die Erfüllung bringen würde. Beide waren so unbelastet und munter, daß Manfred über das übliche »Hallo, wie geht’s?« keinen Draht zu ihnen fand.
Herr Gosch legte seine Zigarre beiseite und setzte zu einer kleinen Rede an.
»Liebe junge Freunde, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer großen Nora-Familie. Lassen Sie mich mit etwas sehr Grundsätzlichem beginnen: Der Wert der menschlichen Arbeitskraft liegt nicht im physischen Aufwand, er liegt einzig und allein im Geistigen, oder besser gesagt: im Moralischen. Dazu gehört, daß Sie all das freudig tun, was Ihnen von Ihren Kolleginnen und Kollegen und vor allem Ihren Vorgesetzten hier bei uns vorgelebt wird. Und denken Sie immer an die großen Worte Goethes und Schillers: ›Immer strebe zum Ganzen / Und kannst du selber kein Ganzes / Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an!‹ Und dieses Ganze, in das Sie sich dienend einordnen sollen und müssen, ist unsere Firmengemeinschaft, in der es ein klares Oben und ein klares Unten gibt. Wenn Sie sich bewähren in Leistung und Gefolgschaftstreue, dann klettern Sie langsam, aber sicher auf der Karriereleiter nach oben. Jetzt aber sind Sie ganz am Anfang, und aller Anfang ist ja bekanntlich schwer, und Sie sollten sich immer wieder das eine ins Gedächtnis rufen: daß Lehrjahre keine Herrenjahre sind.«
Manfred ging an seinen Schreibtisch zurück und bemerkte, daß sie am Morgen vergessen hatten, das Blatt vom Kalender zu reißen. Er tat es und las, was auf der Rückseite stand: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn. Das Lied aus dem Tonfilm Die große Liebe.
Er wußte, nur ein Wunder konnte ihn noch retten.
Manfred stand am Schraubstock und feilte hingebungsvoll an einem Eisenblock herum. Dessen Maße – 5,8 x 5,3 x 1,8 cm – entsprachen etwa denen von anderthalb Zündholzschachteln. Eine Schraubzwinge sollte das werden, wozu aus dem Rechteck ein U zu machen war, man also aus der Mitte ein Riesenstück herauszufeilen hatte. Da hieß es: tüchtig »schrubben«.
An dreißig weiteren Arbeitsplätzen stand der gesamte kaufmännische Siemens-Nachwuchs des Standorts Berlins, das heißt, alle Stammhauslehrlinge des Jahrgangs 1957 mit Ausnahme der beiden Mädchen, die man in dieser Männerwelt nicht akzeptierte.
Kramer, der Meister der Lehrwerkstatt, kam an Manfreds Schraubstock, hieß ihn, das Werkstück herauszunehmen, und prüfte die Arbeit mit Hilfe einer Schieblehre.
»Exakt! Besser kann es keine Maschine machen. Eine glatte Eins.«
Manfred strahlte. Plötzlich war er der Star der Truppe, und das Leid der Nora-Tage war zunächst vergessen. War dies schon das ersehnte Wunder oder nur ein Zwischenhoch?
Nach sechs Wochen kaufmännischer Praxis in Werken und Vertrieb hatte Siemens alle gehobenen Rekruten hier im alten Wernerwerk versammelt, um sie mit dem feinmechanischen Handwerk vertraut zu machen. Ein »Koofmich«, so hatte Herr Frantz, Manfreds Ausbildungsleiter, gleich am Anfang gesagt, müsse wissen, wie die Produkte, die er zu verkaufen habe, werkseitig entstünden.
Rechts neben Manfred mühte sich Bernhard Bleibaum mit seiner Riesenfeile und tat sich so schwer damit wie ein Kleinkind. Er kam aus einer alten jüdischen Oberschichtfamilie und hielt es für unter seiner Würde, hier wie ein Prolet zu schuften. Außer einem holländischen Diamantenschleifer hatten sie nie einen Handwerker in der Familie gehabt, alle waren sie Historiker, Mediziner und Juristen gewesen. Bernhard Bleibaum hatte in einem Amsterdamer Versteck den Holocaust überlebt. Er war maßlos arrogant, und weil er viel mehr wußte als alle anderen und ungleich intelligenter war, hieß er bei den meisten nur »Zwerg Allwissend«. Daß er hier bei Siemens lernte, war ihm von einer Tante, die eine Kosmetikfirma besaß, nahegelegt worden. »Entweder du lernst von der Pike auf – oder ich vererbe alles dem Tierschutzverein!« Nun, wenn schon lernen, hatte er sich gesagt, dann bei der nobelsten Adresse. So stand er also hier am Schraubstock. Daß er handwerklich so unbegabt war, wurmte ihn gewaltig, und so war er Manfred außerordentlich dankbar, daß der für ihn feilte und bohrte, schmiedete und schliff. Meister Kramer bekam nicht mit, daß Bleibaums Werkstücke überwiegend von Manfreds Hand gefertigt waren. Das war der Beginn einer großen Freundschaft, die auch deswegen so eng wurde, weil Manfreds Vorfahren mütterlicherseits ebenfalls dem mosaischen Glauben angehört hatten. So gestand Bernhard Manfred denn auch, sein jüdischer Taufname sei Moshe.
Links von Manfred hatte Wolfgang Schmitt seinen Arbeitsplatz. Der war nun der krasse Gegensatz zu Moshe, einer jener Charaktere, die beim Fußball die Rolle des Manndeckers spielen. Sicher, auch er hatte das Abitur gemacht, doch las er viel lieber BILD als Böll. Handfest und allezeit fröhlich war er und genoß es, Stammhauslehrling bei Siemens zu sein. Er hatte von nichts anderem geträumt, als sein Leben lang am Schreibtisch zu sitzen und Rechnungen zu prüfen, Turbinen zu verkaufen oder ein Lager zu verwalten. Die Natur hatte ihn mit blühender Akne geschlagen, und so war sein Gesicht mit Erhebungen und tiefen Kratern übersät. Es glich einem Golfball mit blauroten Farbtupfern.
Manfred war dabei, mit einem kleinen Stahlstempel den Namen MATUSCHEWSKI in seine Schraubzwinge zu schlagen, was, sollte es sauber und präzise wirken, ungeheuer schwierig war und die vollste Konzentration erforderte. Ein falscher Hammerschlag, zu stark oder zu schräg, und alles war verdorben. Dann mußte man zum Schraubstock zurück, um ein paar weitere Zehntelmillimeter vom Rohling zu feilen und neu zu beginnen. Passierte das öfter, dann blieb so wenig Masse übrig, daß man ganz von vorn anfangen mußte. MATU… Sein langer Name war ein Fluch. Er legte erst mal eine kleine Pause ein und sah auf die S-Bahn hinaus, die hier wie eine Hochbahn auf stählernem Viadukt durch Siemensstadt fuhr. Dann machte er sich an das S.
Da geschah es.
»In Deckung!« schrie Meister Kramer. Und als erster ging er flach zu Boden. Die anderen folgten ihm.
Was war passiert? Benschkowski hatte ein Stück Eisen von der Größe eines Taschenbuchs gefunden und versucht, Löcher hineinzubohren, um seiner Freundin zum Geburtstag einen originellen Bleistiftständer schenken zu können. Es wäre wohl auch alles gutgegangen, wenn ihn nicht sein Freund Heimann mit einer Zote abgelenkt hätte. Prustend vor Lachen hatte Benschkowski den Hebel der Bohrmaschine losgelassen, und nun raste das schwere Eisenstück, fest am Bohrer sitzend, unrund und eiernd im Kreise herum, wurde immer schneller. Es war nur eine Frage von Sekunden, bis der Bohrer abbrechen und Benschkowskis Bleistiftständer wie ein Geschoß durch die Werkstatt fliegen würde. Bekam es einer an der Kopf oder gar ins Auge, konnte ihn das für Wochen ins Krankenhaus bringen.
Jetzt! Das Eisenstück flog fünf Meter weit und schlug krachend auf Günther Gluecks Arbeitstisch ein, wo es eine Apfelsaftflasche und einen Füllfederhalter zerschmetterte.
»Treffer!« schrie Benschkowski.
Darauf kam Meister Kramer mit seinem fetten Bierbauch angerollt, packte Benschkowski am Schlafittchen und schleppte ihn zu Frantz. Alle rechneten damit, daß sie Benschkowski nun feuerten, doch der kam mit einer milden Ermahnung davon. Schließlich waren seine Eltern beide im Dynamowerk beschäftigt. Manfred merkte schnell, was hier bei Siemens zählte.
Sie gingen in die Kantine, wo Manfred an einem Tisch zu sitzen kam, an dem Hippler und Willich, ihre beiden »älteren Herren«, den Ton angaben. Darüber, wie sie es trotz ihrer geringen Begabung geschafft hatten, zu Elite-Lehrlingen zu werden, wurde viel gemunkelt, und keiner wußte es genau. Hippler hatte eine unheimliche Ähnlichkeit mit Adolf Hitler und ließ es sich, obwohl ganz sicher kein Nazi im engeren Sinne, mit breitem Grinsen gefallen, daß ihn die meisten mit »Heil Hippler!« begrüßten. So auch Moshe Bleibaum, was Manfred nie begreifen sollte.
Hippler war ein Fan von Hertha BSC und freute sich, daß die Elf von der »Plumpe« nach dreizehnjähriger Pause wieder einmal die Berliner Fußballmeisterschaft errungen hatte. Faeder, Schüler, Taube und Schimmöller waren seine Helden.
Willich schwärmte vom Film des Jahres, von Sissi, die junge Kaiserin, und wäre zu gerne Karlheinz Böhm gewesen, der Kaiser Franz.
Moshe Bleibaum, klein und bestenfalls Fliegengewicht, knurrte ihn an. »Und schweigst du nicht, Willich, so brauch’ ich Gewalt.«
Manfred dachte an Renate und wie es war, mit ihr im Kino zu sitzen und die Hand auf ihren Knien zu haben. Vielleicht kam sie am Wochenende nach Berlin. Aber da gab es auch den Klubkampf in Lichterfelde draußen auf dem Kasernengelände: 7. Amerikanisches Infanterieregiment gegen NSF und den SSC Südwest, und er wollte zum ersten Mal in der Männerklasse über 100 Meter starten. Vielleicht gab es da das große Wunder, er lief 10,3 – und ein Späher der University of California holte ihn zum Studium nach Amerika und rettete ihn. Schluß mit der Sklaverei bei Siemens.
»Auf die Plätze …«
Manfred fühlte sich unendlich schlapp, und pinkeln mußte er auch. Aber das war immer so gewesen, wenn er in den Startlöchern hockte, und gehörte ganz einfach dazu.
Neben ihm kniete Dirk Kollmannsperger, sein alter Freund und Spezi, der damals den Sprung von der 12. in die 13. Klasse nicht geschafft hatte und nun ganz gemächlich das Abitur baute.
»Fertig …«
Manfred kam hoch und fiel in den Schuß, ohne daß der Starter es merkte, hatte also ideale Voraussetzungen, eine Superzeit zu laufen. Doch seine Muskeln waren zu schwach, seine 77 Kilo richtig abzufangen, und so stürzte er fast. Mühsam kam er in Tritt und suchte Anschluß zu halten. Der farbige Amerikaner auf Bahn 2 war schon enteilt, und auch Dirk Kollmansperger zog ihm davon. Den hatte er bislang immer weit hinter sich gelassen, und gegen seine 11,1 nahmen sich die 11,9 des Freundes auch ausgesprochen mickrig aus. Manfred riß sich zusammen, doch dabei verkrampfte er sich nur und verlor noch mehr an Boden. Klar: das frühe Aufstehen, um nach Siemensstadt zu kommen, die Plackerei bei Nora und in der Lehrwerkstatt, das wenige Training. Im Ziel brach er fast zusammen, ausgebrannt wie nach einem Marathonlauf, und seine Zeit war nicht 10,3, sondern 12,3, exakt dieselbe wie bei seinem ersten Start als Jugendlicher, damals im Katzbachstadion.
Aus der Traum vom großen Sprinter. Er warf seine Spikes in die Ecke. Nichts war es mit dem großen Wunder. Er setzte sich auf die kleine Tribüne und sah den anderen zu, saß da wie ein Opi vor dem Bauernhaus, wenn die Enkel spielten.
Die Wunder ruhn, der Himmel ist verschlossen. Interpretieren Sie diesen Satz der Johanna von Orleans. Deutschunterricht bei Frau Hünicke. Vor drei Jahren erst gewesen und dennoch Ewigkeiten her. Hatte er sie damals immer verflucht, so sehnte er sich jetzt nach seiner alten Schule zurück.
Alles lief falsch, und das Glück wohnte immer am anderen Ufer.
GIs, mit Maschinenpistolen behangen, hasteten vorüber. Wenn sich ein Schuß gelöst und ihn getötet hätte, es wäre ihm sehr recht gewesen.
Als er nach Hause kam, fand er einen Brief von Renate auf seinem Tisch. Sie schrieb, sie müsse ihn unbedingt wiedersehen. »Um sieben unter der Uhr am Bahnhof Zoo …«
Da geschah das Wunder doch noch. Sie arbeitete jetzt bei Bayer in Leverkusen und war gewiß gekommen, um ihn zu sich zu holen. Und er wußte schon genau, was sie sagen würde: »Wir heiraten nächsten Monat, und du studierst dann in Köln. Was ich verdiene, reicht dicke für uns beide. Du mußt unbedingt von Siemens weg, das ist dein Tod.«
Lange lag er in der Badewanne und stellte sich vor, wie es mit Renate sein würde.
Als er dann am Hardenbergplatz stand und auf sie wartete, hatte er Angst, daß sie tatsächlich kommen würde. Und alles, was er getan hatte, kam ihm furchtbar schmutzig vor. Bei ihr im Zimmer: wie bei einer Prostituierten. Und ihre Eltern: o Gott. Sie waren in irgendeiner Sekte, und alles war so dumpf. Sein Schwiegervater – kein Arzt, sondern Lagerarbeiter, seine Schwiegermutter – keine Lehrerin, sondern Verkäuferin, und statt der Villa in Dahlem eine kleine miefige Wohnung in der Reuterstraße. Er hatte schon gehofft, daß in seinem Leben alles eine Nummer größer sein würde. Aber ein Mann war nur ein Mann, wenn er es schon einmal getan hatte, und Renate hatte es ihn tun lassen. Schnell, bevor ihre Brüder wieder ins Mehrbettzimmer stürzten, um nach einem Ball zu suchen, und bevor ihre Mutter schrie: »Rena, wo bleibste denn: Kartoffeln schäl’n!«
Da kam sie von der Gedächtniskirche her, und ihr weißes Kleid bauschte sich erst und schmiegte sich dann eng an ihren Körper, als der Wind ein wenig böig wurde. Sofort vergaß er alle Mißstimmigkeiten und hatte nur den einen Gedanken, mit ihr auf einer Wiese zu liegen und … Eine Göttin war sie und kein Schmuddelkind.
Als sie ihn begrüßte, war es wie ein Schock für ihn. Nicht anders als Fräulein Strich morgens im Büro, so gab sie ihm die Hand. Kein Kuß, keine Umarmung.
»Tag, Manni.«
»Tag, Rena.«
»Du, ich muß gleich wieder los.«
Seine Enttäuschung war so unermeßlich groß, daß er wie gelähmt neben ihr stand, sich klein und unscheinbar vorkam, unfähig war, um sie zu kämpfen. Jetzt hätte er ganz souverän bleiben und so witzig sein müssen wie die Männer im Film. Statt dessen aber stieß er nur ungeschickt hervor, daß er schon wisse, was geschehen sei: »Du hast ’n anderen, was!?«
Renate sah an ihm vorbei zur Uhr hinauf. »Ja …«
Wie sie das sagte, klang das nach Entschuldigung, enthielt wohl auch die Bitte, jetzt um sie zu kämpfen, doch Manfred verstand diese Feinheiten nicht, war nur in seinem Stolz verletzt. Dann eben nicht, es gibt ja auch noch andere, dachte er trotzig.
»Kann man nichts machen«, sagte er und streckte ihr die Hand hin. »Dann auf Wiedersehen beim Klassentreffen 1976 – fünfundzwanzig Jahre, nachdem wir uns in der Albert-Schweitzer-Schule zum ersten Mal gesehen haben.«
Renate zögerte. »Er ist Zahnarzt und …« Sie machte ihre korallenrote Handtasche auf, um nach einem Taschentuch zu suchen.
Es geschah nur noch mit Manfred, er gehorchte Impulsen, die unkontrolliert aus seinem Innern kamen. »Ich dachte, wir sind miteinander verlobt …«
Sie sah ihn an. »Warum denn das?«
»Schließlich haben wir miteinander …«
»Da wär’ ich mit vielen verlobt«, entfuhr es ihr.
»Ach, so ist das …« Manfred hatte das schon vermutet, aber dennoch war er zutiefst erschüttert, es so direkt von ihr zu hören. Ohne es zu wollen, riß er den Fünfzigmarkschein aus dem Hemd, den er sich für Kino und Essen eingesteckt hatte, und stopfte ihn in ihre Tasche. »Da, für das eine Mal!«
Sie haute ihm kräftig eine runter und verschwand im nahen U-Bahn-Eingang.
»Nennurbdnuseg!« rief der Mann, der in der Tür des S-Bahn-Wagens stand. »Umsteigen zur U-Bahn-Linie D wie Dora. El Dorado, das Goldland.«
Jeden Mittwochmorgen, wenn Manfred zur Siemens-Werkschule fuhr, begegnete er dem selbsternannten Zugschaffner, einem Rentner von vielleicht siebzig Jahren, der ganz normal gekleidet war und durch nichts anderes auffiel als durch seine Macke, die Stationsnamen auf dem Berliner Vollring auszurufen – allerdings rückwärts gelesen.
»Gniddew!« Der Wedding war sein absoluter Lieblingsbahnhof, und am Klang von Gniddew berauschte er sich richtig und schrie sein Glück in den Morgen hinaus.
Manfred, der in der Kuschelecke eines der alten hölzernen Wagen eingenickt war, schreckte hoch.
»Eßartsztiltup.« Schmatzend mit wulstigen Lippen gesprochen.
»Eßartslessueb.«
»Ediehnrefgnuj.«
Putlitzstraße, Beusselstraße, Jungfernheide – hier war umzusteigen in die Stichbahn nach Gartenfeld, und hier traf Manfred jedesmal einen der dreißig anderen Stammhauslehrlinge, die sich jeden Mittwoch ganz- und jeden Freitag halbtäglich in der Siemens-Werkschule zu versammeln hatten. Diesmal war es Matthias Labové, ein feister, wortgewandter Schleimer mit dicker Brille, hoher Intelligenz und durchaus einiger Begabung zum Kabarettisten und Satiriker.
»Wer reißt so früh durch Nacht und Wind«, lispelte Matthiaß Labové. »Wollen wir auch heute wieder unßere ganße Kraft in den Dienßt am Hause Siemenß stellen …?«
Für einen Augenblick verschmolzen vor Manfreds Augen die Konturen Labovés mit denen des rückwärtssprechenden Originals, und er vermochte nicht zu entscheiden, ob die beiden nun einen Sprach- oder er einen Hörfehler hatte. Vielleicht hörte er alle Menschen nur noch zischeln und lispeln.
Auf dem Bahnhof Siemensstadt stiegen sie aus und gingen zur alten Hauptverwaltung des Elektro-Imperiums, das im Jahre 1957 nur noch Potemkinsche Fassade war. Die meisten Räume standen leer, die maßgebenden Siemens-Verwalter hatten sich längst in den politisch sicheren deutschen Süden abgesetzt und herrschten nun von München und Erlangen aus.
Labové parlierte pausenlos und ohne Punkt und Komma. »Das Saarland ist nun wieder deutsch, herrlich, und die Römischen Verträge unterßeichnet, ab 1. Januar 58 gibt’ß die EWG, ich wechßle, wenn ich hier fertig bin, gleich ßu Siemenß-Madrid.«
»Ja, klar …« Manfred flüchtete sich in schützende Einsilbigkeit.
»Adenauer für die Atomwaffen, ja, ich auch, und waß hat er gesagt: die seien doch nur eine ›Weiterentwicklung der Artillerie‹ – kößtlich! Und die Gesamtdeutsche Partei hat sich aufgelößt, ißiß denn die Möglichkeit, und der Gustav Heinemann, der geht ßur Eß-Pe-De!«
Manfred ertappte sich bei dem Gedanken, Labové vor eine Straßenbahn zu stoßen. Leider kam keine, auch hätte der kleine Glueck, der gerade angewetzt kam, den Mord ganz sicher gemeldet.
Sie zückten ihre Ausweise, passierten den Pförtner und verirrten sich auch diesmal wieder, da Labové eine Abkürzung nehmen wollte, im Labyrinth der Flure und Treppen, Quergebäude und Innenhöfe. Alles war frisch gebohnert und roch furchtbar nach Linoleum.
Als sie ihren Klassenraum endlich erreicht hatten, sprang die Uhr gerade auf acht. In der Tür lauerte Frantz, ihr Ausbildungsleiter, ein dröger Kommißkopp mit auffällig vielen Warzen im Gesicht. Frantz heißt die Kanaille. Manfred konnte nicht anders, als dies in Abwandlung eines Ausrufs aus Schillers Räubern zu denken. Er haßte ihn.
»Hier kommt man nicht zu spät«, schnarrte Frantz. »Noch mal das Glück auf Ihrer Seite gehabt, die Herren!«
»Den Glueck«, korrigierte ihn Labové.
»Wieso? Ach so! Wunderbarer Witz.«
Während Manfred, Labové und der kleine Glueck zu ihren Plätzen strebten, nahm Frantz die Sitzordnung zur Hand und prüfte die Anwesenheit seiner 30 Stammhauslehrlinge. Auf einem aufgeklappten Aktendeckel klebten ihre Paßfotos, und darunter standen die Namen, fein säuberlich mittels einer Schablone geschrieben. In fünf Reihen à sechs Mann waren sie geordnet worden, nicht etwa nach Sympathie oder der Stelle, wo man in der Firma angesiedelt war – Halske, Schuckert, Nora oder Bauunion –, sondern nach dem Alphabet. Und es war eine Tabuverletzung schlimmer Art, wenn jemand nicht da saß, wo er zu sitzen hatte.
»Besondere Vorkommnisse?« fragte Frantz. »Beschwerden? Ärgernisse?«
»Nur Sie«, murmelte Moshe Bleibaum.
Frantz zuckte zusammen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er den vorlauten Scheißkerl längst rausgeschmissen, doch von oben war die Weisung gekommen, Bleibaum zu hofieren und bei der Stange zu halten, denn man hatte seine Begabung erkannt und noch Großes mit ihm vor. Obwohl keiner seiner Vorfahren Siemens-Indianer gewesen war.
In der ersten Stunde hatten sie Betriebswirtschaftslehre bei Bartz, der von irgendeiner Handelsschule kam und sich hier bei Siemens ein Zubrot verdiente. Er baute sich, als Frantz gegangen war, vorne auf, nahm den Zeigestock in die Hand und schlug damit auf den Lehrertisch.
»Die Bestandteile des Wechsels – alle im Chor. Erstens …«
»Ort und Tag der Ausstellung!« schrien sie.
»Zweitens …«
»Angabe des Verfalltages!«
»Drittens …«
»Die Bezeichnung ›Wechsel‹ im Text – die sogenannte Wechselklausel!«
Manfred schrie mit und schämte sich nicht nur deswegen, sondern auch, weil es ihm Spaß machte, hier als Idiot zugange zu sein. Alle, die sie hier saßen, hatten das Abitur gemacht, kannten sich aus mit Goethe, Mozart, Faraday, Mendel und den Benzolringen und mußten sich von einem Arsch wie diesem Bartz wie Deppen auf einem Kasernenhof drillen lassen. Aber irgendwie war es auch schön, hier in diesem fast reinen Männerbund das Hirn auszuschalten und ganz einfach mit der Herde mitzutrotten.
»Achtens …«
»Die Unterschrift des Ausstellers!«
»Bravo!« Bartz freute sich. »Worüber haben wir das letzte Mal gesprochen …? Fräulein Mirau …«
Hannelore Mirau war das einzige weibliche Wesen im Raum, zwar den männlichen Stammhauslehrlingen nicht völlig gleichgestellt, aber immerhin schon im selben Lehrgang mit ihnen. Frantz hielt sie zwar für einen unverzeihlichen Irrtum der Führung und eine Perversion organisationalen Denkens, hatte sie aber kommentarlos akzeptieren müssen. Mit Hannelore Mirau brach für ihn die Herrschaft der Weiber an, die Verseuchung des Hauses Siemens und dessen sicherer Untergang.
»Sie haben begonnen, uns einen Überblick über die Zusammenschlußformen von Unternehmungen zu geben. Begonnen haben wir mit dem Konditionskartell.« Hannelore hatte alles mitgeschrieben.
»Gut.« Bartz war es gewohnt, in seiner Handelsschule von »Mädels« umgeben zu sein. »Kommen wir nun zum Gebietskartell …«
Manfred sparte sich die Mühe des Mitschreibens, denn Hannelore Mirau saß neben ihm und hatte auf seine Bitte hin ein Blatt Blaupapier in ihren Block gelegt. So bekam er am Ende jedes Werkschultages alles Notierenswerte gratis geliefert. Sie tat das gern für ihn, und er war sich sicher, daß sie ebenso gern noch viel mehr für ihn getan hätte, doch irgendwie scheute er sich davor, offene Türen einzurennen. Hannelore war sanft und lieb, ein Gretchen, wie es im Buche stand, ja, aber … Hing er noch immer an Renate, gefangen vom Mythos des ersten Mals, war es der Schock, daß sie ihn verraten hatte, war alles noch zu früh – er wußte es nicht. Hannelore, das hieß auch: Enge und Verlust an Freiheit, und davor hatte er mehr Angst als vor jeder Einsamkeit. Alles selber machen zu müssen, war nicht das Wahre, aber jeden Tag und jede Nacht nur Hannelore, das war ebenso schlimm.
Vorne brabbelte Bartz. »Kommen wir nun – drittens – zum Preiskartell. Alle Unternehmungen verzichten auf eigene Kalkulationen und einigen sich auf einen gemeinsamen Marktpreis. Damit beherrschen sie den Markt …«
Manfred schaffte es nicht mehr, Bartz zuzuhören, und litt immer stärker. Was hätte er nicht alles tun können, anstatt hier rumzusitzen: nach Schmöckwitz fahren und mit dem Boot in den Gosener Graben hinein … mit Hannelore Hand in Hand durch den Zoo laufen und Eis essen … in Neukölln auf dem Balkon sitzen, Orangensaft mit Gin im Glas, und lesen. Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas, oder Heinrich Mann, Professor Unrat. Statt dessen verblödete er hier bei Siemens.
Vorn in der Ecke hing eine Bahnhofsuhr, und das Rucken der Zeiger war das einzige, was ihn wahrhaft interessierte. Sechzig lange Male mußte der Sekundenzeiger, lang und schmal und rot, ein Stückchen weiterzucken, ehe der Minutenzeiger einen Abschnitt weitersprang. Der Sekundenzeiger tat es mit einem solchen Ruck, daß Manfred fürchtete, er würde einmal abbrechen, so daß die Zeit für immer stehenblieb und er bis zum Ende aller Tage hier auszuharren hatte. Aber der Zeiger brach nicht.
Endlich kam die Pause. Sie rissen die Fenster auf und packten ihre Brote aus.
Bickel holte seine Klarinette heraus und improvisierte. Es klang wie bei einer Beerdigung in New Orleans.
Leo Roos, viele Zentimeter zu klein geraten und mit schwarzem Kräuselhaar, tönte herum und tat allen kund, er sei der beste Tennisspieler des Berliner Nordens. Sein Vater war stadtbekannter Präsident einer Wohlfahrtsorganisation, und er hatte viel zu tun, damit klarzukommen.
Günther Glueck hatte seine Kamera mitgebracht, eine primitive Agfa-Klack, und versuchte, Bilder zu schießen, wobei er den Apparat um 45 Grad verkantet hielt. Moshe Bleibaum behauptete von Glueck – »Glueck, Glueck, weg war er!« –, daß Kaspar Hauser sich neben ihm wie Einstein ausgenommen hätte.
Ronald Rink, Ronnie, mußte dringend auf die Toilette und trampelte schon wie ein Dreijähriger, doch Benschkowski und Heimann, seine beiden Freunde, hielten ihn fest.
»Ich mach’ mir in die Hosen!« schrie Rink. »Laßt mich los, das tut doch weh!«
»Ein Siemens-Indianer kennt keinen Schmerz«, lachte Hippler.
»Heil Hippler!« rief Moshe Bleibaum und klopfte dem Jahrgangsältesten wohlwollend auf die Schulter. »Wie fühlt sich denn mein Führer heute?«
»Großartig.«
»Ich kann es nicht mehr aushalten!« schrie Ronnie Rink. Der handtellergroße nasse Fleck auf seiner hellen Sommerhose bewies das auch. Benschkowski und Heimann ließen ihn los, und er stürzte zur Toilette. Alle bogen sich vor Lachen. Manfred auch, obwohl er es an sich widerlich fand. Das Merkwürdigste aber war, daß Rink nicht darauf kam, sich von den beiden abzuwenden, obwohl sie ihn immer wieder quälten.
Manfred stand mit Axel Pietsch, Wilhelm Höfer und Gerhard Adler zusammen.
Pietsch erzählte, wie er es im Kino, im gerade eröffneten »Zoo-Palast«, mit seiner neuen Freundin in der letzten Reihe kräftig getrieben hatte, und Manfred beneidete ihn heftigst.
Auch Höfer wußte Spannendes zu berichten, wie nämlich die Siemens-Bauunion, der er angehörte, die Stadtautobahnbrücke über die Spree und die S-Bahn in Angriff nahm, daß man von einem Riesenpfeiler ausgehen und nach beiden Seiten weg gleichsam ins Nichts bauen würde, bei einem Orkan aber alles vom Einsturz gefährdet sei.
Selbst Gerhard Adler fesselte die anderen, obwohl er nur die Buchhaltungsprobleme referierte, die seinen Vater in der ZN Berlin plagten, der hiesigen Zweigniederlassung in der Schöneberger Straße, aber alle kamen sie ja einmal im Laufe ihrer Lehre in eine ZN, und da war es immer gut, schon vorab Bescheid zu wissen.
Nur bei Manfred hörte keiner zu, obwohl er seinen Kommentar über Ruth Leuwerik als »Königin Luise« nicht viel schlechter fand als den von Friedrich Luft am Sonntag im RIAS. »Hab’ ich mit meinen Eltern bei uns im ›Maxim‹ gesehen – kennt ihr das …? Is’n großes Kino an der Sonnenallee, Ecke …«
»Gehn wir wieder rein«, sagte Pietsch.
Die nächste Stunde – Kaufmännisches Rechnen – wurde von Schupp bestritten, ebenfalls Lehrer an einer der vielen Berliner Handelsschulen. Er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit Heinz Erhardt und nahm es nicht so tragisch, daß während seines Unterrichts nur die wenigsten ganz bei der Sache waren. Heimann, Benschkowski und Rink spielten Skat, Moshe Bleibaum las So zärtlich war Suleyken von Siegfried Lenz, Bickel komponierte einen Blues, Hannelore Mirau löste Kreuzworträtsel. Manfred und Höfer, der rechts von ihm saß, hatten sich Wolfgang Schmitts Steckschach geborgt und kämpften nun verbissen, gestört nur von Schupps Gebrabbel.
Auch das Kaufmännische Rechnen war irgendwann vorüber, und da vor der Mittagspause nur noch Steno kam, konnte Manfred vorerst aufatmen. Es gab ja nur eines hier: Bloß nicht auffallen und sich irgendwie durchwurschteln.
Ihnen die Kurzschrift beizubringen, wie die Stenografie bei Siemens offiziell hieß, war Sache eines kleinen, aber energischen Männleins in anthrazitfarbenem Nadelstreifenanzug, das auf den Namen Buntsack hörte, was bei Manfred gut ankam, denn August Buntsack war der größte Tänzer und Frauenheld in seinem Kultbuch Die Gerechten von Kummerow (von Ehm Welk).
Wie ein römischer Feldherr stand Buntsack vorn am Katheder, als er loszutoben begann. »Das schlägt dem Faß den Boden aus, was Sie sich da letzte Woche geleistet haben. Aber, ich versichere Ihnen, meine Herren: Dieses Gefecht haben Sie zwar gewonnen, nicht aber die Schlacht: Die findet heute statt.«
Was war geschehen? Buntsack hatte eine Stenoarbeit angekündigt und diese Attacke näher erläutert: »Datum, Nummer der Arbeit und den Namen schreiben Sie nicht in Kurzschrift, sondern so: Max Müller, Nr. 1, 31. 5. 1957.« Das hatte er dann auch an die Tafel geschrieben – mit der Folge, daß alle, einem geflüsterten Kommando Benschkowskis folgend, Max Müller auf ihrem feinlinierten Blatt zu stehen hatten. Für heute hatte er nun eine viel längere und schwerere Arbeit vorbereitet, dabei voll von Frantz gedeckt.
Während Buntsack die speziellen Stenobögen austeilte, kam Moshe Bleibaum, der in der ersten Reihe saß, nach hinten zu Manfred geschlichen und bat ihn, für ihn mitzuschreiben. Er war zu stolz, diesen »Tippsenkram« zu lernen, und konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, das auch nur ein einziges Mal im Leben gebrauchen zu können. Für Manfred hingegen war die Sache ein Klacks, denn er hatte sich das Stenografieren schon vor Jahren beigebracht, während Schmöckwitzer Ferientage, und konnte den angesagten Text gleichzeitig zwei- bis dreimal zu Papier bringen, parallel sozusagen.
»Ich hatte Furcht vor Paul«, diktierte Buntsack. »Das Mädchen gab Otto den Apfel. Die Kette ist nicht aus Gold. Kaufe Gold aus dem nahen Bergwerk. Der Raucher macht Rauch.«
Manfreds weicher Bleistift flog über das Papier, und der Coup sollte tatsächlich glücken: Beide bekamen sie eine Eins.
Nach der Kurzschriftstunde folgte die Mittagspause, und sie eilten zur Kantine. An Manfreds Tisch führten Hippler und Moshe das Wort, und Hannelore Mirau, Wolfgang Schmitt und ihm blieb nur die Zuhörerrolle.
»Na, Dicker, biste auch mit Hertha über die Wupper gegangen?« Das bezog sich auf die 1:14-Niederlage, die Hertha BSC im Spiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft in Wuppertal kassiert hatte.
Hippler grinste. »Nee, nich mit Hertha über die Wupper, sondern mit Karin über drei Runden.«
»Du? Du machst doch schon nach ’ner halben Runde schlapp.«
»Willste mal zusehen?« fragte Hippler.
»Bin ich blind!« lachte Moshe Bleibaum. »Und außerdem: Gegen ’nen Beschnittenen hast du nie ’ne Chance.«
»Du mit deiner Kondition … Du hustest dir ja schon die Lunge aus’m Hals, wenn du auch nur ein Stockwerk hochlaufen mußt.«
Moshe Bleibaum lachte. »Das kommt daher, daß ich vom Stamme Benjamin bin. Das waren die letzten, als wir aus Ägypten zurückgekommen sind, und die haben in der Wüste den ganzen Staub schlucken müssen.«
So ging die Zeit ganz angenehm vorbei, doch litt Manfred sehr darunter, auch hier wieder nur Statist zu sein. Aber die anderen beherrschten das witzige Geplänkel um vieles besser als er, und er kam sich unendlich schwerfällig vor.
»Was haben wir’n jetzt nach der Mittagspause?« Diese Frage war das einzige, was Manfred zum Tischgespräch beizusteuern wußte.
»Volkswirtschaftslehre.«
Es kam also der große Auftritt von Dr. Schumm-Schelling, der den Klassenraum des Jahrgangs ’57 als Bühne mißbrauchte, um jeden Mittwoch sein Einpersonenstück »Mein Leben für Siemens« aufzuführen. Leitender Angestellter war er, AT oder NB, »Außertariflicher« oder »Normalbesoldeter«, und eine Mischung aus Buddha und Heinrich George, ein kahlköpfiger Machtmensch jedenfalls, selbstgefällig und eitel, ein übler deutscher Bildungsbürger. Natürlich trug er einen dunkelblauen Maßanzug, und an seinem fettesten Finger funkelte ein goldgefaßter Lapislazuli. Seine Stimme war hoch und manieriert wie die eines Transvestiten, doch Benschkowski war berichtet worden, daß Schumm-Schelling im Alter von 63 Jahren mit seiner Sekretärin ein Kind gezeugt hatte. Manfred fand ihn derart unerträglich, daß er sich immer wieder ausmalte, wie es sein würde, wenn Schumm-Schelling aus dem Fenster fiel und unten wie eine reife Tomate zerplatzte. Andererseits aber stellte er sich vor, selber Schumm-Schelling zu sein und vorne auf dem kleinen Podium große Töne zu spucken.
»Meine sehr verehrte Dame, meine Herren, Thema des heutigen Tages ist die Arbeit, genauer gesagt: Die Arbeit – ein knapper Produktionsfaktor. Was assoziieren Sie denn, wenn Sie das Wort Arbeit hören …? Nun …?« Er stieg vom Podium, schritt den Seitengang entlang und sah fordernd in die ungewiß lächelnden Gesichter, ohne aber eine Antwort abzuwarten, denn reden wollte hier nur er. Und so stellte er sich auch in Positur, um mit großer Geste Heinrich Seidel zu zitieren: »Arbeit! Arbeit! Segensquelle, Arbeit ist das Zauberwort, Arbeit ist des Glückes Seele, Arbeit ist des Friedens Hort. Nur die Arbeit kann erretten, nur die Arbeit sprengt die Ketten, Arbeit macht die Völker frei!«
»Wann schreiben wir denn bei dem ’ne Arbeit?« fragte Gerhard Adler seinen Nebenmann.
Schumm-Schelling hörte es und lief rot an. »Raus!« Er stürzte zur Tür, um sie Adler aufzuhalten. »Sie melden sich bitte bei Herrn Frantz.« Er tupfte sich mit einem weißen Seidentüchlein den Schweiß von der Stirn. »So … Weiter im Text. Arbeit – ein knapper Produktionsfaktor. Wie kommt das? Nach einem Kriege, der uns den Zusammenbruch des gesamten Wirtschaftsgefüges gebracht hat, wird es trotz der Verluste an Menschen ein Überangebot an Arbeitskräften geben, weil nur wenige Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Allmählich werden dann aber immer mehr in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden … Ich will Ihnen ein Beispiel geben: Am 15. Mai 1945 komme ich nach Siemensstadt. Zu Fuß. Unsere Werke liegen alle in Schutt und Asche. Ich finde einen Spaten und fange an, das Dynamowerk wieder aufzubauen. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen! Ein anderer kommt und findet eine Brechstange. Ein Dritter, ein Vierter, ein Fünfter scharen sich um mich …«
Manfred versuchte, sich Schumm-Schellings kläffender Stimme zu entziehen, indem er sich zusammengezwirbelte Papierstückchen in die Ohren steckte, aber das half nur wenig. Dann versuchte er nach zen-buddhistischer Manier solange auf einen Wasserfleck an der Decke zu starren, bis er in Trance verfiel.
Er hatte das Gefühl, schon seit Wochen tot zu sein, so sehr drehte sich alles im Leeren. Er hatte sich selber irgendwie verlassen und lebte nun außerhalb seiner selbst, war nicht mehr er, sondern ein anderer, war sich fremd geworden. Diese Welt war nicht die seine, sie gehörte ihm nicht. Er lebte nicht mehr, er wartete nur. Doch worauf? Auf das Ende seiner Lehrjahre bei Siemens. Und dann? Dann war er Siemens-Angestellter, bezahlt nach K 3. Bis ans Ende seiner Tage … Ein entsetzlicher Gedanke, aber zu nichts anderem taugte er ja. Nimm dein Schicksal endlich an! Das hing mit Hannelore zusammen. Wenn er sich jetzt zu ihr beugte, um sie zu fragen, ob sie heute abend ins Kino gehen wollten – Sissi, die junge Kaiserin mit Romy Schneider oder Königin Luise mit Ruth Leuwerik standen zur Debatte –, dann war alles entschieden. Und er setzte auch schon an: »Du, hast du …« – da stand Schumm-Schelling vor ihm.
»Sie permanenter Schwätzer! Haben Sie noch immer nicht begriffen: Hier redet nur einer – und das bin ich.«
Manfred lief rot an, und der Schweiß brach ihm aus. »Ich hab’ ja zugehört, Herr Dr. Schumm …«
»Schumm-Schelling, wenn ich bitten darf.«
»Herr Dr. Schumm-Schelling.«
»Nun, was habe ich denn gesagt, mein Lieber …?« Schumm-Schelling stand vor ihm, hatte ihn am Revers seines Sakkos gepackt und zog ihn langsam nach oben.
Manfred verspürte den Impuls, ihm das Knie in die Hoden zu rammen. Das wäre dann auch der Ausbruch aus dem Siemens-Gefängnis gewesen. Doch bei seiner Erziehung, immer brav und artig, schaffte er das nicht, sondern konnte nicht anders, als sich unterwürfig zu geben.
»Sie haben gesagt, daß der Nachholbedarf nach dem Kriege die Wirtschaft so stark angekurbelt hat, daß immer neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, solange, bis die Arbeiter nun knapp werden.«
»Nun gut …« Schumm-Schelling ließ ihn wieder fallen. »Und dann? Fräulein Mirau …«
»Der Produktionsfaktor Arbeit wird immer knapper …«
»Und? Bleibauch …«
Moshe Bleibaum grinste. »…baum, bitte, Herr Dr. Schemm-Schulling.«
Wieder stürzte Schumm-Schelling zur Tür und riß sie auf. »Raus!«
Doch Moshe Bleibaum kümmerte sich nicht im geringsten um diese Aufforderung, er blieb seelenruhig sitzen, gähnte ostentativ und blätterte in seiner Wirtschaftszeitung.
»Wenn Sie nicht gehen, dann gehe ich!« schrie Schumm-Schelling.
»Das wäre fürwahr die optimale Lösung«, erwiderte Moshe, während alles den Atem anhielt.
Schumm-Schelling warf die Tür ins Schloß, aber von innen, und lief zu Moshe Bleibaum, um ihn hochzureißen und ihm die Hand zu schütteln. »Gratuliere, mein Lieber! Ja, meine Dame, meine Herren, dies ist das Holz, aus dem Siemens seine Führungskräfte schnitzt. Weiter so, Herr Blei … Herr Bleibaum, und weiter im Stoff.« Und so, als wäre nichts gewesen, stolzierte er aufs Podium zurück. »Wenn sich die Nachfrage nach Arbeitskräften, die normalerweise immer arbeiten würden und müßten, nicht decken läßt, dann muß man versuchen, Arbeitskräfte zu finden, die nur arbeiten gehen, um eine Verbesserung ihres ohnehin schon relativ hohen Lebensstandards zu erreichen: Frauen. Ein weiterer Weg besteht in der Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte …«
Manfred kam nicht umhin, Schumm-Schelling zu bewundern. Meisterhaft, wie er es geschafft hatte, das Gesicht zu wahren. Fest stand offenbar, daß einer der hohen Herren in Vorstand oder Aufsichtsrat dabei war, Bernhard Bleibaum systematisch aufzubauen und Karriere machen zu lassen – was sich dann bis zu Schumm-Schelling herumgesprochen haben mußte. Vielleicht hatte man in München große Amerika-Pläne, und da war es sicher gut, einen hochbegabten jüdischen Siemens-Mann nach drüben zu schicken, so Manfreds Spekulation. Oder hatte Moshe nur geblufft?
Nach Schumm-Schelling folgte das Fach »Geschichte und Organisation des Hauses Siemens«. Die Lehrkraft kam aus dem firmeneigenen Archiv und trug den Namen Rudi Auer.
»Aua!« schrien denn auch viele, als er den Klassenraum betrat, denn Auer tat wirklich weh, wie er da unbedarft und bieder vor ihnen stand, vierschrötig wie ein märkischer Kartoffelbauer, dick und rosig wie ein Schweinchen.
»Werner Siemens wurde 1816 in der Nähe von Hannover geboren. Seine Vorfahren waren Kaufleute, Landwirte, Ackerbauern und Bergherren. Georg Halske ist in Hamburg geboren worden. Er zeichnete sich durch eine große handwerkliche Geschicklichkeit aus. Werner Siemens findet 1847 in ihm den geeigneten Mechaniker für den Bau des von ihm erfundenen Zeigertelegraphen mit selbsttätiger Unterbrechung …«
Benschkowski hatte eine grandiose Idee und begann, nach allen Seiten hin zu flüstern. »Wenn der Zeiger der Uhr vorne auf halb vier springt, lachen alle los, egal, was Auer gerade labert. Das machen wir dann alle halbe Stunde. Weitersagen.«
»Werner Siemens und Georg Halske finden also zusammen, und 1847 kommt es in der Schöneberger Straße in Berlin zur Gründung der Firma Siemens & Halske mit einem Grundkapital von ungefähr 6800 Talern, die ein Verwandter von Siemens zum größten Teil zur Verfügung stellte …«
Das war die Sekunde. Benschkowski gab das Zeichen, und alles lachte los. Auer zuckte zusammen, begriff nicht. Die Wochen zuvor hatte er nie auch nur die geringste Rückmeldung registrieren können. Und nun dies? Er erschrak. Hatte er sich irgendwie versprochen, war aus einer harmlosen Formulierung Unzüchtiges geworden …? Hatte er womöglich statt Verfügung Verführung gesagt – oder, daß Werner Siemens und Georg Halske ein Paar geworden waren …? Ja, das wahrscheinlich, und sofort korrigierte er sich.
»Nicht, was Sie denken: Werner Siemens war glücklich verheiratet …« Er war richtiggehend beruhigt, als nun bald wieder der Normalzustand eingetreten war, das heißt, ihn niemand mehr zur Kenntnis nahm. So verging auch die nächste halbe Stunde mit simpler Hofberichterstattung.
»In unendlich schwierigen Verhandlungen mit russischen Beauftragten, insbesondere mit dem wendigen Grafen Kleinmichel, gelingt es dem genialen Werner Siemens, dem Gründer unseres Hauses, das heute Weltgeltung genießt, gelingt es Siemens, die Konzessionen für den Bau der Telegraphenleitungen um Riga (1852), von Petersburg nach Warschau, Warschau–Granitza und Moskau–Sebastopol (1854 im Krimkrieg) zu erlangen. Es werden Niederlassungen in St. Petersburg (1855) und Ingenieurbüros in Moskau und Warschau errichtet. Leiter der russischen Betriebe wird Carl …«
Der Zeiger der Uhr sprang auf vier, und wieder setzte ein ungehemmtes Wiehern ein.
Auer verstand es noch immer nicht, aber er wagte auch nicht, die Lehrlinge zu fragen, warum sie denn lachten. Vielleicht hatte er, ohne es zu merken, wirklich etwas Witziges gesagt … Aus Angst, daß ihm dies ein drittes Mal unterlaufen könnte, brach er die Stunde unter dem Vorwand, er habe noch einen wichtigen Termin, vorzeitig ab.
»Der geht zu Frantz und schmeißt den Bettel hin«, sagte Moshe Bleibaum, und so kam es auch.
Manfred ging nicht zur S-Bahn, sondern mit Heimann, Benschkowski und Rink zur Nonnendammallee, um mit der 55 nach Hakenfelde zu fahren, wo Tante Eva und Onkel Jochen mit Curt, Püppi und Ilschen in einer Neubausiedlung wohnten. Die drei anderen wollten indessen mit dem 10er Bus nach Charlottenburg.
Manfred eilte nach drüben, wo die Straßenbahn, die 55, angerauscht kam. Ein typenreiner Zug, ein T 24 und zwei B 24. Er quetschte sich vorn hinein und hatte das Glück, ganz dicht hinter dem Mann an der Kurbel zu stehen. Irgendwie war der Tag gerettet.
In Hakenfelde angekommen, umarmte ihn Tante Eva. »Ich freu’ mich ja so für dich, daß du nun auch bei Siemens bist. Mein Vater ist ja da so glücklich gewesen, als Oberingenieur.« Das »so« sprach sie mit großer Emphase, mit einem z vorn und einem o, das ins ou überging.
Manfred fühlte sich schuldig, daß er nicht so glücklich war, wie er es hätte sein müssen, empfand es als eine Art Behinderung, ähnlich der Kinderlähmung, unter deren Folgen Onkel Jochen litt.
Manfred funktionierte wie ein Roboter. Es war ein einfaches Programm, das er auszuführen hatte. Erstens: nach links unten bücken und den Rohling aus einer Kiste nehmen, ein taschenbuchgroßes Stück, das wie Messing aussah, aber keines war, sondern nur galvanisiertes Eisen. Zweitens: den Rohling unter die Stanze legen. Drittens: beide Hände weit zur Seite ziehen, auf zwei große runde Knöpfe legen und diese kräftig drücken. Viertens: abwarten, bis der große Stempel mit wahnsinniger Wucht herabgeschossen kam und das Werkstück verformt hatte, und dann mußte es wieder von der Stanze entfernt werden. Fünftens: nach rechts unten bücken und das fertige Teil fein säuberlich in eine zweite Kiste legen. In welches Gerät es dann eingebaut wurde, wußte er nicht.
Aus der Lehrwerkstatt hatte man die kaufmännischen Stammhauslehrlinge nicht wieder in ihre Büros zurückgeschickt, sondern vor dem ersten kurzen Urlaub noch in die Produktion gesteckt. Als Siemens & Halske-Mann war Manfred ins Wernerwerk für Fernmeldetechnik (WWF) gekommen und hatte zuerst in einem Montagesaal fehlerhafte Telefone auseinandergeschraubt, die die Endkontrolle nicht passiert hatten, um dann in der Werkhalle unten eine erkrankte Arbeiterin zu vertreten.
Es war eine furchtbar anstrengende Arbeit, die ihn aussaugte; es war der pure Stumpfsinn, den ganzen Tag über die immergleichen Griffe auszuführen. Und dennoch litt er hier weniger als vordem im Nora-Büro, was vor allem zwei Gründe hatte. Einmal war es die Atmosphäre hier. Das heiße Öl mit seinem animalischen Geruch, der höllische Rhythmus der stampfenden Maschinen und die tropische Schwüle reizten die Sinne so sehr, daß die Frauen ihre blauen Kittel weit öffneten und die Männer kaum noch an sich halten konnten. Manfred fühlte sich wie beim Karneval in Rio. Immer wieder kam es vor, daß die Meister Paare erwischten, die es hinter irgendwelchen Kisten trieben, und ging man unten am Stichkanal und an der Spree spazieren, trat man auf gebrauchte Kondome. In der Nachtschicht sollte es, so hörte man, heiß hergehen. Zum anderen funktionierte er seine Arbeit zum Wettkampf um, das heißt, er kämpfte in jeder Stunde um einen neuen Rekord. Ringsum wurden sie schon unruhig, weil er wie ein Irrer ackerte und zu befürchten war, daß der Refa-Mann auftauchte. Mit einer Stoppuhr in der Hand, um Manfred zum Maß der Dinge zu machen. Gegen Mittag kam denn auch der Meister vorbei, der Ziegenbalg hieß und eine rotblaue Trinkernase hatte.
»Moment mal, Matuschewski.«
»Ja …?« Manfred drehte sich um.
»Ich warne Sie.«
Manfred lachte. »Ich paß’ schon auf, daß ich den Kopf nicht unter der Stanze liegen hab’.«
»Es könnte aber sein, daß Sie eine Bierflasche auf Ihren Kopf kriegen.«
Manfred sah nach oben und verstand den Meister nicht. »Wieso’n das?«
»Weil die anderen Sie für ’nen Akkorddrücker halten, der Ihnen die Preise kaputtmacht.«
»Ach, Gott, ja.« Daran hatte er nicht gedacht, daß die Refa-Leute merkten, wie schnell man sein konnte, wenn man sein Letztes gab. »Ich mach’ jetzt öfter ’ne Pause.«
So kämpfte er jeweils eine Dreiviertelstunde mit äußerster Verbissenheit, um sich dann eine Viertelstunde Ruhe zu gönnen und durch die Halle zu schlendern, immer auch in der Hoffnung, daß eine der aufgeladenen Arbeiterinnen gerade bei ihm Entspannung suchte. Aber die waren offenbar alle in festen Händen oder sahen ihm den schlaffen Kissenpuper schon von weitem an.
Auf der Toilette traf er Benschkowski, der ihm gestand, es in der Werkhalle nicht mehr ausgehalten zu haben. »Mir gegenüber an der Maschine sitzt eine, Mann, du …! Bloß gut, daß morgen wieder Werkschule ist, sonst muß ich mich kastrieren lassen.«
»Morgen ist doch keine Werkschule mehr.« Manfred war sich da hundertprozentig sicher. »Da haben wir schon Ferien.«
»Mensch!« Benschkowski schlug sich gegen die Stirn. »Und die hier im Werk glauben, daß wir weiter wie jeden Mittwoch zur Werkschule gehen …«
»Ja, und …?« Manfred wußte nicht, worauf der andere hinauswollte.
»Na, Mann: Wir verabschieden uns heute bei unseren Meistern, sagen, daß wir ja morgen in der Schule sind – und machen uns dafür ’n schönen Tag. Irgendwo im Wald und auf der Heide. Meinetwegen auch auf der Susi, Moni oder Hannelore.«
»Genial!« rief Manfred. Ihm fiel augenblicklich ein, daß er ja mit Wolfgang Schmitt schon lange mal in Schmöckwitz paddeln wollte. »Aber das geht doch nur, wenn wir alle nicht kommen.«
»Richtig. Und darum laß uns jetzt loslaufen und allen anderen Bescheid sagen.«
Als dann endlich Feierabend war, kam bei Manfred Ferienstimmung auf. Ein Tag ohne Siemens, ein Tag in Schmöckwitz – ein Geschenk des Himmels. Er sang einen selbstkomponierten Schlager, als er auf das Tor zuschritt: »Unverhofft kommt oft das Glück zu dir …«
Es störte ihn wenig, daß ausgerechnet bei ihm der Zufallsgenerator zuschlug und die rote Lampe oben unterm Dach des Pförtnerhäuschens aufleuchtete.