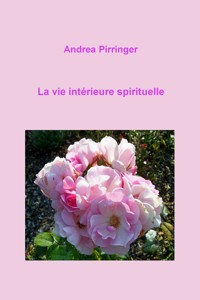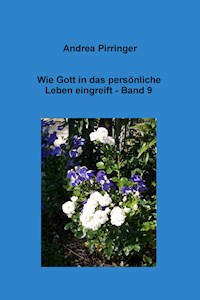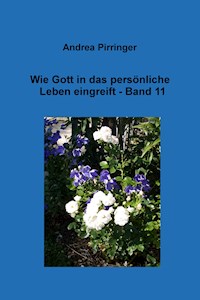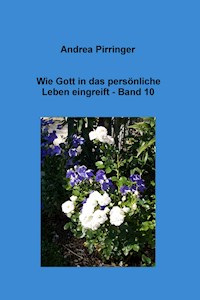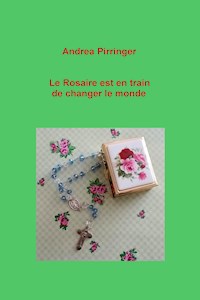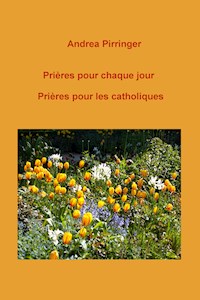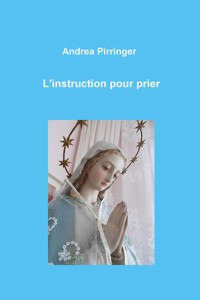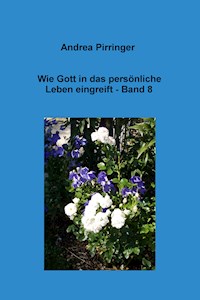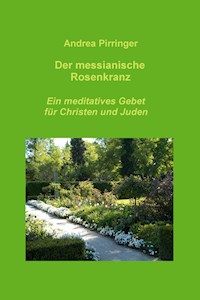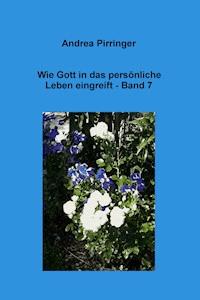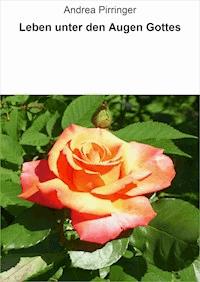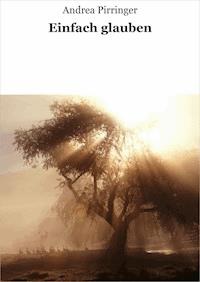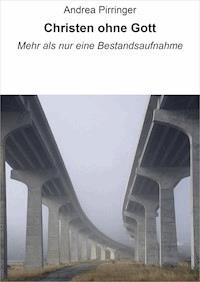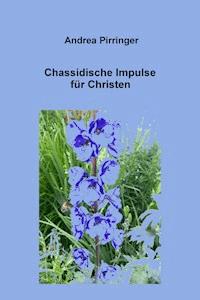
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum dieses Buches steht die Person des Gründers des Chassidismus: Baal Schem Tov. – Ein großer Heiliger, Beter und Mystiker, der nicht nur für Juden, sondern auch für Christen wegen seiner kraftvollen Spiritualität inspirierend und zugleich hilfreich für das Wachstum im Glauben sein kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Pirringer
Chassidische Impulse für Christen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorbemerkung
Kurze Einführung in den Chassidismus
Das Spannungsfeld zwischen West- und Ostjudentum
Nachträgliche Einleitung
Gegenüberstellung der christlichen und der jüdisch-chassidischen Sichtweise
Kurz zum Leben des Gründers
Die aktive Mystik
Das Verdienst des Baal Schem
Theresia von Lisieux und der Baal Schem
Die Schwierigkeit für seine Nachfolger
Rabbi und Wunder-Rebbe
Die Erlösung und die Messias-Frage
Die chassidische Fröhlichkeit
Die Leibfreundlichkeit
Die Einfalt des Herzens
Nachwort
Über die Autorin
Impressum neobooks
Vorbemerkung
Quellgebend für dieses Buch ist - unter anderem - das Werk Der Chassidismus. Mysterium und spirituelle Lebenspraxis (Freiburg im Breisgau 1978, ISBN 359108056X) des international bekannten geisteswissenschaftlichen Schriftstellers und evangelischen Theologen Gerhard Wehr, welcher leider im April dieses Jahres verstorben ist.
Ich habe in der vorliegenden Abhandlung einzelne Gedanken und Textstellen des Autors aufgegriffen, welche ich in den nachfolgenden Ausführungen unter der Abkürzung „G.W.“ sowie mittels der Angabe der entsprechenden Seitenzahl zitiere.
Darüber hinaus beziehe ich mich auf das Buch von Martin Buber (Hrsg. Lothar Stiehm) Baal Schem Tow. Unterweisung im Umgang mit Gott (Heidelberg 1981, ISBN 3-7953-0912-3), aus welchem ich (unter Angabe der Seitenzahl) zitiere oder darauf verweise (Abkürzung „M.B.“).
Weitere Quellen werden im fortlaufenden Text genannt.
Es ist mir ein persönliches Anliegen, die Gemeinsamkeiten von Christentum und Chassidismus herauszuarbeiten, aber auch bestehende Unterschiede im Denken und Glauben nicht zu verschweigen.
Kurze Einführung in den Chassidismus
Wenn man über diese Glaubensrichtung spricht, muss man gleich zu Beginn zwei Personen nennen: Baal Schem Tov (kurz „Baal Schem“ oder „Bescht“ genannt), mit bürgerlichem Namen Israel ben Elieser, sowie Martin Buber.
Ersterer war der Gründer dieser Bewegung, letzterer ein österreichisch-jüdischer Religionsphilosoph, der es sich zu einer Lebensaufgabe gemacht hatte, den Chassidismus zu erforschen und seine Erkenntnisse darüber in umfangreichen Aufzeichnungen festzuhalten.
Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle der jüdische Religionshistoriker Gershom Scholem, der sich insbesondere mit der jüdischen Mystik auseinandergesetzt hat.
Als eine weitere wichtige Persönlichkeit muss in diesem Zusammenhang genannt werden: Rabbi Nachman von Bratzlaw (oder Breslev), der Urenkel des Baal Schem, dessen Weisheit und eigentümliche Frömmigkeit große Bekanntheit erlangt hat.
Der Gründer
Rabbi Israel ben Elieser lebte im 18. Jahrhundert und starb am 22. Mai 1760 (das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt). Sein Wirkungskreis erstreckte sich zunächst auf Podolien (ehemalige Adelsrepublik Polen-Litauen, heute ukrainisch) und später weit darüber hinaus.
Er selbst hat über seine Lehre - eine neue geistig-mystische Strömung des Judentums - nie schriftliche Aufzeichnungen geführt. Vieles wurde von seinen Schülern sowie deren Schüler mündlich überliefert. Buber nahm sich um die Sammlung und Sichtung der zahlreichen Fragmente an und entwickelte darin einen großen Eifer, sodass die Beschäftigung mit dem Chassidismus zu seinem Lebenswerk wurde.
Das Milieu
Das Alltagsleben der osteuropäischen Juden fand im sog. Schtetl (auch Stetl oder Städtel genannt) statt. Dabei handelte es sich um Dörfer, kleine Städte oder Stadtteile, welche Wohnstätte der jüdischen Bevölkerung waren. – Dieses besondere Umfeld, in dem sich Vergangenes konservierte, ein großes materielles Elend und häufig räumliche Enge herrschte, bestand bis zum Beginn des 2. Weltkriegs.
Einen sehr lebendigen Einblick in die damalige Zeit gewährt das Buch von Rachel Salamander, Die jüdische Welt von gestern (ISBN 3-423-30700-5) ab S. 60 ff.
Der qualitative Unterschied zu den Ghettos bestand darin, dass die Menschen im Schtetl keine diskriminierte, abgesonderte Minderheit waren, sondern sich dort zuhause fühlten, da sie unter sich sein sowie ihren Glauben und ihre Tradition pflegen konnten.
Heute wird das Bild des Schtetls oft romantisch-verklärt beschrieben, was der früher herrschenden nüchternen Realität (Leben ohne Gas, Strom, Kanalisation und fließendes Wasser) nicht gerecht wird. Vielmehr war es eine hohe Kunst, dem täglichen Mangel an den nötigsten Dingen mit Optimismus, Humor und unerschütterlichem Gottvertrauen zu begegnen.
(Anmerkung zur historischen Einordnung: Der Baal Schem lebte bereits 200 Jahre zuvor. Die Fotos aus dem 19. und 20. Jahrhundert können daher nur einen ungefähren Einblick in die damaligen Verhältnisse geben.)
---
In diesem besonderen „Nährboden“ konnte sich - gemäß dem Sprichwort „Wo die Not am größten, dort ist Gott am nächsten.“ - eine neue Form der Spiritualität etablieren, für die zwei Elemente charakteristisch sind: einerseits die mit dem Alltag verwobene Frömmigkeit und religiöse Begeisterung, andererseits der Hang zum Mystischen. - Dem Glaubenden wird alles zum Zeichen.
Vor dem Hintergrund einer in den Synagogengemeinden herrschenden religiösen und rituellen Erstarrung entstand so der Chassidismus. Er brachte eine spirituelle Begeisterung und Erneuerung, sowie eine „welt- und schöpfungszugewandte, werkfreudige Mystik“ (G.W., S. 10).
Ein weiteres Merkmal des Chassidismus (G.W., S. 7 ff) ist die Überwindung der – scheinbaren – Gegensätze von „Oben“ und „Unten“, Diesseits und Jenseits, Gut und Böse, Geist und Materie, säkularem und geistlichem Leben. Gott wird – bildlich gesprochen – in das Alltagsleben des Menschen hereingeholt, sodass „der Himmel die Erde berührt“. Der Ewige ist nicht „irgendwo da oben“ oder „weit weg“, sondern der Mensch ist eingebettet in die Schöpfung, ein „Funke Gottes“. Diese göttlichen Funken stecken in allem. Dadurch ist auch alles mit Ihm verbunden.
Das Spannungsfeld zwischen West- und Ostjudentum
Die damalige jüdische Bevölkerung durchlebte eine immer mehr auseinanderdriftende Entwicklung. Während zahlreiche Juden in den östlichen Ländern (Polen, Ukraine etc.) ein Dasein in großem Elend führten, gelang vielen in den westlichen Ländern (Deutschland, Österreich) der Aufstieg in bürgerliches, manchmal sogar feudales Umfeld. Eine Anpassung bzw. Gleichstellung an das kulturell-gesellschaftliche Leben war erwünscht und wurde daher angestrebt. Dazu gehörte auch die Auseinandersetzung mit den modernen Wissenschaften.
Einen informativen Einblick gibt hier wieder das Buch von Rachel Salamander: Die jüdische Welt von gestern, ab Seite 152. Der Kontrast zwischen beiden Gruppen konnte größer nicht sein. Daraus ergab sich ein gewisser mitleidig-abschätziger Blick der Westjuden auf die Ostjuden, die in ihren Augen wegen ihrer Volksfrömmigkeit und Armut als rückständig und einfältig angesehen wurden.
Die Hüter der Orthodoxie können jedoch das Verdienst für sich verbuchen, die Glaubenslehre treu bewahrt und weitergegeben zu haben. Spirituelle Tiefe und Fülle kann sich nur dort entwickeln, wo sich der Mensch vom Materiellen löst und sich auf das Geistig-Göttliche hin orientiert.
"Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott."
Werner Karl Heisenberg, deutscher Physiker
Berührungspunkte zwischen beiden Welten gab es nur wenige. Etwa, wenn man sich zur Kur in die böhmischen Bäder begab. Ein Genuss, den sich auch mancher wohlhabende ostjüdische Rebbe leisten konnte. (Näheres dazu im Buch von Mirjam Triendl-Zadoff, Nächstes Jahr in Marienbad (ISBN 9783525569955.)
„Betrachteten fromme Juden aus Osteuropa eine solche Reise als „Pikuach nefesch“, als Gebot zur Erhaltung des Lebens - so erklärte die Jüdische Bäder- und Kurortezeitung - folgten Kurgäste aus dem Westen, meist nervöse Städter, der Religion der Moderne, den Wissenschaften.“ (aus: Der Jude in den Kurorten, 1929, in: Ohne Wasser ist kein Heil, Stuttgart 2005 (Hrsg. von Sylvelyn Hähner-Rombach).
Nachträgliche Einleitung
Warum soll(te) sich der Christ – gerade heute - mit dem Chassidismus beschäftigen?
Durch die Öko- und Bio-Bewegung sowie den Umweltschutz-Gedanken ist der Blick auf die Schöpfung (unabhängig davon, ob man nun religiös ist oder nicht) wieder interessant geworden. – Ich sage hier absichtlich: wieder, denn das ganzheitliche, schöpfungsbejahende Denken ist bereits Bestandteil des jüdischen Vätererbes, also nicht wirklich „neu“, aber angesichts der gegenwärtigen Probleme der Menschheit aktueller (und auch nötiger) denn je.
Auch der Hl. Franziskus - der sich seit der Wahl seines Namensvetters, Jorge Mario Bergoglio, zum Papst – neuer Beliebtheit erfreut, und dessen Spiritualität in der Person des Hl. Vaters gewissermaßen eine „Wiederbelebung“ erfährt, hat dieses Denken aufgegriffen („Bruder Sonne, Schwester Mond“) und fühlte sich der Natur und den Tieren nahe (weshalb der Baal Schem manchmal mit ihm verglichen wird).
Hierzu schreibt Gerhard Wehr treffend (G.W., S. 9): „Die weltarme Gott-und-die-Seele-Frömmigkeit überließ einer quantitativ-materialistischen Naturwissenschaft und Technik diese Erde.“ Die Trennung zwischen Spiritualität und Welt hat zu einer schmerzlich fühlbaren Kluft geführt. Viele fragen sich heute: „Wo ist Gott?“ und nehmen Seine Schechina (hebr. für Einwohnung, Wohnstatt, Gegenwart Gottes) in ihrem Umfeld – und auch in sich selbst – nicht (mehr) wahr.
---
Ein Aspekt dieser Fehlentwicklung ist die weit verbreitete Irrmeinung, der in einem säkularen Umfeld lebende Mensch sei nicht ebenso zur Heiligkeit berufen wie jener, der eine monastische Lebensweise gewählt hat. Daraus leiten sich Aussagen ab wie: „Beten ist nur etwas für Klosterschwestern.“ und: „Der Herrgott soll uns bitteschön in Ruhe lassen, solange wir Ihn nicht brauchen. (Bei Bedarf holen wir Ihn dann aus Seinem Schrank hervor.)“
„Die Heiligkeit liegt nicht in dieser oder jener Übung, sondern sie ist eine Gesinnung des Herzens, die uns demütig macht und klein in den Armen Gottes, unserer Schwachheit bewusst und bis zur Verwegenheit vertrauend auf seine Vatergüte. ...
Mein Weg ist ganz Vertrauen und Liebe, ich verstehe die Seelen nicht, die vor einem so liebevollen Freund Angst haben. ... Ich sehe, dass es genügt, sein Nichts zu erkennen und sich wie ein Kind Gott in die Arme zu werfen.“
Thérèse von Lisieux
Gegenüberstellung der christlichen und der jüdisch-chassidischen Sichtweise
Die Unterschiede zum Christentum
Manche der Verschiedenheiten, die zwischen Chassidismus und Christentum bestehen, lösen sich auf, wenn man sie in ihrer gesamten Tiefe auslotet. Man stößt dabei unweigerlich auf den Urgrund alles Seienden: den barmherzigen Gott. Daher habe ich die ursprünglich geplante Zweigliederung dieses Buches – in Gemeinsamkeiten und Unterschiede - wieder verworfen. Stattdessen geht es mir darum, die fließenden Übergänge zwischen beiden Denkrichtungen darzustellen.
Dort, wo es ein hohes Maß an Übereinstimmung bzw. Abweichung gibt, weise ich explizit darauf hin.
Kurz zum Leben des Gründers
Der kleine Israel wird frühzeitig Waise und wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Im Selbststudium eignet er sich später talmudische und kabbalistische Kenntnisse an, eine darüber hinausgehende Bildung genießt er jedoch nicht.