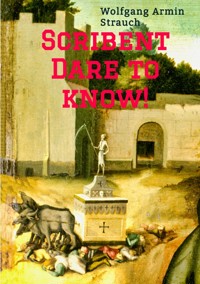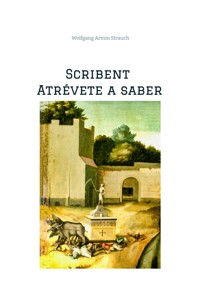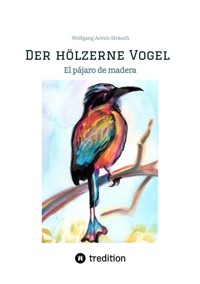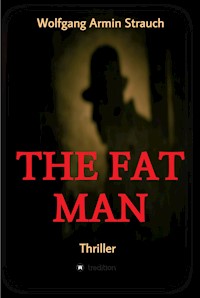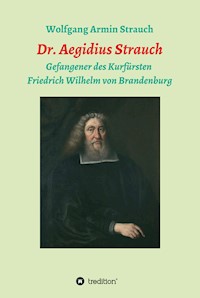8,99 €
Mehr erfahren.
Soll das noch eine zuckersüße Aschenbrödel-Geschichte sein? Nein! Und doch spielt ein Lied aus dem Cinderella-Film eine zentrale Rolle. Zwischen den harmlosen bunten Buchdeckeln hat sich ein knallharter Kriminalroman versteckt. Die hochsensible Emely ist verzweifelt. Ihre Mutter hat Leukämie und wartet in der Charité auf eine Stammzellentransplantation. Ihr Vater ist wie vom Erdboden verschluckt. Sie fragt sich, ob die Polizei ihre Vermisstenanzeige ernst nimmt, denn sie ist erst fünfzehn Jahre alt. In ihrer Not wendet sie sich an den Kriminalisten Schlüter, dessen Frau mit ihrer Mutter in einem Zimmer lag und die Krankheit nicht überlebte. Ihr Vater wird schwer verletzt neben einer Leiche in Nürnberg gefunden. Emely und Schlüter verstehen nicht, warum er überhastet von Berlin nach Nürnberg gefahren ist. Doch dann bringt ein Polaroidfoto aus dem Jahr 1985 sie auf eine Spur. Damals hat eine Firma aus Nürnberg beim Bau eines Stahlwerks in Eisenhüttenstadt mitgewirkt. Das Foto zeigt ihre Großmutter, die seit 1989 vermisst ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Hochsensibilität ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die mit hoher Sensitivität für und starken Reaktionen auf Sinnesreize einhergeht. Schätzungen zufolge können etwa 15 % bis 20 % der Bevölkerung als hochsensibel gelten. Es handelt sich um eine erhöhte Wahrnehmungssensibilität für äußere und innere Reize.
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
Dank an Ingrid und Christine,
die dieses Buch freundlich lektoriert haben.
Wolfgang Armin Strauch
Cinderellas Lied
Kriminalroman
© 2024 Wolfgang Armin Strauch
Umschlag, Illustration: Wolfgang Armin Strauch
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
•
Softcover
978-3-384-31712-4
•
Hardcover
978-3-384-31713-1
•
E-Book
978-3-384-31714-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH
Abteilung "Impressumservice"
Halenreie 40-44
22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Angaben zum Autor
Bücher vom Autor
Cinderellas Lied
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Kapitel 1
Cinderellas Lied
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
Kapitel 1
Ein warmer Wind strich über seine Haut. Es roch nach Kamille. In einem Fliederstrauch stritten sich Spatzen um die besten Plätze. Er versuchte, seinen Kopf zu heben. Es gelang ihm nicht. Ein stechender Schmerz warf ihn zurück. Nur seine Augen ließen sich bewegen. Arme und Beine versagten ihren Dienst. Die Finger waren taub.
Wo war er? Und was noch schlimmer war. Er begriff nicht, wer er war. In seinem Augenwinkel bewegte sich etwas. War das ein Mensch? Kam Hilfe?
Mit Mühe versuchte er, zu rufen. Nur ein Hauchen drang an sein Ohr. Mit einer Erschütterung fiel etwas in seine Richtung. Ein blutverschmierter Kopf versperrte ihm die Sicht. Die Augen waren aufgerissen und starr.
Er kannte den Mann nicht, der neben ihm zusammensackte. Sand füllte die Lücken zwischen ihnen. Er spürte, wie sich Körner in seinen Ohren sammelten. Aus dem Rascheln wurde ein dumpfes Geräusch. Jetzt hörte er nur noch sich selbst, den Herzschlag und das Röcheln seiner Bronchien.
Eine schwere Müdigkeit machte sich breit. Er wünschte sich, dass sie blieb, denn aus allen Fasern strömten Schmerzen, als ob sie darauf gewartet hatten, ihn zu quälen.
Aufhören! Sie sollen aufhören. Kann man sich den Tod wünschen? Das Gesicht vor ihm verschwamm. Wassertropfen zogen ihre Bahnen und verwischten das Blut des Gesichtes. Der tote Mann schien zu einem abstrakten Kunstwerk zu werden, dessen Sinn er nicht ergründen konnte.
War er schon auf dem Weg ins Jenseits?
War es eine Prüfung? Sollte er noch mehr Qualen aushalten?
Wasser schwappte über seine Augen. Er versuchte, das Kinn möglichst weit nach vorn zu schieben, um nicht zu ertrinken. Sein linker Mundwinkel war taub. Wasser floss in seinen Mund. Er schmeckte ein Gemisch aus Blut und Erde. Er presste die Lippen aufeinander. Doch sie reagierten kaum auf seine Befehle. Konnte er schwimmen? Er wusste es nicht. Wenn ich hier herauskomme, lerne ich schwimmen. Und tauchen. Durch seine Nase sickerte Wasser. Ein Reflex ließ ihn husten. Mund und Nase waren wieder frei. Ein schmaler Lichtstrahl fiel auf die Netzhaut.
Man sagt, dass vor dem Tod das Leben an einem vorbeistreicht.
Doch wer war er?
Erinnerungen waren ausgelöscht. Selbst sein Name fiel ihm nicht ein. In seinem Kopf begann es zu klopfen. Die Qualen wurden übermächtig, bis das Gehirn entschied, unnütze Funktionen abzuschalten. Irgendetwas strich über sein Gesicht. Er wollte die Augen öffnen. Es gelang ihm nicht. Auf den Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe und den ohrenbetäubenden Donner reagierte er nicht mehr. Regen spülte sein Gesicht frei, das wie eine Maske aus der Erde sah.
Kapitel 2
Emely wachte viel zu früh auf. Sie fand sich im Bett ihrer Eltern. Ihr Vater war nicht nach Hause gekommen. Schon gestern Abend hatte sie versucht, ihn zu erreichen. Die Abwesenheitsmeldung hatte behauptet, dass man ihm mitteilt, dass sie angerufen habe. Sie glaubte nicht den sterilen Worten des Anrufbeantworters. Was für ein abartiges Wort. Anrufbeantworter. Niemand beantwortete ihre Fragen. Sie hatte sich unruhig gefühlt, weil es gar nicht seine Art war, nicht zurückzurufen. Es gab in der Familie ein ungeschriebenes Gesetz, immer zu hinterlassen, wo man ist. Das galt besonders, wenn man später kam. Seit ihre Mutter wegen Leukämie erkrankt war, gab Emely diese Regelung etwas Sicherheit, bei aller Hilflosigkeit gegenüber der Krankheit. Blanke Angst kroch in ihr hervor. Sie zog das Nachthemd ihrer Mutter unter dem Kopfkissen hervor. Das tat sie oft, wenn die Chemotherapie ihre Mama in der Charité festhielt.
Noch einmal zog sie ihr Mobiltelefon hervor. „Der Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen.“
Sie schickte über den Messenger noch eine Nachricht und nutzte sogar SMS. Mit jedem vergeblichen Versuch stieg ihre Aufregung. Ihre Hände begannen zu zittern. „Du musst ruhig bleiben, sagte sie sich.“
Manchmal half es, tief durchzuatmen. Es war zwecklos. Sie kannte diese Unruhe. Dr. Wilhelm hatte ihr Tipps gegeben, wie sie darauf reagieren kann. Sie musste Gefühl und Verstand voneinander trennen, wenn sie rational handeln wollte. Emely stand auf, ging in die Küche und goss sich ein Glas Wasser ein und trank es in einem Zug aus. Dann duschte sie sich ausgiebig und sah immer wieder auf den Bildschirm. Der Messenger behauptete, dass ihr Vater im Moment nicht online sei. „Vielleicht ist sein Akku leer oder der Empfang schlecht“, sprach sie vor sich her. Doch je mehr sie sich zu beruhigen versuchte, umso mehr wuchs in ihr die Gewissheit: „Es ist etwas passiert!“
Sie suchte die Nummer der Arbeitsstelle ihres Vaters heraus. Nach dem dritten Klingeln meldete sich eine weibliche Stimme: „Bellmann GmbH, Hermling. Was kann ich für Sie tun?“
„Hier ist Emely Schubert, die Tochter von Leon Schubert. Kann ich bitte meinen Vater sprechen?“
„Tut mir leid. Er ist noch nicht da. Worum geht es denn?“
„Mein Papa ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen und meldet sich nicht. Ich dachte, dass er vielleicht auf Dienstreise ist. Wissen Sie etwas davon.“
„Augenblick. Ich sehe in seinem Kalender nach. Nein. Hier steht nichts. Er ist heute nicht gekommen.“
Emely klagte: „Er meldet sich immer ab. Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas passiert ist.“
„Ich sehe gerade, dass er sich gestern bei uns nicht abgemeldet hat. Ich werde seine Kollegen fragen, ob sie etwas wissen.“
„Rufen Sie mich bitte an, wenn Sie etwas erfahren.“, sagte Emely
„Natürlich. Ist deine Mutter nicht zu Hause?“
„Nein, sie ist stationär in der Charité. Sie bekommt eine Chemo.“
„Dein Vater hat mir davon erzählt. Ich werde unseren Chef anrufen. Wenn du Hilfe brauchst, rufe mich ruhig noch einmal an.“
„Danke, Frau Hermling.“
Emely scrollte in ihrer Kontaktliste und tippte auf den Namen ihrer Klassenlehrerin. „Hallo Frau Schwarz.“
„Hallo Emely. Bist du krank?“
„Nein. Aber mein Papa ist gestern nicht nach Hause gekommen. Sonst meldet er sich immer ab. Meine Mama ist zur Chemo. Ich wollte fragen, ob ich etwas später in die Schule kommen kann. Ich möchte auf der Station nachfragen, ob mein Papa gestern in der Klinik war oder sich telefonisch gemeldet hat.“
„Emely. Mach das. Das ist wichtiger als die Deutschstunde. Melde dich bitte, wenn du etwas erfährst. Hast du schon auf seiner Arbeitsstelle nachgefragt?“
„Ja. Dort hat er sich gestern nicht abgemeldet. Die Sekretärin möchte den Chef anrufen und sich danach bei mir melden.“
„Das ist wirklich außergewöhnlich. Wenn im Krankenhaus und der Arbeit deines Vaters keiner etwas weiß, solltest du zur Polizei gehen und ihn als vermisst melden. Falls man sich dort querstellt, ruf mich bitte an.“
„Das mache ich.“
„Ich lasse mein Mobiltelefon an. Falls sich alles klärt, kommst du einfach zur Schule.“
„Danke, Frau Schwarz.“
Emely weinte. Sie konnte nicht anders. Sonst versuchte sie immer, möglichst erwachsen zu wirken. Doch mit fünfzehn Jahren fühlte sie sich wie in einer Zwischenwelt. Was sie hörte, las oder sah, vermischte sich mit Gefühlen, die sie nicht zuordnen konnte. Ihre Mutter hatte mit ihr über die Pubertät gesprochen. Sie glaubte, alles verstanden zu haben, doch da war immer noch etwas, das sie nicht zuordnen konnte. Immer neigte sie dazu, alles zu bewerten. Wenn sie in die Klasse kam, spürte sie sofort, wenn etwas nicht stimmte. Die anderen Mädchen redeten über Musik und Jungs. Nachdem ihre Mutter Leukämie bekommen hatte, waren diese Gespräche banal und unwichtig. Zunächst wollte sie mit ihrer Mutter darüber reden, doch sie wollte sie nicht zusätzlich belasten. Ihr Papa war ein guter Zuhörer und immer lieb zu ihr, doch in dieser Sache hilflos überfordert. Sie warf es ihm nicht vor. Sicher hatte er mit der Krankheit von Mama genug zu tun. Er war auch anders als sie. Egal, wie er war, sie liebte ihn. Jetzt war er verschwunden und sie fühlte schmerzhaft, wie sehr er ihr fehlte. „Mama wird es auch so ergehen“, dachte sie bei sich.
Emely fuhr mit dem Fahrrad die zwei Kilometer zur Klinik. Auf den Fluren war viel Bewegung. Es war Frühstückszeit. Sie ging zur Stationsschwester. „Entschuldigen Sie. Ich heiße Emely Schubert. Meine Mutter ist Evita Schubert. Können Sie mir sagen, ob mein Vater hier war? Er ist gestern nicht nach Hause gekommen.“
Die Schwester sah in ihrem Computer nach. „Deine Mutter hat ihre Chemo bekommen. Du weißt ja, dass sie danach immer Probleme hat. Sie hat die Nacht über tief geschlafen. Es gibt keine Notizen über Besonderheiten. Vielleicht hat Schwester Anne etwas eingetragen. Einen Augenblick bitte, ich siehe mal im Patientenzimmer nach.“
Die Schwester ging zum Ende des Ganges und verschwand in einer Nische. Einen Augenblick später kam sie zurück zur Anmeldung. „Also, deine Mutter schläft. Ich habe mich umgesehen. Es gibt keine Notizen, dass sie Besuch hatte.“
„Danke für Ihre Bemühungen.“
„Ich werde Dr. Wilhelm sagen, dass du hier warst.“
„Das ist schön. Grüßen Sie ihn bitte von mir und sagen Sie ihm, dass ich nicht nerven will, aber ich bin wirklich besorgt. Sicher werde ich heute noch einmal vorbeikommen.“
Sie gestand sich ein, dass sie nicht geglaubt hatte, ihren Vater im Krankenhaus zu finden. Von hier aus hätte er sie jederzeit erreichen können. Ihr Telefon klingelte: „Emely? Hier ist Frau Hermling.“
„Ja?“
„Ich habe gerade mit dem Chef gesprochen. Dein Vater hat sich bei ihm nicht gemeldet. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, wo er ist. Gleich mehrere Termine mussten ausfallen, weil er unentschuldigt gefehlt hatte. Nur ein Kollege meinte, dass er von ihm eine Bemerkung mitbekommen hat, dass er noch etwas zu erledigen hat. Worum es sich handelte, habe er nicht gesagt. Es war gestern Vormittag. Emely, ich glaube, du solltest zur Polizei gehen. Die können prüfen, ob es einen Unfall gegeben hat, an dem er beteiligt war. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich kann im Moment nicht weg und der Chef ist bereits im Flieger. Sag der Polizei, dass sie gern bei mir anrufen können. Weißt du, wo die Polizeiwache ist?“
„Ja, wir waren schon einmal mit der Klasse beim LKA in der Keithstraße.“
„Gut. Wenn du nicht weiterkommst, rufe mich an. Warst du eigentlich schon im Krankenhaus?“
„Ja. Papa war gestern nicht zu Besuch. Ich glaube, ich gehe zur Polizei und warte, was man dort sagt.“
Emely fuhr mit dem Fahrrad zur Keithstraße. Von der Anmeldung schickte man sie zum Dezernat für Vermisstensuche. Sie fühlte sich unwohl. Ein uniformierter Polizist sah ihre Unschlüssigkeit und fragte, ob er helfen kann.
„Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Bin ich hier richtig?“
„Ja. Ich bringe dich am besten gleich zum zuständigen Dezernat.“
Gemeinsam mit dem Mann lief Emely an Tafeln mit Fahndungsblättern vorbei. Die Bilder erschreckten sie. Waren die Menschen schon tot? Bei einigen stand ein Datum, seit wann sie vermisst wurden. Manche Fälle lagen bereits Jahre zurück. In ihr verkrampfte sich etwas. Würde hier ein Foto ihres Vaters hängen, wenn Wochen und Monate vergingen? Emely fühlte sich eingeschüchtert. „Hier ist die Vermisstenstelle“, sagte der Polizist.
Sie gingen in das Zimmer. „Guten Tag, mein Name ist Emely Schubert. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben.“
„Augenblick, ich bin gleich bei dir“, sagte der Beamte hinter dem Tresen.
An der Wand hing ein Whiteboard, das offensichtlich nichts mit der Polizeiarbeit zu tun hatte. Wie hypnotisiert las Emely: ‚Sven Schlüter‘. Sie kannte den Mann aus der Klinik. Seine Frau lag neben ihrer Mutter und war verstorben. Emely zitterte. Mit einem Mal dachte sie daran, dass auch ihre Mutter sterben könnte, während ihr Papa verschwunden ist. Sie würde allein sein. In ihren Gedanken sah sie das Gemälde, das ihre Mutter von ihrer Großmutter gemalt hatte. Es bestand aus tausenden Farbpunkten, die erst aus der Entfernung ein Bild ergaben. Würde von ihren Eltern auch nur Farbpunkte übrigbleiben? Sie holte ihr Smartphone aus der Tasche und suchte ein Bild, das sie mit ihren Eltern im Urlaub zeigte. Ihre Mama trug eine Pudelmütze, weil ihre Haare nach der Chemo ausgefallen waren. Sie hatte damals gesagt, dass Haare unwichtig sind.
„Fräulein Schubert?“ Eine ältere Frau streckte ihr die Hand entgegen. Emely nickte. „Ich werde erst einmal alles aufschreiben. Nachher wird sich Herr Keppler mit dir unterhalten. Er ist im Moment in einer Besprechung, wird aber bald kommen. Ich muss einige Fragen stellen, die dir vielleicht unangenehm sind. Für uns sind sie aber von Bedeutung.“
Die Frau trug die Antworten in Feldern auf einem Bildschirm ein. Emely fühlte sich unangenehm berührt, als sie danach gefragt wurde, ob ihr Papa schon öfter verschwunden war und ob er eine Freundin oder enge Bekannte hat, bei der er sein könnte. Sie antwortete auf alle Fragen. „War dein Vater in der letzten Zeit traurig oder ist er allein spazieren gegangen?“
„Nein! Mein Papa beabsichtigt nicht, sich umzubringen!“, schrie Emely.
„Beruhige dich bitte. Ich muss das fragen. Wir werden alles tun, um deinen Vater zu finden. Für die Fahndung brauchen wir aber möglichst genaue Angaben.“
„Kann ich mit Herrn Schlüter sprechen?“
„Warum?“
„Ich kenne ihn. Seine Frau lag im Krankenhaus neben meiner Mama. Ich weiß, dass sie gestorben ist. Er wird mich verstehen.“
„Ach, Kind, das tut mir leid. Deine Mutter hat auch Leukämie?“
„Sie bekommt gerade eine Chemo. Können Sie sich vorstellen, wie sie sich fühlt, wenn sie wach wird und mein Papa verschwunden oder vielleicht sogar tot ist?“
„Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss schrecklich sein. Deswegen möchtest du lieber mit Herrn Schlüter sprechen?“
„Ja. Der wird mich besser verstehen.“
„Ach Emely. Herr Schlüter ist leider nicht da. Nach dem Tod seiner Frau war er sehr traurig. Er musste sich deswegen behandeln lassen und braucht selbst noch viel Ruhe. Bis nächste Woche ist er krankgeschrieben. So lange können wir aber nicht warten. Bei Vermisstenfällen spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Ich werde alles vorbereiten, damit Herr Keppler die Vermisstenmeldung sofort veranlassen kann. Er wird bestimmt gleich da sein. Möchtest du ein Wasser oder eine Cola trinken?“
„Ein Wasser wäre schön.“
Emely sah sich im Büro um. Auf dem Schreibtisch der Frau lag ein verschlossener Umschlag. Darauf stand die Adresse von Sven Schlüter. Emely gab ihrem inneren Drang nach und verließ das Büro. Sie musste mit Herrn Schlüter sprechen.
Kapitel 3
Das Tor öffnete sich automatisch. Schlüter fuhr vorsichtig in die Garage. Jedes Mal ärgerte er sich darüber, dass die Einfahrt zu eng war. Der Vorbesitzer hatte einen alten VW Käfer und das Tor danach anfertigen lassen. Auf beiden Seiten des Wagens hatte er nur wenige Zentimeter Spiel. Die Sensoren ließen das Überwachungssystem des Autos piepen und den Bildschirm rot aufleuchten. „Ist ja gut. Ich habe es begriffen“, brabbelte er in sich hinein. Wenn er noch einmal wegmusste, hätte er sein Auto draußen stehen lassen, doch er fühlte sich nach dem Gespräch mit der Psychologin erschöpft und wollte nur noch gemütlich auf der Hollywoodschaukel sitzen und ein Bier trinken. Gequält öffnete er die Autotür, nahm seine Tasche vom Beifahrersitz, stieg aus und schlug die Tür zu. Automatisch zückte er die Fernbedienung. Das Auto blinkte ihm zu. Beim Umdrehen sah er einen Schatten.
„Svenja! Willst du mich nicht begrüßen? Ich habe dich längst gesehen.“ Er lachte. Doch es war nicht seine Tochter. Ein schmächtiges Mädchen stand neben dem Tor. Sie hielt den Kopf etwas schräg und sah ihn abschätzend an.
„Herr Schlüter?“
„Ja, der bin ich.“
Schlüter betätigte die Fernbedienung der Garage. Das Tor senkte sich. Er drehte sich zu dem Mädchen. „Möchtest du zu mir?“
Das Mädchen nickte.
„Kann ich dir etwas anbieten? Ich habe bestimmt Orangensaft.“
„Gern.“
Schlüter öffnete die Haustür und rief: „Svenja!“.
„Ich glaube, sie ist gerade mit dem Fahrrad los“, sagte das Mädchen.
Als Schlüter mit zwei Gläsern Saft aus dem Haus kam, saß die Besucherin in einem der Korbstühle. Sie hatte ein Smartphone in der Hand. Nach einem kurzen Blick auf den Bildschirm legte sie es auf den Tisch.
Schlüter sah sie an und verglich sie mit seiner Tochter. Sie war vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Ein Alter, bei dem er immer unsicher war, ob es noch um Kinder handelte. Glücklicherweise hatte er die Pubertät bei seiner Tochter schadlos überstanden. Vielleicht war es bei ihr eher unauffällig, weil seine Frau die gesamte Aufmerksamkeit beansprucht hatte. Nach ihrem Tod blieb eine Leere, die Svenja nicht ausfüllen konnte. Er fühlte sich schuldig, sie auch noch mit seinen eigenen psychischen Problemen zu belasten. Vermutlich hatte sie genauso gelitten, es nur nicht gezeigt. Sie erinnerte ihn in ihrer Selbstständigkeit an seine Frau.
„Worum geht es? Hat Svenja etwas angestellt?“
„Nein, nein. Es geht nicht um ihre Tochter.“
„Dann bin ich ja beruhigt.“
„Ich wollte Sie nur etwas fragen, dann gehe ich wieder.“ „Na dann, heraus mit der Sprache.“
„Mein Vater ist verschwunden. Ich war schon auf ihrer Dienststelle. Dort hat man meine Angaben aufgenommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man der Vermisstenanzeige wirklich nachgeht, weil ich noch nicht volljährig bin.“
„Darauf kommt es nicht an. Wie kommst du darauf, dass dein Vater verschwunden ist?“
„Er ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen und hat wichtige Termine auf der Arbeit verpasst, die er nie versäumt hätte.“
„Kann es nicht sein, dass er sie nur vergessen hat? Hast du auf seiner Arbeitsstelle angerufen? Vielleicht ist er dienstlich unterwegs oder steht im Stau.“
„Papa hat die Termine bestimmt nicht vergessen. Er hat nicht angerufen. Ich habe Angst, dass ihm etwas passiert ist. Er würde Mama nie im Stich lassen.“
„Hat sich deine Mutter an die Polizei gewandt?“
„Das kann sie im Moment nicht. Sie hat ihre Chemo bekommen und schläft. Ich wollte sie wegen Papa nicht wecken. Sie wissen doch, wie das ist. Ihre Frau hat vor einiger Zeit mit meiner Mama in einem Zimmer gelegen. Von daher kenne ich Sie. Als Papa heute früh nicht da war und ich ihn nicht erreichen konnte, bin ich zur Polizei gegangen. Ich weiß nicht, ob man mich ernst genommen hat. Ich bin mir aber sicher, dass etwas passiert ist.“
Schlüter musterte das Mädchen. „Tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe. Ich war damals immer so in Gedanken.“
Sie fasste seine Hand an und drückte sie. „Ich habe gesehen, wie zärtlich Sie mit Ihrer Frau umgegangen sind. Als wir Mama besucht haben, war ihre Frau irgendwann nicht mehr im Zimmer. Die Schwester sagte uns, dass sie gestorben ist. Ich fand das sehr traurig.“
Schlüter flüsterte: „Sie hat es nicht geschafft.“
„Ich weiß. Mama hat mir von ihr erzählt.“
„Wie heißt du? Ich habe mir den Namen deiner Mutter leider nicht gemerkt. Ich hatte mit mir selbst zu tun.“
„Meine Mama heißt Evita und mein Papa Leon Schubert. Ich bin Emely.“
„Und warum kommst du zu mir?“
„Meine Mama hatte mir erzählt, dass Sie Polizist sind. Ich habe ihren Namen auf einem Kuvert bei der Polizei gelesen. Ich habe nach Ihnen gefragt. Ihre Kollegin hat mir gesagt, dass Sie noch krank sind.“
„Das stimmt. Ich bin erst nächsten Montag wieder im Dienst. Nach dem Tod meiner Frau war ich lange Zeit krank und bin gerade erst von der Kur zurück. Wenn du möchtest, bitte ich meine Kollegen, sich um dich zu kümmern.“
Emely flehte: „Verstehen Sie. Ich bin mir sicher, dass mit Papa etwas nicht in Ordnung ist. Wir können uns immer auf ihn verlassen. Die Frau bei der Polizei sagte, dass bei Vermisstenfällen die Zeit eine wichtige Rolle spielt.“
Schlüter suchte sich Stift und Papier. „So. Jetzt erzählst du mir alles der Reihe nach. Dann werde ich meine Kollegen anrufen. Vielleicht kann ich alles etwas beschleunigen.“
Emely nahm ihr Smartphone und scrollte den Bildschirm.
„Vorgestern Abend haben wir beim Abendessen vereinbart, dass Papa meine Mama mit dem Auto zur Klinik fährt und sie nach der Chemo am Nachmittag besucht. Ich bin normal zur Schule gegangen. Am Nachmittag fand ich keine Notiz von Papa und auch keine Nachricht auf dem Handy. Heute früh war er immer noch nicht da. Ich versuchte, ihn zu erreichen. Er ging nicht an sein Handy. Auf Nachrichten reagierte er nicht.“
Sie zeigte Schlüter eine lange Liste mit Anrufversuchen.
„Bist du gleich zur Polizei gegangen?“
„Nein. Ich habe erst bei meiner Lehrerin, Frau Schwarz, angerufen. Sie gab mir frei. Ich rief auf der Arbeitsstelle von Papa an. Die Sekretärin wunderte sich auch, weil er wichtige Beratungen versäumt hatte und sich nicht gemeldet hat. Ein Kollege soll gesagt haben, dass er sich bei ihm abgemeldet hat, ohne zu sagen, wohin er fährt und wann er wieder zurück ist. Die Sekretärin sah Papas Dienstkalender durch und rief den Chef an. Es stellte sich heraus, dass er schon gestern mehrere Termine verpasst hatte und auf Rückfragen nicht reagierte. Die Sekretärin schickte mich daraufhin zur Polizei. Vorher war ich aber noch in der Klinik, um nach Mama zu sehen. Ich sagte der Schwester, dass mein Papa nicht nach Hause gekommen ist, und fragte, ob er sie vielleicht besucht hat. Sie sah im Behandlungszimmer nach und kontrollierte die Einträge der Nachtschwester. Mein Papa war nicht da.
Bei der Polizei habe ich mit einer Frau gesprochen, die mir viele Fragen gestellt hat. Ein Herr Keppler sollte sich um mich kümmern.“
„Hast du mit Herrn Keppler gesprochen?“
„Nein. Er war in einer Besprechung. Ich habe nur mit der Frau geredet, die mir immer nur sagte, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Bevor ich hergekommen bin, habe ich zu Hause im Arbeitszimmer von Papa nachgesehen, ob er irgendetwas hinterlassen hat. Aber da war nichts. Ich wunderte mich nur, dass er sein iPad nicht mitgenommen hatte. Bei Dienstreisen hatte er es immer dabei. Mir fiel ein, dass er in letzter Zeit entspannter war als sonst. Ich hatte ihn aber nicht nach den Gründen gefragt, da ich froh war, wenn er sich nicht immer nur Sorgen um Mama machte. Ich habe es aber genau gespürt. Da war irgendetwas. Mama wollte ich nicht fragen, da sie wegen der Chemo mit sich selbst zu tun hat. Das Gefühl, das ich hatte, war so, als ob er neue Hoffnung wegen Mamas Genesung hatte. Und nun ist er mit einem Mal weg und ich weiß nicht, was ich Mama sagen soll.“
Emely sah Schlüter mit einem Blick an, den er nicht zuordnen konnte. Er fühlte sich bedrängt, aber auch voller Mitgefühl. Schlüter ergriff die Hand des Mädchens.
„Ich werde mich darum kümmern. Jetzt rufe ich erst einmal auf der Dienststelle an.“
Schlüter ging ins Haus und rief Keppler an. Nach fünf Minuten kam er wieder heraus.
„Man kümmert sich um den Fall. Sie haben bereits nach Unfällen gesucht.“
„Gibt es Hinweise?“, fragte das Mädchen.
„Nein. So schnell geht es nicht. Kannst du mir Adressen von Verwandten und Bekannten deiner Eltern aufschreiben, die wir befragen können?“
„Ja. Aber die sind zu Hause im Telefonbuch meiner Eltern. Ich habe das iPad mitgenommen. Auf ihm stehen auch einige.“
Svenja war gekommen und saß am Tisch. Sie hantierte an einem iPad herum.
„Ist es das iPad von Emelys Vater?“
Sie nickte. „Ja. Ich kann vielleicht darüber das Mobiltelefon von Emelys Vaters orten.“
Schlüter wiegte seine Kopf. „Ich hoffe, du weißt, was du machst?“
Seine Tochter winkte ab. „Ein Moment! Das Internet ist heute wieder so lahm …“
Nach einem Augenblick sah sie erst zu ihrem Vater und dann zu Emely. Langsam drehte sie den Bildschirm so, dass beide eine Karte sahen, auf der eine rote Markierung zu sehen war.
Schlüter fragte: „Wo ist das?“
Svenja sagte: „Nürnberg.“
Emely vergrößerte den Kartenausschnitt, bis er eine große freie Fläche und langgestreckte Gebäude zeigte. Die Markierung bewegte sich nicht. Emely las laut vor: „Hier steht Messegelände. Wir kennen niemanden in Nürnberg!“
Svenja legte ihren Arm um ihre Schulter. „Vielleicht hat jemand das Handy gestohlen.“
Emely lehnte sich an sie. „Ja, vielleicht.“ Es klang wenig überzeugend. Sie zitterte. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Schlüter sprang auf und lief ins Haus. Als er wieder herauskam, hatte er seine Jacke an und die Autoschlüssel in der Hand.
„Ich habe Herrn Keppler angerufen. Meine Kollegen werden das Ergebnis jetzt mit unseren Möglichkeiten prüfen. Ich schlage vor, dass wir zu dir nach Hause und dann ins Krankenhaus zu deiner Mutter fahren.“
Kapitel 4
Schlüter bugsierte das Auto aus der Garage. Emely zeigte ihm den Weg zur Wohnung. Sie befand sich in Berlin-Moabit in einer Querstraße. Der Gründerzeitbau hatte ein großes Tor, von dem es in die Hinterhäuser ging. Rechts war der Aufgang zum Vorderhaus. In der zweiten Etage war die Wohnung. Vor der Tür war ein Abtreter mit der Aufschrift „willkommen“. Emely öffnete die Tür. Es roch nach Infektionsmitteln. Sie verschwand in einem Zimmer. Kurze Zeit später tauchte sie mit einem Notizbuch auf.
„Viele von den Leuten kenne ich nicht. Die meisten sind aus der Zeit, als wir noch in Eisenhüttenstadt gewohnt haben. Unsere Wohnung in Moabit haben wir erst seit einem Jahr. Meine Eltern hatten sich entschlossen, nach Berlin zu ziehen, weil der Weg zur Leukämie-Behandlung in der Charité kürzer ist. Als Mama krank wurde, haben sich viele Bekannte zurückgezogen. Sie können im Anrufregister nachsehen. Kaum jemand hat sich in letzter Zeit gemeldet. Vielleicht haben sie aber auch unsere neue Nummer nicht. Ob sie meine Eltern über das Mobiltelefon angerufen haben, weiß ich nicht. Mama hat ihr Telefon im Krankenhaus.“
„Darf ich mich etwas in der Wohnung umsehen?“, fragte Schlüter.
„Natürlich. Ich habe aber schon alles kontrolliert.“