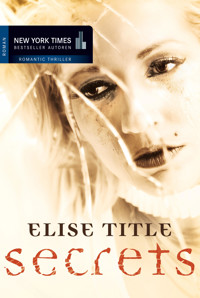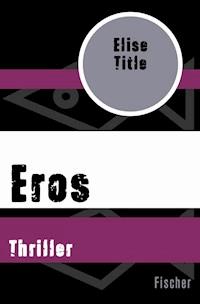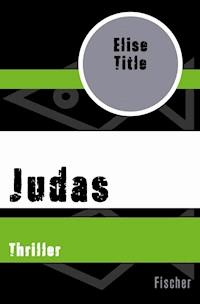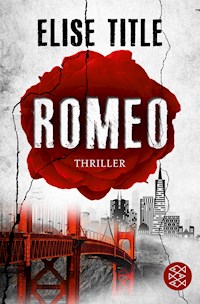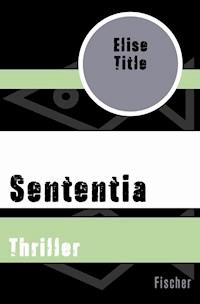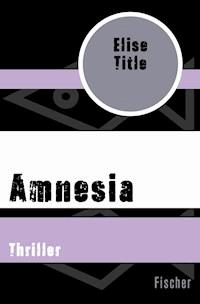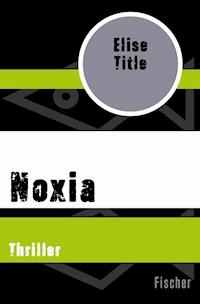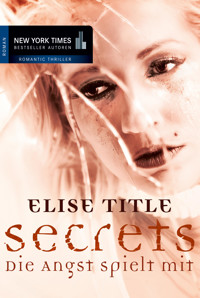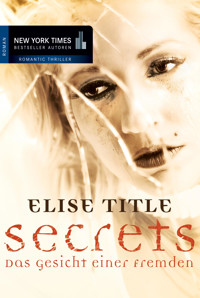4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Natalie Price
- Sprache: Deutsch
Polizeichef Steven Carlyle wird unter Mordverdacht verhaftet. Er soll eine junge Frau aus der Bostoner Oberschicht getötet haben, die ein Doppelleben als Edelprostituierte führte. Alle Hinweise deuten auf ihn. Doch Superintendent Natalie Price zweifelt an der Schuld ihres Vorgesetzten. Undercover als Callgirl »Samantha« kommt sie einem Komplott auf die Spur, das plötzlich auch ihr Leben bedroht ... ›Circe‹ ist nach ›Judas‹ und ›Amnesia‹ der dritte Natalie-Price-Thriller von Elise Title. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elise Title
Circe
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER Digital
Inhalt
Prolog
»Wie ich sehe, ist es ein Weilchen her.« Sie lächelt, während ihre Finger über seine nackte Brust gleiten.
Seine Miene verfinstert sich. Er mag es nicht, so durchschaubar zu sein. Macht sie sich nun auch noch über ihn lustig? Das mag er erst recht nicht. Außerdem, was denkt sie denn? Dass er Geld drucken kann? Vielleicht haben einige ihrer anderen »Kavaliere« Geld wie Heu, aber ihr Preis ist ihm entschieden zu hoch. Nicht, dass er sich davon aufhalten ließe.
»Entspann dich, Süßer. Ich bin schon ganz aufgeregt«, flüstert sie ihm ins Ohr, nimmt seine Hand, führt sie zwischen ihre Beine. »Da siehst du, was du mit mir machst.«
Er lächelt sie an. Sein erstes Lächeln, seit er hier ist. Er ist froh, dass das Licht gedämpft ist. Er schämt sich nämlich ein bisschen wegen seiner Zähne. Nach über dreißig Jahren Nikotin und Koffein sind sie furchtbar gelb. Seine Frau liegt ihm ständig in den Ohren, sich die Zähne aufhellen zu lassen. Bei sich selbst hat sie es letzten Monat machen lassen. Aber er ist im Sechseck gesprungen, als die Zahnarztrechnung über elfhundert Dollar ins Haus flatterte. Und das nachdem er im Monat davor fast zwei Riesen für die Kronen seines Sohnes berappt hatte, dank einer Schlägerei, bei der die beiden Vorderzähne des Jungen auf dem dreckigen Boden einer Bar im South End landeten. Junge, von wegen! Sean wurde bald sechsundzwanzig, verhielt sich aber längst nicht so. Schön, Sean hatte hoch und heilig versprochen, ihm alles bis auf den letzten Cent zurückzuzahlen. Na toll. Ob er das noch erleben würde?
»Hey, mein Lieber, du bist ja mit den Gedanken ganz woanders.« In ihrem Lächeln liegt ein leichter Vorwurf.
»Bist du nicht dafür zuständig, das zu verhindern?«, zischt er sie an. Er ist sauer auf sie, aber noch mehr auf sich selbst. Wieso muss er ausgerechnet jetzt an Zahnarztrechnungen denken?
»Hoppla, ein Mann mit Temperament. Das gefällt mir.« Sie nimmt seine Hände und legt sie auf ihre üppigen Brüste. Er fragt sich, ob das Manöver nicht vor allem dazu dient, seine Hände beschäftigt zu halten. Damit sie sich nicht zu Fäusten ballen. Ob sie auch schon mal an Typen geriet, die sie schlugen? Ihr richtig Angst einjagten?
Die Möglichkeit, dass sie Angst haben könnte, erregt ihn. Natürlich hat er nicht vor, ihr wehzutun. Er hat noch nie eine Frau geschlagen. Ihm gefällt nur einfach das Machtgefühl, das er verspürt. Männer sollten stärker sein als Frauen, sollten sagen, wo’s langgeht.
Als ihre Hand sich um seine Erektion schließt, ist er schnell wieder bei der Sache. Er mag es, wie sie ihn anfasst. Er mag es, wie sich ihre harten Brustwarzen in seine Handflächen drücken. Er mag es, dass ihre Titten echt sind. Wären sie mit Silikon gefüllt, hätte er das Interesse verloren. Trotzdem, so erregt ist er noch nicht, um nicht mit einem Anflug von Enttäuschung zu registrieren, dass ihre Brüste nicht so fest und prall sind wie bei einer Zwanzigjährigen.
Wie alt mag sie sein? Fünfundzwanzig? Vielleicht ein paar Jahre älter. Aber ein Rasseweib, keine Frage. Und was ihm noch mehr gefällt: Sie hat Ausstrahlung. Wie versprochen. Selbst ohne die Designerklamotten und die teure Spitzenunterwäsche strahlt sie Klasse aus. Da ist es egal, dass ihr seidenweiches, blondes Haar aussieht wie eine Perücke. Die Farbe ihrer Schamhaare hätte ihm einen Hinweis liefern können, aber sie ist da unten rasiert, glatt wie ein Baby. Das gefällt ihm. Gefällt ihm sehr. Er mag so ziemlich alles an ihr, sogar die gepflegten Nägel, das matt schimmernde Grauschwarz des Nagellacks. Ganz anders als seine Frau, die eine Vorliebe für schrille Farben wie Feuerwehrrot oder knalliges Pink hat. Selbstverständlich hat er Dana nie erzählt, wie sehr ihn diese Farben abturnen. Erstens hätte es sie nur gekränkt, und zweitens hätte es sowieso nichts geändert, weil im Bett zwischen ihnen schon seit gut fünf Jahren kaum noch was lief. Schön, etwa einmal im Monat lässt ihn Dana noch an sich ran, aber er spürt genau, dass es ihr keinen Spaß macht. Er fragt sich, ob es ihr je Spaß gemacht hat. Ob es ihm selbst Spaß gemacht hat. Das heißt mit ihr. Nicht, dass er Dana nicht liebt. Das tut er. Und er liebt seine beiden Kinder, obwohl beide Jungs, jeder auf seine Weise, eine Riesenenttäuschung für ihn sind.
»Noch ein Schlückchen Champagner?«
»Was? Oh … ja, bitte«, sagt er, obwohl er weiß, dass er schon ein bisschen betrunken ist. Zuerst die trockenen Martini – waren es zwei? Oder drei? Er kann es nicht genau sagen, weil sie dafür gesorgt hat, dass sein Glas nie leer wurde. Und dann, als sie schon nackt waren, hat sie den Champagner aufgemacht. Den sie schon fast geleert haben. Genauer gesagt, den er fast allein geleert hat, denn sie hat kaum einen Tropfen angerührt. Was soll’s. Er braucht den Alkohol wohl dringender als sie. Braucht ihn, um sich zu entspannen. Was nicht heißen soll, dass er sich noch nie was nebenher gegönnt hätte. Mann, er hat jede Menge Nutten gehabt.
Aber das hier ist was anderes. Kein Vergleich. Hier ist nichts, aber auch gar nichts irgendwie schäbig. Sehr professionell. Alles erstklassig. Das wunderbare Sandsteinhaus auf der Joy Street im Schickimickiviertel Beacon Hill mit der angebauten Garage, in die er einfach reinfahren konnte, ohne gesehen zu werden, das erstklassige Gesöff, die klassische Musik und vor allem – diese Frau. Genevieve. Scheiße, sogar der Name klingt nach Klasse. Unwichtig, ob es ihr richtiger Name ist. Er glaubt es eigentlich nicht. Er ist jedenfalls nicht Phil Mason. Übrigens ein kleiner Insiderscherz. Phil Mason ist der Zahnarzt seiner Familie.
Sie greift zum Nachttisch, nimmt einen halb vollen Champagnerkelch und lässt die perlende Flüssigkeit langsam über ihre samtige Haut träufeln. »Na los«, raunt sie. »Lass es dir schmecken.«
Er will sich über sie beugen, doch sie packt sein Haar und reißt so fest daran, dass ihm die Augen brennen.
»Du hast vergessen, danke zu sagen«, flüstert sie.
Nach der Besprechung mit dem Leiter der Strafvollzugsbehörde, Commissioner Warren Miller, war sein Stellvertreter, Deputy Commissioner Steven R. Carlyle, verstimmt. Miller war einer von der alten Schule, was Carlyle im Grunde gut fand. Aber es hatte auch einige Nachteile. Miller versuchte dauernd, es allen recht zu machen. Da versprach er seinen Mitarbeitern beispielsweise, das Gefängnis mit harter Hand zu leiten, und im nächsten Augenblick erklärte er, dass die Überbelegung der Zellen ein schwerwiegendes Problem darstelle und man für innovative Ansätze offen sein müsse.
Heute hatte Carlyle mitbekommen, wie Miller nickte, als Deputy Commissioner Russell Fisk die mögliche Erweiterung der Entlassungsvorbereitungszentren zur Sprache brachte. Diese Zentren stellten eine Verbindung zwischen Gefängnis und dem Leben draußen dar. Häftlinge, bei denen man von einem geringen Rückfallrisiko ausging und die nur noch zwischen sechs Monaten und einem Jahr vor sich hatten, ehe sie entweder auf Bewährung entlassen werden konnten oder ihre Strafe komplett abgesessen hatten, wurden in ein Entlassungsvorbereitungszentrum verlegt, wo man ihnen einen Job außerhalb der Einrichtung verschaffte. Abgesehen von der Arbeit in einer regelmäßig kontrollierten Umgebung und dem Besuch genehmigter Therapiekurse – wie beispielsweise Zornbewältigung – mussten die Insassen sich im Zentrum aufhalten und waren somit praktisch weiter inhaftiert. Jeder Verstoß gegen die Regeln zog eine Anhörung im Disziplinarausschuss nach sich und führte in den meisten Fällen letztlich zu einer Rückverlegung in eine geschlossene Haftanstalt.
Insgesamt gab es im Staat Massachusetts acht solcher Zentren. Das neueste war das Horizon House im South End von Boston. Und es war Fisks Liebling. Vor über drei Jahren hatte er den Commissioner überredet, im Horizon House den Versuch zu wagen, männliche und weibliche Insassen gemeinsam unterzubringen – was bei Carlyle auf heftige Ablehnung gestoßen war. Noch stärkere Bedenken hatte Carlyle erhoben, als der Commissioner die Stelle des Superintendents mit einer Frau besetzte. Schon wieder Fisks Einfluss. Carlyles Widerstand gegen das gemischte Zentrum im Allgemeinen und gegen Superintendent Natalie Price im Besonderen hatte sich als überaus berechtigt erwiesen. Innerhalb von zwei Jahren war es im Horizon House zu zwei schwerwiegenden Zwischenfällen gekommen, und beide Male hatte die Presse an dem ganzen Projekt kein gutes Haar gelassen. Und nach Carlyles Ansicht trug Superintendent Price in beiden Fällen die Hauptverantwortung. Aber aus irgendeinem für Carlyle unerfindlichen Grund war Price nicht nur nicht entlassen worden, sondern Miller stand auch weiterhin voll hinter dem Horizon House. Und hinter ihr.
Selbst jetzt noch, wo die Besprechung längst zu Ende war, merkte Carlyle, dass es in ihm rumorte. Er spürte, wie ihm die Galle überlief. Er musste sich zusammenreißen. Mehr noch. Er musste sich entspannen, bei der göttlichen Genevieve. Möglichst noch heute Abend. Es spielte keine Rolle, dass er erst gestern bei ihr gewesen war. Und es war ihm egal, was es kostete. Seit er im August das erste Mal zu ihr gegangen war, traf er sich mindestens einmal alle zwei Wochen mit ihr. Was nicht ganz einfach für ihn war. Sie war teuer. Sehr teuer. Er hatte ein paar Konten frisieren müssen, in Töpfe greifen, die er besser nicht angerührt hätte. Aber egal. Mittlerweile waren seine Abende mit dieser erotischen und einfallsreichen Prostituierten unerlässlich für seine psychische Stabilität. Natürlich hatte er auch mal ein paar andere ausprobiert, wenn Genevieve nicht frei war. Auch die waren gut gewesen, zumindest hatte er keine von denen von der Bettkante gestoßen. Aber es störte ihn, dass er sich mit ihnen in Hotelsuiten treffen musste statt im Sandsteinhaus. Das war ihm zu riskant. Und sie waren nun mal nicht Genevieve. Genevieve war einzigartig, war das Warten wert und auch das viele Geld. Falls sie heute noch Zeit für ihn hatte, würde er seine Frau anrufen und ihr sagen, dass er am Abend noch eine Besprechung hätte. Wahrscheinlich würde Dana ihm zwar nicht glauben, aber er bezweifelte, dass es ihr viel ausmachen würde.
Er war in seinem Büro und zog gerade sein Handy aus der Tasche, als ihm der große Umschlag auf dem Schreibtisch auffiel. Keine Briefmarke. Wahrscheinlich wieder so ein behördeninterner Mist – ständig wurde man mit irgendwelchen Mitteilungen und Memos überschüttet. Er hätte den Umschlag wahrscheinlich erst mal liegen lassen, wenn sein Blick nicht auf den Absender in der oberen linken Ecke gefallen wäre. Nur ein Name ohne Adresse. Ein Vorname. Genevieve.
Er war wie vom Donner gerührt. Wie zum Teufel hatte sie herausgefunden, wer er war? Man hatte ihm absolute Anonymität zugesichert. Ein Mann in seiner Position musste schließlich vorsichtig sein.
Er zog ein Foto aus dem Umschlag.
Seine Sekretärin klopfte leise an seine Tür und kam unaufgefordert herein. »Deputy Carlyle? Ich hab Ihnen eine Tasse Tee gekocht und ordentlich Zucker reingetan. Sie haben ein bisschen erschöpft ausgesehen nach der Besprechung.« Als sie sich seinem Schreibtisch näherte, schob er rasch einen Aktenordner über das Foto.
»Bitte sehr«, sagte sie munter und stellte die Tasse vor ihm hin.
Der Kragen seines weißen Hemdes fühlte sich zu eng an, sein ganzer Körper war feucht vor Schweiß. Das Herz hämmerte ihm in der Brust. Waren das die Zeichen für einen Herzinfarkt? Die Sekretärin hatte gesagt, er habe vorher schon erschöpft ausgesehen. Dann musste er jetzt aussehen wie ausgekotzt.
Keine noch so große Portion Zucker würde ihm wieder Auftrieb geben, doch weil die Frau ihn so besorgt ansah, würgte er ein paar Schlucke des widerlich süßen Tees herunter.
»Schmeckt Ihnen der Tee, Deputy?«
Er blickte sie aus glasigen Augen an. Er hatte Angst, tot umzufallen. Vielleicht sogar noch mehr Angst vor dem, was das Foto bedeutete.
»Ja, Grace«, krächzte er mühsam. Zum Beweis leerte er die Tasse in einem Zug. Und um Grace wieder loszuwerden.
»Schön. Dann geht’s Ihnen bestimmt gleich wieder besser. Brauchen Sie noch was für die Besprechung morgen im Bewährungsausschuss?«
»Nein. Nein, danke.« Dann riss er sich ein bisschen zusammen und sagte: »Ach doch. Auf … meinem Schreibtisch lag ein Umschlag …«
»Ja, den hat ein Junge abgegeben, als Sie noch in der Besprechung mit dem Commissioner waren.«
»Hat er … irgendwas gesagt?«
»Nein.« Die Sekretärin zögerte. »Ist wirklich alles in Ordnung mit Ihnen, Deputy?«
Er spürte, wie ihm Galle in die Kehle stieg. Er musste seine ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht vor dieser armen Frau zusammenzubrechen. »Ein stressiger Tag … mehr nicht«, murmelte er. »Wie üblich.«
Die Sekretärin nickte. Grace Lowell, eine große, dralle Frau mit unmodisch kurz geschnittenem Haar, zu viel Make-up und dem falschen Lidschatten für ihren olivefarbenen Teint, arbeitete erst seit zwei Wochen für den Deputy Commissioner. Sie konnte nicht wissen, dass dieser Tag für ihn so ziemlich der unüblichste war, den er sich vorstellen konnte.
Zehn Minuten später starrte Carlyle das Foto wieder düster an. Die Schmerzen in seiner Brust waren verschwunden. Er war zu betäubt, um irgendwas zu spüren.
Gott, dachte er müde, wie unglaublich hässlich der Sexualakt doch aussehen konnte. Das Bild hatte nichts mit diesen retuschierten Fotos in den Pornoheften zu tun, mit deren Hilfe er sich schon unzählige Male einen runtergeholt hatte. Zugegeben, die Männer auf den Fotos hatten ihn nie sonderlich interessiert. Aber auch die waren nackt.
Das Bild zeigte einen Steven Carlyle, der genauso aussah wie der übergewichtige, untrainierte siebenundfünfzigjährige Mann, der er nun mal war. Er kniete auf dem Bett. Eine unansehnliche Spreckrolle warf tiefe Falten quer über seinen Bauch. Die Zellulitisrunzeln auf seinem Hintern und den Hüften waren abstoßend deutlich. Die Kamera hatte sogar die Pockennarben auf der linken Schulter eingefangen, die bleibende Erinnerung an seine üble Pubertätsakne.
Genevieves schlanker, nackter Körper dagegen sah großartig aus. Sie würde auf dem Cover von jedem Sexheft eine gute Figur machen. Aber war es purer Zufall, dass ihr Gesicht durch eine blonde Haarwolke größtenteils verdeckt war? Er glaubte es nicht. Ihre Identität blieb unklar, zumindest auf dem Foto.
Und seine? Er studierte die Aufnahme. Sein Gesicht war im Profil zu sehen. War er wirklich genau zu erkennen? Vielleicht nicht. Zumindest bezweifelte er, dass sich anhand des Fotos eine eindeutige Identifizierung vornehmen ließe.
Aber Steven Carlyle war sich darüber im Klaren, dass dieses Foto bestimmt nicht das einzige war. Sein Magen krampfte sich zusammen, als sein Zorn den Siedepunkt erreichte. Man hatte ihm eine Falle gestellt. Er war reingelegt worden. Das hier war ein Erpressungsversuch, keine Frage. Und er war ihnen auf den Leim gegangen wie ein brünstiger Bauerntölpel und hatte im wahrsten Sinne des Wortes die Hose runtergelassen.
Und jetzt, was wollte dieses erpresserische Miststück von ihm? Geld? Da sie offensichtlich wusste, wer er war, wusste sie ja wohl ganz bestimmt auch, dass Staatsdiener selbst auf seiner Ebene hundsmiserabel bezahlt wurden.
Er knallte das Foto mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch. Und in dem Moment sah er, dass auf der Rückseite etwas stand.
Sein Körper erstarrte. Ihm stockte der Atem.
Die Nachricht war kurz. Du musst mir einen Gefallen tun. In Liebe, wie immer, Genevieve.
Die Stimme seiner Sekretärin tönte zwitschernd aus der Sprechanlage. »Deputy, ich mache nur noch ein paar Briefe fertig, dann bin ich weg. Schönen Abend noch.«
Er hörte sie, antwortete aber nicht. Die Aussichten, dass er heute oder irgendwann in nächster Zeit einen schönen Abend haben würde, waren gleich null. Seine Wut kochte über.
Er würde sie umbringen. Verdammte Scheiße, er würde sie umbringen.
»He, he, wo bleibt dein Feuer, Süße? Ist doch noch früh. Ich dachte, wir könnten noch ein, zwei Nummern schieben.«
»Tut mir Leid, Billy. Heute nicht.«
»Hast du noch einen Termin?«
»Nein. Aber eines von den anderen Mädchen müsste jeden Moment aufkreuzen.«
Billy Thomson – der Deckname, den der angesehene Anwalt Jerry Tepper sich zugelegt hat – schlägt die Decke zurück und zeigt ihr auffordernd seine Erektion, die nur zum Teil von einem Damenslip aus rotem Satin bedeckt ist. »Kann ich dich wirklich nicht überreden? Du darfst mir auch wieder Handschellen anlegen.«
Sie lächelt. »Ich darf?« Sie geht ins Badezimmer und lässt die Tür dabei offen.
Widerwillig steigt er aus dem Bett, zieht den Satinschlüpfer aus und greift nach seinen seidenen Boxershorts. »Was ist mit nächster Woche? Selber Ort? Selbe Zeit?«
»Selbe Zeit, aber wir müssen uns drüben in der Hotelsuite treffen«, ruft sie ihm zu.
»Ach Mist, du weißt doch …«
Sie kommt nackt zurück ins Schlafzimmer, ein beschwichtigendes Lächeln auf den Lippen. »Nur nächste Woche, Süßer. Eine unglückliche Terminüberschneidung. Kommt nicht wieder vor.«
Sie reicht ihm seine Hose und hilft ihm dann, sich anzuziehen. Sie muss ihn loswerden, damit sie weg kann.
»Du siehst gut aus, Billy«, sagt sie zu ihm und drückt ihm die schütteren Haare fest, die er vergeblich so kämmt, dass sie seine kahle Stelle verdecken sollen. Männer sind ja so eitel, denkt sie. Von ihrer Blindheit mal ganz zu schweigen.
Er ergreift ihren Arm und lächelt. »Hören wir auf mit der Schauspielerei, Genevieve. Für die anderen kann ich ruhig Billy sein, aber bei dir, Jessica –«
Sie küsst ihn voll auf den Mund. »Die Schauspielerei macht doch erst richtig Spaß. Bis nächste Woche, Billy.«
Ein Schatten der Verärgerung huscht über sein Gesicht.
Sie übersieht es geflissentlich.
Sobald er durch die Tür ist, fliegt die blonde Perücke vom Kopf. Sie springt rasch unter die Dusche, trocknet sich ab, fährt sich mit den Fingern durch das kurze kastanienbraune Haar und nimmt die smaragdgrünen Kontaktlinsen heraus.
Ein kurzer Blick auf die Uhr, und sie hastet zurück ins Schlafzimmer, nimmt ihre Kaschmirhose mit dem passenden Blazer aus dem ansonsten leeren Schrank und zieht sich an. Sie ist spät dran.
Er wird sich Sorgen machen. Er macht sich immer Sorgen, wenn sie zu spät kommt. Aber jetzt wird er sich noch mehr Sorgen machen als sonst. Vielleicht hätte sie nichts sagen sollen, als er gestern Abend anrief. Sie hatte es auch nicht vorgehabt, sondern wollte warten, bis sie ihn persönlich sehen würde.
Aber er hatte die leichte Anspannung in ihrer Stimme gehört und wollte wissen, was los war. Sie hätte ihm versichern können, dass alles bestens sei. Aber in Wahrheit wollte sie von ihm beruhigt werden, wollte sie von ihm getröstet werden.
Stattdessen wurde er noch nervöser, als sie es war. Und zornig. Und – ja – verängstigt. Immer und immer wieder sagte er, dass das Timing schlechter nicht hätte sein können. Als ob sie das nicht selbst wüsste. Aber es war schließlich nicht ihre Schuld. Ja, sie hatte einen Fehler gemacht, war ein ganz kleines bisschen nachlässig gewesen. Aber sie hatte es wieder gutgemacht. Sie war sicher – na ja, fast sicher –, dass sie ihre Trümpfe nicht aus der Hand gegeben hatte. Von jetzt an würde sie vorsichtiger sein. Alles würde nach Plan laufen. Das hatte sie ihm am Telefon gesagt. Hatte ihre eigenen Bedenken vergessen, weil sie ihn beruhigen wollte. Und gehofft, dass er ihr glaubt.
Einen Moment denkt sie an »Billys« Verärgerung, weil sie ihm nicht mehr Zeit gewidmet hat. Sie hat ihm den Wunsch nicht gern abgeschlagen. Schließlich weiß gerade sie, wie wichtig es ist, die Kunden bei Laune zu halten. Vor allem, wenn die Kunden zu den einflussreichsten Männern in Boston gehören. Männer, die man bitten konnte – und es häufig auch tat –, gewisse Beziehungen spielen zu lassen, gewisse Gefälligkeiten zu gewähren. Manchmal lief so was freiwillig, manchmal war ein bisschen Aufmunterung vonnöten. Bei Jerry Tepper war weniger Aufmunterung erforderlich gewesen als bei anderen.
Jessica ist es lieber, wenn kein Druck ausgeübt werden muss. Das soll nicht heißen, dass sie davor zurückscheut, wenn es nötig ist. Und sie muss zugeben, dass es ihr wirklich ein Gefühl von Macht gibt, wenn sie einen mächtigen Mann dazu bringt, etwas zu tun, was er nicht unbedingt tun will.
Natürlich wäre ihre Chefin nicht begeistert, wenn sie dahinter käme, dass ihre Spitzenkraft Schwarzarbeit macht. Aber wie sollte sie schon dahinter kommen? Und was sie nicht wusste, würde ihr auch nicht schaden.
Würde keinem schaden.
Als Jessica Asher über die Straße zu ihrem neuen, silberglänzenden Porsche lief, warf sie einen kurzen Blick auf ihre brillantenbesetzte Rolex. Aus den Augenwinkeln heraus sah sie einen weißen Geländewagen um die Ecke biegen und in ihre Richtung kommen, aber sie dachte nicht weiter darüber nach, weil sie die Fahrbahn schon fast überquert hatte und kurz vor ihrem Auto war. Sie drückte gerade auf die Fernbedienung ihrer Zentralverriegelung, als der Geländewagen einen plötzlichen Schwenk nach links machte. Erschrocken sah Jessica auf. Der Wagen kam auf sie zugerast. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. Der Fahrer musste betrunken sein. Oder er hatte einen Herzanfall. Eine andere Erklärung gab es nicht.
Doch dann sah sie das Gesicht des Fahrers. Und wusste mit grauenvoller Gewissheit, dass es doch eine andere Erklärung gab. Ihr Mund wollte einen Namen formen. Aber sie kam nicht mehr dazu, ihn hinauszuschreien.
Als der Geländewagen sie erfasste, wurde sie regelrecht vom Boden gehoben und wäre ein gutes Stück durch die Luft geschleudert worden, wenn ihr eigenes Auto die Flugbahn nicht blockiert hätte. Ihr Körper krachte mit unglaublicher Wucht auf die Fahrerseite des Porsches, ihr hübsches Gesicht zersplitterte die Seitenscheibe, ihr geschmeidiger Körper drückte das Metall ein. Der Aufprall wäre furchtbar schmerzhaft gewesen, doch Jessica Asher hatte Glück im Unglück. Sie war auf der Stelle tot.
Trotzdem setzte der Geländewagen noch einmal nach.
1
Als ich mein Büro betrete, steht ein wundervoller Strauß mit einem Dutzend langstieliger gelber Rosen auf dem Schreibtisch. Ich freue mich nicht darüber, obwohl ich nicht ganz sicher bin, wer sie geschickt hat. Aber ich habe eine starke Vermutung. Oder zwei starke Vermutungen. Die Sache ist die, ich hatte gehofft, dass sich keiner diesen Tag rot im Kalender angestrichen hätte. Ich stehe nicht auf Geburtstage, jedenfalls nicht auf meine eigenen. Sie deprimieren mich. Und zwar nicht wegen des Älterwerdens – in meinem Beruf verleiht mir das Alter mehr Gewicht, mehr Glaubwürdigkeit –, sondern weil ich an einem Punkt in meinem Leben bin, an dem ich nie sein wollte.
Dieses Jahr bildet da keine Ausnahme. Ich bin noch immer geschieden, habe noch immer eine Beziehung zu einem Mann, der sich nicht binden will, mache noch immer Fehler mit einem anderen Mann, an den ich mich wohl nie binden werde. Ich arbeite viel zu viel. Ich bin öfter einsam als nicht, vermisse noch immer schmerzhaft meine beste Freundin Maggie, obwohl sie schon fast zwei Jahre tot ist. Ich mache mir immer viel zu viele Sorgen – wegen meiner Mitarbeiter, meiner Häftlinge, meiner Schwester, die so naiv ist zu glauben, ihr pädophiler Ehemann wäre geheilt. Sogar Hannah, mein Hund, macht mir Sorgen. In letzter Zeit wirkt sie so schlapp und müde und hat gar keinen Appetit.
Ach so, ja, seit neuestem gibt es noch was, weswegen ich mir Sorgen machen kann. Meine Periode ist drei Wochen überfällig. In den letzten Tagen war ich schon sechsmal im Drugstore, um mir einen Schwangerschaftstest zu kaufen, der mich endlich von der quälenden Ungewissheit befreien soll. Aber jedes Mal habe ich dann doch irgendwas anderes gekauft. Das sieht mir so gar nicht ähnlich. Bis jetzt war ich immer der Überzeugung, dass ich zumindest eines bin, nämlich entschlussfreudig. Ich reiß mich nicht um Probleme, bestimmt nicht, aber ich stecke auch nicht den Kopf in den Sand, wenn ich welche habe.
Das hier ist allerdings was anderes. Es ist ein Problem, das ich am liebsten einfach verschwinden lassen würde. Aber ich kann nicht. Verdrängung funktioniert bei vielen Menschen – meine Schwester Rachel ist ein Paradebeispiel –, aber bei mir eben nicht. Sosehr ich auch versuche, nicht an die Möglichkeit einer Schwangerschaft zu denken, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Aber heute ist Schluss damit. Wenn sich bis Feierabend immer noch nichts getan hat, besorge ich mir auf dem Weg nach Hause einen Schwangerschaftstest. Damit das Elend ein Ende hat. Oder erst richtig anfängt …
Kaum vorstellbar, dass es mal eine Zeit gegeben hat, in der ich mir ein Baby gewünscht habe. Aber zu der Zeit hätte ich auch mit Bestimmtheit sagen können, wer der dazugehörige Vater war.
Es klopft an der Tür. Sharon Johnson, meine Berufsberaterin, steckt den Kopf herein. »Herzlichen …«
»Schon gut, schon gut«, murmele ich.
Sie betrachtet mich mitleidig, kommt herein und schließt die Tür hinter sich. »Wie wär’s, wenn du am Sonntag zum Brunch kommst? Ray macht ihre berühmten – oder besser gesagt berüchtigten – Blaubeerpfannkuchen.« Sie tätschelt ihren leicht gerundeten Bauch. »Bei der Frau gehe ich auf wie ein Hefekloß.«
»Hör doch auf. Du bist hinreißend schön und noch dazu glücklich«, sage ich trocken und habe schlagartig den dicken Bauch vor Augen, den ich wahrscheinlich bekommen werde. Und leider nicht von Blaubeerpfannkuchen.
Ein Lächeln breitet sich auf Sharons kakaobraunem Gesicht aus. »Wenn ich nicht genau wüsste, dass du stockhetero bist, könnte ich fast meinen, du willst mich anmachen.«
»Glaub mir, wenn ich nicht hetero wäre und du nicht in einer tollen Beziehung mit dieser klasse Frau leben würdest, und wenn du nur eine Freundin und nicht auch noch meine Mitarbeiterin wärst, dann, meine Liebe, könnte es durchaus passieren, dass ich dich anmache«, frotzele ich. Aber hinter meinem lockeren Witz steckt blanker Neid. Sharon ist eine Frau, die in ihrem Leben schon einige Schläge einstecken musste, sogar im Knast hat sie schon gesessen. Was überhaupt der ausschlaggebende Grund gewesen ist, warum ich sie damals eingestellt habe. Ich brauchte jemanden, der für die Insassen von Horizon House Arbeitsplätze beschaffte und sie kontrollierte. Ich hatte gehofft, dass Sharon ihnen als Vorbild dienen könnte. Wenn sie, ein Ex-Knacki, ihr Leben in den Griff bekommen hatte, dann konnten sie das auch.
Aber gerade weil sie ein Ex-Knacki war, musste ich um sie kämpfen wie ein Löwe. Der Vorgesetzte, der mir die größten Steine in den Weg legte, war Deputy Commissioner Steven R. Carlyle. Aber Carlyle legt mir sowieso, wo immer er kann, Steine in den Weg.
»Also, was ist mit dem Brunch? Du kannst auch deinen Typen mitbringen.«
Welchen von beiden?
»Lieber ein anderes Mal.«
»Geht’s dir noch immer nicht gut?«, fragt Sharon und mustert mich prüfend.
»Wie meinst du das?« Schlagartig gehe ich in Verteidigungshaltung.
»Ich meine nur, dass du mir in den letzten zwei Wochen irgendwie verändert vorkommst.«
Ich spüre, wie ich rot anlaufe. »Hab einfach viel um die Ohren«, sage ich vage.
Sharon hakt nicht nach. Auch wenn wir uns in den letzten zwei Jahren angefreundet haben, sind wir uns doch beide der unsichtbaren Grenzen bewusst. Keine von uns überschreitet sie.
»He, lächle doch mal, Nat. Du siehst keinen Tag älter aus als dreiunddreißig.«
Ich drehe mich um und sehe meinen Deputy Superintendent Jack Dwyer in der offenen Tür stehen. »Sehr lustig.« Jack weiß ganz genau, dass ich heute dreiunddreißig geworden bin.
Mit gerunzelter Stirn späht er auf die Rosen. »Leo?«
»Weiß nicht. Bin gerade erst reingekommen.« Aber ich vermute, wenn Jack die Rosen nicht geschickt hat, müssen sie von Detective Leo Coscarelli sein – der Mann, der sich nicht binden will, zumindest nicht an mich.
Ich stelle meine Tasche neben dem Schreibtisch auf den Boden. Im Stehen, mit dem Rücken zu Jack, sehe ich die Post durch.
»Denk dran, um elf haben wir eine Disziplinaranhörung«, sagt er und kommt auf mich zu. »Sollen wir die Einzelheiten noch mal durchsprechen?«
Ich blicke ihn verständnislos an. Wie soll ich an eine Anhörung denken, die ich komplett vergessen hatte? Welcher von meinen Häftlingen hat gegen eine Vorschrift verstoßen? Wichtigere Frage: Wo zum Teufel hab ich in letzter Zeit meinen Kopf? Ich bin froh, dass Freitag ist. Ich brauche das Wochenende, um wieder ins Lot zu kommen. Wenn ich doch bloß endlich meine verdammte Periode kriegen würde.
»Dennis Finn«, hilft Jack mir auf die Sprünge. »Der Typ, der vor einem Monat aus der Strafanstalt Norton zu uns verlegt worden ist. Hat drei bis fünf Jahre wegen Diebstahls bekommen. Dienstagabend hatte er diese kleine Auseinandersetzung mit Hutch, erinnerst du dich?«
»Ach ja, stimmt.« Ich seufze müde. »Man sollte meinen, wenn Finn sich schon unbedingt prügeln muss, wäre er wenigstens schlau genug, sich nicht ausgerechnet mit einem Vollzugsbeamten anzulegen, schon gar nicht mit Hutch.« Finn hätte auch so vor den Disziplinarausschuss gemusst, ganz gleich, mit wem er sich geschlagen hat, weil jede Prügelei ein Verstoß gegen die Hausvorschriften ist. Aber dieser Fall ist umso ernster, da der Mann, den Finn geschlagen hat – Gordon Hutchins, der leitende Vollzugsbeamte im Horizon House –, ausgerechnet in dem Ausschuss sitzt, der über Finns Schicksal zu entscheiden hat. Durchaus möglich, dass einstimmig beschlossen wird, Finn zurück hinter Gitter zu schicken. Aber falls irgendwelche mildernden Umstände vorliegen – in seinem Fall ein Laufpass der Freundin und eine schwere Erkrankung eines seiner Kinder –, haben wir wenigstens ein bisschen Spielraum.
Es fällt mir nie leicht, Häftlinge aus dem Programm zu werfen. Keinem von uns. Aber wir tun es, wenn es sein muss. Jedes Anzeichen dafür, dass wir die Regeln lockern, würde das gesamte Programm gefährden, aber auch die Sicherheit aller Beteiligten – Mitarbeiter, Insassen und die Öffentlichkeit.
»Ist das Finns erster Verstoß?« Auch das käme ihm zugute.
Jack blickt mich aus zusammengekniffenen Augen an. »Was ist los mit dir, Nat? Du hast doch sonst immer sämtliche Fakten und Zahlen über unsere Insassen im Kopf. Geht’s dir gut? Ich weiß nicht. In letzter Zeit bist du so –«
»Mir geht’s prima«, entgegne ich barsch. Und das kommt noch hinzu. In letzter Zeit bin ich nicht nur unkonzentriert, sondern auch ungeduldig und missmutig. Ein schlechtes Zeichen bei einem Kontrollfreak wie mir.
Jacks Blick wandert zurück zu den Blumen. »Die müssen von Leo sein.«
Ich starre ihn zornig an. »Wie gesagt, ich weiß es nicht.«
»Ist er in Ungnade gefallen?« Jack bemüht sich gar nicht erst, seiner Stimme nicht anmerken zu lassen, dass ihn diese Möglichkeit erfreuen würde.
Ich werfe ihm einen drohenden Blick zu. »Das hatten wir doch alles schon, Jack. Schon oft«, füge ich spitz hinzu. »Ich werde nicht mit dir über meine Beziehung zu Leo sprechen.«
»Okay«, sagt er und schiebt sich ein bisschen näher, »dann reden wir eben über unsere Beziehung.«
»Wir haben keine Beziehung«, sage ich mit Nachdruck. »Keine beziehungsmäßige Beziehung«, präzisiere ich, und prompt schlägt meine gereizte Stimmung in Mattigkeit um, dabei hat der Tag noch gar nicht richtig angefangen. Ein weiteres schlechtes Zeichen. Mattigkeit ist mir eigentlich fremd.
Jack schiebt sich noch näher heran, sodass seine Schulter meine berührt. »Was war mit dieser warmen Septembernacht, als du in mein Bett gekrabbelt bist und …«
Ich mache einen großen Schritt nach links, um dem Körperkontakt auszuweichen. Jack macht wieder einen Schritt auf mich zu. Unser kleines Tänzchen. Der Ablauf ist uns beiden nur allzu vertraut.
»Hör auf, Jack. Das Thema hatten wir doch schon. Es war ein Fehler. Wir hatten vereinbart, dass …«
»Von wegen – du wolltest, dass ich dich notgedrungen so tun lasse, als wäre es ein Fehler gewesen.«
»Lass gut sein, Jack. Im Ernst. Sonst …«
»Schön, von mir aus.« Er bleibt, wo er ist, die Arme vor der breiten Brust verschränkt. Er trägt ein weißes Hemd, die Ärmel über den muskulösen Unterarmen hoch gekrempelt, und eine gestreifte Krawatte, die schon bessere Tage gesehen hat und die er über dem geöffneten Hemdkragen gelockert hat. Irgendwie schafft er es, lässig männlich zu wirken und gar nicht schlampig. Verdammt, er sieht sexy aus, um ehrlich zu sein.
»Wie wär’s, wenn wir zusammen zum Lunch gehen? Ich verspreche auch, nichts Beziehungsmäßiges anzusprechen.«
Ich verdrehe die Augen.
»Und außerdem gibt’s noch mehr zu feiern als bloß deinen Geburtstag. Ich hab meinen Rekord gebrochen. Drei Wochen nüchtern. Seit einundzwanzig Tagen ist kein Tropfen Alkohol über meine Lippen gekommen.«
»Das ist toll, Jack.«
»Ich bin wirklich auf dem besten Weg, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, Nat. Wir werden schließlich alle nicht jünger. Ich werde bald einundvierzig. Meine Mom ist mit achtundvierzig an einem Herzinfarkt gestorben, mein Dad mit dreiundfünfzig an Leberversagen. Vielleicht hab ich bloß noch ein paar Jährchen. Und die will ich nüchtern verbringen. Und hoffentlich nicht allein.«
Jacks Kampf mit dem Alkohol ist ein altes Problem. Und ein Problem, das mir leider nur allzu vertraut ist, da mein Vater seinen Kampf mit der Flasche verloren hat und sich einen Strick nahm, weil er nicht mehr weiter wusste. Bis heute bin ich mit mir uneins, ob Dad sich am Ende für die leichte oder die schwere Lösung entschieden hat. Oder ob er überhaupt noch wusste, was er tat, denn laut Obduktionsbericht war sein Blutalkohol bei Eintritt des Todes höher als auf der Tabelle ablesbar.
Ich betrachte meinen Stellvertreter jetzt mit einem freundlicheren Blick. »Es freut mich wirklich, dass du die Sache so gut im Griff hast, Jack. Halt durch, dann überlebst du deine Eltern um mindestens dreißig Jahre.«
Er verzieht das Gesicht. »Ich glaube, so lange halt ich es mit mir selbst nicht aus.«
Ich lächele.
»Also, was ist nun, Nat? Lunch im La Maison? Du kannst ein Gläschen Champager trinken, und ich stoße mit Perrier auf dich an.«
Kein Champagner oder sonst was Alkoholisches, falls ich schwanger bin …
»Die Anhörung könnte länger dauern«, sage ich schroff. »Und ich hab den ganzen Nachmittag über Termine.«
»Gut, dann eben Abendessen.« Wenn Jack etwas will, lässt er so leicht nicht locker. Darin sind wir uns ziemlich ähnlich. Ein Jammer, dass wir normalerweise nicht dasselbe wollen. »Dann müssen wir uns nicht so beeilen …«
»Ich kann nicht, Jack. Leo und ich …«
Er hebt die Hand wie ein Verkehrspolizist, und seine heitere Stimmung verfliegt. »Ja, klar. Stimmt. Hätte ich mir denken können. Du und Leo. Richtig. Kein Problem, Nat –«
Ehe mir etwas einfällt, womit ich das Ego meines Stellvertreters wieder aufbauen könnte, klingelt das Telefon. »Jack, ich muss rangehen.« Normalerweise nimmt Paul Lamotte, mein Sekretär und ebenfalls Insasse des Horizon House, die Gespräche entgegen, aber er ist schon die ganze Woche krank.
»Nat?« Eine männliche, überaus sachliche Stimme.
»Ja.«
Jack dreht sich grußlos um und verlässt den Raum.
»Hier spricht Warren Miller.«
Ich verkrampfe mich ein wenig vor Anspannung. Einen unerwarteten Anruf vom Leiter der Strafvollzugsbehörde bekomme ich nicht alle Tage. »Commissioner Miller. Was kann ich für Sie tun?«
»Wir haben ein Problem, Nat. Und ich möchte Sie um Ihre Unterstützung bitten.«
Meine Anspannung steigert sich rasch zu Besorgnis. »Was für ein Problem?«
»Das möchte ich lieber nicht am Telefon besprechen.«
»Soll ich zu Ihnen ins Büro kommen? Um elf habe ich hier im Zentrum eine Disziplinaranhörung, aber die kann auch mein Stellvertreter leiten –«
»Sie müssen sofort herkommen.«
»Okay, bin schon unterwegs.«
»Ich bin aber nicht im Büro.« Kurze Pause. Ich höre ihn in die Sprechmuschel atmen. »Ich bin im Vierzehnten Revier. An der Charles Street.«
Mein Magen zieht sich zusammen. »Geht’s um einen meiner Insassen?« Das hätte mir gerade noch gefehlt. Dass einer meiner Häftlinge mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.
Anstatt meine Frage zu beantworten, sagt Miller abrupt: »Nat, ich erwarte Sie in einer Viertelstunde.«
Drei Minuten später will ich gerade aus meinem Büro hasten, als das Telefon erneut klingelt. Ich mache auf dem Absatz kehrt und reiße den Hörer ans Ohr. Vielleicht ist es wieder der Commissioner und es war nur ein falscher Alarm?
»Haben dir die Rosen gefallen, Natalie?«
»Ja, ja, wunderschön, Leo.« Mir fällt ein, dass ich nicht mal einen Blick auf die Karte geworfen habe. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr. »Hör mal, ich bin auf dem Sprung. Bleibt es bei heute Abend?«
»Ich verlass mich drauf.«
»Prima –«
»Wo musst du denn so eilig hin?«
Ich zögere. »Vierzehntes Revier. Kennst du da irgendwen?«
»Worum geht’s?«
»Weiß ich noch nicht. Aber nichts Gutes, da bin ich sicher. Also, kennst du da irgendwen?«
»Ja, allerdings. Fran Robie. Sie ist bei der Mordkommission.«
Mich überläuft es kalt, und meinem Magen geht es noch schlechter. »Hoffen wir, dass ich sie nicht brauchen werde. Aber falls doch, kann ich ihr sagen, dass ich eine Freundin von dir bin?«
»Eine Freundin? Ja. Klar. Du kannst ihr sagen, dass du meine Freundin bist.«
Erst nachdem ich aufgelegt habe, frage ich mich, ob Fran Robie vielleicht auch »eine Freundin« von Leo ist.
2
Als ich dem dickbäuchigen Sergeant am Empfang meinen Namen nenne, springt er auf und hastet um seine Theke herum. Ich werde offensichtlich erwartet.
»Bitte, hier entlang, Superintendent.« Sein Verhalten ist sachlich, aber korrekt. Ich folge ihm eine breite Treppe hinauf, auf der uns einige Polizisten entgegenkommen. Wir gehen einen schmalen Gang hinunter, kommen an mehreren geschlossenen Türen vorbei, dann an einer offenen, die in einen mittelgroßen Einsatzraum mit etwa einem Dutzend paarweise angeordneten Schreibtischen führt. Vor der nächsten Tür, die wieder geschlossen ist, bleibt der Sergeant stehen. »Da wären wir, Superintendent. Der Commissioner erwartet Sie.«
Ich erstarre, als der Sergeant nach dem Türknauf greift. Auf der Scheibe in der Tür steht in schwarzen Druckbuchstaben: Captain Francine Robie. Und unter dem Namen: Mordkommission.
»Ich glaube, ich … muss mich … übergeben«, nuschele ich.
Der Sergeant dreht sich schnell zu mir um, aber ich kann ihn nicht mehr ganz klar sehen. »Damen … toilette?«
Er zeigt den Gang hinunter. Ich rase los und schaffe es gerade noch zu einem Klo, treffe aber doch nicht ganz die Schüssel, als ich auf die Knie falle und loskotze.
Fünf Minuten später habe ich den bekleckerten Leinenrock ausgewaschen, den Mund ausgespült, frischen Lippenstift aufgelegt, die gelösten Haarsträhnen wieder gebändigt und trete wieder auf den Flur, wo mich drei besorgte Augenpaare erwarten. Zwei davon erkenne ich – sie gehören dem Sergeant und dem Commissioner. Das dritte Augenpaar gehört einer Frau, und ich denke mir, dass es sich um Captain Francine Robie handelt. Mordkommission.
»Kleine Magenverstimmung«, murmele ich, und einen Moment lang ist meine Verlegenheit größer als meine Sorge, warum man mich wohl herbestellt hat.
Commissioner Warren Miller tritt auf mich zu. Er ist Anfang sechzig. Ein großer, knochiger Mann mit kräftiger Nase, markantem Kinn und akkurat geschnittenen, dunkelbraunen Haaren, die grau durchsetzt und glatt nach hinten gekämmt sind. Er trägt einen für seine hagere Gestalt maßgeschneiderten marineblauen Anzug. Er ist kein attraktiver Mann, aber er hat eindeutig Charisma. »Es tut mir furchtbar Leid, Nat. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie krank sind –«
»Bin ich nicht. Es ist … es geht mir wieder gut. Wirklich.« Die drei weiterhin unverwandt auf mich gerichteten Augenpaare verraten, dass ich niemanden überzeugt habe.
»Am besten, Sie kommen in mein Büro und setzen sich, Supterintendent. Möchten Sie ein Glas Wasser?« Die Frau, die mir noch nicht offiziell vorgestellt wurde, deutet auf die Tür mit der Aufschrift Captain Francine Robie.
Ich nicke. Sie führt mich zu der jetzt weit geöffneten Tür und tritt zur Seite, um mich zuerst hineinzulassen. Der Commissioner folgt mir dicht auf den Fersen. Vielleicht fürchtet er, ich könnte ohnmächtig werden, und will in meiner Nähe bleiben, um mich notfalls aufzufangen.
Bevor Robie ebenfalls eintritt, wendet sie sich an den Sergeant. »Rick, besorgen Sie uns ein Glas Wasser mit Eis.«
»Wird gemacht, Captain.«
»Nehmen Sie Platz. Bitte, Superintendent.« Captain Robie überlässt mir die Entscheidung zwischen einem Schaukelstuhl aus Ahorn oder einem von zwei Polstersesseln, die mit einem erdfarbenen Paisleystoff bezogen sind. Der Schaukelstuhl kommt nicht in Frage – schon bei dem Gedanken daran wird mir schlecht –, daher entscheide ich mich für einen der Polstersessel. Der Commissioner lässt sich in dem anderen nieder.
Ich bin ein wenig erstaunt, dass ein Büro in einem Polizeirevier so gut ausgestattet ist. Nicht nur das – es ist sogar richtig gemütlich. Ein Flickenteppich auf dem Boden, cremefarbene Baumwollvorhänge am Fenster, hübsch gerahmte Fotos an der Wand – hauptsächlich Bilder vom Meer und von Booten –, die Tapete nicht wie üblich behördengrün, sondern in einem warmen Terracottaton. Selbst der Schreibtisch ist nicht die standardmäßige Scheußlichkeit aus Metall. Robie arbeitet an einem wuchtigen Eichenschreibtisch, dem die Patina des Alters anzusehen ist. Sie hat den Schreibtisch mit dem Rücken an eine Seitenwand gestellt, sodass sie auf der rechten Seite das Fenster mit den Vorhängen hat und auf der linken die Tür.
Unter anderen Umständen würde ich mir die geschmackvolle Einrichtung mit der Tatsache erklären, dass das Büro einer Frau gehört. Doch die Mehrheit von uns Frauen, die wir uns für eine Laufbahn in Männerdomänen wie Strafvollzug oder Polizei entschieden haben, ist stets bemüht, sich anzupassen. Oder zumindest unsere Unterschiede nicht auch noch zu betonen.
Francine Robie scheint derlei Bedenken nicht zu haben. Und das gilt nicht nur für ihr Büro, sondern auch für ihr Aussehen. Selbst wenn sie sich anstrengen würde, gelänge es ihr sicherlich nicht zu verbergen, wie attraktiv sie ist. Aber von Anstrengungen in besagter Richtung kann gar keine Rede sein – im Gegenteil, sie zeigt schamlos, was sie hat. Seidiges, blondes Haar mit dezent getönten Strähnchen, das ihr locker auf die Schultern fällt, dunkelbraune Augen mit perfekt aufgetragenem Lidstrich, die Wimpern mit genau der richtigen Menge Mascara getuscht, sodass sie nicht zusammenkleben, und eine Bräune, die entweder aus einem spätherbstlichen Urlaub oder dem Sonnenstudio stammt.
Auch die Garderobe der Kriminalbeamtin ist alles andere als altjüngferlich. Schwarze Lederstiefel mit fünf Zentimeter hohen Absätzen, figurbetonte schwarze Samthose, eine apfelgrüne Seidenbluse, die nicht nur wegen ihrer leuchtenden Farbe die Blicke auf sich zieht, sondern auch, weil die oberen zwei Knöpfe offen stehen.
Selbst wenn ich mein anthratzitfarbenes Leinenkostüm nicht voll gekotzt hätte, würde ich mir jetzt wie eine graue Maus vorkommen.
»Geht’s wieder?«, erkundigt sich Captain Robie fürsorglich. Sie steht noch immer.
»Ja. Danke.«
»Superintendent Price, ich bin Fran Robie.« Nach dieser förmlichen Vorstellung streckt sie mir ihre Hand entgegen. Ich schüttele sie kurz.
Zugegeben, ich finde Robie nicht unbedingt sympathisch. Nicht bloß wegen ihres tollen Aussehens, ihrer Kleidung, ihrer geschmackvollen Büroeinrichtung, sondern auch, weil sie jünger ist als die meisten Captains bei der Polizei, denen ich bislang begegnet bin. Ich würde schätzen, Anfang dreißig. Andererseits könnte sie auch älter sein, als sie aussieht. Ich bin ohnehin nicht besonders gut darin, das Alter von Leuten zu erraten. Leo ist da ein gutes Beispiel. Als ich ihn kennen lernte, dachte ich, er sei viel zu jung, um schon Detective bei der Mordkommission zu sein. Aber sein jugendliches Aussehen täuschte. Ich sage täuschte, weil Leo in den letzten zwei Jahren deutlich gealtert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich zumindest teilweise dafür verantwortlich bin. Aber ich bin nicht die einzige Frau in Leos Leben, die an den grauen Strähnen in seinem braunen Haar schuld ist. Nicki Holden, die Mutter seines Sohnes, hat auch ihren Anteil daran.
Ich spüre, dass Robie mich ansieht. Ich erwidere ihren Blick. Sie betrachtet mich nachdenklich, vermutlich versucht sie, sich einen Eindruck von mir zu verschaffen.
Andererseits, vielleicht hat sie bloß Angst, ich könnte wieder anfangen zu kotzen.
Robie setzt sich in den braunen, ergonomischen Ledersessel vor ihrem Schreibtisch und dreht ihn so, dass sie mich und den Commissioner im Blick hat. Commissioner Miller sitzt leicht vorgebeugt, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Hände flach aufeinander gelegt.
Gerade als Miller das Wort ergreifen will, klopft es an der Tür. Der Sergeant vom Empfang kommt mit einem Glas Eiswasser. Ich nehme es, danke ihm und merke, dass er auf ein Nicken von Captain Robie wartet, ehe er rasch wieder den Raum verlässt.
Sowohl Miller als auch Robie schweigen. Anscheinend warten sie darauf, dass ich von dem Wasser trinke, das ich eigentlich gar nicht will. Ich nehme einen höflichen Schluck und wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie endlich mit der Sprache herausrücken.
Ich stelle das Glas auf einem Hochglanz-Reisemagazin ab, das auf einem Eichentischchen neben meinem Sessel liegt. Ich halte es kaum noch aus, will endlich wissen, was los ist.
Miller räuspert sich. »Captain Robie leitet die Ermittlungen in einem Mordfall. Einer von unseren Leuten wird in der Sache vernommen. Sie können sich denken, dass mich das sehr beunruhigt.«
Ich schaue ihn fragend an. »Einer von unseren Leuten?« Würde der Commissioner einen Häftling als einen von unseren Leuten bezeichnen? Und würde ein Captain persönlich die Ermittlungen in einem ganz gewöhnlichen Mordfall leiten? Die Antwort auf beide Fragen lautet: Nein. Die Sache muss wichtig sein. Entweder ist das Opfer prominent oder der Verdächtige ist es. Einer von unseren Leuten …
Millers Finger verschränken sich, als er die Hände fester gegeneinander presst. »Carlyle«, sagt er dann, und seine Stimme wird plötzlich leiser.
Ich muss mich verhört haben. Vielleicht hat die Übelkeit von vorhin gar nichts mit einer Schwangerschaft zu tun, wie ich insgeheim befürchte. Vielleicht habe ich eine Entzündung im Innenohr.
»Sie kennen Steven Carlyle, Superintendent?«, wirft Robie ein.
»Den Deputy Commissioner? Natürlich, ich – wird er verhört? Ist er … gilt er als Verdächtiger in einem Mordfall?« Ich weiß nicht mal, wer ermordet wurde, aber darum geht es im Augenblick auch nicht. Der Gedanke, dass der Deputy Commissioner überhaupt verdächtigt wird, kommt mir völlig lächerlich vor. Das soll nicht heißen, dass ich ihm irgendwelche Sympathien entgegenbringe. Oder viel von seiner Arbeit oder seiner Persönlichkeit halte. Aber er und Mord?
Na ja, eines steht fest – es würde jede Menge Schlagzeilen machen, wenn der stellvertretende Leiter einer Strafvollzugsbehörde wegen Mordes festgenommen würde. Aber wen um alles in der Welt kann er denn umgebracht haben? Genau das ist meine nächste Frage.
»Jessica Asher«, sagt Robie und betrachtet mich dabei unverwandt.
»Der Unfall mit Fahrerflucht?« Auch wenn ich in den letzten zwei Wochen ziemlich abgelenkt war, diese schreckliche Geschichte ist mir nicht entgangen. Sie war schließlich tagelang in sämtlichen Medien. Jetzt wird mir erst recht klar, warum Francine Robie mit den Ermittlungen betraut wurde. Nicht nur, dass der Verdächtige ein hohes Tier im Strafvollzug ist, nein, das Opfer stammt auch noch aus einer bekannten Bostoner Familie.
»Wollen Sie damit sagen, dass Sie Steven Carlyle für den Fahrer des Wagens halten, der diese arme Frau versehentlich überfahren hat und dann geflüchtet ist?« Ich betone das Wort versehentlich und blicke kurz zum Commissioner hinüber, der blass und mit grimmiger Miene dasitzt. Ich rechne schon fast damit, das auch ihm gleich schlecht wird.
»Es hat sich inzwischen ein Zeuge gemeldet, der behauptet, gesehen zu haben, dass Miss Asher mit Absicht überfahren wurde.«
»Was?« Perplex war ich schon vorher, aber jetzt verschlägt es mir die Sprache. »Soll das heißen, Sie glauben, der Fahrer –«, ich bringe es nicht über mich, Carlyle zu sagen, »wollte die Frau töten?« Als wäre es nicht schon schlimm genug, wegen Fahrerflucht mit Todesfolge drangekriegt zu werden. Mit dieser Zeugenaussage wird die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich Anklage wegen Mordes erheben.
»Wer ist der Zeuge?«, fragt der Commissioner.
»Ein Trucker aus dem Westen von Massachusetts, der zufällig an dem Tag in Boston war.«
»Wieso hat er sich nicht sofort gemeldet?«, will ich wissen.
»Er sagt, ihm sei erst jetzt klar geworden, was er da an dem Tag wirklich gesehen hat«, sagt Robie. »Als die Sache passierte, hat er bloß gesehen, wie ein weißer Geländewagen von einem silbernen Sportwagen zurücksetzte, in den er offensichtlich hineingefahren war. Der Trucker hatte nicht mitbekommen, dass jemand angefahren worden war. Er war seit letzten Dienstag unterwegs. Er sagt, auch nachdem er aus den Nachrichten von Ashers Tod erfahren hatte, überlegte er noch tagelang bin und her, ob er sich aus der Sache raushalten oder sich melden sollte. Wir können von Glück sagen, dass sein Gewissen sich durchgesetzt hat. Einer meiner Männer war bei ihm und hat seine vollständige Aussage aufgenommen.«
»Hat er den Fahrer identifiziert?«, frage ich und höre, wie zittrig meine Stimme klingt. Ein Augenzeuge würde Carlyles Schicksal zwar nicht besiegeln, aber er würde seine Situation mit Sicherheit noch aussichtsloser machen.
Robie antwortet nicht sofort. Es ist, als wollte sie mir ganz bewusst Zeit zum Grübeln lassen. »Nein. Er war zu weit weg. Er konnte noch nicht mal das Fabrikat des Geländewagens mit Sicherheit angeben. Er meinte, wahrscheinlich ein Jeep Cherokee, aber beschwören würde er es nicht. Nur bei der Farbe war er sich sicher – weiß, und dass der Wagen ziemlich neu aussah.«
»Das, was der Trucker gesehen hat, beweist noch längst nicht, dass es kein Unfall war«, wende ich ein.
»Das ist nicht alles«, sagt Robie. Und die Art, wie sie es sagt, gibt mir zu denken. »Der Trucker hat gesehen, dass der Geländewagen nach dem Zurücksetzen noch einmal Gas gegeben und den Sportwagen erneut gerammt hat. Und dabei hat er natürlich nicht nur den Sportwagen gerammt.«
Mir dreht sich vor Abscheu erneut der Magen um.
»Superintendent, was wissen Sie über Jessica Asher, das Opfer?«, fragt mich Robie.
»Nicht viel.« Ich hab die Todesanzeige gelesen, aber das Foto, das daneben abgedruckt war, ist mir deutlicher in Erinnerung. Eine schöne, lebensprühende junge Frau. Außerdem hatte das Boston Magazine postwendend einen Artikel mit etlichen Farbfotos gebracht, die von der Jetsetterin mit den kastanienbraunen Haaren auf diversen Wohltätigkeitsveranstaltungen gemacht wurden.
»Wussten Sie, dass sie die Tochter von Anthony Asher war? Er war in den achtziger Jahren Justizminister von Massachusetts und ist kürzlich verstorben.«
Ich nicke. »Ja, das habe ich gelesen.«
»Und dass sie erst siebenundzwanzig war?«
»Ich wusste, dass sie noch sehr jung war.«
»Wussten Sie auch, dass ihre Schwester Debra Asher mit Eric Landon verheiratet ist, dem Geschäftsführer von Data-Com, den aber vermutlich mehr Leute kennen, weil er bei der letzten Wahl mit seiner Kandidatur um das Gouverneursamt gescheitert ist?«
Ich nicke. Mein Exmann war ein großer Landon-Anhänger. Er hatte Landons Wahlkampf mit einer großzügigen Spende unterstützt und deshalb auch eine Einladung zu der Asher-Landon-Hochzeit bekommen. Er ging allein hin. Ich war kein Landon-Fan. Und das war bloß eines der Themen, bei denen Ethan und ich unterschiedlicher Meinung waren. Ein weiteres – wichtigeres – war sein außerplanmäßiges Interesse an Bettgeschichten mit anderen Frauen.
Robie lächelt. »Mir scheint, Sie haben Landon Ihre Stimme nicht gegeben.«
Ich lächele nicht zurück. Ebenso wenig wie der Commissioner. Ich möchte wieder auf die aktuelle, wesentlich ernstere Angelegenheit zurückkommen.
»Mir ist noch immer nicht klar, wieso Steven Carlyle vernommen wird. Sie haben doch gesagt, dass der Zeuge den Fahrer nicht erkannt hat.«
»Wenn wir eine eindeutige Identifizierung hätten, würden wir den Deputy Commissioner ganz sicher nicht nur vernehmen.«
»Aber weshalb dann? Hat der Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt? Ist der Wagen auf Carlyle zugelassen? Haben Sie sonst irgendwelche Indizien –?«
Robie hebt eine Hand, um mich zum Schweigen zu bringen. »Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Ermittlungen, Superintendent.«
»Schön, dann verraten Sie mir eins«, hake ich nach. »Wenn Sie glauben, dass der Fahrer des Wagens Jessica Asher absichtlich überfahren hat, und wenn Sie glauben, dass dieser Fahrer möglicherweise Steven Carlyle sein könnte, was wäre dann sein Motiv? Wieso hätte er sie töten sollen? Welche Verbindung besteht zwischen dem Opfer und Carlyle?«
Da ich eigentlich nicht damit rechne, dass Captain Robie sonderlich entgegenkommend sein wird, bin ich überrascht, als sie ohne Zögern antwortet: »Miss Ashers Palm Pilot wurde unter ihrem Auto gefunden. Ist vermutlich durch den Aufprall aus ihrer Handtasche gefallen. Sie hatte einen Teil der Daten mit Passwort gesichert, aber anscheinend war ihr nicht klar, dass sich Passwörter ziemlich leicht knacken lassen. Sogar sehr leicht«, fügt Robie hinzu.
»Ich werd’s mir merken«, sage ich, weil auch ich gewisse Informationen auf meinem Palm Pilot mit Passwort geschützt habe.
»Es war ein Terminkalender. Im ungesicherten Bereich des Computers gab es natürlich einen ganz normalen Terminkalender mit den üblichen Terminen. Frisör, Verabredungen zum Abendessen, Arzttermine, Kleideranproben.«
»Und Sie haben Carlyles Namen in dem anderen Terminkalender entdeckt? Soll das der Beweis dafür sein, dass er den Geländewagen gefahren hat? Die beiden haben sich also irgendwann mal getroffen, na und? Das heißt für mich noch lange nicht –«
»Er hat sich häufiger mit ihr getroffen. Seit August diesen Jahres.«
»Wie oft?«
»Achtmal. Jeweils im Abstand von etwa zwei Wochen. Der letzte eingetragene Termin war am Mittwoch, dem 17. Oktober. Um 19.00 Uhr. Zwei Tage vor ihrem Tod.«
»Und hat Carlyle erklärt, worum es bei diesem Treffen ging?«
Ehe Robie antworten kann, schaltet sich der Commissioner ein. »Möglicherweise ging es bei diesen Treffen mit Miss Asher um eines unserer Häftlingsprogramme.«
Diese Hypothese ist nicht abwegig. In den über zehn Jahren, die ich im Strafvollzug arbeite, habe ich etliche Frauen kennen gelernt, viele davon vom Schlage Jessica Asher – jung, attraktiv, gebildet und häufig gut betucht –, die von bestimmten Häftlingen fasziniert waren. Manchmal passierte das bereits während der Verhandlung, vor allem, wenn es sich um einen Aufsehen erregenden Fall handelte. Dann konnte es sein, dass bis zu einem Dutzend Frauen tagtäglich im Gerichtssaal erschien. Sie schmissen sich in Schale, konkurrierten um die besten Plätze in der ersten Reihe, schickten Briefchen, Blumen und ließen sich alles Mögliche einfallen, um die Aufmerksamkeit des Angeklagten auf sich zu ziehen. Darüber hinaus gibt es Frauen, die sich – und darauf spielt der Commissioner an – in einem Freiwilligenprojekt zur Wiedereingliederung von Häftlingen engagieren.
Auf gewisse Frauen scheinen Männer hinter Gittern eine besondere sexuelle Anziehungskraft auszuüben. Dabei glauben sie nicht mal unbedingt, dass der Häftling unschuldig ist. Für manch eine ist gerade die Tatsache, dass der Mann schuldig ist, besonders sexy. Täter, aber eben auch Gefangener – da kann ihnen ja nichts passieren. Denken sie zumindest …
Problematisch an der Hypothese des Commissioner ist nur, dass Carlyle als sein Stellvertreter hauptsächlich im Verwaltungsbereich arbeitet und für steuerliche Fragen und Etatplanung zuständig ist. Außerdem ist er sozusagen der Verbindungsmann zwischen der Strafvollzugsbehörde und dem Berufungsausschuss. Falls Asher daran interessiert gewesen wäre, bei der freiwilligen Häftlingsbetreuung mitzuarbeiten, hätte sie sich nicht mit Carlyle, sondern mit Russell Fisk getroffen, dem anderen Stellvertreter des Commissioner, der innerhalb des Strafsystems die verschiedenen Programme koordiniert und kontrolliert.
Keiner sagt etwas, und die Stille zermürbt mich. Ich wende mich an Robie. »Also schön, nehmen wir mal an, Steven Carlyle hat die Frau gekannt. Na und? Viele Leute haben Jessica Asher gekannt. Haben Sie die alle zur Vernehmung herbringen lassen? Stehen die alle unter Verdacht?«
»Das würde ich auch gerne wissen, Captain«, sagt der Commissioner empört. »Sie haben ja vorhin schon eingeräumt, dass in dem mit Passwort geschützten Terminkalender jede Menge Namen stehen.«
»Alles Männer«, betont Robie.
»Wie viele?«, frage ich.