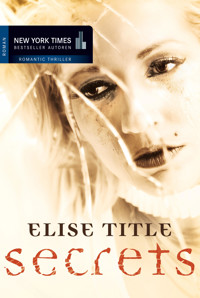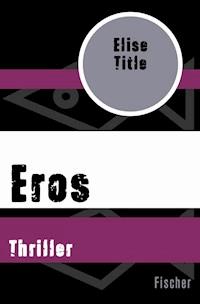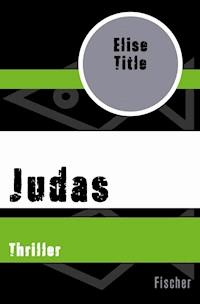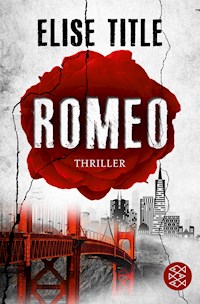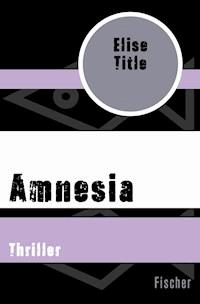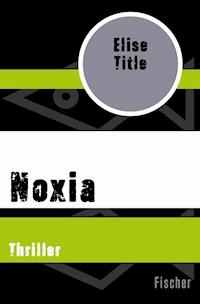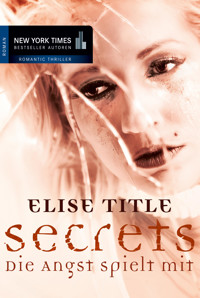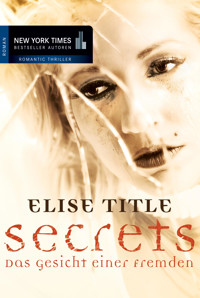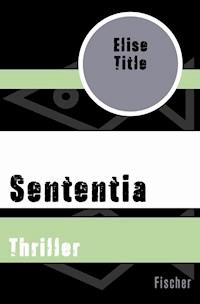
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Peri ist eine junge, erfolgreiche Restaurantbesitzerin in New York. Was keiner weiß: Ihre Mutter wurde ermordet, als Peri acht Jahre alt war, ihr Vater kam aufgrund Peris Aussage lebenslang hinter Gitter. Doch da beweist eine DNA-Analyse, dass er zu Unrecht verurteilt wurde. Peri macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder, der jetzt auch nach ihrem Leben trachtet ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 632
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elise Title
Sententia
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER Digital
Inhalt
Prolog
»Du musst keine Angst haben, Peri.«
»Pilar«, flüsterte sie störrisch, während sie sich nervös eine Strähne ihres dunkelbraunen Haars um den Zeigefinger zwirbelte. Die Strähne hatte sich aus dem glänzenden Lacklederhaarband gelöst, das ihr das lange wellige Haar aus dem Gesicht hielt.
»Ja, entschuldige, Pilar.«
Es gefiel ihr nicht, wie er ihren Namen sagte. Es gefiel ihr nicht, wie er vor ihr kniete, so nah, dass sie seinen Atem riechen konnte. Thunfischatem. Igitt. Sie hasste Thunfisch. Und ihr Daddy hasste Thunfisch. Ihr Daddy. Nur an ihn zu denken tat schrecklich weh.
»Wir haben das doch schon ganz oft besprochen. Es wird ganz genauso –«
Er redete weiter, doch Pilar hörte nicht zu. Sie hätte diesen stinkenden Mann am liebsten weggeschubst, aber sie war zu klein und er zu groß.
»Pilar? Du musst tapfer sein.« Thunfischatem streckte einen kurzen Wurstfinger aus und berührte sie an der Schulter.
Sie schrie auf und schlug nach seiner Hand.
Er seufzte und stand schwerfällig auf. Er war fett. Fett und glatzköpfig, und er stank, obwohl er einen schicken Anzug trug und an seinem dicken kleinen Finger einen Diamantklunker stecken hatte. Wenn er sie noch mal anfasste, dann würde sie … dann würde sie …
Sie presste die Augen zu, biss sich auf die Unterlippe. »Ich will nach Hause.«
Sie hörte eine neue Stimme, leiser, schmeichelnder, aber mit einem ungeduldigen Unterton. »Schätzchen, du darfst ganz bald nach Hause, mit mir und Debra. Aber vorher –«
Pilar riss die Augen auf. Ihr Großvater kniete jetzt neben ihr. Er war viel älter, aber er roch gut. Wie der Wald. Ihre Mommy roch auch immer gut. Bloß mehr nach Blumen.
Aber nicht beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte Mommy nicht schön gerochen. Da hatte sie ganz … ganz schlecht gerochen.
»Ich will zu mir nach Hause.« Doch noch während sie das sagte, sah Pilar, wie das Gesicht ihres Großvaters hart wurde. Sie wusste, dass sie nie wieder zu sich nach Hause gehen würde. Sie war seit dem grässlichen Tag nicht mehr dort gewesen. Es war alles ein schrecklicher Albtraum.
Weil sie so laut schluchzt, als sie ihre Nana anruft, weiß Pilar nicht, ob ihre Großmutter überhaupt versteht, was sie ihr am Telefon sagen will. »Ich will zu meinem Daddy. Hol meinen Daddy, Nana. Er soll kommen. Er soll kommen.« Und dann, viel, viel später – so kommt es ihr wenigstens vor, aber vielleicht war es gar nicht so lang –, ist ihr Daddy auf einmal da, und sie läuft zu ihm, klammert sich an ihn, bis er sie langsam wegschiebt. Als Daddy Mommy sieht, fängt er ganz schlimm an zu weinen, sogar noch schlimmer als sie. Pilar denkt, dass ihm vielleicht das Herz bricht. Sie läuft wieder zu ihm, und dann weinen beide, auch noch, als der kleine chinesische und der dicke, fette Polizist mit dem roten Gesicht sie voneinander trennen. Die Polizisten sind beide in Uniform und gleichzeitig mit dem Krankenwagen gekommen, nachdem Pilar die 911 gewählt hatte, wie ihre Eltern es ihr beigebracht haben. Aber jetzt sind die Männer aus dem Krankenwagen wieder weg. Pilar hat gesehen, wie einer von ihnen sich über ihre Mommy gebeugt hat, und dann hat er den dicken, fetten Polizisten angesehen und den Kopf geschüttelt …
»Pilar, du musst gut aufpassen. Du musst aufpassen, was ich sage«, hörte Pilar Thunfischatem sagen. Sie nickte, aber sie passte nicht auf. Sie war noch immer bei sich zu Hause an jenem grässlichen Tag.
Der kleine chinesische Polizist hält sie fest. Sie versucht, sich loszureißen, schafft es aber nicht. Ihr Daddy wird böse auf ihn. Ganz böse. Er fängt an, ihn mit schlimmen Wörtern zu beschimpfen, und dann wird Rotgesicht sehr böse. Er packt ihren Daddy, wirft ihn zu Boden, biegt ihm die Arme auf den Rücken und legt ihm Handschellen an. Dann lässt der kleine chinesische Polizist sie los, aber als Pilar zu ihrem Daddy will, schreit Rotgesicht sie an, sie solle zurückbleiben, und sie kriegt Angst. Dann kommen noch mehr Männer in die Wohnung. Sie tragen Gummihandschuhe. Einer hat einen Fotoapparat. Ein anderer einen großen, schwarzen Koffer. Wie ein Schwarm Ameisen huschen sie ins Schlafzimmer. Sie achten auf niemanden außer auf Rotgesicht, der jetzt ihren Daddy hochreißt.
Tränen laufen ihr übers Gesicht, als Pilar auf die Knie fällt, so wie in der Kirche, in die sie immer mit Daddy gegangen ist, und Rotgesicht anfleht, ihren Daddy loszulassen. In dem Moment taucht Großvater Morris auf. Pilar weiß nicht, woher er das mit Mommy weiß oder warum er da ist. Aber ihr Daddy wird ganz still, als er ihn hereinkommen sieht. Ohne ein Wort geht ihr Großvater zu ihrem Daddy, schaut ihn ganz furchtbar an und spuckt ihm dann ins Gesicht. Pilar denkt, jetzt wird ihr Daddy bestimmt wieder richtig böse. Aber er sagt kein Wort. Er lässt bloß den Kopf hängen, und die beiden Polizisten führen ihn ab. Pilar läuft ihrem Daddy nach, klammert sich an sein Hosenbein. Ihr Großvater zieht sie weg und sagt, es werde alles wieder gut. Aber sie weiß, das stimmt nicht. Nichts wird wieder gut, nie, nie wieder.
Noch während die Polizisten ihren armen Daddy zur Wohnungstür zerren, sagt ihr Großvater, sie solle ihre Sachen packen, er werde sie mit zu sich nach Hause nehmen. Sie schreit, dass sie nicht mit ihm mit will, dass sie zu ihrer Nana will. Aber dann ruft ihr Vater ihr von der Tür aus zu, es wäre nur für kurze Zeit und dass Nana krank ist. Daddy sagt ihr, er muss nur eben mit den Polizisten mitgehen, um alles zu klären, und dann holt er sie ab. Versprochen.
Aber er hat sie angelogen. Ihr Daddy hat sie angelogen. Er hat sie nicht abgeholt. Und sie hat ihn seit dem grässlichen Tag nicht mehr gesehen, weil ihr Großvater sie nicht mit zu dem Gefängnis nimmt, wo Daddy eingesperrt ist …
»Peri, du träumst wieder mit offenen Augen«, sagte ihr Großvater, und seine Stimme klang nicht mehr so sanft.
Das stimmte nicht. Aber Pilar hatte keine Lust, ihm das zu sagen. Träume waren etwas Schönes. Als sie klein war, hatte sie schöne Träume. Aber jetzt hatte sie nur noch böse Träume, auch tagsüber mit offenen Augen.
Ihr Daddy würde das verstehen. Auch ihre Nana, ihre richtige Großmutter, die Daddys Mommy war. Sie kannte diesen Großvater kaum, bei dem sie leben musste. Und sie wusste, dass Debra, von der Großvater immer sagte, sie wäre ihre Großmutter, gar nicht ihre Großmutter war. Wie ihre Mommy ihr vor langer Zeit erzählt hatte, war ihre richtige Grandma gestorben, als ihre Mommy noch ein kleines Mädchen gewesen war, und Debra war diese Frau, die Großvater Morris geheiratet hatte, als ihre Mutter kaum unter der Erde war. Pilar verstand nicht, was ihre Mutter damit gemeint hatte, aber eins verstand sie ganz genau: Ihre Mutter hatte Debra gehasst, und deshalb hasste Pilar sie auch. Obwohl sie sie nie gesehen hatte, bis sie bei Großvater Morris einzog.
Pilar fühlte sich wie Aschenputtel. Nur glaubte sie nicht, dass ihre gute Fee, ihre Großmutter, sie je würde retten können, weil die Türen des großen Stadthauses, in dem sie bei ihrem Großvater in Manhattan wohnte, so viele Schlösser hatten und Debra ihre Nana niemals reinlassen würde. Und Debra erlaubte Pilar nie, mit Nana zu telefonieren, bis die schließlich nicht mehr anrief.
Aber einmal war ihre Nana in Pilars neue, scheußliche Schule gekommen. Sie hatte einfach mitten im Unterricht in jedem Klassenraum nachgesehen, bis sie sie fand. Als Pilar Nana hereinmarschieren sah, dachte sie, nun würde sie endlich gerettet. Aber ehe Pilar zur ihr konnte, wurde ihre Großmutter von zwei Sicherheitsleuten gepackt und zurück auf den Flur bugsiert. Nana beschimpfte sie laut auf Spanisch. Schlimme Wörter, wie sie auch ihr Daddy benutzte, wenn er böse war. Aber Pilar war froh, dass ihre Nana schimpfte. Pilar hätte auch am liebsten geschimpft. Sie kannte ein paar schlimme Wörter auf Spanisch und Englisch. Als Pilar hinter Nana her wollte, hielt die Schulleiterin, die auf dem Flur wartete, Pilar am Arm fest und zog sie mit in ihr Büro. Wenig später kam John, um sie nach Hause zu bringen, obwohl sie noch zwei Stunden Unterricht gehabt hätte. John war der Mann mit der blöden blauen Uniform und der noch blöderen blauen Mütze, der sie in Großvater Morris’ großem, schicken schwarzen Auto jeden Tag zur Schule fuhr und wieder abholte.
»Pilar, du musst dich konzentrieren.« Thunfischatem war wieder da.
Aber sie konzentrierte sich ja. Bloß nicht auf das, was er wollte.
»Ich vermisse meine Nana«, flüsterte Pilar, den Tränen nahe. Sie wollte sagen, dass sie auch ihren Daddy vermisste, dass sie ihn am meisten vermisste, aber jedes Mal, wenn sie ihren Daddy auch nur erwähnte, wurde Großvater Morris wütend, und Thunfischatem Meyers schärfte ihr wieder ein, das bloß nicht im Gerichtssaal zu sagen. Deshalb sprach sie lieber von allen anderen, nach denen sie sich in den langen einsamen Monaten gesehnt hatte. »Ich vermisse meine Cousinen und meine Tante Lo und Onkel Mickey und Onkel Héctor und alle meinen Freundinnen –«
»Du findest neue Freundinnen«, fiel ihr Großvater ihr ins Wort. »Nette Mädchen aus den besten Familien. Du hast großes Glück, du darfst auf die angesehenste Privatschule in Manhattan gehen, Peri. Auf dieselbe Schule, auf die deine Mutter, möge sie in Frieden ruhen, gegangen ist.« Er unterdrückte blinzelnd die Tränen, ehe er noch mehr Dinge aufzählte, für die sie dankbar sein sollte. »Du kannst dich außerdem glücklich schätzen, in einem schönen Haus in einem wunderbaren Viertel zu wohnen, wo es sauber und sicher ist. Du hast alles, was ein Kind sich nur wünschen kann. Debra überhäuft dich ständig mit wunderhübschen neuen Anziehsachen, und was ist mit dem Walkman, den wir erst letzte Woche für dich gekauft haben? Nicht viele Mädchen in deinem Alter haben –«
»Ich will den blöden Walkman nicht. Und ich hasse die Sachen, die Debra für mich kauft. Ich will meine alten Sachen wiederhaben. Und ich hasse die bescheuerte Schule und die blöde Uniform, die man tragen muss. Und die Mädchen da sind alle doof und eingebildet. Die lästern heimlich über mich. Und ich hasse euer großes, fieses Haus und euer dämliches Viertel. Und ich heiße nicht Peri Gold, ich heiße Pilar López. Ihr könnt mir nicht einfach einen neuen Namen geben. Ihr könnt nicht –«
»Schluss jetzt, Peri«, sagte ihr Großvater scharf. »Du verstehst das noch nicht, aber wir haben deinen Namen nur zu deinem Besten geändert. Und du solltest dem Schicksal danken, dass du nicht mehr in der kakerlaken- und rattenverseuchten Wohnung mitten in einem gefährlichen Slumviertel lebst, wo an jeder Ecke Drogensüchtige und anderes Gesindel herumlungern.«
Tränen kullerten Pilar über die Wangen. »Da waren keine Ratten«, sagte sie wütend. »Und es ist kein Slum. Mommy und Daddy haben da gelebt, seit ich auf die Welt gekommen bin. Und meine Nana und Tante Lo leben noch immer da. Und auch alle –«
Großvater Morris’ Augen wurden schmal, und er sah jetzt sehr böse aus. »Das reicht.«
Aber Pilar wollte nicht aufhören. Konnte nicht. »Wo ist Nana? Ich will zu meiner Nana. Du hast gesagt, sie wäre hier. Du hast es versprochen –«
Großvater Morris seufzte schwer. »Du siehst deine … deine andere Großmutter später. Das verspreche ich dir. Aber jetzt musst du dich beruhigen, damit du gleich im Gerichtssaal die Fragen von Mr Meyers beantworten kannst, so wie du es die ganzen Wochen geübt hast. Und wenn das vorüber ist –«
»Ich will jetzt zu ihr«, sagte ich verstockt. »Ich will bei meiner Nana leben. Sie will das auch. Und ich will nicht mehr bei dir leben.«
Hinter ihrem Großvater räusperte Thunfischatem sich ungeduldig. »Es ist gleich so weit, Mr Gold.«
»Jetzt hör mal zu, Peri, du bist schon viel zu alt, um so ein Theater zu machen –«
»Ich bin erst sieben«, fauchte sie ihren Großvater an. »Und meine Mommy hat dich nie gemocht. Sie hat gesagt, du bist gemein. Und dass du sie nie liebgehabt hast.«
Das Gesicht ihres Großvaters lief rot an. »Das stimmt nicht. Ich hatte deine Mutter sehr lieb. Sie war mein einziges Kind. Und du bist mein einziges Enkelkind. Ich liebe dich aus ganzem Herzen, und deine Großmutter und ich werden immer, immer für dich da sein. Was deiner Mutter passiert ist, ist eine furchtbare, entsetzliche Sache, Peri – meiner wunderbaren Tochter, meiner Ali. Wenn nur –« Er verstummte plötzlich und sah aus, als hätte er gerade schreckliches Bauchweh bekommen. Dann wurde sein Gesicht noch röter, und er sah sie nicht mehr an. »Ich könnte das Schwein eigenhändig umbringen.«
»Raph López wird seine gerechte Strafe bekommen, Mr Gold«, sagte Thunfischatem. »Der Fall ist todsicher. Die Geschworenen werden ihn garantiert schuldigsprechen. Und er wird hundertprozentig die Höchststrafe bekommen. López wird nie wieder freikommen, darauf können Sie sich verlassen.«
»Mein Daddy soll aber wieder freikommen«, rief Pilar, die das Gefühl hatte, sich gleich übergeben zu müssen. »Er ist doch schon so lange im Gefängnis. Wieso kann er nicht wieder nach Hause kommen?«
Die Tür zu dem Raum öffnete sich, und eine sehr große, dünne Frau mit einem mürrischen Gesicht erschien. Sie hatte kurze lockige Haare, trug ein blaues Kostüm mit einer weißen Bluse und sagte zu Thunfischatem, dass Pilar López aufgerufen worden sei.
Pilar fühlte sich ein kleines bisschen besser, als sie ihren richtigen Namen hörte. Doch dann packte sie die Panik. Jetzt kam der Moment, vor dem ihr graute.
Sie sank auf ihrem Stuhl in sich zusammen. »Ich … ich will nicht.«
»Es wird Zeit«, sagte Thunfischatem. »Vergiss nicht, Peri … Pilar, du darfst deinen Vater nicht mal ansehen, auch keinen von seiner Familie oder seinen Freunden, wenn wir im Gerichtssaal sind. Du siehst einfach die ganze Zeit nur mich an. Dann wird alles halb so schlimm.«
»Schwörst du, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit?«
Pilars kleine Hand zitterte, als sie die Bibel berührte. Sie nickte, aus Angst zu weinen, wenn sie sprach. Ihr Daddy sollte sie nicht weinen sehen. Und auch sonst keiner. Es waren so viele Leute im Gerichtssaal. Sie versuchte, niemanden anzusehen, nicht bloß weil Thunfischatem ihr das gesagt hatte, sondern weil sie spürte, dass alle sie anstarrten.
Die junge Frau in dem blauen Kostüm, die ihr die Bibel hinhielt, flüsterte: »Du musst laut sprechen fürs Protokoll.«
Pilar schluckte schwer. »Ja, ich schwöre«, bekam sie irgendwie krächzend heraus.
Sie war froh, als die Frau die Bibel wegnahm. Sie wischte sich die verschwitzten Handflächen an dem Tellerrock ihres rosa Baumwollkleides ab. Sie hatte nichts mehr in Rosa angehabt, seit sie vier geworden war. Rosa war was für kleine Mädchen. Aber Debra hatte ihr das Kleid gekauft, extra fürs Gericht. Pilar würde es in Stücke schneiden, sobald das hier vorbei war. Sie fand all die Sachen, die Debra ihr kaufte, einfach scheußlich. Mommy hätte sie auch scheußlich gefunden. Bei Mommy durfte sie sich ihre Sachen immer selbst aussuchen. Jeans und T-Shirts mit lustigen Sprüchen drauf. Wo waren jetzt alle ihre alten Sachen?
»Du darfst dich jetzt hinsetzen, Pilar«, sagte eine Frauenstimme leise von oben. Sie schaute nach rechts hoch und sah eine kleine Frau, die in einer schwarzen Robe hinter einem großen Holzaltar saß. Pilar wusste, dass da der Richter sitzen musste, aber sie hatte nicht mit einer Frau gerechnet. Und die Richterin hatte ein kleines Lächeln auf den Lippen, als sie Pilar in die Augen sah. Vielleicht war die Richterin ja nett, dachte Pilar, und würde ihren Daddy nicht für immer ins Gefängnis stecken, wie Thunfischatem gesagt hatte.
»Danke«, sagte sie höflich zu der Richterin. Pilar setzte sich nicht richtig auf den großen Holzstuhl, bloß vorne auf die Kante, so dass die Spitzen ihrer schwarzen Mary-Jane-Lackschuhe noch den Boden berührten, und faltete die verschwitzten Hände fest auf dem Schoß.
Die ersten paar Minuten waren ganz schrecklich. Sie musste der Richterin ihren ganzen Namen nennen – Pilar Celestina López –, Peri Gold würde sie nicht sagen, weil das nicht ihr richtiger Name war, ganz egal, was ihr Großvater behauptete. Die Richterin dachte das wohl auch, denn sie berichtigte sie nicht. Dann fragte die Richterin sie, wie alt sie war und in welche Klasse sie ging. Zwei weitere leichte Fragen. Und Pilar hoffte schon, die Richterin und nicht Thunfischatem würde ihr vielleicht alle Fragen stellen. Dieser netten Frau zu antworten, wäre bestimmt nicht so schwer.
Doch noch während Pilar das dachte, kam Thunfischatem bereits auf sie zu. Als er vor ihr stehen blieb, war er ihr wenigstens nicht mehr so nah wie zuvor. Er lächelte sie an, doch Pilar wusste, dass er sie eigentlich nicht leiden konnte. Mit seiner falschen freundlichen Stimme fragte er Pilar, ob sie eine gute Schülerin wäre, und sie sagte, sie hätte immer gute Zeugnisse. Die ganze Zeit hielt sie den Kopf gesenkt und starrte auf ihre verkrampften Hände im Schoß.
»Ich weiß, das hier ist sehr schwer für dich, Pilar, und du sollst auch nicht länger hier sein als nötig. Aber es ist wichtig, dass du uns erzählst, was an jenem Tag passiert ist, am Freitag, dem 21. Januar. Lass dir ruhig Zeit, meine Kleine.«
»Ich bin nicht Ihre Kleine«, fauchte Pilar, sah vor Wut hoch und funkelte den stinkenden Anwalt an.
Und auf einmal war es vorbei. Aus den Augenwinkeln sah sie ihren Vater, ganz weit links. Ihr Blick huschte zu ihm hinüber, und Tränen schossen ihr in die Augen. Daddy. Daddy. Sie wäre am liebsten aufgesprungen und zu ihm gerannt. Um auf seinen Schoß zu klettern, wie sie es so oft getan hatte. Sie konnte die Berührung seiner Finger spüren, wie sie ihr die Haare zurückstrichen. Dann würde er sie sachte schaukeln und ihr auf Spanisch ein Schlaflied vorsingen. Er hatte eine so schöne Stimme …
Aber Daddy schaute sie nicht an. Er hielt den Kopf gesenkt, genauso wie sie noch vor einer Minute. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen. Sie sah von ihm nur das pechschwarze Haar. Aber nur ganz wenig davon. Wo waren die schönen, dichten Locken geblieben? Wieso hatte er sie abschneiden lassen? Sie mochte seine Haare doch so. Weil ihre Haare fast genauso wie seine waren. Genauso wellig, nur nicht so schwarz. Aber längst nicht so hell wie Mommys …
Plötzlich hob ihr Vater ruckartig den Kopf, und ihre Blicke trafen sich. Er war auch nicht so tapfer. Auch er konnte die Tränen nicht zurückhalten. Sie liefen ihm übers Gesicht. Er sah so traurig aus. Fast so traurig wie an dem schrecklichen Tag, als er erfuhr, dass Mommy tot war. Der Tag, als die Polizisten ihn ins Gefängnis sperrten. Der Tag, an dem ihr Großvater ihr sagte, ihr Daddy hätte ihre Mommy getötet. Zuerst wollte sie ihm nicht glauben. Aber nicht nur ihr Großvater sagte das. Alle sagten das. Die Polizisten, die Leute in den Nachrichten, Thunfischatem und die anderen Anwälte, die manchmal bei ihm waren.
»Er wollte das nicht.« Pilar merkte gar nicht, dass sie sprach.
»Es war ein Unfall. Mein Daddy wollte meiner Mommy nicht wehtun. Er wollte das nicht. Er wollte das nicht …« Der Rest ihrer Verteidigungsrede ging in haltlosem Schluchzen unter.
Thunfischatem versuchte, sie zu beruhigen, aber sie musste immer weiter weinen. Pilar hörte, wie die Richterin eine zehnminütige Pause anordnete. Pilar war froh, dass sie nicht wieder auf die Bibel schwören musste. Sie wollte die Sache jetzt nur noch schnell hinter sich bringen. Sie rasselte alles herunter, was sie für Thunfischatem in den letzten paar Monaten wenigstens hundertmal zur Übung hatte aufsagen müssen.
»Ich bin von der Schule nach Hause gekommen.« Sie nannte ihre Adresse, als Thunfischatem fragte. Manhattan, East 133rd Street, Wohnung 2 C. »So ungefähr um halb vier –« Er hatte ihr eingeschärft, ungefähr zu sagen, weil niemand erwarten würde, dass sie die genaue Uhrzeit wusste. Danach stockte sie.
»War deine Mutter zu Hause?«
Pilar presste die Augen zu. Jetzt kam der schlimme, schlimme, schlimme Teil.
»Sie war im Schlafzimmer, ist das richtig, Pilar?«, half Thunfischatem nach.
»Ja«, murmelte Pilar schwach, öffnete die Augen nur, weil das Bild, das sie mit geschlossenen Augen sah, so schrecklich war.
»Erzähl uns einfach, was du gesehen hast, als du ins Schlafzimmer deiner Mutter gegangen bist.«
»Sie … war auf dem Bett. Sie hat geblutet. Ich bin zu ihr gelaufen. Ich hab geweint.«
»Was hatte deine Mutter an?«
Pilars Gesicht wurde vor Scham rot. »Nichts«, murmelte sie.
»Alison Gold López lag nackt und blutend auf ihrem Bett«, sagte Thunfischatem.
»Ich hasse dich«, zischte Pilar dem Anwalt zu.
Er blickte kurz zu der Richterin hoch, setzte ein trauriges Gesicht auf. Dieser dicke fette Lügner. Dann wandte er sich wieder Pilar zu. Das traurige Gesicht war verschwunden. »Deine Mutter war noch am Leben, als du sie gefunden hast, ist das richtig, Pilar?«
Ihr Hass auf den Anwalt wich einer Welle Schuldgefühle. »Ja, und ich wollte, dass es nicht mehr blutet. Ich hab alle Handtücher genommen, die ich finden konnte … und … und ich hab die 911 gewählt und einen Krankenwagen gerufen, wie meine Mommy und mein Daddy mir das beigebracht haben.« Sie weinte jetzt leise. »Und ich hab auch meine Nana angerufen … und gesagt, dass ich zu meinem Daddy will …«
»Pilar, wir können noch mal eine kleine Pause machen, wenn du möchtest«, sagte die Richterin sanft.
Pilar achtete nicht auf sie. »Es hat so lange gedauert, bis jemand gekommen ist. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Deshalb hab ich Mommys Hand gehalten –«
»Hast du irgendetwas zu ihr gesagt?«
»Ich hab gesagt, ich hab dich lieb, Mommy.«
»Und du hast deine Mutter gefragt, was passiert ist, ist das richtig?«
Pilar antwortete nicht.
Es war mucksmäuschenstill im Saal. Einen Moment lang stellte Pilar sich vor, alle wären verschwunden und das alles hier wäre in Wirklichkeit nur ein ganz schrecklicher böser Traum. Gleich würde sie aufwachen, und ihre Mutter wäre am Leben, und ihr Daddy würde sie auf den Armen schaukeln und sie zum Kichern bringen …
»Was hat deine Mutter geantwortet, als du sie gefragt hast, was passiert ist, Pilar?«
Sie hasste diesen fetten, stinkenden Mann, sie hasste ihn wirklich. Sie wünschte, er würde tot umfallen.
»Du musst einfach nur die Wahrheit sagen, Pilar. Was hat deine Mutter zu dir gesagt?«, drängte Thunfischatem.
Und Pilar wusste, dass er keine Ruhe geben würde, bis sie antwortete. Und bis sie antwortete, würde sie hier im Gerichtssaal bleiben müssen, wo sie doch einfach nur wegwollte. Vielleicht würde sie ja wirklich weglaufen, wie sie es sich oft überlegte, sogar Pläne schmiedete, wie sie Debra entkommen könnte, der weißen Hexe …
Ihre Augen schossen zu ihrem Vater hinüber, der den Kopf wieder gesenkt hielt. Und auf einmal sah sie in der Reihe hinter ihm ihre Nana, zwischen Tante Lo und Onkel Mickey. Neben Tante Lo saß Onkel Héctor, der eigentlich gar nicht ihr richtiger Onkel war, sondern der Freund von Tante Lo, weshalb er fast ein Onkel war. Ihre Nana klammerte sich an Tante Lo fest, und sie weinten beide, aber ohne einen Laut.
»Pilar?«
Vielleicht würden sie alle sie jetzt hassen. Und ihre Nana würde sie niemals bei sich wohnen lassen.
Sie würde Thunfischatem antworten müssen, das wusste sie. Aber sie könnte lügen. Ja, das könnte sie. Nur, sie hatte auf die Bibel geschworen, die Wahrheit zu sagen, und wenn sie log, würde sie in die Hölle kommen. Und dann würde sie ihre Mommy nicht im Himmel sehen, und das wäre das Schlimmste auf der Welt. Noch schlimmer als das hier.
»Was hat deine sterbende Mutter gesagt, Pilar?«
»Raph.« Pilar sagte es im Flüsterton.
»Raph«, wiederholte Thunfischatem laut. »Der Name deines Vaters. Als du sie gefragt hast, wer ihr das angetan hat, hat sie Raph gesagt. Ist das richtig, Pilar?«
Plötzlich schrie ihre Nana laut auf, und Onkel Mickey sprang von seinem Stuhl und fing an, Thunfischatem zu beschimpfen, und auf einmal war die Richterin nicht mehr so nett. Sie sagte ihnen, sie müssten den Saal verlassen, wenn sie sich nicht beherrschen könnten. Ihre Nana vergrub das Gesicht in den Händen, und Tante Lo drückte sie fest, doch sie wurden beide still. Onkel Mickey starrte die Richterin finster an und stürmte dann aus dem Saal. Thunfischatem wartete, bis ihr Onkel draußen war und die großen Schwingtüren sich wieder geschlossen hatten. Dann stellte er ihr dieselbe Frage erneut.
»Ja«, murmelte sie, »aber vielleicht …«
»Schon gut, Pilar«, schnitt Thunfischatem ihr das Wort ab. »Jetzt habe ich bloß noch ganz wenige Fragen an dich.«
Sie wusste, was er vorhatte, aber sie hatte gehofft, er hätte es sich anders überlegt. Oder dass die Richterin ihm vielleicht sagen würde, es wäre genug. Aber das passierte nicht.
Thunfischatem würde ihr genau die Fragen stellen, die er mit ihr so oft eingeübt hatte. »Pilar, hat dein Vater, oder Raph, wie er genannt wird, am Freitag, dem 21. Januar dieses Jahres, mit dir und deiner Mutter in eurer Wohnung auf der East 133rd Street zusammengelebt?«
Pilar warf ihrem Vater einen besorgten Blick zu. Er hatte den Kopf nicht mehr gebeugt. Er sah sie jetzt an, noch immer mit Tränenstreifen im Gesicht, aber er versuchte, sie anzulächeln. Sie war erleichtert, dass er nicht böse auf sie war.
»Nein«, sagte sie leise.
»Nein, dein Vater Raphael López lebte nicht mit dir und deiner Mutter zusammen, als der Mord geschah, ist das richtig?«
»Das hab ich doch schon gesagt«, blaffte sie. »Er hat meine Nana besucht.«
»Du meinst, er hat bei ihr gewohnt.«
Pilar starrte ihn zornig an. »Er wollte zurückkommen.«
»Wann ist dein Vater von zu Hause ausgezogen, Pilar?«, fragte Thunfischatem geduldig.
Sie zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht mehr.«
»Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate bevor deine Mutter starb?«
»Er wollte wieder nach Hause kommen.« Jetzt blickte sie ihren Vater flehentlich an. »Das hast du mir versprochen, richtig, Daddy? Du und Mommy, ihr wolltet euch wieder vertragen, und alles sollte wieder so werden wie früher.«
Er brachte ein schwaches Nicken zustande und wandte dann verschämt den Kopf ab.
»Pilar«, sagte Thunfischatem scharf. »Bitte schau mich an, wenn du antwortest. Also, warum ist dein Vater von zu Hause ausgezogen?«
»Ich weiß nicht«, sagte sie trotzig, aber sie blickte wieder nach unten auf ihre Hände. Es war nicht gelogen, sie wusste es nicht genau.
»Stimmt es nicht, dass deine Mutter ihm gesagt hat, er solle gehen?«
Der Mann, der neben ihrem Vater saß, stand auf. »Einspruch, Euer Ehren. Suggestivfrage.« Er war groß und mager, und er hatte Pickel im Gesicht. Er trug nicht mal einen richtigen Anzug, bloß eine Khakihose und ein hässliches Tweedjackett.
»Abgelehnt«, sagte die Richterin, und Pickelgesicht zuckte die Achseln und setzte sich wieder hin. Pilar verstand das nicht, bat aber nicht um eine Erklärung. Früher hatte sie ihre Mommy oder ihren Daddy immer gebeten, ihr Sachen zu erklären, und das hatten sie immer getan. Sie mochten es, wenn sie Fragen stellte. Sie sagten, dadurch würde sie richtig schlau.
»Hast du je gesehen oder gehört, wie deine Eltern sich gestritten haben, Pilar?«, fragte Thunfischatem.
»Nein. Ich weiß nicht. Alle streiten sich. Sogar im Fernsehen.«
»Dann haben deine Eltern sich also gestritten«, hakte Thunfischatem nach.
Sie zuckte die Achseln.
»Ist das ein Ja, Pilar?«
»Ja«, stieß sie hervor.
»Und an dem Tag, als dein Vater ausgezogen ist, haben er und deine Mutter gestritten, ist das richtig?«
»Ich weiß nicht genau.« Sie gab nicht die Antworten, die Thunfischatem mit ihr so oft geübt hatte.
»Sie müssen sich gestritten haben. Hat dein Vater dir später nicht gesagt, er und deine Mutter wollten sich wieder vertragen? Man kann sich nur dann wieder vertragen, wenn man sich vorher gestritten hat, nicht wahr, Pilar?«
Wieder erhob Pickelgesicht mit dünner Stimme Einspruch, aber die Richterin sagte wieder »abgelehnt« und forderte Pilar auf, zu antworten. Pickelgesicht zuckte bloß die Achseln wie beim letzten Mal und schob irgendwelche Papiere auf dem langen Tisch hin und her.
»Erinnerst du dich, ob deine Eltern sich am Morgen des 26. November gestritten haben, dem Freitag nach Thanksgiving, Pilar?«
Sie antwortete nicht, obwohl ihr das Geschrei von Mommy und Daddy an dem Morgen noch in den Ohren dröhnte. Sie hatte noch im Bett gelegen und sich das Kissen über den Kopf gezogen, um die bösen Worte nicht zu hören. Aber sie schrien beide so laut …
»Du warst an dem Freitag nicht in der Schule, weil du wegen Thanksgiving die ganze Woche Ferien hattest. An dem Tag warst du zu Hause. Und an dem Tag, genauer gesagt, um ungefähr acht Uhr fünfundvierzig, forderte deine Mutter nach einem halbstündigen Streit deinen Vater auf, die Wohnung zu verlassen und nie wiederzukommen.«
»Einspruch, Euer Ehren, das ist eine Feststellung, keine Frage«, knurrte Pickelgesicht, ohne auch nur die Augen von seinem chaotischen Papierberg zu heben.
Ehe die Richterin antworten konnte, schob Thunfischatem rasch hinterher: »Ist das richtig, Pilar?«
»Ich weiß nicht mehr«, stammelte sie. Das war nicht die Antwort, die sie geben sollte.
»Und dann hat dein Vater deine Mutter mit einem bösen spanischen Schimpfwort angeschrien und ist zur Tür hinausgestürmt, die er so fest zugeknallt hat, dass eine von den Angeln rausgerissen wurde.« Diesmal fügte er rasch hinzu: »Ist das richtig, Pilar?«, ehe Pickelgesicht »Einspruch« sagen konnte.
»Ich weiß nicht mehr«, sagte sie hartnäckig.
»Du hast auf die Bibel geschworen, die Wahrheit zu sagen, Pilar.«
»Ich glaub, ich weiß es doch noch«, gab sie schließlich zu.
»Mommy und Daddy haben sich auch davor öfters gestritten und Daddy ist böse weggegangen, aber sie haben sich dann wieder vertragen und alles war wieder gut.«
Sobald sie Thunfischatems Lächeln sah, wusste sie, dass sie das Falsche gesagt hatte, obwohl sie nicht verstand, warum es falsch war.
Das einzig Gute war, dass Pilar jetzt, wo Thunfischatem so froh aussah, wirklich glaubte, er würde aufhören. Aber er fragte weiter und weiter. Wie oft hatten ihre Eltern sich gestritten? Wie oft hatte ihr Vater wütend die Wohnung verlassen? Hatte ihr Vater ihre Mutter je geschlagen? Ihr gedroht? War es bei der letzten und längsten Trennung ihrer Eltern nicht oft vorgekommen, dass ihr Vater vor der Wohnung auftauchte und verlangte, hereingelassen zu werden, um mit ihrer Mutter zu sprechen? Hatte ihre Mutter ihn je reingelassen, wenn Pilar zu Hause war? War sie nicht auch an dem Tag zu Hause gewesen, als er versuchte, die Wohnungstür aufzubrechen? War das nicht am Tag nach Weihnachten gewesen? Wusste sie, was eine einstweilige Verfügung war?
Als Pilar schon dachte, es würde niemals aufhören, schenkte Thunfischatem ihr ein beifälliges Lächeln und blickte dann zu der Richterin hoch, und jetzt fand Pilar sie gar nicht mehr nett.
»Die Staatsanwaltschaft hat keine weiteren Fragen an die Zeugin, Euer Ehren.«
Als er sich abwandte, wollte Pilar automatisch aufstehen, doch die Richterin erklärte ihr, dass jetzt der Anwalt ihres Vaters an der Reihe war, ihr Fragen zu stellen.
Wieder meldete sich ihr Bauchweh. Thunfischatem hatte ihr zwar erklärt, dass das passieren würde, und war sogar ein paar Fragen mit ihr durchgegangen, die der Anwalt ihres Vaters stellen könnte, aber Pilar hatte gehofft, die Richterin würde vielleicht sagen, sie hätte genug Fragen beantwortet.
Pickelgesicht stand auf. Pilars einziger Gedanke war, dass er furchtbar jung und schmuddelig aussah. Wieso trug er keinen schicken Anzug wie Thunfischatem? Wieso wirkte er so nervös? Sie sah das einzelne Blatt Papier, das er in der zitternden Hand hielt. Er klammerte sich an dem Blatt fest und blickte stur darauf. Pilar hoffte, dass es nicht voller Fragen war.
Zuerst wischte er sich mit dem Ärmel über die pickelige Stirn. Dann räusperte er sich und das klang wie bei einem Frosch. Schließlich fragte er sie, ob ihre Mommy viele Freunde gehabt hatte, von denen sie Besuch bekam, wenn ihr Vater nicht zu Hause war. Oder nachdem ihr Vater ausgezogen war.
»Nein«, sagte sie, obwohl das nicht die reine Wahrheit war. Manchmal war Onkel Mickey vorbeigekommen. Aber er war gekommen, weil er seine linda chica, wie er Pilar immer nannte, genauso gern sehen wollte wie ihre Mommy. Und Onkel Héctor kam auch oft zu Besuch, weil er so allein war, wenn Tante Lo im Schönheitssalon arbeitete.
»Hast du je gesehen, dass dein Vater deine Mutter geschlagen oder ihr sonst irgendwie wehgetan hat?«, fragte Pickelgesicht.
»Nein. Nie. Nie. Nie.« Das war die reine Wahrheit.
»Keine weiteren Fragen an die Zeugin, Euer Ehren.«
Die Richterin blickte Thunfischatem an. Er schüttelte den Kopf. »Kein Kreuzverhör, Euer Ehren.«
Die Richterin lächelte Pilar an. »Vielen Dank, Pilar. Du darfst jetzt gehen.«
Pilar zögerte, und dann blickte sie die Richterin flehentlich an.
»Sie lassen doch nicht zu, dass mein Daddy nie wieder freikommt, oder? Es tut ihm nämlich alles furchtbar leid, das weiß ich.« Ihre Augen huschten zu ihrem Vater. »Nicht wahr, Daddy? Sag ihr, dass es dir leidtut. Bitte, bitte, Daddy, sag, es tut dir leid, und dann verzeiht sie dir und wir können nach Hause –«
1
»Du willst was von mir.«
Sam Berger lächelte. Er hatte ein Lächeln, das einen Eisberg zum Schmelzen bringen konnte – oder das Herz einer Frau. Außer Karen Meyers’ Herz. Sie hatte fast vier Jahre lang mit Sams sexy Lächeln zusammengelebt – obwohl, in den letzten paar Monaten hatte er eigentlich nicht mehr viel gelächelt. Zumindest nicht für sie.
Karen Meyers sah, wie Sam den Blick langsam durch ihr Büro im fünfzehnten Stock mit Aussicht auf den City Hall Park schweifen ließ. Um diese Zeit, fast fünf Uhr am Nachmittag, stand die Sonne bereits ziemlich tief, und aus den Büros in den umliegenden Gebäuden glitzerte Licht. Nicht mal Mitte November, aber es wurde schon früh dunkel. Karen konnte den Winter nicht ausstehen, sie hasste seine endlosen finsteren Stunden, seine Aneinanderreihung von Feiertagen, die eigentlich für frohe Stimmung sorgen sollten, es aber nicht taten, zumindest nicht bei ihr.
Es gab noch etwas, das Karen nicht ausstehen konnte. Sie hasste Überraschungen. Und gerade eben war ihr die größte Überraschung seit langem ins Haus geschneit. Oder genauer gesagt ins Büro.
»Hübsch«, sagte Sam, mit Blick auf den Kelim, der fast den ganzen Boden bedeckte. Allein der orientalische Teppich sorgte in dem Büro für etwas Farbe. An den Wänden hingen große schwarz-weiße Landschaftsaufnahmen in Chromrahmen, die Bürosessel waren aus edlem grauem Weichleder, der überdimensionale Schreibtisch und die Wand aus Aktenschränken dahinter waren jeweils aus dunklem Kirschholz. Der ganze Raum verströmte genau die richtige Mischung aus unaufdringlicher Eleganz und Professionalität. Nicht dass Karen sich für gewöhnlich hier mit Mandanten traf. Dafür gab es bei Markham, Speers & Calhoun noch elegantere, noch edler ausgestattete Räume.
Karen wusste, dass Sam nicht gefiel, was er sah, obwohl seine Miene leicht amüsiert blieb. Sie wartete ungeduldig ab und hatte dabei das Gefühl, dass eher sie als ihr Büro begutachtet wurde.
»Ich mache einen neuen Film«, sagte Sam und streifte den Riemen seiner abgewetzten, braunen Kameratasche von der Schulter, um sie auf einen der Ledersessel vor ihrem Schreibtisch zu legen. »Könnte dich interessieren, Karen.« Endlich richtete er seine Augen auf sie.
Das also war ihre Begrüßung nach achtzehn Monaten Funkstille. Sie waren beide keine Freunde von Smalltalk. Sam schon gar nicht. Daher hoffte sie, er würde möglichst rasch zum Grund seines Besuches kommen und genauso schnell wieder verschwinden.
»Siehst du diesen Stapel Akten, Sammie?« Nur Karen und seine Mutter nannten ihn Sammie. Karen deutete auf einen Berg Ordner auf ihrem Schreibtisch. Sie wollte wirklich, dass er zur Sache kam. Das Wiedersehen nach der langen Zeit brachte sie doch ganz schön durcheinander.
Sam lächelte bloß. »Kaum zu übersehen.«
»Also, spar dir den Vorspann, sag, was du von mir willst und lass mich Nein sagen. Dann kannst du dich vom Acker und ich mich wieder an meine Arbeit machen.« Karen hielt sich wacker, aber ihre Stimme war nicht so fest, wie sie sich das wünschte. Das letzte Mal, dass sie und Sam sich gesehen hatten, war im letzten Mai gewesen, als sie im Büro ihres Anwalts die Scheidungspapiere unterschrieben.
Er warf einen Blick auf ihre Hand, die noch auf dem Aktenstapel lag, und sein Lächeln wurde nur noch breiter, was seine verdammt hübschen Grübchen zum Vorschein brachte. Verlegen zog Karen den tiefen Ausschnitt ihres perlmuttfarbenen Kaschmirpullovers höher. Dabei hatte sie normalerweise keine Hemmungen, etwas Dekolleté zu zeigen, wie zum Beispiel am Morgen im Gerichtssaal, als sie Richter Alan Neville um Vertagung bat, weil einer ihrer Hauptzeugen in einem Kartellprozess nicht erschienen war. Neville bewahrte zwar sein berühmtes Pokerface, doch Karen entging nicht, dass der Blick des Richters nach unten auf ihre üppige Brust glitt, ehe er ein barsches »Drei Tage, Ms Meyers!« knurrte.
Sam trat näher, stützte die Handflächen auf den Rand ihres überfüllten Schreibtischs und beugte sich leicht zu ihr vor.
»Dieser Dokumentarfilm, den ich mache –«
Karen hob eine Hand, um ihn zu bremsen. »Sammie, ich hab doch gesagt, fass dich kurz. Ich bin sicher, es wird ein toller Film, genau wie deine letzten drei oder wie viele es waren –«
»Für den letzten habe ich einen Emmy gekriegt.«
»Glückwunsch.« Karens Stimme wurde eine Spur sanfter. Sie hatte sich den prämierten Film mit dem Titel Hanging Out angesehen, als er knapp einen Monat nach ihrer Scheidung auf HBO lief. Sie hatte ihn gar nicht sehen wollen, weil sie den Film für einen großen Teil ihrer Eheprobleme verantwortlich machte, besser gesagt, die viele Zeit, die Sammie dafür investiert hatte, um das ganze Land zu bereisen und mittelose Männer und Frauen zu interviewen, die tagaus, tagein an Straßenecken in verarmten Stadtvierteln herumhingen. Sammie hatte so eine Art, seinen Interviewpartnern nahezukommen und ihr Herz zu erobern. Die Geschichten, die er ihnen entlockte, waren intim, schmerzhaft und hart und mitunter abstoßend. Aber immer packend.
Sammies Film war gut. Besser als gut. Er hatte den Emmy verdient. Ja, Karen hatte sich auch die Verleihung angesehen, überzeugt, dass er für die beste Fernsehdokumentation prämiert werden würde. Hatte sie sich gewünscht, dass er auf die Bühne gehen und sie in seiner Dankesrede erwähnen würde? Schließlich hatte sie ihn in den ersten Monaten seines Projekts nicht nur emotional, sondern auch finanziell unterstützt. Zugegeben, es hätte einer gewissen Ironie nicht entbehrt, wenn er sich bei ihr bedankt hätte. Aber ihre Überlegungen waren ohnehin überflüssig gewesen. Er war gar nicht erschienen. Sam Berger war als Mann hinter der Kamera nicht fürs Rampenlicht geschaffen. Irgendein wasserstoffblonder Blödmann aus irgendeiner Seifenoper hatte den Preis für ihn entgegengenommen.
Karen spürte die Augen ihres Exmannes auf sich, und sogleich stieg ihr die Röte in die Wangen. Sammie hatte noch immer diese Wirkung auf sie, obwohl sie ehrlich glaubte, dass sie mit der Scheidung ihren Frieden gemacht hatte; schließlich war sie doch zu der Überzeugung gelangt oder hatte sich zumindest eingeredet, dass es so am besten war. Dennoch …
Sie warf einen überdeutlichen Blick auf ihre Rolex und musterte ihn dann ungeduldig.
In gelassener Missachtung dieser unübersehbaren Geste schob Sam seine lange, schlaksige Gestalt in den grauen Ledersessel vor Karens Schreibtisch. »Ich sage deshalb, die Doku könnte dich interessieren, weil sie was mit der Arbeit zu tun hat, mit der du dich in deinem Jurastudium in New York befasst hast.«
Er hängte ein Bein lässig über eine Armlehne, eine Pose, die für Karen vertraut und provokativ zugleich war. Er sah verdammt gut aus. Die Scheidung bekam ihm offensichtlich bestens. Keine Spur mehr von den dunklen Schatten, die er um die Augen gehabt hatte, als die Streitereien zwischen ihnen eskaliert waren. Keine Spur mehr von den Falten, die seine Stirn auch dann zerfurchten, wenn er sie nicht runzelte. Mit fünfunddreißig wirkte Sam Bergers Teint noch immer frisch. Und seine dunkelbraunen Locken ringelten sich so wild und lang wie eh und je bis in den Nacken. Er war ähnlich gekleidet wie in ihrer gemeinsamen Zeit, verwaschene blaue Jeans mit ausgebeulten Knien, schwarzer Pullover mit Rundhalsausschnitt, die Ärmel zu kurz und am Bund vom zu vielen Waschen ausgeleiert, sowie abgewetzte schwarze Cowboystiefel aus Ziegenleder, dieselben, die er schon trug, als sie sich vor sieben Jahren ineinander verliebten. Die Stiefel hatten länger gehalten als ihre Beziehung.
Wie er ihr so gegenübersaß, wirkte Sam völlig locker. Karen dagegen fühlte sich alles andere als entspannt. Wenigstens wusste sie, dass sie selbst auch noch ziemlich gut aussah. Noch immer unter fünfundfünfzig Kilo, noch immer gut in Form dank des mörderischen Trainings, das sie allmorgendlich im Fitnessstudio absolvierte und das sie immer erst hinterher genießen konnte. Ihr Friseur hatte ihr glattes rotblondes Haar, das sie nun kürzer trug als während ihrer Zeit mit Sam, dezent mit hellen Strähnchen aufgepeppt, und die fransige Stufenschnittfrisur betonte ihre Kopfform und wirkte jugendlich und professionell zugleich. Außerdem war sie pflegeleicht, ein großes Plus für eine Frau, die im Schnitt siebzig Stunden die Woche und mehr arbeitete.
Karen sah, dass Sam seelenruhig auf eine Reaktion von ihr wartete. Sie war in Gedanken so weit abgeglitten, dass sie fast vergessen hätte, was er gesagt hatte. Dann wurde ihr klar, warum ihr das alles in den Sinn gekommen war. Er beschwor eine Zeit herauf, die sie am liebsten aus ihrem Gedächtnis verbannt hätte. »Ich habe im Studium viel gearbeitet, Sam. Und seit ich Partnerin bei Markham, Speers & Calhoun bin, habe ich noch sehr viel mehr Arbeit. Selbst wenn ich bereit wäre, dir einen Gefallen zu tun, ich habe ehrlich nicht die Zeit. Ich ersticke in Arbeit, wie du siehst.«
Sam überging ihre Bemerkung, ein Zug, der Karen oft frustriert hatte. Na, wenigstens das hatte sich nicht geändert.
»Ich meine dieses Projekt zum Thema Fehlurteile, das du im letzten Semester gemacht hast. Damals wolltest du später unbedingt was mit Strafrecht machen. Pflichtverteidigerin werden, sobald du die Zulassung in der Tasche hättest, weil es dich empört hat, wie schlecht sich die meisten Pflichtverteidiger für ihre mittellosen Mandanten einsetzen.«
Karen spürte, wie sich ihr Mund anspannte. Sam hatte einen Nerv getroffen. Und das wusste er ganz genau, was es nur noch schlimmer machte. Leidenschaftliches Engagement für die gesellschaftlich Benachteiligten war damals zwischen Karen und Sam ein starkes Bindeglied gewesen. Anders als bei ihr war Sams Leidenschaft auf dem Gebiet nie abgeebbt. Alle seine Filme hatten sich mit irgendeinem Aspekt von Armut oder Ungerechtigkeit befasst (was beides, wie er ihr erklärte, für gewöhnlich Hand in Hand ging). Sein erster Film – den er bereits schnitt, als sie ein Paar wurden – befasste sich mit sozial schwachen Familien, sein zweiter mit der Ausbeutung illegaler Einwanderer als Küchenhilfen in Nobelrestaurants und der dritte, der ihm den Emmy einbrachte, mit größtenteils Afroamerikanern und Latinos, die allmählich den Lebensmut verloren, während sie perspektivlos an irgendwelchen Straßenecken herumhingen. Ohne Begleitkommentar erzählte Sams Dokumentation davon, wie die Armut Männern jede Hoffnung auf ein besseres Leben nimmt und sie zu Drogen, Alkohol und Straftaten verleitet.
Karen dagegen hatte kurz vor dem Examen unvermittelt von Strafrecht zu Wirtschaftsrecht gewechselt, eine Entscheidung, die ihr Ex ihr nie so ganz verziehen hatte.
»Du siehst gut aus, Karen«, sagte Sam, wobei sich ein ganz schwacher israelischer Akzent in seine Stimme schlich. In Haifa geboren und aufgewachsen, hatte er nach seinem Militärdienst in Israel die Filmhochschule in New York besucht. Er war in New York geblieben und wenige Jahre nach seiner Heirat mit Karen amerikanischer Staatsbürger geworden.
»Guter Haarschnitt. Sehr elegant. Und sogar mit Strähnchen. Hübsch.«
Sams abrupter Themenwechsel brachte Karen nur noch mehr auf die Palme. Für einen Mann, der so sensibel mit seinen Interviewpartnern umging, ließ Sams Gespür für die Menschen in seinem persönlichen Umfeld schon immer zu wünschen übrig.
Sie starrte ihn erbost an, aber im Grunde war sie verlegen. Nicht bloß wegen ihrer neuen Frisur, sondern wegen ihrer ganzen Erscheinung. Sie wünschte jetzt, sie hätte eines ihrer Businesskostüme angehabt, mit einer klassischen weißen Bluse, ein Outfit, das sie immer dann anzog, wenn sie ihre schlanke, aber kurvenreiche Figur kaschieren wollte. Der tief ausgeschnittene Pullover, der ihr am Morgen noch gute Dienste geleistet hatte, steigerte jetzt nur ihr Unbehagen.
»Und die Rolex. Muss eine schöne Stange Geld gekostet haben. Hast du sie dir selbst gekauft, oder war sie ein Geschenk?«
Ihr Mund zuckte. Was fiel ihm ein, ihr so eine persönliche Frage zu stellen? Sie antwortete nicht. Sollte er ruhig denken, dass die Uhr ein Geschenk war. Von einem jungen, heißen Liebhaber.
Ihr Schweigen schien ihn nicht aus der Ruhe zu bringen. »Ich schätze«, fuhr er lakonisch fort, »eine Partnerin in einer New Yorker Topkanzlei braucht nun mal gewisse Accessoires.«
Ihr Zorn wurde übermächtig. »Es gab mal eine Zeit, da hat dich das Geld, das ich als Wirtschaftsanwältin verdient habe, nicht gestört. Du hast dich jedenfalls nicht beschwert, als ich einen gehörigen Batzen von meinem schwer verdienten Geld in deine preisgekrönte Doku investiert habe.«
»Entschuldige«, sagte Sam leise. »Du hast recht. Manchmal bin ich ein Riesenarsch.«
»Nein«, sagte sie knapp. »Bloß ein Arsch.«
»Wirklich, es tut mir echt leid, Karen.«
Sie zuckte die Achseln, entschlossen, es auf sich beruhen zu lassen. Leichter gesagt als getan.
»Komm endlich zur Sache, Sam.«
»Also, ich weiß, ich berühre einen wunden Punkt, wenn ich von deiner Beteiligung an dem Projekt über die Fehlurteile anfange. Aber deine Gruppe und ganz besonders du, Karen, ihr habt da sehr wertvolle Arbeit geleistet. Für wie viele Insassen habt ihr ein Wiederaufnahmeverfahren erreicht? Ein Dutzend? Mehr? Und die Staatsanwaltschaft hat nur zwei Fälle davon wieder vor Gericht gebracht. Und beide verloren. Außerdem habt ihr es geschafft, dass drei Schuldurteile aufgehoben wurden. Dank euch sind diese zu Unrecht verurteilten Menschen als freie Bürger wieder aus dem Knast gekommen.«
»Ja, nachdem sie jahrelang unschuldig gesessen hatten. Nicht zu vergessen, dass wir auch einige Fehler gemacht haben«, sagte Karen und sah Sam dabei unverwandt an.
Sie wussten beide, welchen Fehler sie vor allem meinte, einen, dessen Wirkung auf Karen so tiefgreifend gewesen war, dass er den Verlauf ihrer Karriere verändert hatte. Dass er Karen verändert hatte.
2
Karens letzter Fall im Rahmen des kurz »FUP« genannten Fehlurteile-Projekts im letzten Semester ihres Jurastudiums war ein Häftling namens George Jones gewesen. Der zurückhaltende, freundliche zweiunddreißig Jahre alte Afroamerikaner war ihr auf Anhieb sympathisch gewesen. Er hatte in der Strafanstalt Attica nicht nur seinen Highschool-Abschluss nachgemacht, sondern auch mitgeholfen, ein Programm auf die Beine zu stellen, in dem Häftlinge auf freiwilliger Basis den zahlreichen Analphabeten unter ihren Mitinsassen Lesen und Schreiben beibrachten.
Nachdem sie die Protokolle seines Prozesses und seiner drei gescheiterten Berufungen durchgeackert hatte, war Karen überzeugt, dass die Beweislage ausreichte, um für Jones eine Wiederaufnahme des Prozesses zu bewirken, womöglich sogar eine Umwandlung seiner lebenslänglichen Haftstrafe. Vorausgesetzt sie konnte beweisen, dass seine DNA nicht mit der des Vergewaltigers und Mörders einer jungen Studentin übereinstimmte. Doch obgleich Jones unerschütterlich seine Unschuld beteuerte, war es nicht leicht, den Häftling davon zu überzeugen, wie gut seine Chancen auf eine Freilassung standen. Er hatte schon zu viele Enttäuschungen hinnehmen müssen.
Bei jedem Gespräch mit dem Häftling merkte sie, wie er immer mutloser wurde. Doch Karen glaubte, ihr Eifer und ihr Vertrauen würden für sie beide reichen. Nie zuvor hatte sie sich so in einen Fall hineingekniet. Sie war zu der festen Überzeugung gelangt, dass er unschuldig war und sie ihn freibekommen konnte.
Doch am Ende scheiterte sie. Scheiterte mit den denkbar schlimmsten Folgen. George Jones erhängte sich in seiner Zelle, nachdem er vierzehn Jahre, drei Wochen und zwei Tage seiner Strafe abgesessen hatte. Genau am selben Tag hatte Karen es endlich geschafft, einen Labortechniker der Rechtsmedizin zu überreden, das fünfzehn Jahre alte Beweismaterial aus dem Vergewaltigungsfall aus einem Regal in irgendeinem Lagerraum im Keller hervorzuholen. Als der Mann zwei Tage später aufgeregt anrief, um Karen zu sagen, dass er an der Unterwäsche des Opfers Spermaspuren gefunden und eine Probe genommen hatte, hätte sie beinahe erwidert, er könne es sich sparen, ihr die Ergebnisse zu schicken. Doch sie hatte das Gefühl, es dem Häftling schuldig zu sein, ihr Versprechen einzulösen. Sie würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um seine Unschuld zu beweisen.
Jones war schon etliche Wochen tot und auf dem Gefängnisfriedhof begraben worden, als Karen vom Labor der Uniklinik die Ergebnisse der DNA-Untersuchung erhielt. Sie bewiesen George Jones’ Beteuerungen, dass er nichts mit der Vergewaltigung und Ermordung einer neunzehnjährigen Studentin am Barnard College zu tun gehabt hatte. Überdies stellte sich heraus, dass die DNA mit der eines weiteren Häftlings übereinstimmte, der wegen einer anderen Vergewaltigung verurteilt worden war und makabrerweise nur drei Zellen entfernt von der Zelle einsaß, in der Jones sich erhängt hatte. George Jones wurde posthum entlastet, wodurch seine Mutter, seine Freundin und sein sechzehnjähriger Sohn zumindest Gelegenheit hatten, den unschuldigen Mann in das Familiengrab umbetten zu lassen.
Karen und Sam hatten an der Trauerfeier für George Jones in der Baptistenkirche auf der Upper Westside teilgenommen. Die kleine bedrückte Trauergemeinde bestand aus Familienangehörigen und den wenigen Freunden, die während seiner langen Jahre im Gefängnis mit George in Verbindung geblieben waren. Nicht mal eine Woche später gab Karen das FUP auf und wechselte in den Bereich Wirtschaftsrecht, eine Entscheidung, von der sie weder ihre Strafrechtsprofessorin Jessie Harrison, die das FUP leitete, noch ihr Verlobter Sam Berger abbringen konnten. Karen vermutete, dass zumindest Sammie glaubte, sie würde irgendwann schon wieder zur Vernunft kommen. Während ihrer gesamten Ehe spürte sie, wie enttäuscht er von ihr war, obwohl er es nie aussprach. Sie hatte gewusst, dass er weiterhin dachte, sie würde wieder zur Vernunft kommen. Jetzt wurde ihr klar, dass er die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben hatte.
»Das FUP liegt ewig zurück, Sam. Ich bin woanders angekommen.« Selbst Karen hörte den gezwungenen Unterton in ihrer Stimme.
»Das sehe ich.«
»Ich mag meine Arbeit.« Sie erhob sich von ihrem Schreibtisch, drehte Sam den Rücken zu und ging zu einem Aktenschrank. Sie zog eine der oberen Schubladen auf und suchte die aufgehängten Akten durch, als müsste sie etwas ungemein Wichtiges finden.
»Früher hast du deine Arbeit geliebt.«
»Liebe ist sentimentaler Quatsch«, sagte sie trocken und zog die dickste Akte in der Schublade heraus.
Er zuckte die Achseln. »Und mögen?«
Sie drehte sich wieder zu ihm um, die überflüssige Akte an die Brust gedrückt. »Okay, okay. Was willst du von mir?« Sie wusste, dass Sam erst gehen würde, wenn sie sich anhörte, weshalb er gekommen war. Und bis dahin würde sie ihre innere Ruhe nicht wiederfinden.
»Einer von den Typen, die sich für das FUP beworben haben, als du noch dabei warst, war ein Häftling namens Raphael López. Ihr habt ihn nicht akzeptiert.«
»Wir hatten Hunderte Bewerber, Sammie.«
»He, das sollte kein Vorwurf sein, Karen. Er ist bloß das Thema meiner neuen Doku.«
Karen kniff die Augen zusammen. »Hat irgendwer beim FUP seinen Fall jetzt übernommen?« Das Projekt an der juristischen Fakultät lief nach wie vor. Und ähnliche waren im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dennoch, bei den Tausenden Häftlingen, die sich pro Woche bewarben, konnten die vorhandenen Projekte nur einen ganz geringen Prozentsatz bearbeiten.
»Kommt er raus?«, fragte Karen. Auch wenn sie lange nicht mehr an dem Projekt mitgearbeitet hatte, ihr Herz schlug noch immer dafür.
Der Anflug eines Lächelns umspielte Sams Lippen. »Hab doch gewusst, dass du gleich zum Kern des Problems kommst.«
»Dann sitzt er also noch.«
Sam nickte und sein Blick wurde ernst.
»Lebenslänglich?«
»Ohne Aussicht auf Bewährung. Die Geschworenen, von denen übrigens keiner ein Latino war und nur einer ein Schwarzer, haben ihn schuldiggesprochen. Ein Afroamerikaner namens Jackson Scott. Scott ist Arzt. Leitet die Notaufnahme im Mercy East. Damals vor knapp dreiundzwanzig Jahren war er Student. Netter Kerl. Und ein sehr guter Arzt.«
»Und woher weißt du das?«
Sam lächelte kleinlaut. »Vor ein paar Monaten hat mich so ein Typ auf offener Straße ausgeraubt. Der Bursche war höchstens fünfzehn, und als er Reißaus nahm, bin ich hinterher.«
»Und hast du ihn erwischt?«
»Ich hab noch immer schnelle Beine, was in diesem Fall nicht so gut war. Der Typ hatte ein Springmesser, und als ich ihn gepackt und herumgerissen habe und meine Eisenfaust auf sein Kinn zuschoss, da hatte er mir sein Messer schon in den Bauch gerammt.«
»Mein Gott, Sammie, wieso bist du ihm nach? Das war idiotisch. Und wofür? Eine Brieftasche? Mit vielleicht zwanzig, dreißig Dollar drin und ein paar Kreditkarten, die bis zum Anschlag belastet sind?« Ihre Stimme klang aufgeregt. Einen Moment lang war sie wieder in der Vergangenheit, einer Vergangenheit mit Sammie, die ihr allerhand Aufregungen beschert hatte. Ihre Reaktion war ihr peinlich, aber ihr Ex schien das nicht zu merken.
Sam lachte. »Ich hab sogar schon versucht, meinen Emmy zu verhökern, aber wer ist schon scharf auf den Emmy eines Dokumentarfilmers? Selbst wenn mein Film eine Million Zuschauer hatte, wären vielleicht fünf imstande, zu sagen, wer ihn gedreht hat.«
»Warst du schwer verletzt?« Die Worte kamen ihr wie von selbst über die Lippen. Verdammt, wann würde sie endlich aufhören, sich Sorgen zu machen?
Sam zog seinen Pullover hoch, und zum Vorschein kam nackte Haut mit einer fünf Zentimeter langen, nicht ganz verheilten Narbe knapp rechts neben dem Bauchnabel. »Scott hätte das Zeug zum Schönheitschirurgen. Hat mich wie ein Profi zusammengenäht.«
Karen schaute weg und hoffte, dass Sammie denken würde, sie könnte den Anblick der Wunde nicht ertragen. In Wahrheit löste der Anblick der Haut, die sie einmal so intim berührt hatte, eine beunruhigend heftige Erregung in ihr aus. Hastig befand sie, dass sie schlicht überarbeitet war. Die Erschöpfung hatte sie anfällig gemacht.
»Jedenfalls, wir sind ins Gespräch gekommen, der Doc und ich«, fuhr Sammie fort, beugte sich vor und schien sich nun ganz auf die Geschichte zu konzentrieren.
Karen nahm unterdessen wieder an ihrem Schreibtisch Platz, legte die Akte auf einen Stapel und richtete den Blick erneut auf Sammie. Erleichtert stellte sie fest, dass er den Pullover wieder runtergezogen hatte.
»Wie bist du auf den Fall López gekommen?« Karens Neugier war zu stark. Es war schließlich schon nach fünf, und obwohl eine Riesenmenge Schriftsätze auf sie wartete, blieb ihr ja noch das ganze Wochenende. Das ganze Wochenende, um zu arbeiten. Keine anderen Pläne. Keine Verabredungen. Das heißt, wenn sie Woody nicht mitrechnete, einen zwölf Jahre alten inkontinenten Golden Retriever, den sie unlängst von ihrer älteren Nachbarin geerbt hatte. Mrs Balluci hatte sich das Becken gebrochen und musste schließlich in ein Pflegeheim umziehen.
Karen hatte sich eigentlich nur vorübergehend um den Hund kümmern wollen, weil sie davon ausging, dass sich schon jemand aus der Familie ihrer Nachbarin seiner annehmen würde. Doch als sie bei einem der Söhne halbherzig anfragte, bekam sie zur Antwort, dass in seinem Mietshaus keine Haustiere erlaubt seien, und sein Bruder teilte ihr kurz und knapp mit, er habe eine Hundeallergie. Somit blieb Karen auf dem Hund mit seinem Inkontinenzproblem sitzen. Jedes Mal, wenn sie abends nach sechs von der Arbeit kam, erwartete sie unweigerlich eine Urinpfütze, die Woody mit Vorliebe direkt an der Wohnungstür hinterließ.
Dennoch war ihr der Hund rasch ans Herz gewachsen. Er war ein liebes, anhängliches Tier. Ein lebendiges, atmendes Wesen, mit dem sie abends auf der Couch kuscheln konnte. Neuerdings ließ sie ihn sogar in ihrem Bett schlafen.
Verdammt, dachte sie, ich brauche dringend einen Mann. Es war einfach zu lange her. Was nicht heißen sollte, dass sie ihren Ex als möglichen Kandidaten ins Auge fasste. Falls er überhaupt interessiert wäre. Was sie bezweifelte, wenn die Geschäftsmiene, die er auf der anderen Schreibtischseite aufgesetzt hatte, ein Indiz war. Wahrscheinlich hatte er eine Freundin oder war vielleicht sogar wieder verheiratet. Ihr Blick fiel auf seinen Ringfinger. Nichts. Aber andererseits hatte er auch keinen Ehering getragen, als sie noch verheiratet waren.
Falls Sam auch nur ansatzweise ahnte, was in ihr vorging, so ließ er es sich nicht anmerken. »Jackson Scott, der Arzt in der Notaufnahme, hat mir erzählt, er hätte sich von den Geschworenen im López-Prozess mit dem Schuldspruch am schwersten getan. Vor allen Dingen, weil die Anklagevertretung fast ausschließlich Indizienbeweise gegen den von seiner Frau getrennt lebenden Ehemann hatte oder sich auf Aussagen von fragwürdigen Augenzeugen und Experten berief. Scott war einfach nicht hundertprozentig von López’ Schuld überzeugt. Außerdem fand er López’ Pflichtverteidiger nahezu lächerlich. Scott beschrieb ihn als einen verängstigten kleinen Jungen, der sich in einem Irrgarten verlaufen hat und hofft, wenn er sich bloß lange genug still und leise verhält, wird ihn schon jemand retten. Oder in diesem Fall, seinen Mandanten retten.«
»Ein unerfahrener, inkompetenter Pflichtverteidiger. Ist ja ganz was Neues.« In Karens müder Stimme schwang das pure schlechte Gewissen mit, das diesmal nichts mit Sammie zu tun hatte. Sie erinnerte sich schmerzhaft daran, dass sie fest vorgehabt hatte, nach der Zulassung als Anwältin Pflichtverteidigerin zu werden.
»Jedenfalls«, fuhr Sam rasch fort, »die Entscheidung ist dem Doc, der damals noch Medizinstudent war, verdammt schwergefallen, aber irgendwann hat er dem Druck der Gruppen doch nachgegeben. López kam also nach Attica, und einige Monate später schrieb Scott ihm einen Brief. Er hoffte, dadurch irgendwie mit der Sache ins Reine zu kommen.«
»Lass mich raten«, fiel Karen ihm ins Wort. »Er wollte, dass López gestand, damit der Schuldspruch gerechtfertigt war und er kein schlechtes Gewissen mehr haben musste?«
»So was in der Art. Doch López schwor, dass er unschuldig ist. Um es abzukürzen, López und Scott wurden Brieffreunde und schreiben sich seit nunmehr zweiundzwanzig Jahren.«
»Und López beteuert nach wie vor seine Unschuld.«
»Und Scott ist auch davon überzeugt. Der Doc hat jeden Brief von López aufbewahrt. Der Mann hat einen kraftvollen Schreibstil. Ist ein intelligenter, belesener Bursche. Vor seiner Verhaftung hat er Abendseminare am Hunter College besucht. Und das Absurde ist, er hat Jura studiert, Schwerpunkt Strafrecht. Er wollte Anwalt werden.«
»Hat er derzeit jemanden, der ihn vertritt?«, fragte Karen vorsichtig.
»Keine Bange. Deshalb bin ich nicht hier. Ich erwarte nicht, dass du seine Anwältin wirst«, sagte Sam rasch, doch zum ersten Mal sah er ihr nicht direkt in die Augen. »Jedenfalls, López hatte schon sämtliche Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft, als er sich 2006 beim FUP und bei einem halben Dutzend ähnlicher Projekte bewarb. Immer vergeblich.«
»Vielleicht gibt sein Fall zu wenig her.«
»Karen, die Ermittlung, der Prozess, das war alles ein Witz. Die Cops sind am Tatort herumgetrampelt und haben Spuren verwischt. Für sie war López von vornherein der Täter, und sie haben ihn auf der Stelle verhaftet. Andere Verdächtige wurden nicht mal in Erwägung gezogen. Der Pflichtverteidiger Gary Brewer hat keinen einzigen Zeugen der Verteidigung befragt, nicht mal López’ Mutter, die geschworen hat, dass ihr Sohn zum Zeitpunkt des Mordes bei ihr zu Hause war. Menschenskind, Brewer hat López im Gerichtssaal überhaupt zum ersten Mal gesehen.«
Karen seufzte. Solche Geschichten hatte sie zur Genüge zu hören bekommen, als sie beim FUP mitgemacht hatte, und sie war jedes Mal entsetzt gewesen. Unzureichende Ermittlungen, überarbeitete, unterbezahlte und unerfahrene Pflichtverteidiger, die Unmöglichkeit, sich anständige Hilfe für den Berufungsantrag zu besorgen … Wenn du in diesem Land arm warst und dir weder einen Privatdetektiv noch eine erfahrene, qualifizierte Rechtsvertretung leisten konntest, war dein weiteres Schicksal reine Glücksache. Und das Glück war dir meist nicht hold.
Karen war nicht naiv. Jede Menge mittelloser Männer und Frauen, die Straftaten begingen, hatten den Schuldspruch verdient. Gleichwohl hatten sie dasselbe unveräußerliche Recht auf einen fairen Prozess wie Leute mit Geld. Und wenn du mittellos und unschuldig warst, außerstande, dir einen anständigen Anwalt zu leisten, dann war Prozessmissbrauch leider an der Tagesordnung. Für viel zu viele war der Kampf um Gerechtigkeit ein fruchtloses Unterfangen. Genau deshalb hatte Karen sich früher mit so großer Leidenschaft in ihrer Arbeit engagiert.
Sie spürte Sams Augen auf sich, und sie war sicher, dass er ihre Gedanken las. Zum Teufel mit ihm. Nicht nur, weil er so scharfsichtig war, sondern auch weil er hier aufgetaucht war und Erinnerungen in ihr wachrief, denen sie sich nie wieder hatte stellen wollen.
3
»War das alles?«, sagte sie. »Keine handfesten Beweise?« Karen hätte gern etwas gehabt, was die Verurteilung dieses Häftlings rechtfertigte. Dann wäre es ihr leichter gefallen, den Fall aus dem Kopf zu verbannen.