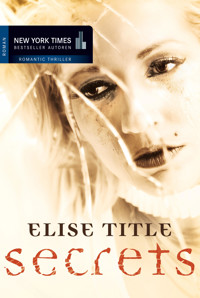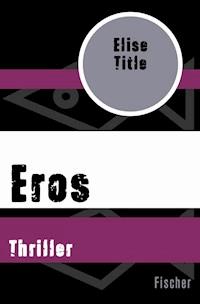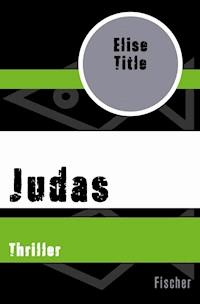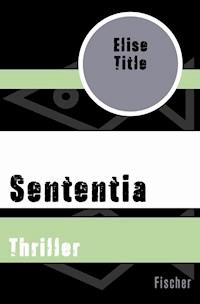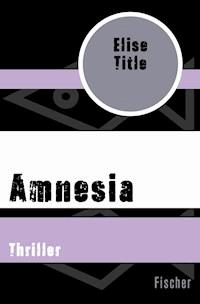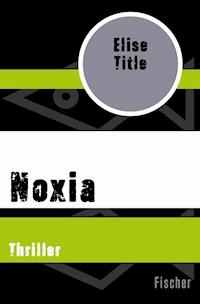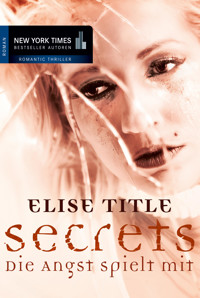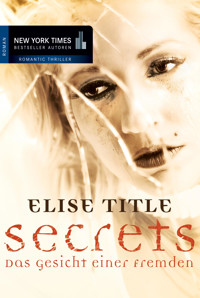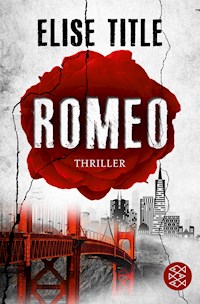
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Natalie Price
- Sprache: Deutsch
In San Francisco treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Seine Opfer: alleinstehende Frauen. Sie alle waren schön, selbstbewußt, beruflich erfolgreich. Als die Psychiaterin Melanie Rosen ermordet und mit herausgeschnittenem Herz gefunden wird, ist die Polizei ratlos. Schließlich war sie es, die das Profil des Mörders erstellt hat. Da gerät auch ihre Schwester Sarah ins Visier des Unbekannten. Als diese per Post Blätter aus dem Tagebuch der Ermordeten erhält, beschließt sie, den Kampf aufzunehmen. Sie ist fest entschlossen, den Täter zu stoppen, und davon überzeugt, daß die Polizei sie beschützen wird. Doch sie ahnt nicht, wie nah ‹Romeo› ihr bereits ist ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elise Title
Romeo
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER Digital
Inhalt
Prolog
Lustlose Hingabe ist Taubheit, Leere, ein schwarzes Loch. Aber es gibt eine andere, absolut verlockende Form der Hingabe: den Akt der völligen Unterwerfung.
M.R., Tagebuch
Die gespannte Erwartung ist spürbar. Unter der Haut. Im Kopf. Prickelt an ihrem ganzen Körper – an den Fußsohlen, zwischen den Schenkeln, den Brüsten, auf der Zunge, sogar auf den Augenlidern. Bringt das Schlafzimmer zum Vibrieren. Dringt durch ihren kühlen, mauve- und cremefarbenen Kokon.
Sie spürt, wie das elektrisierende Pochen einem unerbittlichen Beben weicht. Das Chaos, dem sie nicht entfliehen kann, setzt sich in Bewegung. Würde sie ihm entfliehen, wenn sie könnte? Nein. Ohne diese Erregung würde sie sich wie amputiert fühlen. Wie tot.
Das einzige Problem ist die Schuld. Heimtückisch schleichend, nagend, eitrige Wunden fressend. Natürlich getarnt, denn sie ist eine Meisterin der Täuschung wie der Wahrnehmung. Eine eingeschlossene Kraft, die sorgsam in ihren vorgegebenen Grenzen gehalten wird. Grenzen, die sie vorgibt.
Sie summt eine Melodie aus Kindertagen – irgendein Wiegenlied – und zieht währenddessen ihre blutroten Fingernägel langsam über ihre kleinen Brüste. Der Schmerz ist ihr Aphrodisiakum, denn nur er gebietet den Gedanken Einhalt, die ihr durch den Kopf wirbeln. Nur der Schmerz bringt die Kritik ihrer verletzten Psyche zum Schweigen.
Ihre glänzenden, manikürten Nägel gleiten über ihre weichen Brüste. Dann über die Brustwarzen. Hinterlassen brennend rote Streifen auf elfenbeinfarbener Haut. Ihre Brustwarzen sind hart, prickeln erwartungsvoll. Sie dreht sie leicht zwischen Zeigefinger und Daumen. Sie schnappt nach Luft und spürt einen unerwartet stechenden Schmerz, als sich ihre Lungen mit Luft füllen. Mit sechsunddreißig kann das kein Herzanfall sein. Sie ist in tadelloser Form, trainiert jeden Tag, spielt Squash, Tennis, ernährt sich fettarm. Vor noch nicht einem Monat hat sie ihren alljährlichen Check-up machen lassen, und man hat ihr eine blendende Gesundheit attestiert. Was dann? Sie weiß es.
Ein Anfall von Gewissensbissen. Er erfaßt sie wie ein Sturm. Ein Gefühl, das sie haßt. Paß auf, Melanie! Du willst dich ganz dicht am Rand des Abgrunds bewegen und nicht wirklich Schaden nehmen. Stürz nicht ab dabei.
Allmählich trocknet der Schweiß auf ihrer Haut. Ein kühler Hauch des Spätoktobers weht durch das offene Fenster. Die Geräusche von der Straße dringen herein, während der Abendnebel San Francisco einhüllt. Viertelmond. Der Himmel leuchtet unheimlich.
Ein resolutes Klingeln an der Haustür. Alles stockt. Selbst ihr Atem. Dann reißt sie sich rasch zusammen. Sie verharrt vor dem großen Spiegel im Schlafzimmer und mustert sich kühl, distanziert. Sie hat ihre Garderobe sorgfältig zusammengestellt. Maßgeschneiderte rosafarbene Seidenbluse. Weich fließende, schwarze Seidenhose. Schwarze Sandaletten an den nackten Füßen. Zwar elegant, aber mit einer verführerischen, aufreizenden Note. Sie fährt sich mit dem Kamm durch ihr dichtes, glattes kastanienbraunes Haar, das ihr stumpf geschnitten bis auf die Schultern fällt. Noch ein kurzer kritischer Blick. Ja, sie ist bereit.
Ein ironisches Lächeln umspielt ihre Lippen, selbst dann noch, als sie ein Schwindelgefühl überkommt und taumeln läßt, so daß sie sich an der Wand abstützen muß. Es vergeht schnell wieder. Durch die Kraft ihres Willens. Sie kann das. Alles in Ordnung. Sie lächelt.
Sie geht in ihr Wohnzimmer und mustert den Raum mit dem kritischen Blick einer Frau, die sich ständig bewußtmachen muß, was sie erreicht hat. Wie alles in ihrem viktorianischen Stadthaus in Pacific Heights ist auch dieser Raum stilvoll und elegant. Nicht die Spur überladen. Die verputzten Wände zart pfirsichfarben. Vor den Fenstern Teakholz-Jalousien. Marokkanischer Teppich in dunklen Farbtönen – Braun, Umber, Grau – auf dem weißgestrichenen Dielenboden aus Eichenholz. Ein Paar zweisitzige Sofas mit blaßkaramelfarbenem Seidenbezug steht sich gegenüber. Auf dem Couchtisch aus Kiefernholz eine Vase mit Chrysanthemen, zwei Sektgläser aus Kristallglas. Ein großes Erkerfenster bietet sich für Pflanzen an, aber es sind keine da. Sie hat keine glückliche Hand dafür und will nicht zusehen müssen, wie etwas Lebendiges unter ihren Händen langsam dahinstirbt. Trauer oder Verzweiflung über das Versagen? Sie ist nicht sicher. Beides verfließt häufig ineinander.
Es klingelt nicht noch einmal, aber sie weiß, daß er draußen im Flur steht, geduldig wartend. Wissend, daß sie die Vorfreude auskostet. So wie er. Dessen ist sie sich sicher. Schon allein der Gedanke daran erregt sie.
Sie lächelt, als sie die Tür öffnet. Hastig setzt sie wieder ihre Maske auf und spürt doch, daß sie leicht verrutscht ist.
Er rührt sich nicht und mustert sie unverhohlen, mit ausdruckslosem Gesicht.
Ihr Blick fällt auf die Verpackung in seiner Hand. Champagner. Interessant. Provozierend. Ein Ausdruck von Verspieltheit. Sie zügelt sich selbst. Sie will nicht analysieren.
Sie sitzen auf einem der Sofas. Sie beobachtet ihn, während sie aus ihren Kristallglaskelchen den Champagner trinken. An seinen Augen kann sie ablesen, daß er sich wohl fühlt. Sie hat sanfte Jazzmusik aufgelegt – Branford Marsalis. Die Beleuchtung ist gedämpft, Kerzenlicht, die Stimmung entspannt und romantisch. Er spielt mit ihrem Haar, während er an seinem Glas nippt.
Sie versucht, sich nicht anmerken zu lassen, daß sie es kaum noch erwarten kann. Jetzt, wo er da ist, hat sie keine Angst mehr. Sie vertraut ihm. Sieht ihn als Meisterdirigenten einer großen Sinfonie. Und sie ist sein Orchester.
Er streicht ihr federleicht über die Wange. Sie empfindet die Liebkosung fast wie eine Explosion.
«Heute abend siehst du aus wie ein kleines Mädchen», sagt er.
Sie ist überrascht. Aber insgeheim erfreut. «Ein kleines Mädchen?»
«Du willst es verbergen, aber es gelingt dir nicht.»
Er legt seinen Arm um sie und zieht ihren Kopf sachte an seine Schulter. So sitzen sie in zärtlichem Schweigen, bei flackernden Kerzen, und lauschen Marsalis’ klagendem Tenorsaxophon.
Vorspiel.
Vor der Stereoanlage. Sie weiß nicht recht, welche CD sie nehmen soll. Er tritt von hinten an sie heran. Sie will sich zu ihm umdrehen, aber er legt ihr die Hände auf die Schultern und hält sie fest. Als er sie losläßt, bleibt sie ergeben stehen. Seine Finger gleiten verführerisch über ihren Rücken, ihr Gesäß.
Sie stellt sich vor, daß er lächelt, als er feststellt, daß sie unter ihrer seriösen Kleidung weder BH noch Slip trägt, aber sie will sich nicht bewegen – nicht mal den Kopf –, um zu sehen, ob sie recht hat. Gehorsam zu sein, ist einfach zu erregend.
Er zieht ihr die Bluse aus der Hose, schiebt seine kühlen Hände darunter und legt seine gespreizten Finger flach auf ihren Rücken. Sie steht ganz still, erwartungsvoll.
«Such irgendwas aus. Irgendwas mit einem heißen Rhythmus», flüstert er ihr ins Ohr.
Sie will sich gegen ihn lehnen, sich an ihn schmiegen, spüren, ob er erregt ist, aber ihr gefällt das träge Tempo, das er bestimmt. Zwischen ihnen herrscht stilles Einverständnis.
Sie entscheidet sich für Bob Marley. Die erotische Spannung des Reggae strömt aus den Lautsprechern. Sie wiegt sich im Rhythmus. Schließt die Augen. Wissend, daß sie sich nicht verlieren wird. Er ist der perfekte Führer auf ihrer Reise.
Er wiegt sich nicht mit ihr, aber seine Hände bewegen sich langsam nach vorn über ihre Rippen, schieben sich zu ihren Brüsten hinauf.
Sein Mund an ihrer Halsbeuge. «Zieh deine Hose aus.» Der Befehlston ist kühl und verlockend zugleich.
Sein jäher Tempowechsel trifft sie unvorbereitet. Sie hat den Verdacht, daß ihn das freut. Ihre Hände verraten, wie nervös und begierig sie ist, doch es gelingt ihr, den Knopf zu lösen, und sie öffnet den Reißverschluß. Jetzt lächelt er. Dessen ist sie sicher, auch wenn sie noch immer mit dem Rücken zu ihm steht.
Ihre Hose fällt um ihre Füße zu Boden. Er bleibt hinter ihr stehen, knetet ihren nackten Hintern, während sie sich weiter im Rhythmus der Musik wiegt.
«Du hast ein Grübchen.»
Leichte Beunruhigung. Ein Makel? «Ist das gut oder schlecht?» Ihre Stimme bebt.
Er lacht leise. «Sehr gut.»
Warme Lust durchströmt sie. Ein Sieg.
In ihrem Sessel, jetzt völlig nackt. Er kniet zwischen ihren weit gespreizten Beinen. Sie kann sein Gesicht nicht sehen. Zwischen ihren Brüsten vergraben. Sie holt tief Atem, rekelt sich, greift nach ihm.
«Noch nicht», sagt er leise, und seine Zunge gleitet an ihr hinunter. «Jetzt geht es nur um dich. Aber du darfst dich nicht bewegen.»
Seine Großzügigkeit treibt ihr Tränen in die Augen. Es ist eine Ewigkeit her, daß ein Mann ihre Bedürfnisse wichtiger genommen hat als seine.
Er drückt sie nach hinten, schiebt seine Hände unter ihren Hintern, zieht sie zu sich heran, eine kostbare Gabe.
Seine Segnungen sind geschickt, wundervoll. Ihre Lust ist so intensiv, daß es beinahe schmerzt, ein Gefühl, das ihren ganzen Körper erschauern und vibrieren läßt.
Er hebt den Kopf, sieht zu ihr auf, seine Lippen glänzen naß von ihr. «Hast du Phantasien von uns gehabt?» fragt er mit einem so jungenhaften Lächeln, daß ihr Herz sich verkrampft. Das überrascht sie. Ihr Herz hatte doch damit nie etwas zu tun. Ein wohlbehütetes Organ. Bis jetzt.
«Hast du?» fragt er wieder.
«Ja.» Sie lächelt scheu. Mädchenhaft. Die Frau in ihr beginnt, sich zu verflüchtigen. «Ja.» Sie antwortet, diesmal ungefragt.
Nebeneinander auf der Bettkante. Seine Augen sind nicht auf sie gerichtet, sondern auf den Kommodenspiegel gegenüber. Sein Blick ist noch immer aufmerksam und distanziert zugleich.
Ein Anflug von Frustration. Sie will, daß er sich auszieht. Aktiver teilnimmt.
«Erzähl mir deine Lieblingsphantasien.» Seine Stimme ist leise, verführerisch drängend.
Sie wird rot. «Das ist aber sehr persönlich.» Über die Absurdität dieser Bemerkung muß sie lachen.
«Vor mir mußt du nichts verbergen», sagt er mit dieser lockenden, betörenden Stimme.
Ihre Verlegenheit ebbt ab, es ist einfach zu unanständig, als daß sie widerstehen könnte.
Sie beginnt zögernd. «Ich habe irgendwo auf einem Highway eine Autopanne. Nachts. Ein Lastwagenfahrer hält an. Er kommt näher, aber es ist so dunkel, daß ich ihn nicht genau sehen kann. Autos zischen an uns vorbei. Ich kann die Abgase riechen. Die Scheinwerfer erfassen uns, aber irgendwie fällt das Licht nur auf mich. Er bleibt im Schatten.»
«Was macht er?»
«Er sieht sich den Motor an, sagt aber, daß der Wagen nicht zu reparieren ist. Dann knallt er die Haube runter. Er steht ganz dicht neben mir.» Ihre Atmung hat sich verändert. Ist schneller. Heftiger.
«Hast du Angst?»
«Ja. Er hat etwas Brutales an sich.» Ihr Herz rast. «Aber ich bin auch erregt», gesteht sie. Sie sagt nicht, warum, aber es ist die Gefahr, das Ausgeliefertsein, die Furcht, das verbotene Verlangen, sich gegen ihren Willen hinzugeben.
«Was macht er?»
«Er zieht mich aus. Direkt am Straßenrand. Während die Autos vorbeifahren. Ich wehre mich, aber er schlägt mich ein paarmal ins Gesicht und droht, daß er mir noch mehr weh tun wird, wenn ich nicht mache, was er will. Als ich ganz nackt bin, hebt er mich auf die Motorhaube und drückt mich nieder. Er drückt meine Beine weit auseinander. Er ist sehr grob. Die Autos fahren jetzt langsamer vorbei. Ich flehe ihn an, mit mir ins Auto zu gehen, wo uns keiner sehen kann.»
«Willst du das wirklich?»
«Nein, nein, nein. Mittlerweile bin ich richtig heiß. Ich will ihn. Es ist aufregend, so ausgeliefert zu sein, so hilflos.» Genauso fühlt sie sich jetzt. Die Phantasie verwandelt sich in Wirklichkeit.
«Weiter.»
«Er ist auf mir, nimmt mich auf der kalten Motorhaube. Harte, wilde Stöße. Hände, die meine Handgelenke umklammern. Ein Wagen hält an. Drei junge Männer steigen aus. O Gott, mir wird klar, daß sie mich alle nehmen werden –»
Sie redet jetzt hastig, die Worte kommen wie von selbst. Sie kann sich nicht mehr auf sein Bild im Spiegel konzentrieren. Sie kann sie beide nicht mehr erkennen. Alles löst sich auf.
Zusammengerollt auf ihrem Bett. Sie lächelt sittsam – die Novizin, die Unschuldige –, während er über ihr steht und auf sie herabblickt.
«Sag mir, was ich tun soll», flüstert sie. «Wie kann ich dir gefallen?»
Er lächelt, und seine Augen wandern ihren Körper auf und ab. «Du hast kleine Titten.»
«Ich hasse sie», gibt sie zu, spürt, wie die Scham sie erfaßt. Auf gar keinen Fall möchte sie ihm mißfallen.
Sachte streichelt er ihre Brüste. Beruhigt sie. Sie lächelt verunsichert. Bis er zu ihren Brustwarzen gelangt und sie kneift, die Finger wie eine Zange. Sie zuckt zusammen, aber sie spürt einen Adrenalinstoß.
Ja, ja, tu mir weh. Das habe ich verdient.
In der Badewanne. Er wäscht sie. Er ist sehr sanft, besonders an den Stellen mit den Blutergüssen. Seine Fürsorge erregt und rührt sie gleichermaßen. Seine Zärtlichkeit verstärkt die Lust, die Spannung.
«Bist du Daddys kleines Mädchen?» fragt er, seine Stimme ist liebevoll, zärtlich. Ein neues Spiel.
Das ungezogene kleine Mädchen ist jetzt die reine Unschuld. «Ja, Daddy.»
Sie steht in der Wanne, das gehorsame Kind, die Arme an den Seiten, während er sie abreibt und untersucht. So genau betrachtet zu werden, erregt sie ebenso wie die Berührung.
«Du willst doch ganz sauber sein, nicht?»
Ja, es stimmt. Wasch die Sünde ab. Reinige meinen Körper. Mach mich wieder neu.
Er wäscht jetzt ihren Bauch, immer weiter nach unten.
«Gefällt dir das, wenn ich dich da wasche?» Er fängt an, sie mit seinen seifigen Fingern zu massieren. Grob. Genau wie sie es mag. «Und hier?» Er stößt kurz in ihre Vagina. Sie ist sehr erregt, aber wie ist es mit ihm? Er ist noch angezogen, sein Körper ganz dicht an der Wanne, so daß sie nicht sehen kann, ob er eine Erektion hat.
«Ja, ja.» Sie muß sich an der gefliesten Wand abstützen.
Unvermittelt hört er auf, dreht sie jäh herum. Fast wäre sie ausgerutscht, aber sie kann sich noch auffangen. Er scheint es gar nicht zu merken. Er fängt an, ihren Rücken und Hintern zu schrubben.
«Fester», befiehlt sie.
Das macht ihn wütend. Er will von seinem kleinen Mädchen nicht herumkommandiert werden. Mit einer Scheuerbürste bearbeitet er ihren Hintern.
Sie schreit auf, als er sie hart mit der Borstenseite schlägt. Einmal, zweimal –
Ja, bestraf mich. Mach, daß ich wieder gut bin. Ich will wieder gut sein.
Auf dem Teppich am Fußende des Bettes, Arme und Beine gespreizt, die Hände umklammern die Messingstange des Bettgestells. Sie ist nicht gefesselt, aber er hat befohlen, daß sie nicht loslassen darf. Sie spielt das willige Opfer – eine Rolle, die zu ihr paßt wie eine zweite Haut.
Inzwischen schmerzt und pocht ihr ganzer Körper vor Verlangen – Verlangen, Verlangen. Er zwingt sie, es immer wieder zu sagen: «Ich will dich. Ich will dich. Ich will dich.»
In seinem Lächeln liegt nichts Jungenhaftes mehr. Es ist verschlagen, amüsiert. Die Grenze zwischen Phantasie und Realität verschwimmt. Keine Täuschung mehr möglich. Er hat die geheimen Winkel ihres Denkens und Fühlens erobert, in Besitz genommen. Er schlägt sie auf die Brust. Sie empfindet den Schmerz kaum noch, als sie sich ihm entgegenbäumt, die Knöchel weiß, so fest umklammert sie die Stange.
Er schlägt sie wieder. «Bist du eine Hure?»
«Nein.» Den Aufschrei erzwingt er mit dem zweiten Schlag auf ihre Brust. Diesmal zuckt sie zusammen, aber sie ist dabei, sich im Schmerz zu verlieren.
«Bist du eine Hure?»
«Nein, nein.»
Wieder schlägt er sie. «Du lügst. Du lügst.»
Noch während in ihr Panik aufsteigt, daß er die Kontrolle verliert, verschließt heiseres Verlangen ihr die Kehle. Sie starrt zu ihm auf, die braunen Augen weit aufgerissen und feucht schimmernd vor Lust. Sie will ihn in sich haben.
Soll sie darum bitten? Fordern? Flehen? Sie hat ein wenig Angst. Sein Vergnügen daran, ihr Schmerzen zu bereiten, hat zugenommen. Sie sieht es in seinem Gesicht, seinen Augen. Wenn er zu heftig wird, muß sie die Sache beenden. Und die perfide, schreckliche Wahrheit ist, daß sie das gar nicht will.
Über seinen Knien. Das Gesicht nach unten auf dem Bett. Atemnot. Wachsender Schmerz, aber steigendes Verlangen. Unerträglich.
Etwas Weiches, Seidiges streift über ihren Hintern. Sie wendet den Kopf, kann es kurz sehen. Ein Schal. Ein weißer Seidenschal.
Erschrecktes Aufkeuchen. Bilder schießen ihr durch den Kopf – vier junge Frauen, ihre einst hübschen Gesichter brutal zugerichtet, ihre Körper gefesselt, vergewaltigt, verstümmelt. So gräßlich. So grauenhaft. Und doch – diese Faszination. Einem anderen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein. Gezwungen zu sein, jede Kontrolle aufzugeben. Jede Verantwortung.
Sie dreht den Kopf. Er lächelt, als ob er wüßte, was tief in ihr lauert.
«Du kannst mir vertrauen, Melanie. Und gleichzeitig deine Neugier befriedigen.»
Sie will widersprechen, aber die Worte bleiben ihr im Halse stecken.
Er lächelt sanft, während er ihr den Schal wie ein Geschenk darbietet.
Ihr Blick trifft seinen nur einen kurzen Moment. Aber er weiß, daß das neue Spiel eröffnet ist.
Ein schreckliches Dröhnen in ihrem Kopf. Die verdrehte Haltung ihres gefesselten Körpers wird unerträglich. Ihr Kiefer pocht; sie hat das Gefühl, als hätten sich sämtliche Zähne unter seinen brutalen Schlägen gelockert. Was noch schlimmer ist, er quält sie beharrlich bis an den Rand des Orgasmus mit seinen Händen, seinem Mund – aber nie mit seinem Penis.
Sie fühlt sich zutiefst erniedrigt. Und gedemütigt, weil sie selbst diese widerwärtige Behandlung akzeptiert, weil sie davor zurückschreckt, ihr ein Ende zu machen. Aber das muß sie jetzt. Sonst, das weiß sie, wird sie vollends den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, in den Abgrund stürzen.
«Bitte, bind mich los. Das tut weh.»
«Ich dachte, du wolltest ihre Schmerzen erleben, Melanie.»
Etwas in ihrer Brust zieht sich zusammen. Sie war sicher, daß er kooperieren würde.
«Das macht uns doch beide nicht an.» Diese Lüge spricht sie ganz sachlich aus.
Er lächelt. Er kennt die Wahrheit.
Keuchend und zitternd auf dem marokkanischen Teppich im Wohnzimmer, noch immer gefesselt, Knöchel und Handgelenke fast gefühllos, die Spannung im Rücken unerträglich. Ihre Haut ist rot und wund. Striemen. Entsetzliche Striemen zeichnen sich auf ihrem Körper ab.
«Sag es mir», flüstert er und läßt seine Finger über ihre blutunterlaufene Wange gleiten. «Willst du mich immer noch, Melanie? Sag die Wahrheit.»
Sie kann nicht antworten. Sie weiß nicht mehr, was wirklich ist. Sie ertrinkt in Verwirrung.
«Noch etwas Champagner?» fragt er fast im Plauderton.
Sie schüttelt den Kopf. Der Alkohol würde auf ihren blutigen Lippen brennen. Hysterie breitet sich zitternd auf ihrer Haut aus.
«Wie wär’s mit einer Pause?» sagt sie und zwingt sich zu einem Lächeln. «Mal ein Weilchen abkühlen? Wir haben noch gar nichts gegessen. Wir essen was und dann –»
Er achtet nicht auf sie.
Er kniet neben ihr, preßt ihr das Sektglas gegen die Lippen.
Sie will wieder den Kopf schütteln. «Bitte –»
Er packt sie fest im Nacken, schüttet ihr den Champagner in den Mund. Sie würgt, hustet, spuckt ihn aus. Jetzt ist sie wütend.
Er lächelt sie herzlich, liebevoll an, aber in seinen Augen liegt nichts. Wenn die Augen Spiegel der Seele sind, dann hat seine Seele ihn heute abend verlassen.
Er steht auf, geht zur Stereoanlage und sieht ihre CDs durch. Als er die CD findet, die er sucht, legt er sie auf. Er dreht sich zu ihr um, noch immer lächelnd, während die ersten Takte von Gershwins Rhapsody in Blue den Raum erfüllen.
«Die Musik hast du schon öfter gespielt, nicht wahr, Melanie? Wieso hat Romeo sie jedem seiner Opfer vorgespielt? Das hast du dich doch gefragt, oder?»
«Ja, das habe ich mich gefragt.» Ihre Stimme ist kaum noch ein Krächzen.
Er wechselt das Thema. «Sie haben alle seine dunkelsten Phantasien mit ihm geteilt. So willig, wie du es getan hast. Es hat sie angeturnt. Genau wie dich, Melanie.»
Was redet er da? Er kann nicht wissen, was diese Frauen mit dem Serienmörder erlebt haben, bevor er sie tötete. Er spielt noch immer mit ihr. Aber genug ist genug.
Erst in diesem Augenblick sieht sie, daß er durchsichtige, dünne Gummihandschuhe trägt. Wann hat er die angezogen? Sie war so weggetreten, daß er sie praktisch schon die ganze Zeit getragen haben kann.
«Nein», wimmert sie, klammert sich ans Leugnen wie an eine Rettungsleine.
Ich kenne diesen Mann. Ich vertraue ihm. Es ist ein Spiel. Bloß ein Spiel –
Er beugt sich so dicht zu ihr hinab, daß sie den Champagner in seinem Atem, seine Erregung riechen kann.
«O Romeo! Warum denn Romeo?» flüstert er und legt ihr dabei sacht eine Hand unter das Kinn. «Romeo ist hier, bei dir, Melanie.»
Der Todesstoß. Der letzte Schlag, der ihren Selbstbetrug entlarvt. Sie hat nichts mehr unter Kontrolle. Ein leises Stöhnen schierer Angst dringt aus ihrem Mund. Sie kann nicht atmen. Kaltes, nacktes Grauen – ein Blitzschlag, der sie durchbohrt.
Ihre Knie graben sich schmerzhaft in den Teppich. Er sitzt auf einem der Sofas. Mit der Hand umschließt er seinen Penis, während er ihren Kopf gegen seine Schenkel preßt. Sie ist zu schwach, um sich zu wehren. Es würde auch nichts nützen.
«Ich war ganz gerührt, als du mich im Fernsehen ‹Romeo› getauft hast. ‹Romeo. Ein brutaler Psychopath, der seine Opfer umwirbt und ihre Herzen stiehlt.›»
Er hält inne, lacht. Ein Lachen ohne jeden Humor.
«Im Fernsehen siehst du toll aus, Melanie. Ich habe mir keinen deiner Auftritte in Cutting Edge entgehen lassen.»
Er betrachtet sie nachdenklich. «Was würdest du diesen neugierigen Gaffern wohl jetzt über mich erzählen? Das wäre doch eine echte Sensation, Melanie. Ein Zeugenbericht aus erster Hand. ‹Meine Nacht mit Romeo.› Ich wette, die Einschaltquoten wären astronomisch.»
Er streichelt sich selbst wie in Trance. Sie bleibt ganz ruhig. Will ihn weiter reden lassen. Will mehr hören, mit dem sie arbeiten kann.
«Deine Theorie über die Herzen meiner Opfer fand ich richtig gut. Daß ich sie mitnehme, um die Frauen in meinem perversen Geist weiter am Leben zu halten. Bis sie anfangen, zu verwesen. Bis ich gezwungen bin, ein stinkiges altes Herz gegen ein schönes frisches einzutauschen.» Er grinst. «Das war gut, Melanie. Totaler Quatsch, aber sehr guter Quatsch.»
«Im Grunde geht es um Verletzungen», sagt sie leise. «Verletzungen, die in Wut umschlagen und in das verzweifelte Verlangen danach, sich mächtig zu fühlen – die Situation zu beherrschen.» Sie weiß, daß sie jetzt nicht nur ihn analysiert.
«Aber dann hast du neulich abend diesen ganzen abgedroschenen Scheiß von wegen Ödipuskomplex und so weiter erzählt. Absolut billig, Melanie.» Er lächelt zynisch, aber als sie den Kopf dreht, um sein Gesicht zu sehen, weiß sie, daß er in einen Zustand gleitet, wo er unerreichbar ist.
«Kinder sind verletzlich. Viele Menschen können ihnen weh tun», sagt sie. «Und dieser Schmerz staut sich auf –»
Er hat sich neben sie auf den Teppich gleiten lassen. Geistesabwesend stochert er mit den Fingern zwischen ihren Schenkeln. Sie versucht, keine körperliche Reaktion zu zeigen.
Er preßt die Lippen auf ihr feuchtes Haar. Seine Finger finden den Weg in sie hinein. Entsetzt und verzweifelt wird ihr klar, daß sie noch immer naß ist. Er lächelt sie an. Als hätte er es erwartet.
«Du bist genau wie die anderen Schlampen.»
«Nein. Nein, das bin ich nicht.» Sie kann den flehentlichen Tonfall in ihrer Stimme hören. Das ist nicht gut, aber sie kann nichts dagegen machen. «Du kennst mich. Du empfindest … etwas für mich. Das willst du mir nicht antun … nicht mir.»
Er stößt sie abrupt weg. Schweißnaß lehnt er sich gegen das Bein des Sofas und lächelt zu ihr herab. Einen Augenblick denkt sie, daß er gekommen ist. Ein lautloser, selbstgemachter Orgasmus. Sie denkt, daß ihr ein Aufschub gewährt wird.
Er packt sie am Kinn und reißt ihren Kopf zu sich herum. «Sag es. Romeo. Ich will es aus deinem Mund hören, du Nutte.»
Sie sieht die Wut in seinen Augen aufflammen. Sie findet keinen Zugang zu ihm. Panik durchflutet sie. Vor Schmerz und Angst ist sie halb wahnsinnig. Aber sie darf nicht aufgeben. Sie kann einen Weg finden. Sie hat immer einen gefunden. Jetzt muß sie es.
«Ich habe mich sehr gut amüsiert», sagt sie ruhig.
«Ich weiß. Das haben sie alle.» Das sagt er so beiläufig, daß ein Schauder ihren nackten, geschundenen Körper ergreift. «Eine Zeitlang. Dann wollten sie aufhören. Genau wie du. Spielverderber. Wer A sagt, muß auch B sagen.»
Ein Gefühl von Resignation erfaßt sie, aber sie reißt sich zusammen. Ist es ihr verbissener Überlebenswille oder das Kräftemessen ihrer beider Willen, das sie zwingt, weiterzumachen? Nicht mal das weiß sie mehr.
«Du bist müde», sagt sie leise, obwohl doch sie von physischer Erschöpfung gezeichnet ist. «Jedesmal denkst du ans Aufhören. Du willst aufhören. Hinterher verachtest du dich selbst.»
Er ist amüsiert. «Wir haben ein Rendezvous, Frau Doktor, keinen Termin.»
«Mir liegt etwas an dir. Ich weiß, wie sehr du leidest.»
Er lacht leise. «Du hältst dich für so clever, so schlau, so scharfsinnig. Du denkst, du kennst die Wahrheit über mich. Einen Dreck weißt du, du Luder.»
Er rückt näher an sie heran. Sein Schwanz drückt gegen ihren Schenkel. Hart, kalt, feucht. Er lehnt sich zurück gegen das Sofa, schließt die Augen, summt die Musik mit.
«Ist das nicht romantisch?» säuselt er. Der Hohn eines Irren.
Ihr ist übel, vor Entsetzen kommt ihr der Champagner hoch. «Mir ist schlecht.»
Er überhört sie. Geht weg. Kommt summend zurück. Liebkost ihre Schenkel. Streichelt ihr Haar.
Sie riecht etwas Fauliges. Widerwärtiges. Das Echo seiner Stimme in ihrem Kopf. Bis sie anfangen, zu verwesen. Bis ich gezwungen bin, ein stinkiges altes Herz gegen ein schönes frisches einzutauschen …
«Bitte. Mir ist wirklich schlecht –» Ihr ganzer Körper wird von heftigem Zittern geschüttelt.
«Armes Baby», sagt er tröstend.
«O Gott –» Sie erbricht sich auf den Teppich. Das Würgen will kein Ende nehmen.
Fürchterliches Schluchzen. Er wischt sie mit einem Schwamm ab. Muß ihn aus der Küche geholt haben. Sie ist so weggetreten, sie hat nicht mal gemerkt, daß er draußen war.
«Sag es, Melanie», drängt er sanft, während er das Erbrochene von ihr abwischt.
Tränen strömen ihr übers Gesicht. «Tu’s nicht. Laß mich dir helfen. Ich kann dir helfen.»
«Du hilfst mir jetzt schon, Melanie.»
Sie spürt, wie es passiert. Etwas Dunkles senkt sich herab. Sie sucht nach etwas in sich, an dem sie sich festhalten kann, aber da ist nichts.
Er steht vor ihr. Ein Messer in seiner behandschuhten Hand. Auf der silbrigen Klinge spiegeln sich schimmernd die Chrysanthemen in der Bronzevase auf dem Couchtisch.
Er tritt näher. Ihre Augen gleiten von dem Messer zu seinem Penis. Sie kann die Augen nicht davon abwenden.
«Willst du ihn?»
Ihr Herz rast. Ihre Haut prickelt. Zu ihrem eigenen Entsetzen und Ekel ist ihr ganzer Körper wie elektrisiert. Sie hat sich verloren. In ihm verloren.
Das Zimmer ist dunkel. Sie kann ihn nicht sehen. Sie kann ihn nur spüren. Sein Penis pulsiert an ihrer Hüfte. Die geschliffene Messerspitze auf ihrer Brust.
«Sag es. Sag: ‹Ich will dich, Romeo.›» Sein Arm liegt um ihre Taille, wiegt sie zu den Klängen von Rhapsody in Blue.
Selbst mit dem Tod vor Augen bleibt sie die Voyeurin. Hat sie nicht schon seit einer Ewigkeit mit dem Tod getanzt?
«Sag es, Melanie. Sag es, und du wirst erlöst», raunt er lockend.
Ja, erlöst. Nicht aufgeben, nicht wirklich, sondern alles zurückfordern, was ich verloren habe.
«Ich will dich, Romeo.» Kaum hat sie ihr letztes Geständnis gehaucht, fällt sie tief nach innen. Nichts anderes existiert mehr als dieser letzte Akt des Loslassens, die ungeheure Erregung und das paradoxe Gefühl von Macht, das sie verzehrt.
Die Musik erreicht ein Crescendo, als das Messer herabstößt. Melanie kann den Schrei nicht hören. Sie ertrinkt darin.
Er starrt auf sie herab und lächelt ehrfürchtig. Er kommt mit einem heftigen, heißen Strahl, als er in sie eindringt, die Explosion seines Samens und ihr Blut auf immer in seiner Psyche verschmolzen. In einem Herzschlag. Melanies letztem.
1
Romeos Zwang zu töten, bevor er vergewaltigen kann, ist ein Schlüsselelement seines Rituals. Denn wenn er zum Orgasmus kommt, verliert er – wie wir alle – die Kontrolle und zeigt seine Verletzlichkeit … Und er kann nicht zulassen, daß seine Opfer Zeugen dessen werden, weil er Angst hat, daß sie es gegen ihn verwenden würden. Nur tot stellen diese Frauen keine Bedrohung dar.
Dr. Melanie Rosen in Cutting Edge
Das letzte Mal, daß Sarah Rosen mit ihrer Schwester Melanie sprach, war früh am Morgen jenes Tages, an dem Melanie ermordet wurde. Normalerweise wäre Sarah stinksauer gewesen, noch vor dem Weckerklingeln geweckt zu werden, aber sie hatte einen so fürchterlichen Alptraum gehabt – eine riesige, drohende Hand mit dicken, haarigen Fingern, die sich um ihren Hals legte, eine Stimme im Dunkeln, die heiser «Sarah, Sarah» rief –, daß der Anruf im Grunde eine Erlösung war. Bis sie hörte, wer am anderen Ende der Leitung war.
«Ich hätte mir denken können, daß du es bist», sagte Sarah benommen und schob sich eine Strähne ihres kurzgeschnittenen, borstigen kastanienbraunen Haars aus der Stirn. Sie tastete auf dem Nachttisch nach ihrer Brille, die irgendwo mitten in dem Wirrwarr von Illustrierten, Zeitungen, Wecker, Büchern und einem halbvollen Glas Weißwein liegen mußte, wobei sie letzteres versehentlich umstieß.
Ungeachtet der Pfütze setzte sie ihre Suche fort. Die goldgeränderte Brille, deren John-Lennon-Rahmen leicht verbogen war, befand sich wundersamerweise unter ihrem Kopfkissen, gemeinsam mit einem leeren Dessertteller, von dem sie ihren Mitternachtsimbiß gegessen hatte. Als sie die Brille hervorzog, fiel der Porzellanteller auf den Holzboden und zersprang.
«Was war das denn?» fragte Melanie.
«Nichts. Ein Teller», sagte Sarah und setzte die Brille auf. Immer wenn Sarah es mit schwierigen Leuten zu tun hatte oder, um fair zu sein, mit Leuten, deren Art ihr Schwierigkeiten bereitete, fühlte sie sich sicherer, wenn sie klar sehen konnte.
«Du bist und bleibst eine Schlampe», sagte Melanie tadelnd.
«Ich funktioniere nun mal am besten im Chaos.» Tatsächlich sah ihr Schlafzimmer aus wie nach einem Einbruch: Sämtliche Kommodenschubladen standen offen, Strickjacken, Socken und Unterwäsche hingen schichtweise heraus, als ob ein Einbrecher hektisch nach versteckten Wertgegenständen gesucht hätte. Der einzige Sessel, ein alter hölzerner Schaukelstuhl für die Veranda, den der Vormieter zurückgelassen hatte, verschwand fast unter den vielen Kleidungsstücken, die sich darauf angesammelt hatten. Die Unordnung wurde noch verstärkt durch die Kartons, die an der gegenüberliegenden Wand gestapelt waren und die sie seit ihrem Einzug in diese Zweizimmer-Parterre-Wohnung in San Franciscos Mission District vor fast einem Jahr nicht mehr angerührt hatte.
Melanie war über den Umzug ihrer Schwester entsetzt gewesen. Im Mission District waren Schießereien auf offener Straße fast an der Tagesordnung. Sie hatte Sarah ein masochistisch fahrlässiges Verhalten vorgeworfen. In Wahrheit war Sarah sehr ängstlich, doch wenn sie sich darüber Gedanken machen mußte, was draußen vor sich ging, hatte sie keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, was in ihr selbst vor sich ging, was sie noch weit mehr ängstigte.
«Sarah, du kannst dein Leben nicht in Ordnung bringen, wenn du keine Ordnung in dein Leben bringst», sagte Melanie schneidend.
«Jahrelanges Psychologiestudium, und alles, was du mir zu bieten hast, ist eine Moralpredigt?» entgegnete Sarah trocken. «Aber es ist ja noch früh am Tag, Melanie. Vielleicht bist du ja bloß noch nicht richtig in Schwung.»
«Es ist fast sieben. Mußt du nicht um neun im Büro sein?»
«Ja. Und das bedeutet, daß ich noch eine gute halbe Stunde hätte schlafen können.» Sie würde ihrer Schwester nicht dafür danken, daß sie sie aus dem Alptraum gerissen hatte.
«Ich habe nicht viel Zeit», sagte Melanie energisch. «Mein erster Patient kommt in zehn Minuten.»
Das war Sarah nur recht, denn sie konnte ihre große Schwester nur in ganz kleinen Portionen verkraften. «Was willst du?»
«Das weißt du doch, Sarah. Ich will, daß du Dad besuchst.»
Sarah ließ sich aufs Kissen zurückfallen und zog ihre karierte Bettdecke bis unters Kinn. Ein Schuh, der sich in der Tagesdecke versteckt hatte, fiel polternd zu Boden. «Es ist noch zu früh am Tag.»
«Eigentlich wollte ich dich heute abend einfach zu ihm mitnehmen, aber ich bin verabredet. Laß uns morgen über den Mittag hinfahren. Ich komme bei dir im Büro vorbei und hole dich ab.»
«Nein», sagte Sarah. «Ich werde allein hinfahren.» Es fiel ihr schon schwer genug, ihren Vater im Pflegeheim zu besuchen, aber ein regelrechtes Familientreffen würde das Ganze für sie noch schlimmer machen.
«Wann denn, Sarah? Du warst schon seit Wochen nicht mehr da», nervte Melanie. «Neulich abend hat er nur davon geredet, daß er dich überhaupt nicht mehr sieht. Daß du ihn vergessen hast.»
«Red mir keine Schuldgefühle ein, Mellie.» Sarah wußte, wie sehr es ihre Schwester ärgerte, wenn sie anders genannt wurde als Melanie. Melanie, nach der berühmten österreichischen Psychoanalytikerin Melanie Klein. Den Namen hatte ihr Vater ausgesucht. Natürlich.
«Laß gut sein, Sarah.»
«Du bist die liebe Tochter, ich bin der letzte Dreck. Das wissen wir doch.»
«Ich will dir keine Schuldgefühle einreden. Du hast ein schlechtes Gewissen und läßt es an mir aus. Dafür habe ich keine Zeit. Wann besuchst du ihn?»
«Samstag.» Sarah hoffte, daß sie ihren guten Freund Bernie überreden konnte, mitzukommen. Zur moralischen Unterstützung. Sie seufzte. «So. Bist du jetzt glücklich?»
«Glücklich? Nein, Sarah, ich bin nicht glücklich. Wie soll ich glücklich sein, wenn mein Vater, der einmal einer der angesehensten Psychiater der Welt war, meint, ich wäre fünf Jahre alt, und möchte, daß ich mich auf seinen Schoß setze, damit er mich mit einem Wiegenlied in den Schlaf singen kann?»
Sarah zuckte zusammen. Aber als sie sprach, war ihr Tonfall bewußt kühl und gleichgültig. «Der Mann hat Alzheimer. Hast du mir nicht immer Vorträge darüber gehalten, daß man sich der Realität stellen muß? Ich glaube sogar, du hast das von Dad übernommen. Er hat ja auch nicht mehr viel Verwendung dafür.»
«Empfindest du denn gar nichts für deinen Vater? Himmel, Sarah, du bist kein Kind mehr. Du kannst nicht alles darauf abwälzen, daß ich Daddys Liebling war.»
Sarah schob ein Buch beiseite, damit sie einen Blick auf ihren Wecker werfen konnte. «Es ist drei vor sieben, Melanie. Du willst doch deinen Patienten nicht warten lassen.»
«Ich rufe dich morgen an», sagte Melanie eher resigniert als verärgert. «Nachdem ich Dad besucht habe. Ich kann dir dann aber nur ganz kurz Bericht erstatten, weil ich um zwei einen Termin mit Feldman habe.»
«Bestell ihm schöne Grüße», sagte Sarah trocken.
«Dad oder Feldman?»
«Das mußt du selbst rausfinden, Schwesterlein. Du bist schließlich die Psychotante.»
Es war fast Mittag an diesem letzten Donnerstag im Oktober. Ein Nieselregen setzte ein, als Sarah sich nach ihrem Vormittagstermin auf den Weg in ihr Büro machte. Es hatte seit Wochen nicht geregnet. Der Regen schlug auf ihre Stimmung.
Ein Bild schoß ihr durch den Kopf. Sie sah sich selbst als aufgeschossenes, schlaksiges Mädchen – gerade dreizehn geworden –, wie sie am Fenster ihres Zimmers stand, kurz nachdem sie in das weitläufige viktorianische Haus an der Scott Street gezogen waren. Sie preßte das tränenüberströmte Gesicht gegen die kühle Glasscheibe und starrte in den Regen hinaus auf die Bucht mit der Golden Gate Bridge, die sich undeutlich im Nebel abzeichnete.
Damals hatte sie das Haus in Pacific Heights gehaßt. Und das tat sie noch immer. Das Haus ihres Vaters. Jetzt das ihrer Schwester. Es war Sarah nur recht. Sie wollte es nicht. Sie hatte nur schlimme, traurige Erinnerungen daran. Eigentlich war es paradox, denn sie waren von Mill Valley dorthin gezogen, um anderen schlimmen, traurigen Erinnerungen zu entfliehen. Manchen Dingen konnte man nun mal nicht entfliehen. Außer, wenn man sie verdrängte. Sarah beherrschte das Vergessen wie eine regelrechte Kunst. Meistens.
Heute wollte es nicht klappen, wahrscheinlich weil sie sich so bedrückt fühlte. Ständig blitzten Erinnerungen auf, wie gelbe Warnlampen. Sarah gab dem Regen die Schuld an den beunruhigenden Bildern. An dem blöden Alptraum. An dem Telefonanruf ihrer Schwester heute morgen. War Melanie wirklich ihrem Vater im Pflegeheim auf den Schoß geklettert? Sarah schloß die Augen, als sie spürte, wie ein unangenehm heißes Gefühl sie durchlief, trotz des feuchten Windes, der böig auffrischte, während der Nieselregen dichter wurde.
Eine Frau, die ihren Wagen vor der Davies Hall in eine enge Parklücke manövrierte, kam versehentlich mit dem Ellbogen an die Hupe. Sarah riß die Augen auf.
Eine Möwe, die etwas zu weit von der Bucht abgekommen war, schwebte über ihr, die Flügel weit ausgebreitet, durchschnitt den dunkler werdenden Himmel. Fliegen, fliegen, weit weg.
Völlig durchnäßt und durchgefroren erreichte sie das Amt des Sozialdienstes für Rehabilitation, das in einem architektonisch nichtssagenden Wolkenkratzer an der Ecke Van Ness Avenue/Hayes Street untergebracht war.
Sie arbeitete seit sechs Jahren dort, seit sie an der San Francisco State University ihren Abschluß als Sozialarbeiterin gemacht hatte. Die Bezahlung war lächerlich – weit unter dem, was sie, eine Rosen, nach Ansicht ihres Vaters und ihrer Schwester hätte verdienen können –, aber Sarah hatte nicht den teuren Lebensstil der beiden, geschweige denn deren Hang zum Leistungsdenken. Jedenfalls machte ihr die Arbeit Spaß, wenn bloß der Papierkram nicht gewesen wäre. Sie fand ihre Tätigkeit sinnvoll. Sie hatte das Gefühl, gebraucht zu werden. Und sie mochte die meisten ihrer Schützlinge, derzeit vierzig Körperbehinderte oder körperlich Benachteiligte, wie es politisch korrekt hieß. Der Mehrzahl von ihnen war es völlig egal, wie man sie nannte. Sie wollten bloß ihr Leben wieder in den Griff bekommen, eine Arbeit finden, die sie erlernen konnten, um damit wieder den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können, und ansonsten ihre Ruhe haben. Sarah erging es ganz ähnlich.
Als sie die trostlose Eingangshalle des Bürogebäudes betrat, knurrte ihr Magen. Es passierte oft, daß sie völlig vergaß, etwas zu essen. Sie machte auf dem Absatz kehrt und steuerte den Coffee Shop gleich um die Ecke an, um sich etwas zum Mittagessen zu holen.
Vorne auf der Theke lagen fertig zubereitete und verpackte Sandwiches aus. Sie kaufte ein Putensandwich und warf es in ihre Umhängetasche, um es mit ins Büro zu nehmen. Als sie das Wechselgeld einsteckte, entdeckte sie ihren Kollegen und besten Freund Bernie Grossman. Bernie hatte seinen Rollstuhl an einen der grauen Tische hinten im Coffee Shop gerollt und verschlang eine Schüssel Chili con carne.
Als sie näher kam, blickte er auf. «Du bist naß», sagte er.
Bernie, Anfang Vierzig, hatte ein Gesicht, bei dem Sarah immer an einen Cherub denken mußte. «Es regnet.»
Er tupfte ihr das feuchte Gesicht mit seiner Serviette ab.
Sie schob seine Hand weg und setzte sich auf den Stuhl neben ihm. «Heb sie dir auf. Du brauchst sie dringender als ich. Meine Güte, du hast überhaupt keine Manieren, Bernie!» Sein dichter grauer Bart war mit Chili bekleckert.
Er grinste. «Weiß ich. Das macht Tony völlig wahnsinnig. Er ist so etepetete.»
Sarah fischte ihr Sandwich aus der Umhängetasche, stockte dann aber, um ihren Freund argwöhnisch zu mustern, bevor sie es auspackte. «Hast du ‹Tony› gesagt?»
Bernie wischte sich die Essensreste vom Jeanshemd, dessen Knöpfe sich über seinem Bauch spannten. «Habe ich dir noch nichts von Tony erzählt?»
Sarah packte ihr Sandwich aus und untersuchte es genauer. Scheiße. Auf dem Etikett stand Putenfleisch mit Mayonnaise, aber das Roggenbrot war mit Senf beschmiert. Egal, so viel Hunger hatte sie nun auch wieder nicht.
«Bernie, du hast gesagt, Tony wäre ein verdammter Idiot und der letzte, mit dem du dich je einlassen würdest.»
«Okay, man kann ja seine Meinung auch einmal ändern. Jedenfalls, als ich gestern mit einer widerlichen Magenverstimmung daniederlag, was meinst du, wer da plötzlich auftauchte, um sich um mich zu kümmern?»
«Florence Nightingale höchstpersönlich?»
«Tony ist zufällig ein staatlich geprüfter Krankenpfleger.»
«Der seinen Beruf nicht mehr ausüben darf, weil er seine Finger zu tief ins Medikamentenschränkchen gesteckt hat. Hör doch auf, Bernie. Du kannst nun wirklich keinen Typen gebrauchen, der mit Drogen rummacht.»
Niemand wußte das besser als Sarah. Außer vielleicht Bernie.
Bernie Grossman war einer von Sarahs ersten Fällen gewesen. Ein studierter, homosexueller, jüdischer Drogenabhängiger, der vor einer Schwulenbar auf der Castro Street so brutal zusammengeschlagen worden war, daß er mit mehreren gebrochenen Rückenwirbeln in der Notaufnahme landete. Nach sechsmonatiger physischer Rehabilitation, verbunden mit einem zwei Monate dauernden Entzug, war Bernie in ihre Abteilung gekommen, clean, an den Rollstuhl gefesselt, noch immer schwul – und in der Hoffnung, daß er vielleicht im Alter von fünfunddreißig Jahren endlich der Mensch werden könnte, zu dem ihn seine eingewanderten Eltern, die in Pasadena lebten, erzogen hatten.
Gut zwei Jahre später, mit einer ständig nörgelnden Sarah im Rücken, schaffte er seinen Abschluß als Sozialarbeiter, und dank Sarahs Fürsprache wurde er auf Probe und unter ihrer Aufsicht in der Rehabilitationsabteilung eingestellt. Weitere sechs Monate später war er noch immer clean, legte seine letzte Prüfung ab und wurde fest angestellt. Das war nun mittlerweile vier Jahre her, und er hatte sich in dieser Zeit zu einem erfolgreichen Mitarbeiter gemausert.
«Wie soll ich mich denn von solchen Leuten fernhalten, Sarah?» fragte Bernie, nachdem er einen weiteren Löffel Chili gegessen hatte. «Fast all meine Fälle sind Exdrogenabhängige.»
«Ich rede nicht von deinen Klienten», sagte Sarah spitz.
«Tony ist seit sieben Monaten sauber, Süße. Ich schwöre dir bei meiner Ehre, sobald er irgendwas anderes schluckt als Aspirin, befördere ich ihn sofort mit einem Tritt vor die Tür.» Er grinste. «Natürlich im übertragenen Sinne. Jedenfalls, liebste Sarah, bin ich noch immer kein Mönch, Gott sei Dank, aber eben auch kein Idiot. Wie mein guter alter Dad immer gesagt hat, manche von uns Trotteln müssen erst ordentlich auf die Schnauze fallen, bevor sie was kapieren.»
«Apropos gute alte Dads …»
Bernies verschwörerisches Grinsen ließ Vorderzähne sehen, die auch nach dreijähriger zahnorthopädischer Behandlung noch nicht gerade waren. «Du haßt deinen Dad.»
«Habe ich tatsächlich gesagt, daß ich ihn hasse?»
Sein Grinsen wurde noch breiter. «Ja.»
Sarah seufzte. «Man sagt nicht immer genau das, was man denkt.»
«Oder nicht alles, was man denkt», fügte Bernie hinzu.
«Was soll das? Willst du mich heute völlig fertigmachen?»
«Du bist aber auch empfindlich», erwiderte er, fuhr ihr aber gleichzeitig liebevoll mit der Hand durch das kurze feuchte Haar. «Erzähl Onkel Bernie, was los ist.»
«Also, meine Schwester liegt mir in den Ohren, daß ich meinen Dad besuchen soll. Er hat nach mir gefragt.»
Bernie strich Butter auf eine Scheibe Brot und tunkte sie in sein Chili. «Letztes Mal, als du bei ihm warst, hat er dich doch nicht mal erkannt.»
«Hat er auch nicht. Aber hin und wieder gibt es lichte Momente. Manchmal ist er erstaunlich klar.» Sie seufzte. «Ich weiß nicht, was schlimmer ist.» Bekümmert dachte sie an ihren Besuch vor einem Monat, als er sich nur allzu gut an sie erinnert hatte.
An jenem Nachmittag war sie quälende dreißig Minuten bei ihrem Vater gewesen und hatte in eisigem Schweigen seine verbalen Attacken über sich ergehen lassen. Er hatte sie als inkompetent bezeichnet, als faul, unaufrichtig und – seltsamerweise – als moralisierend. Diese Tirade war nicht durch seine Krankheit zu entschuldigen, denn die gleichen Vorwürfe hatte Sarah auch in den Jahren, als er bei absolut klarem Verstand war, oft zu hören bekommen.
Als sie noch jünger war und ihr Vater in Topform, hatte er sie gelegentlich heruntergeputzt, um ihr schließlich den Gnadenstoß zu verpassen. Er hatte ihr einen «Cinderella-Komplex» unterstellt und verlangt, daß sie eine Psychoanalyse machen sollte, um mit ihren neurotischen Minderwertigkeitsgefühlen und ihrer Paranoia fertig zu werden. Sarah, nie um eine Antwort verlegen, hatte gekontert, wenn sie Cinderella wäre, wo zum Teufel dann der Märchenprinz steckte. Sie war der festen Überzeugung, daß die meisten Männer in ihrer Umgebung, wenn sie keine Schweine waren, es höchstens zum Frosch gebracht hatten. Auch wenn sie sich die Lippen wund küßte, sie würde keinen von ihnen in einen Prinzen verwandeln können.
«Im Ernst, Sarah, willst du ihn wirklich besuchen?» Bernie bedachte sie mit einem seiner unnachahmlichen Ich-durchschaue-dich-Blicke, bei denen Sarah immer unbehaglich zumute wurde. Obgleich sie Bernie als ihren besten Freund betrachtete und ihm mehr über sich erzählt hatte als je einem anderen Menschen, war sie doch auch ihm gegenüber zurückhaltend. Es gab vieles, über das sie mit niemandem sprechen würde.
«Ich habe Melanie versprochen, daß ich Samstag hinfahre.»
Bernie schüttelte den Kopf, brach ein Stück von dem durchweichten Brot ab und stopfte es sich in den Mund. «Laß dich doch nicht immer von den beiden rumkommandieren, Süße. Verdammt, du bist zwei- unddreißig Jahre alt. Und ich kann dir sagen, was dein Problem ist. Sarah, wann hast du das letzte Mal eine gute Nummer geschoben?»
«Sex wird überbewertet.»
Bernie grinste. «Nein, wird er nicht. Komm schon, plaudern wir ein bißchen aus dem Nähkästchen. Willst du wissen, wann ich das letzte Mal eine Nummer geschoben habe?»
«Nein. Ich will wissen, ob du am Samstag mit zu meinem Vater kommst.»
«Meinetwegen, schon gut. Ich komme mit. Darf ich dir jetzt die köstlichen Einzelheiten meiner gestrigen amourösen Eskapade mit Tony schildern? Er ist nämlich seit Monaten der erste Lover, bei dem ich nicht die Augen schließen und mich netten, dreckigen Phantasien hingeben muß, um wirklich meinen Spaß zu haben.»
Gegen neun Uhr abends stand Sarah vor dem offenen Kühlschrank in ihrer kleinen Küche und nahm sich endlich die Zeit, über ihr Abendessen nachzudenken. Die Auswahl war nicht gerade berauschend: einige Pizzareste, eine Scheibe Käse, von der sie zuvor den schimmeligen Rand würde abschneiden müssen, ein halbvoller Plastikteller mit Chop-suey vom Chinesen, das sie am meisten reizte, bis ihr einfiel, daß es schon gut zwei Wochen alt sein mußte.
Zum erstenmal fragte sich Sarah, mit wem sich ihre Schwester heute abend traf. Ein Neuer? Hatte Melanie am Telefon seinen Namen genannt? Sie glaubte nicht. Melanie erzählte ihr ohnehin nicht viel von ihrem Privatleben. Sie Melanie allerdings auch nicht. Zugegeben, allzuviel hätte sie auch gar nicht zu erzählen gehabt. Doch Melanie wäre die letzte, der sie sich anvertrauen würde. Sie waren sich nie sehr nah gewesen, obwohl Melanie in den schwierigen Zeiten für sie dagewesen war. Aber eher als Psychiaterin denn als Schwester.
Sarah wollte weder über Melanie noch über ihr eigenes klägliches gesellschaftliches Leben nachdenken und konzentrierte sich wieder auf das dringliche Problem. Was sollte sie essen? Sie entschied sich für ein Stück Pizza und wärmte es rasch in der Mikrowelle auf. Dadurch wurde der Rand weich und matschig, aber die Pizza hatte ohnehin nicht besonders gut geschmeckt.
Nachdem sie ihre Pizza gegessen hatte, grübelte Sarah darüber nach, ob sie das schmutzige Geschirr der Woche, das sich im Spülbecken türmte, in Angriff nehmen, eine Freundin anrufen, sich einen Spätfilm reinziehen oder ein heißes Bad nehmen und früh zu Bett gehen sollte.
Eine Viertelstunde später ließ sie sich in ihre altmodische Badewanne mit den geschwungenen Füßen gleiten. Mit ihren einszweiundsiebzig paßte sie nicht ganz rein, also ließ sie die Beine über den Rand baumeln.
Sarah betrachtete ihren Körper nur selten, aber als sie sich so in der Wanne aalte, unterzog sie sich selbst einer genauen Inspektion. Sie war etwas zu dünn, zugegeben, aber sie wirkte dennoch gelenkig und athletisch. Eigenartig, denn abgesehen von langen Fußmärschen, die sie häufig absolvierte, hatte sie nie viel Sport getrieben. Hatte wohl mit ihrer Angst vor Wettkämpfen zu tun, wie ihr Vater diagnostiziert hatte.
Natürlich war ihre große Schwester Melanie während ihrer gesamten Schulzeit eine Sportskanone gewesen – Captain des Hockeyteams in der High-School, drittbeste Tennisspielerin in der College-Mannschaft. Seit kurzem spielte Melanie leidenschaftlich Squash, und ihr Lieblingsgegner war niemand anderes als ihr Exgatte und Psychiaterkollege Bill Dennison. Obwohl sie vor fast zwei Jahren geschieden worden waren, hatten Melanie und Bill noch immer engen beruflichen Kontakt und übernahmen füreinander die Patienten, wenn einer von beiden in Urlaub oder auf einer Tagung war. Und offenbar machte es ihnen noch immer Spaß, gegeneinander anzutreten. Zumindest auf dem Squashcourt.
Einmal hatte Sarah ihnen zugesehen – sie und Melanie hatten anschließend eine ihrer seltenen Verabredungen zum Abendessen –, und während sie Melanie in Aktion sah, drängte sich Sarah der Gedanke auf, daß in der Art und Weise, wie ihre Schwester sich gänzlich dem Spiel hingab, etwas beunruhigend Wildes und Erotisches lag. Sie machte Kleinholz aus Bill und schien es zu genießen, ihn fertigzumachen. Sarah überlegte, ob sie auf jeden Widersacher so reagierte oder ob sie noch immer ungelöste Probleme mit ihrem Exmann verarbeitete. Schließlich wußte Sarah nur allzu gut, daß ihre Schwester nicht die einzige war, die mit Dr. Bill Dennison noch einiges zu klären hatte.
Sarah ließ die Hände über die Rundungen ihrer Hüften gleiten und streckte dabei nacheinander beide Beine hoch in die Luft, wie eine Ballettänzerin. Schöne Beine. Die Beine ihrer Mutter.
Ihre Mutter hatte davon geträumt, Tänzerin zu werden, und diesen Traum dann auf ihre jüngere Tochter übertragen. Sarah lachte wehmütig auf und wackelte mit den Zehen. Schöne Beine, aber zwei linke Füße. Nach sechs Unterrichtsstunden hatte die Ballettlehrerin ihrer Mutter nahegelegt, daß die Tochter es doch vielleicht besser mit Steptanz versuchen sollte. Sarah quälte sich drei Monate lang durch die Tanzstunden, bevor ihre Mutter schließlich einsah, daß sie absolut kein Talent besaß, und sie aufhören ließ. Ganz gegen den Willen ihres Vaters. Er war der Ansicht, daß seine jüngere Tochter Durchhaltevermögen entwickeln müßte und nicht so leicht aufgeben dürfte. Ihre Eltern hatten tatsächlich Krach deswegen. Es war der erste, den Sarah je miterlebte.
Und der letzte.
Sie wusch sich rasch und gründlich, stieg aus der Wanne, trocknete sich ab, schlüpfte in einen weißen, übergroßen Frotteebademantel und tappte ins Wohnzimmer. Nach einem heißen Bad fühlte sie sich normalerweise wohlig müde, doch heute abend war sie nervös und unruhig. Sie ließ sich aufs Sofa plumpsen und wühlte in den Kissen herum, bis sie die Fernbedienung fand. Sie schaltete den Fernseher ein. Der Empfang war miserabel. Schattenbilder, Schneegestöber. Wahrscheinlich gab die Bildröhre allmählich den Geist auf. Irgendwann in nächster Zeit würde sie sich dazu aufraffen müssen, ein neues Gerät zu kaufen.
Träge und desinteressiert schaltete sie die Kanäle rauf und runter. Bis sie eine vertraute Stimme zusammenfahren ließ.
«Denn wenn er zum Orgasmus kommt, verliert er – wie wir alle – die Kontrolle und zeigt seine Verletzlichkeit.»
Sarah fummelte an der Fernbedienung herum und versuchte, das Bild heller zu stellen. Mit gegenteiligem Effekt. Mittlerweile zeigte die Kamera nicht mehr ihre Schwester, sondern die Großaufnahme einer dunkelhäutigen Frau mit kurzgeschnittenem Haar und riesigen Kreolenohrringen.
«Ich bin Emma Margolis, und Sie sehen gerade Cutting Edge. Nach einer kurzen Pause wird die bekannte Psychiaterin Dr. Melanie Rosen weiter mit den beiden Detectives vom Morddezernat, John Allegro und Michael Wagner, über den Serienkiller Romeo diskutieren, der ‹die Herzen der Frauen stiehlt›. Das Gespräch wurde heute nachmittag live in den Räumen des Morddezernats der Polizei von San Francisco aufgezeichnet.»
Fast hätte Sarah umgeschaltet. Obwohl sie gehört hatte, daß Melanie mehrfach in dem abendlichen Nachrichtenmagazin Cutting Edge interviewt worden war, hatte sie es geflissentlich vermieden, sich eine der Sendungen anzuschauen. Sie fand die Faszination, die ihre Schwester im Hinblick auf diesen perversen Killer Romeo an den Tag legte, gelinde gesagt, skurril. Nicht nur, daß Melanie von diesem sensationsgierigen Magazin angeheuert worden war, um den Wahnsinnigen zu analysieren, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzte, nein, sie war auch als sachverständige Beraterin für die Sonderkommission tätig, die zu seiner Ergreifung aufgestellt worden war.
Doch schließlich gewann Sarahs Neugier die Oberhand. Anstatt umzuschalten, stellte sie den Ton ab und ließ die Werbespots über sich ergehen. Als die Sendung weiterging, wurde das Gespräch zwischen Melanie und den beiden Detectives fortgesetzt. Ihre Namen wurden unten eingeblendet, während die Kamera sie in Großaufnahme zeigte, zuerst Melanie, dann den jüngeren Cop, Detective Wagner, schließlich den älteren, Detective Allegro. Wegen des miserablen Empfangs waren ihre Gesichtszüge nicht genau zu erkennen.
Als Sarah den Ton wieder einschaltete, sprach gerade John Allegro.
«Unserer Erfahrung nach konzentrieren sich Serienmörder meist auf sogenannte ‹schlechte Frauen› – Prostituierte, Drogensüchtige, Obdachlose. Oder sie gehören in die Kategorie von Ted Bundy und machen sich an Schulmädchen heran – jung, wehrlos, beeinflußbar. Aber dieser Bursche geht anders vor. Er sucht sich erfolgreiche, intelligente, äußerst attraktive Karrierefrauen aus. Zu seinen Opfern zählen eine Anwältin, eine Börsenmaklerin, eine Finanzberaterin und eine Professorin. Und es gibt nicht einmal nennenswerte physische Übereinstimmungen zwischen den Opfern.»
«Vielleicht erscheint es Romeo zu leicht oder es reizt ihn weniger, Macht über eine Prostituierte oder ein Schulmädchen auszuüben.» Melanies Stimme hatte den selbstsicheren, knappen Tonfall einer Autoritätsperson. «Der Reiz liegt für ihn darin, Frauen zu beherrschen, die Macht haben und Kontrolle ausüben.»
«Und in Wirklichkeit?» mischte sich Detective Wagner ein. «Ich nehme an, Sie beziehen sich darauf, daß zwei der Opfer unseren Ermittlungen nach mit Sicherheit eine Vorliebe für gewisse Sadomaso-Praktiken hatten.»
Melanie sah ihm direkt ins Gesicht. «Ich glaube, daß ein Bedürfnis, ein Verlangen, eine heimliche Sehnsucht danach, sexuell beherrscht zu werden, diese Opfer zu diesem Mann getrieben hat. Sie haben mitgemacht … bis zu einem gewissen Punkt.»
Wagner beugte sich vor. «Wieso? Wieso sollte sich eine Frau wünschen, gepeinigt zu werden?»
«Manche Frauen haben so wenig Selbstachtung, Detective Wagner, daß sie das Gefühl haben, die Mißhandlung zu verdienen», erwiderte Melanie mit ihrer Dozierstimme. Wieder konzentrierte sich die Kamera auf ihr Gesicht. «Mißhandlung kann zur Obsession werden. Wie eine Droge. Romeo konnte diesen Frauen sozusagen den ‹Schuß› setzen, nach dem sie sich verzweifelt sehnten. Ihre wildesten und geheimsten Wünsche erfüllen. Ohne sie zu verurteilen.»
«Nein, er hat sie nicht verurteilt», knurrte Allegro. «Er hat sie bloß abgeschlachtet.»
Eine kurze Stille trat ein, die von Detective Wagner durchbrochen wurde: «Was können Sie uns noch über diesen Perversling erzählen?»
«Das ist das Problem», entgegnete Melanie kühl. «Sie würden nie darauf kommen, daß Romeo pervers ist, wenn Sie ihm gegenüberständen; selbst wenn Sie einige Zeit mit ihm verbrächten. Äußerlich betrachtet, könnte er sogar recht attraktiv sein.»
«Gutaussehend?» fragte Wagner.
Melanie zuckte die Achseln. «Das Aussehen ist subjektiv, Detective. Ich würde eher sagen, faszinierend, charmant. Ganz gleich, wie brutal es am Ende für die Opfer wurde, zunächst war Romeo in der Lage, ihr Vertrauen zu gewinnen. Den Tatorten nach zu urteilen, fingen all diese Begegnungen als Rendezvous an. Bei drei der vier Opfer war sogar der Tisch für ein romantisches Abendessen gedeckt. Kerzenschein und Champagner.»
«Sie wollen also damit sagen, daß es nicht möglich ist, den Typen als Psychopathen zu erkennen?» fragte Allegro.
«Wenn Sie mit ‹Psychopath› meinen, daß er unzurechnungsfähig ist», sagte Melanie erneut mit der Stimme einer anerkannten Autorität, «dann liegen Sie falsch. Romeo ist ein sexueller Psychopath. Nach dem Gesetz würde er niemals für unzurechnungsfähig erklärt werden. Der echte sexuelle Psychopath hat keinerlei Schwierigkeiten, richtig und falsch zu unterscheiden. Hier geht es um einen Zwang, einen unerbittlichen Trieb. Insgeheim fühlt sich Romeo machtlos – wie alle sexuellen Gewalttäter. Nur mit Hilfe von Wut und Zorn kann er dieses Gefühl abwehren. Das ritualisierte Töten und Verstümmeln gibt ihm das Gefühl von Macht. Und sein verzweifeltes Bedürfnis nach Macht geht noch über seine Opfer hinaus. Ich denke, daß ihn auch jene Macht erregt, die er über Menschen mit einer gewissen Autorität hat, wie zum Beispiel die Polizei.»
«Ja, ja», sagte Allegro unwirsch. «Vier Frauen wurden vergewaltigt, mißhandelt und verstümmelt, und es ist uns nicht gelungen, auch nur den Hauch einer Spur zu finden. Was meinen Sie, Doc? Ist Romeo wirklich so clever, oder hat er bis jetzt einfach nur unverschämtes Glück gehabt?»
«Ein bißchen von beidem, würde ich sagen», antwortete Melanie.
«Ein Jammer, daß man das nicht von seinen Opfern sagen kann», bemerkte Wagner bitter.
Zum erstenmal klang Melanies Stimme bewegt. «Ein Jammer? Detective, ich würde sagen, das ist eine Tragödie.»
Sarah stellte den Fernseher ab. Sie fand diese ganze Romeo-Geschichte absolut widerwärtig. Die Vorstellung, daß ein derartig verrücktes, sadistisches Wesen existierte, bereitete ihr Übelkeit. Daß es Frauen gab, die nach außen hin so ausgeglichen wirkten und doch ein krankhaftes, verzweifeltes Verlangen nach Unterwerfung hegten. Daß ihre eigene Schwester diesen wahnsinnigen Killer zu ihrer höchstpersönlichen Cause célèbre erkoren hatte.
2
Du allein verstehst meinen Kampf. Wenn ich dich verliere, verliere ich mich selbst.
M.R., Tagebuch
Um acht Uhr zwanzig am Freitag morgen trafen Detective John Allegro und sein Partner Detective Michael Wagner vor dem Haus von Dr. Melanie Rosen an der Scott Street ein. Der Bereich vor dem Haus war bereits abgesperrt. Der uniformierte Polizist vor der Haustür nickte ihnen zu und trat zur Seite. Im Foyer wurden sie von Johnson und Rodriguez begrüßt, die Detectives vom Morddezernat, die Dienst gehabt hatten, als die Leiche entdeckt wurde. Die Leute vom Rettungsdienst waren auf dem Weg nach draußen. Hier gab es nichts mehr zu retten.
«Wer weint denn da?» wandte sich Allegro, der von oben Schluchzen hörte, an Rodriguez.
Rodriguez, ein drahtiger Mann Mitte Dreißig, zuckte die Achseln. «Der Bursche, der sie gefunden und angerufen hat. Er ist ziemlich von der Rolle. Bislang haben wir so gut wie nichts aus ihm rausbekommen, nur seinen Namen. Perry. Robert Perry. Und daß er einer ihrer Patienten war. Vielleicht könnt ihr beide ihn ja ein bißchen aufmuntern, während wir die Nachbarschaft abklappern. Scheint ziemlich spät letzte Nacht passiert zu sein. Wir wollen nachfragen, ob irgendwer in der Gegend jemanden hat kommen oder gehen sehen. Man weiß ja nie. Vielleicht haben wir diesmal Glück, was?»
In Allegros Nicken lag keine Spur von Optimismus. Vier tote Frauen. Jetzt fünf. Keine Zeugen. Endlose Stunden, Wochen, Monate suchten sie bereits nach Hinweisen, und noch immer tappten sie im dunkeln. Jede mögliche Spur – und nicht gerade viele davon waren vielversprechend gewesen – war überprüft worden und hatte doch nur wieder in einer Sackgasse geendet. Romeo führte sie an der Nase herum.
Nachdem Rodriguez und sein Partner losgezogen waren, gingen Allegro und Wagner die Treppe hinauf dem Schluchzen nach und fanden Robert Perry. Er lag bitterlich weinend und in Embryonalhaltung zusammengerollt auf dem beigen Teppich des Flurs, genau vor dem Bogeneingang zum Wohnzimmer der Psychiaterin.
«Großer Gott», sagte Allegro heiser, und Galle stieg ihm in die Kehle, als er Dr. Melanie Rosens nackte, gefesselte und entstellte Leiche auf einem der karamelfarbenen zweisitzigen Sofas im Wohnzimmer liegen sah. Ihre offenen Augen starrten in den Raum. Der Gestank von Blut und Erbrochenem drang in seine Nase. Es war ein Geruch, der ihm nur allzu vertraut war, aber das machte es ihm nicht leichter. Besonders diesmal.
Wagner spürte, wie sich alles in ihm zusammenzog, als er in den Raum blickte, aber er sagte kein Wort. Statt dessen wandte er rasch den Blick ab und konzentrierte sich auf Robert Perry. Mit weichen Knien ging der Detective neben dem schluchzenden Mann in die Hocke. «Gehen wir runter, Mr. Perry. Da unten läßt es sich leichter reden.»
Perry reagierte nicht auf den Vorschlag. Er hatte die Hände zwischen die Oberschenkel geklemmt, seine Gesichtsfarbe war kalkweiß, sein struppiges sandfarbenes Haar schweißfeucht. Obwohl er einen furchtbaren Anblick bot, war nicht zu übersehen, daß er im Grunde ein gutaussehender Mann war. Wagner mußte an den jungen Robert Redford denken, sogar die sportliche Kleidung paßte dazu: rotkariertes Flanellhemd, Blue Jeans und Wanderschuhe.
Während Wagner sich um Perry kümmerte, zog Allegro ein Paar Gummihandschuhe über und ging entschlossen auf die Leiche zu.
Er beugte sich über den Körper und stellte die gleiche Methode wie bei allen vier früheren Opfern Romeos fest – das klaffende Loch in der Brust, der weiße Seidenschal, mit dem Hand- und Fußgelenke hinter dem Körper gefesselt waren. Und dann das verschrumpelte Herz auf der linken Brust. Zweifellos würde im Autopsiebericht stehen, daß dieses Herz Opfer Nummer vier gehört hatte, Margaret Anne Beiner.
Was hatte Melanie noch gesagt? Der Killer läßt am Tatort immer etwas von sich zurück, und er nimmt etwas mit. Wie wahr. Immer hatte er das Herz seines Opfers mitgenommen. Was Melanie als das Totem des Killers oder sein Souvenir bezeichnet hatte. Und was er zurückgelassen hatte, war das alte Totem gewesen.
Bislang war er so clever gewesen, an keinem einzigen Tatort irgendwelche Fingerabdrücke zu hinterlassen. Allegro war sicher, daß die anderen Erkennungszeichen des Killers – die Flasche Perrier-Jouët auf dem Couchtisch, die CD-Hülle von Gershwins Rhapsody in Blue auf dem Boden neben der Couch, die CD selbst im CD-Player – auch diesmal keine Abdrücke aufweisen würden, wie immer. Und all diese Gegenstände konnten in irgendeinem der unzähligen Läden in San Francisco gekauft oder geklaut worden sein. Zahllose Getränkeläden, Boutiquen und Plattengeschäfte waren bereits von Ermittlern überprüft worden, ohne Ergebnis.
Es war zwar ein leichtes für Romeo, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Die Spermaspuren jedoch, die bei jeder toten Frau gefunden worden waren, konnte er nicht abwischen. Die DNS-Untersuchung der Spermaproben, die den vier früheren Opfern entnommen worden waren, erwies hundertprozentig, daß ein und derselbe Mann alle vier brutalen Morde begangen hatte.
Das Problem war nur, daß der deutliche, aus den DNS-Untersuchungen gewonnene «genetische Fingerabdruck» sie zu keinem Verdächtigen geführt hatte. Auch der Vergleich mit der FBI-Kartei hatte nichts erbracht. Aus keinem anderen Staat und keiner anderen Stadt wurden Morde gemeldet, die nach demselben Schema begangen worden waren. Romeo blieb in San Francisco – zumindest fürs erste.
Das Ergebnis der DNS-Untersuchung war ein eindeutiger Beweis, doch zunächst mußte der Täter gefaßt werden. Und dafür brauchten sie irgendeinen Hinweis auf seine Identität – einen glaubwürdigen Augenzeugen oder zumindest etwas, das er am Tatort zurückgelassen hatte und das mit ihm in Verbindung zu bringen war.
Allegro starrte nach unten auf die Klinge mit Rosenholzgriff, die neben der Leiche auf dem Boden lag. Die Mordwaffe war ein Tranchiermesser. Nichts Besonderes oder Einzigartiges. Und bestimmt ohne Fingerabdrücke.