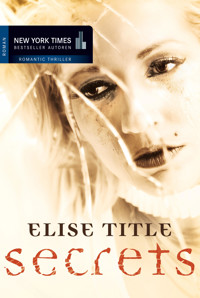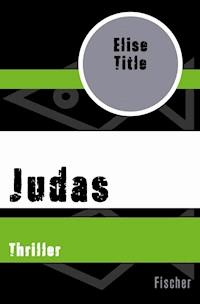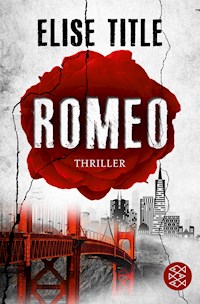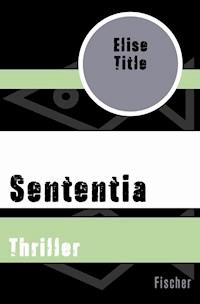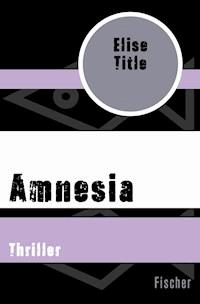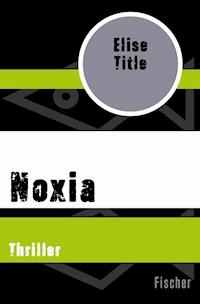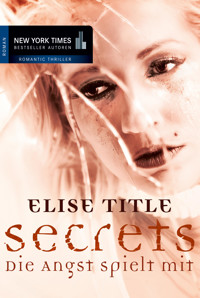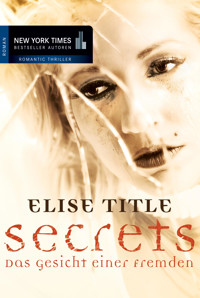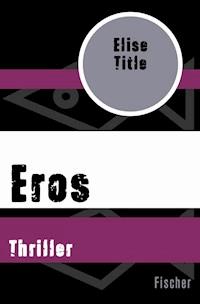
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Natalie Price
- Sprache: Deutsch
Die Psychiaterin Caroline Hoffman wird von Steve Kramer, einem ihrer Patienten, spätnachts angerufen. Er bittet sie flehentlich um ein Gespräch. Als Caroline wenig später am vereinbarten Treffpunkt ankommt, findet sie dort nur die Polizei vor. Ein Sexualmord ist geschehen. Es gibt Hinweise, daß womöglich eine Frau die gräßliche Tat begangen hat ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elise Title
Eros
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER Digital
Inhalt
Prolog
«Ich habe Lust auf ein herrliches heißes Bad in meinem Whirlpool», sagt Natalie. «Die CD mit Miles Davis klingt so schön traurig. Räucherstäbchen aus Sandelholz brennen. Ich habe ein ganzes Kerzenmeer entzündet – komme so richtig in Stimmung. Nur …»
«Nur was?» fragt Steve drängend.
«Er sagt nein.»
«Mag er keine Kerzen?» fragt Tina.
«Es liegt nicht an den Kerzen.»
Greg hakt nach: «An was dann?»
«Er sagt, er will die Wahrheit. Also wandle ich sie für ihn ab. Jetzt liege ich in schwarzer Spitzenunterwäsche auf meinem Bett. Ich fange an, mich zu beschreiben … na ja, ich beschreibe die Art von Frau, von der ich meine, daß sie ihn heiß macht.»
«Und? Macht sie ihn heiß?» will Chris wissen.
«Nein. Also sage ich: ‹Ich mache alles, was dir gefällt. Sag mir doch einfach, was du willst.› Aber er ist auf seinem Wahrheitstrip und will nicht davon runter. Ganz gleich, was ich mir einfallen lasse, er kauft es mir nicht ab.» Natalie runzelt die Stirn. «Er bringt mich durcheinander.»
Steve sagt: «Ich glaube, er macht dir angst.»
Natalie legt die Arme um sich. «Stimmt.»
«Blödsinn», widerspricht Meg. «Das fasziniert dich. Macht dich an.»
Natalie wirft ihr einen wütenden Blick zu.
Chris legt eine Hand auf Natalies Schulter. «Hör nicht auf sie, Nat. Was ist dann passiert?»
Natalie erschauert deutlich sichtbar. «Er fragt mich, wie lange ich das schon mache. Und dadurch fühle ich mich dann völlig … unzulänglich.»
«Und durchschaut», fügt Meg hinzu, aber Natalie tut so, als hätte sie es nicht gehört.
«Ich sage: ‹Hör mal, anscheinend bin ich nicht die Richtige für dich. Vielleicht willst du lieber mit einer anderen reden.› Er sagt: ‹Ich will keine andere. Ich will dich.› Ich sage ihm, daß er mich ja hat.»
«Und was meint er darauf?» fragt Greg neugierig.
Natalie preßt die Lippen aufeinander. «Er sagt: ‹Ich habe dich nicht wirklich … noch nicht. Wie lange brauchst du zum Parkcrest Hotel?› Ich sage ihm, daß er spinnt. So was mache ich nicht. Entweder am Telefon oder gar nicht. Er lacht und sagt: ‹Zimmer 1290, ich warte.›»
Chris seufzt. «Du bist hin, stimmt’s, Nat?»
Natalie nickt mit niedergeschlagenen Augen. «Das erste Mal, daß ich Brad je betrogen habe.»
«Und wie war das, echter Sex mit einem von deinen Telefonkunden?»
Natalies Augen huschen zu Meg hinüber. «Ich weiß, daß du mich nur provozieren willst. Aber eins kann ich dir sagen. Es war super. Unheimlich romantisch. Er war wunderbar. Attraktiv, sanft, zärtlich. Er hat mir gesagt, daß sich meine Haut wie Samt anfühlt. Daß ich schön bin. Begehrenswert. Er war so … aufmerksam. Solchen Sex hatte ich vorher nie. Nicht mit Brad.»
Steve blickt verärgert. «Was soll das heißen? Daß Brad nicht gut im Bett ist? Willst du deinem Mann die Schuld geben? Um dich selbst zu entschuldigen?»
«Nein», sagt Meg. «Sie redet sich ein, daß es nur dieses eine Mal war. Nie wieder –»
Natalie fällt ihr ins Wort. «Ich habe noch nicht zu Ende erzählt.»
Tina beugt sich vor. «Ist er brutal geworden? Hat er dich hinterher geschlagen?»
«Nein … das nicht», stammelt Natalie.
«Na, nun erzähl schon», sagt Greg.
Natalies Gesicht ist gerötet. «Da ist plötzlich eine Frau ins Zimmer gekommen. Sie hatte eine Pistole in der Hand und hat geschrien: ‹Du Schwein, du gottverdammtes Schwein!›»
«Wer war sie? Seine Frau?»
«Ich weiß nicht, Greg. Ist doch auch egal, oder? Sie hatte eine Pistole …»
«Soll das heißen, sie hat den Kerl abgeknallt?» sagt Steve aufgeregt.
«Nein. Ich wünschte, sie hätte», erwidert Natalie.
«Was war das Ganze, Nat? Eine Falle? Für die klassische Erpressung?» fragt Chris.
Natalie schüttelt den Kopf und fängt an zu schluchzen. «Das war kein Trick. Bloß ein … Spiel.»
Tina bringt es auf den Punkt. «Ménage à trois.»
Natalie nickt, stumme Tränen laufen ihr übers Gesicht. Ihr fällt nichts mehr ein. Den anderen auch nicht.
Die sechs gutgekleideten Menschen auf den Metallklappstühlen sehen die siebte Person in ihrer Runde an, die sehr aufmerksam zugehört, aber noch kein Wort gesagt hat. Sie warten auf ihre Reaktion. Ihren Scharfblick. Ihr Verständnis. Jedes Gruppenmitglied lechzt nach ihrer Absolution.
In diesem Raum ist Dr. Caroline Hoffman allmächtig.
«Unterbrechen wir an dieser Stelle», sagt Dr. Hoffman und stoppt das Videoband per Fernbedienung. «Irgendwelche Fragen zum bisherigen Verlauf der Sitzung? Anmerkungen?» Die Psychologin mustert ihre Kolleginnen und Kollegen. Sie sitzen um den Konferenztisch im renommierten Psychiatrischen Institut des Boston General Hospital.
«Natalie läßt angesichts der Episode im Hotel zweifellos sehr viel Schmerz und Scham erkennen.» Dr. Alan Rogers, der leitende Psychiater am Institut, nimmt seine Brille ab und legt sie behutsam neben den Notizblock. «Aber ich nehme auch ihr hartnäckiges Leugnen der Realität wahr. Natürlich ist sie in Panik geraten, als sie dachte, sie sei in Lebensgefahr, aber ich glaube, Meg hat recht. Natalie war erregt.»
«Mir ist die Spannung zwischen Natalie und Meg aufgefallen», sagt Dr. Susan Steinberg. «Meg ist zwar erst ein paar Wochen in der Gruppe, aber sie scheint grundsätzlich die Konfrontation zu suchen. Als wollte sie nicht nur Natalie, sondern auch alle anderen Teilnehmer gegen sich aufbringen. Ich habe den Eindruck, daß sehr viel Zorn in ihr steckt.»
Martin Bassett, im zweiten Jahr Assistenzarzt der Psychiatrie, hebt die Hand. «Vielleicht ist Meg noch immer ambivalent.»
«In welcher Hinsicht?» fragt Caroline Hoffman.
«Ob sie wirklich sexbesessen ist. Es könnte doch sein, daß Meg sich fragt, wo das ausgeprägte Interesse an Sex aufhört und die Obsession beginnt. Kann die Perversion des einen – oder der einen – nicht für den anderen Lust bedeuten? Ich meine, wenn kein Verbrechen begangen, wenn weder das eigene Leben noch das des Partners in Gefahr gebracht wird?»
«Das hört sich an, als würde Sie die Frage beschäftigen, Dr. Bassett.»
Der Assistenzarzt lächelt Caroline entwaffnend an. «Stimmt. Wo genau ziehen Sie die Grenze, Dr. Hoffman?»
«Das kommt auf das Ausmaß an. Menschen, die süchtig sind – ob nun nach Drogen, Alkohol oder Sex –, befinden sich in einer Abhängigkeit. Sie wollen, sie brauchen immer mehr. Sind gezwungen, immer größere Risiken einzugehen. Und letztlich glauben sie, daß sie ohne ihre Sucht wertlos sind.»
«Mit anderen Worten: Sie fühlen sich nur dann richtig lebendig, wenn sie Sex haben?» fragt Martin Bassett.
Carolines Finger berührt den Startknopf an der Fernbedienung. «Meg wird Ihre Frage in der Gruppensitzung beantworten, Dr. Bassett. Ich schlage vor, wir sehen uns das Band zu Ende an und reden dann weiter.»
Dienstag
1
«Nicht», sagte sie sanft.
Martin Bassett hatte Carolines Brust liebkosen wollen, streckte nun aber gehorsam die Arme über den Kopf aufs Bett. «Aye, aye, Captain.»
Caroline rückte jäh von ihm weg. «Machst du dich über mich lustig?»
Der Assistenzarzt setzte sich auf, lehnte sich gegen das Kopfende aus geschnitztem Eichenholz und schob sich das Kissen unter den Hinterkopf. «Nein, ich bin nur verspielt.»
Caroline zog die Bettdecke über ihre nackten Brüste. Sie kam sich albern vor. Unruhig.
«Ich war wohl zu stürmisch, was?» sagte Martin. «Tut mir leid.»
«Ich bin heute abend einfach zu angespannt.»
«Ich glaube, dein Problem ist, daß du das Gefühl hast, ich lasse dich im Stich.»
«Martin, wir haben von Anfang an gewußt, daß unsere Beziehung …»
«Phantastisch werden würde», brachte er den Satz für sie zu Ende.
Caroline lächelte. Aber nur einen Augenblick lang. «Und zeitlich befristet ist.»
Kurz nach ihrem ersten Rendezvous vor vier Monaten hatte Martin sich erfolgreich auf eine Stelle in der Psychiatrie einer Privatklinik in Pittsburgh beworben. «Wir beide haben die Bedingungen akzeptiert …»
«Du hast dich nicht gerade ins Zeug gelegt, um unsere Beziehung zu intensivieren.»
«Stimmt», sagte sie, «das habe ich nicht.»
«Ein bißchen hättest du dich schon ins Zeug legen können.»
«Hätte das einen Unterschied gemacht?» In ihrer Stimme lag ein bittersüßer Unterton.
«Das läßt sich jetzt wohl nicht mehr feststellen, oder?» Er sah sie gereizt an.
«Freu dich doch, Martin. Du siehst einer wunderbaren Zukunft entgegen. In wenigen Wochen bist du hier weg und genießt deine neue Arbeit. Seien wir ehrlich. Im Sommer bist du schon längst mit einer anderen zusammen, und ich werde kaum mehr sein als eine süße Erinnerung.»
«Das verletzt mich, Caroline. Denkst du etwa, es ist mir nur am Sex gelegen?»
«Sag du’s mir.»
Martin lachte verlegen. «Natürlich bin ich verrückt danach, mit dir zu schlafen. Aber ich liebe deinen brillanten Verstand genauso wie deinen herrlichen Körper, Caroline. Und wenn wir mehr Zeit hätten … Ist dir eigentlich klar, daß das unser erster gemeinsamer Abend nach fast zwei Wochen ist? Dein Privatleben – wenn man es überhaupt so nennen kann – kommt immer an allerletzter Stelle. Du bist ein Workaholic, Caroline. Wenn du keine Therapiesitzungen hast, arbeitest du an Berichten, nimmst an Kongressen teil, hältst Vorträge, schreibst …»
«Ackere mich durch Berge von Anträgen für die Krankenversicherungen», fügte sie hinzu. «Wir alle machen in diesem Beruf Überstunden bis zum Umfallen. Das liegt in der Natur der Sache. Das weißt du. Und du wirst es noch besser wissen, wenn du erst deine neue Stelle angetreten hast …»
«Ja», sagte er, «aber du bist die einzige in der Branche, die ich kenne, die sich niemals darüber beschwert. Es macht dir sogar Spaß.»
Caroline runzelte die Stirn. «Ja, ich liebe meine Arbeit. Und das ist auch gut so, nach allem, was ich dafür geopfert habe, um es bis hierher zu bringen.»
«Schön. Aber jetzt, wo du’s geschafft hast, wird es Zeit, daß du dich ein wenig entspannst und die Früchte deiner harten Arbeit genießt. Genieß sie mit mir.»
«Soll das heißen, Schluß mit dem Gerede und weiter mit dem Sex?» Caroline klang eingeschnappt und konnte sich selbst dafür nicht leiden. Aber schließlich hatte sie Martin förmlich die Gelegenheit gegeben, nachzufragen: Was für Opfer? Ein bißchen Interesse zu zeigen. Aber er hatte nichts dergleichen getan. Andererseits hätte sie sich ein wenig mehr ins Zeug legen können …
Nach einem verlegenen Augenblick ließ Martin verspielt eine Strähne ihrer langen dunklen Haare durch seine Finger gleiten. «Wirst du mich vermissen, wenn ich fort bin?»
«Ja.» Das stimmte. Sie würde ihn vermissen. Und sie würde, so mußte sie zugeben, den Sex vermissen.
Er wirkte ermutigt. «So weit ist es nicht von Pittsburgh nach Boston, Caroline. Wir könnten doch weiter –»
«Ach Martin. Wir wissen beide, daß das nicht klappen würde.»
«Für dich oder für mich?»
Caroline fühlte sich plötzlich unsäglich müde. «Lassen wir’s gut sein für heute.» Sie wollte aufstehen. Martins Hände schnellten hoch und drückten auf ihre Schultern. Hielten sie fest.
«Caroline –»
Der Druck war wie ein Stromschlag. Ihre Schläfenmuskulatur verkrampfte sich. «Laß das.»
Martin ließ sie augenblicklich los. «Caroline! Ist ja gut. Es tut mir leid …»
«Ich hätte mich gar nicht erst auf diese Affäre einlassen sollen», sagte sie.
«He, ich hatte da schließlich auch ein Wörtchen mitzureden.»
Sie belohnte ihn erneut mit einem Lächeln.
«Komm, du brauchst jetzt eine schöne Rückenmassage.» Sanft drehte er sie auf den Bauch und fing an, ihre verspannten Muskeln zu kneten.
Allmählich konnte Caroline sich entspannt dem Augenblick hingeben …
Sein graues Tweedjackett mit den anthrazitfarbenen Lederflicken an den Ellbogen liegt auf dem schwarzweißen Marmorboden. Sein blaßblaues Hemd ist aufgeknöpft, sein hochgerutschtes T-Shirt enthüllt einen flachen Bauch mit spärlichen dunklen, lockigen Haaren. Sein weißer Slip und die marineblaue Hose liegen zusammengeknüllt um seine Füße.
Sie kniet vor ihm. Nimmt ihn tief in den Mund. Noch nie war er so hart. So erregt.
Er keucht. «O Gott, o Gott, o Gott.» Er will nicht zum Höhepunkt kommen. Noch nicht.
Ihre Hand schießt nach oben, preßt sich auf seinen Mund.
Er versteht. Ein Museumswärter könnte sie hören. Er lächelt noch, als er gehorsam die Lippen zusammenpreßt. Peter Korza möchte es nicht verderben. Wunder wie dieses passieren nicht alle Tage.
Haydns «Abschiedssinfonie» hallt wild durch Peter Korzas Kopf. Es ist verrückt. Es muß ein schlechter Witz sein. Es kann nicht wahr sein.
Die dicke Kette hängt ihm locker um den Hals. Er hat Schluckauf. Entsetzliche Angst. Die Musik spielt weiter, doch sie klingt jetzt verzweifelt. O Gott, bitte laß das nicht zu!
«Hat es dir gefallen? War es schön? Wolltest du noch mehr?»
Was soll er tun? Nicken? Den Kopf schütteln? Er blickt flehentlich. Sein Körper ist in eiskaltem Schweiß gebadet.
«Tut es dir jetzt leid, du gieriger Bock?»
Gierig, ja. Hungernd nach seiner unwiderstehlichen Verführerin. Vom ersten Augenblick an, als er sie gesehen hatte. Das hautenge schwarze Jerseykleid, in dem sich die Formen ihres sinnlichen Körpers abzeichneten. Und diese faszinierenden grünen Augen. Er wollte sie. Wollte sie ganz. Auf jede erdenkliche Art. Konnte nicht genug bekommen.
Er will es erklären. Aber das kann er nicht mit dem Knebel im Mund. Und er kann sich auch nicht mehr bewegen, weil sich das metallene Würgehalsband immer fester zuzieht.
Als Caroline langsam wieder in Stimmung kam, ging ein Piepser in ihrem Schlafzimmer an.
Martin stöhnte. «Mist. Deiner oder meiner?»
Caroline griff über ihn hinweg nach der Nachttischlampe und schaltete sie ein. «Meiner.»
Caroline zog die Decke höher, als sie den Hörer abnahm. Martin, noch immer nackt, saß im Schneidersitz am Fußende des Bettes.
«Hat das nicht bis morgen Zeit, Steve? Ich kann Ihnen einen Termin geben um … Sekunde …» Sie legte die Hand auf die Sprechmuschel. «Martin, holst du mir bitte meinen Terminkalender?» flüsterte sie und deutete auf ihre Tasche auf der Kommode.
Martin schüttelte den Kopf und grinste. Caroline zeigte ihm einen Vogel, schlug die Bettdecke zurück und lief nackt durchs Zimmer. Sie kehrte zum Bett zurück – Martin hatte sich jetzt auf der Decke ausgestreckt –, nahm den Hörer und blätterte rasch die Seite für Mittwoch auf. «Zehn Uhr.» Es war, gelinde gesagt, äußerst verwirrend, splitternackt in ihrem Schlafzimmer zu sitzen und einen Termin mit einem hysterischen Patienten zu vereinbaren.
«Bitte, Caroline. Ich weiß, es ist spät, aber ich würde mich gern jetzt mit Ihnen treffen. Ich bin in einem Lokal … im Cuppa’s, einem Café an der Huntington Avenue. Nicht weit von Ihrer Wohnung. Ich könnte gleich dasein …»
«Ich würde lieber ein paar Minuten mit Ihnen am Telefon sprechen», schlug Caroline vor. Hinter sich hörte sie, wie Martin genervt aufstöhnte. Sie zog entschuldigend die Schultern hoch, aber ganz so traurig war sie eigentlich nicht über die Unterbrechung.
«Ich fühle mich völlig … daneben.»
«Ist heute abend irgendwas passiert, Steve?»
Er lachte rauh. «Brillante Schlußfolgerung.»
«Und was?» fragte Caroline, ohne den Sarkasmus zu beachten.
«Ich telefoniere vom Café aus. Möchten Sie, daß jeder Kunde hier bei seinem Milchkaffee die schmutzigen Einzelheiten mitkriegt? Kann es sein, daß Sie mich mit Natalie verwechseln? Ich bin nicht der Telefonsexfreak.»
«Sie haben getrunken.»
«Können wir uns treffen?»
«Morgen. Um zehn.»
«Na schön, ich hatte ein paar Drinks.»
«Nehmen Sie ein Taxi nach Hause, Steve …»
«Ich sage Ihnen doch, ich bin nicht besoffen.»
«Aber Sie sind sauer.»
«Ich habe die Schnauze voll, Caroline, aber das ist immer noch besser, als eins auf die Schnauze zu kriegen.»
«Moment», sagte sie. Martin seufzte erneut. Aus den Augenwinkeln sah sie, daß er nach seiner Jeans griff.
«Schon gut. Ich hätte nicht –»
«Wir sehen uns in fünfzehn Minuten in meinem Büro.»
Martin stöhnte laut auf. Caroline durchbohrte ihn mit Blicken und legte rasch die Hand auf die Sprechmuschel. Am anderen Ende der Leitung war plötzlich Stille.
«Steve?»
«Nein. Schon gut. Tut mir leid, daß ich angerufen habe. Es ist spät. Sie haben bestimmt etwas Besseres zu tun.»
«Steve, Sie müssen sich jetzt entscheiden.»
«Das habe ich.» Die Verbindung brach ab.
«Mist.» Caroline legte den Hörer auf. Sie streifte sich das graue Jerseykleid über, das sie den Tag über getragen hatte, schnappte ihren weißen Seidenschlüpfer vom Fußboden und zog ihn rasch an.
«Wo brennt’s denn?» fragte Martin.
«Im Cuppa’s», sagte Caroline, nahm ihren schwarzen Blazer und griff auf dem Weg nach draußen ihre Autoschlüssel, die auf dem Tisch lagen. «Ich hoffe, ich bin rechtzeitig da, bevor der Laden in Flammen aufgeht.»
2
«Na endlich. Es wurde aber auch Zeit.»
Vor Schreck ließ Meg Spaulding ihren Schlüsselbund fallen, als sie im zwanzigsten Stock des Hochhauses mit Blick über den Hafen aus dem Fahrstuhl trat und nach links auf ihre Wohnung zuging. Ryan Gallagher, der als Zeichner in demselben Architekturbüro wie sie arbeitete, saß auf dem Fußboden vor ihrer Tür. Er stand auf und kam auf sie zu.
«Wie hast du den Portier dazu gekriegt, dich reinzulassen?» fragte Meg barsch.
«Er hat mich schon oft genug hier gesehen.» Er hielt kurz inne. «Und ich habe ihm obendrein einen Zwanziger zugesteckt.» Gallagher setzte sein schelmisches Lächeln auf. Er war an die einsachtzig groß, hatte gewelltes aschblondes Haar, entwaffnende strahlendblaue Augen und einen aufgrund regelmäßiger Besuche im Fitneßstudio durchtrainierten Körper. Und ein freundliches Gesicht, stets ein wenig spitzbübisch, aber ausgesprochen attraktiv. Für die meisten Frauen.
Meg kniff die Augen zusammen. «Was hast du eigentlich um diese Uhrzeit hier zu suchen?»
«Gute Frage», sagte Ryan mit leicht scheltendem Unterton, bückte sich und hob ihre Schlüssel auf. «Wenn man bedenkt, daß es nach neun Uhr ist und wir um acht eine Verabredung zum Essen hatten.»
Meg runzelte die Stirn und ging weiter zur Tür. «Das wüßte ich. Du träumst wohl.»
Gallagher hielt mit ihr Schritt. «Also gut, dann eben keine Verabredung. Ein Geschäftsessen. Ist das besser?»
Meg wollte ihm die Schlüssel aus der Hand schnappen, aber er zog rasch seinen Arm hinter den Rücken.
«Ryan, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Wir hatten für heute abend keinen Termin. Und jetzt gib mir meine Schlüssel und geh nach Hause.»
Gallagher lehnte sich gegen ihre Wohnungstür, beide Arme auf dem Rücken, die Beine gekreuzt. «Das Projekt für den Jachtclub im Hafen? Oder hast du vergessen, daß du dir diese einmalige Chance unter den Nagel gerissen hast? Und daß ich dein Wunderknabe bei dem Umbau bin?»
Meg registrierte nicht, daß ihr der Trageriemen der großen Tasche von der Schulter rutschte. «Ich dachte, der Termin wäre erst morgen abend.»
«Dienstag, Meg. Heute ist Dienstag. Was ist eigentlich in letzter Zeit mit dir los?»
Zwischen ihren dunklen Brauen schien sich ein Schatten auszubreiten. «Nichts ist los. Ich habe bloß einen blöden Termin verpaßt. Ist doch kein Weltuntergang. Dann treffen wir uns eben morgen.»
«Mußt du morgen nicht nach New York? Was ist mit dem Jefferson-Einkaufszentrum?»
Meg war ganz durcheinander. Richtig. New York. Ihre Maschine ging um acht Uhr früh. Sie würde bis Donnerstag dort bleiben. Vielleicht auch länger, falls es Probleme gab. Und die gab es ja immer.
«Freitag. Wir treffen uns Freitag», sagte sie schroff. «Wir haben noch jede Menge Zeit. Und jetzt hätte ich gern meine Schlüssel, Ryan. Ich möchte in meine Wohnung, duschen und ins Bett gehen.» Sie streckte ihm die offene Hand entgegen.
«Wie wär’s, wenn ich dir das Bett aufdecke?»
«Jetzt gib endlich Ruhe, Ryan. Du wirst lästig. Wirklich.» Ihre Hand blieb ausgestreckt.
Gallagher ließ die Schlüssel in ihre flache Hand fallen. Er musterte sie nachdenklich, während sie mit den Schlüsseln hantierte, bevor sie den richtigen ins Schloß steckte. «Du siehst heute irgendwie anders aus, Meg.»
«Nein, tu ich nicht», entgegnete sie, drehte den Schlüssel und öffnete die Tür. «Ich sehe schon den ganzen Tag so aus. Dasselbe Kostüm, dieselben Schuhe, dieselbe Handtasche.» Das klang wie eine persönliche Bestandesaufnahme.
Gallagher schnippte mit den Fingern. «Ich hab’s. Jetzt weiß ich, was anders ist.»
Meg blieb in der Tür stehen. Sie trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. «Und das wäre?»
«Deine Augen.»
Impulsiv wandte sie sich zu Gallagher um, blickte ihn durchdringend an. Doch ihre Mundwinkel verrieten Anspannung. «Was soll damit sein?»
«Sie sind grün.»
Meg Spaulding preßte die Handflächen fest auf das Waschbecken im Badezimmer, während sie sich im Spiegel anstarrte.
Wie konnte sie nur so nachlässig, so blöd sein? Das sah ihr gar nicht ähnlich. Mit zusammengepreßten Lippen griff sie sich an die Augen und nahm die grün getönten Einweglinsen heraus. Warf sie ins Klo. Spülte sie runter.
Wieder stützte sie sich mit den Händen auf dem Waschbecken auf. Diesmal, um Halt zu finden. Reiß dich zusammen. Was soll’s? Ein kleiner Fehler. Jeder macht mal einen Fehler. Sogar du.
Sie blinzelte. Ihr Spiegelbild wurde ganz allmählich unscharf. Was sie zunächst verwirrte. Die Kontaktlinsen waren rein dekorativer Natur. Sie konnte ausgezeichnet sehen. Die Verzerrung rührte daher, daß ihr die Tränen kamen.
Verärgert über sich selbst, wandte sie sich vom Spiegel ab. Sie zog sich aus, warf ihre Unterwäsche in den Wäschekorb, stellte die Dusche heißer als sonst und seifte sich energisch mit einem neuen Stück Hafermehlseife ein, die angeblich zum Abschuppen der Haut geeignet war.
Streif die tote Haut ab. Erfrisch dich, erneuere dich. Reinige dich. Sozusagen als therapeutische Maßnahme.
Meg mußte plötzlich an ihre Therapeutin denken. Nein, das Abschälen der Haut würde ihre Seelenklempnerin nicht anordnen. Dr. Caroline Hoffman würde jedes Stück Schmutz unter die Lupe nehmen wollen.
Ihre Therapeutin war das eigentliche Problem, befand Meg. Sie war wunderbar klargekommen, bevor sie mit ihrer Therapie angefangen und sich, entgegen ihrer Überzeugung, bereit erklärt hatte, an dieser schrecklichen Gruppentherapie teilzunehmen. Im Grunde war ihre Chefin Sylvia Fields an allem schuld. Sylvia war bei Hoffman in Behandlung und schien ohne ihre Therapeutin nicht mehr lebensfähig. Sylvia schwärmte immerzu von ihrer Wundertäterin, drängte Meg, zu ihr zu gehen, da Meg ihr in letzter Zeit bedrückt und zerstreut vorgekommen war. Schließlich hatte Sylvia ihren Widerstand gebrochen. Meg erklärte sich zu einem ersten Gespräch mit Dr. Caroline Hoffman bereit, was ihr eine erdrückende Umarmung von Sylvia einbrachte, die ihr damals genauso unangenehm war wie jetzt in der Erinnerung.
Meg drehte die Dusche ab, trat auf die Badematte und trocknete sich rasch. Sie haßte es, wenn ihre Gedanken mit ihr durchgingen. Konzentrier dich auf das eigentliche Problem. Das Problem Dr. Caroline Hoffman.
Sie tappte nackt ins Schlafzimmer und griff nach Stift und Papier neben dem Telefon auf ihrem Nachttisch. Sie kritzelte eine Notiz: Morgen Therapie beenden.
Meg fühlte sich besser. Ihre Teilnahme an der Gruppe mit all diesen Perversen hatte sie nur aufgewühlt, ihre Konzentration völlig falsch gesteuert. Jetzt, wo es so gut wie vorbei war, konnte sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Sie zog sich einen blauen Seidenpyjama an, schluckte zwei rezeptfreie Schlaftabletten und stieg ins Bett. Ihre Hände schoben sich unter die Pyjamajacke, die Handflächen glitten sacht über ihre vollen Brüste, den flachen Bauch. Ihre Haut fühlte sich tatsächlich weicher an, glatter. Gereinigt. Sie schloß die Augen, ein schwaches Lächeln auf den Lippen – ihre Muskeln entspannten sich.
Er hatte ihr seinen Namen genannt, aber sie konnte sich nicht erinnern. Konnte sich kaum erinnern, wie er aussah. Als wäre es in Wirklichkeit gar nicht passiert.
3
Caroline suchte das neonbeleuchtete Café an der Huntington Avenue ab. Steve Kramer war nicht zu sehen.
In der Hoffnung, daß er nach Hause und nicht in eine Bar gegangen war, wo es Alkohol statt Espresso gab, fragte Caroline eine der Kellnerinnen, eine zierliche Frau mit rotblonden Haaren und leuchtendrosa Lippenstift, wo das Telefon war.
«Wir haben hier kein öffentliches Telefon.» Die Kellnerin steckte eine lose Haarnadel wieder fest.
«Aber vor nicht ganz fünfzehn Minuten hat ein Mann von hier aus angerufen», wandte Caroline ein.
«Unmöglich.»
Caroline runzelte die Stirn. Hatte Kramer gelogen?
«Das nächste Telefon ist ein Stück die Straße runter», sagte die Kellnerin. «Vor dem Bullfinch Art Museum. Das Museum hat dienstags bis neun geöffnet.»
Caroline sah auf die Uhr. Viertel nach neun.
Auf halber Strecke sah Caroline das eingeschaltete Blaulicht eines Streifenwagens vor dem Museum. Ein zweiter Polizeiwagen raste an ihr vorbei, mit Blaulicht und Sirene, hielt mit quietschenden Bremsen hinter dem ersten Streifenwagen.
Caroline hatte ein ungutes Gefühl, das noch schlimmer wurde, als der Wagen der Gerichtsmedizin an ihr vorbeifuhr.
Die letzten Worte ihres Gesprächs mit Kramer schossen ihr durch den Kopf. Steve, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Und seine ausdruckslose Antwort. Das habe ich.
Betend fing sie an zu laufen. Sie wußte, daß er bereits zwei Selbstmordversuche unternommen hatte, bevor er zu ihr in die Therapiegruppe gekommen war. Nachdem ihm vor einem Jahr die ärztliche Zulassung entzogen worden war, hatte er eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt. Und zwei Monate später, kurz vor seiner Verhandlung wegen Unzucht und Anstiftung zur Prostitution, hatte er sich in seinem Büro eingeschlossen und sich fast drei Stunden lang eine Pistole an den Kopf gehalten, während die Polizei versuchte, ihn zur Vernunft zu bringen. Bevor er schließlich aufgab, hatte er eine Kugel abgeschossen. In ein Diplom, das an der mahagonigetäfelten Wand hing. Das Abschlußzeugnis seines Medizinstudiums in Harvard.
Zwei Polizisten hielten Caroline zurück, als sie sich dem Museum näherte. Mit zunehmender Beklommenheit sah sie, wie die Leute der Spurensicherung aus dem großen weißen Wagen sprangen und die Treppe zu dem erleuchteten Museum hocheilten.
War Kramer noch in das Museum gegangen, bevor es zumachte? Hatte er sich dort das Leben genommen? Caroline wußte, daß sie wahrscheinlich überreagierte. Aber sie hatte ein schlechtes Gefühl.
«Was ist denn passiert?» fragte sie die Polizisten. «Ein Raubüberfall? Ist jemand verletzt worden? Bitte, ich –»
Einer der Uniformierten, ein kleiner, hagerer Mann mit dicken Tränensäcken unter den wäßrigen Augen, sagte barsch: «Gehen Sie weiter, Lady. Gehen Sie nach Hause. Sie erfahren alles in den Elf-Uhr-Nachrichten.»
«Bitte. Ich bin Ärztin. Ich bin in Sorge wegen eines Patienten von mir –»
Er winkte herablassend ab, drehte sich um und ging zu dem himmelblauen Übertragungswagen von Kanal Acht, der gerade vorfuhr.
Sein Kollege, ein junger Mann mit einer krummen Nase und den breiten Schultern eines Footballspielers, blieb an Ort und Stelle. Er blickte sie interessiert an. «Haben Sie gerade was von einem Patienten gesagt?»
«Ich bin Psychologin. Vor etwa zwanzig Minuten hat mich ein Patient angerufen, der sehr aufgewühlt klang. Möglicherweise selbstmordgefährdet.»
«Hat er gesagt, daß er im Museum ist», fragte der athletische Cop.
«Nein. In einem Lokal namens Cuppa’s.»
«Wie bitte?»
Caroline deutete hinter sich. «Ein Café, es liegt ein Stück die Straße hinunter. Dort gibt es aber kein öffentliches Telefon.»
«Und?»
Wieder deutete sie, diesmal an der Schulter des Beamten vorbei. «Es könnte sein, daß er von dem Telefon da vorne angerufen hat. Oder von einem Telefon im Museum.»
«Wie ist sein Name?»
«Können Sie mir nicht sagen, wer da drin ist? Wenn es mein Patient ist, dann –»
«Sie meinen, er ist selbstmordgefährdet?»
Caroline schluckte. Ihr Rachen war rauh. «Ja.»
«Na dann», sagte der Uniformierte, «müssen Sie sich wohl keine Sorgen machen.»
«Wie meinen Sie das?»
«Der Typ da drin hat sich nicht selbst umgebracht. Den hat einer kaltgemacht.»
«Ermordet?» Sicherlich nicht Steve Kramer. Wieso hätte ihn jemand umbringen sollen?
«Ist er schon identifiziert worden?» fragte sie.
Kurzes Schweigen. «Wie alt ist denn Ihr Bursche? Wie sieht er aus?»
Caroline runzelte die Stirn. «Er ist kein Bursche.»
«Hören Sie, Doc …»
«Na gut, er ist Ende Dreißig.» Caroline versuchte, sich an das genaue Alter zu erinnern. «Achtunddreißig, glaube ich. Nein, neununddreißig», berichtigte sie sich, weil ihr eingefallen war, daß sie vor nicht allzu langer Zeit in der Gruppe über Kramers Angst vor seinem bevorstehenden vierzigsten Geburtstag gesprochen hatten.
«Schön.» Der Beamte wurde ungeduldig. «Sonst noch was?»
«Größe und Gewicht durchschnittlich. Um die einsfünfundsiebzig. Gewicht so gegen die achtzig Kilo. Braunes Haar, akkurat geschnitten. Sieht sympathisch aus. Gut gekleidet. Meistens Anzug und Krawatte. Teuer.»
«Irgendwelche besonderen Kennzeichen? Narben? Muttermale? Zum Beispiel am rechten Oberschenkel?»
«Ich bin Psychologin. Seine Oberschenkel habe ich nie zu Gesicht bekommen», sagte Caroline knapp.
Der Cop rieb sich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken, dann zeigte er auf sie. «Warten Sie hier, Doc. Ich rede mal kurz mit meiner Vorgesetzten.»
Caroline zog ihren wollenen Blazer enger um sich, obwohl es ein recht warmer Aprilabend war.
Jill Nugent, eine adrette, energische Reporterin von Kanal Acht, hatte Caroline mit dem Polizisten reden sehen und versuchte jetzt, ihr Informationen zu entlocken.
«Ich weiß gar nichts. Ehrlich», sagte Caroline mit Nachdruck. Sie wollte weggehen, als eine zweite Frau sie von hinten ansprach.
«Sind Sie die Psychologin?»
Caroline fuhr herum. Im Gegensatz zu der schlanken, blonden Reporterin in den Zwanzigern mit dem eleganten Kostüm war diese Frau klein und dunkelhaarig, aber trotz des maskulinen Blazers und der marineblauen Bluse wirkte sie sehr hübsch.
«Ja», sagte Caroline.
Die Reporterin wurde gleich wieder munter. «Detective, seien Sie doch so lieb und geben Sie mir ein paar Informationen. Was ist da drinnen los? Wer ist das Opfer?»
«Kein Kommentar», zischte die Beamtin.
Nugent wandte sich wieder Caroline zu. «Was haben Sie als Psychologin mit der Sache zu tun? Dürfte ich Ihren Namen erfahren, Doc? Haben Sie irgendeine Ahnung, wer den Sexualmord begangen hat?»
Caroline blinzelte. «Sexualmord?»
Die Polizeibeamtin trat auf die Reporterin zu, ihr Kopf reichte gerade bis zu Nugents kecker Nase. «Zischen Sie ab.»
«Verdammt.» Nugent drehte sich widerwillig um und ging zu einem der Polizisten, der am Wagen der Spurensicherung stand.
Die Beamtin verdrehte die Augen und wandte sich dann wieder Caroline zu.
«Ich bin Lieutenant Amy DeSanto. Detective bei der Mordkommission. Einer meiner Jungs sagt, Sie vermissen einen Mann, der nicht ganz richtig im Kopf ist, und Sie meinen, es könnte unser Toter sein.»
«Haben Sie das Opfer identifiziert?» fragte Caroline.
Lieutenant DeSanto schüttelte den Kopf. «Wie wär’s, wenn wir mal nachsehen, ob es Ihr Spinner ist?»
«Er ist kein Spinner», sagte Caroline scharf.
DeSanto zuckte die Achseln. «Sie müssen es ja wissen.»
Caroline hatte früher schon Tote gesehen und zudem während des Studiums im Anatomieseminar so manche Leiche seziert. Beim ersten Mal war ihr schlecht geworden, denn der Geruch war fast noch schlimmer als der Anblick, aber sie hatte es als Herausforderung betrachtet und das Seminar schließlich mit Bestnote abgeschlossen. Das war nichts Neues. Erstklassige Studentin. Mit Lerneifer. Mit dem Drang, sich zu beweisen. Dem Drang, die Beste zu sein.
Aber bei dieser Leiche war das anders. Die Szene war obszön. Grauenvoll. Der Mann war splitternackt, der Oberkörper über die Knie geklappt, auf dem kalten Marmorboden hinter einer gewölbten Trennwand in einem leeren Ausstellungssaal. Der Kopf war nach rechts gedreht, so daß es aussah, als blickten die offenen, stark vorquellenden grauen Augen hinauf zur kuppelförmigen Decke. Oder zum Himmel? Falls er Gott um Hilfe angefleht hatte, dann war es ein stilles Gebet gewesen. Man hatte ihm ein blaßblaues Oberhemd in den Mund gestopft, wie einen riesigen Stöpsel.
Am grausigsten war das Gesicht. Es war bläulich angelaufen und grotesk verquollen. Das Blut um Mund und Nase schien noch feucht. Caroline hätte auch ohne ihr Medizinstudium gewußt, daß diese gräßliche Verletzung von der dicken Metallkette herrührte, die wie ein Lasso um den Hals des Toten geschlungen und so fest zugezogen war, daß sie ihm tief ins Fleisch schnitt.
Caroline wandte den Blick ab. Sie hatte das Mordopfer zwar noch nie gesehen, aber es durchlief sie schaudernd eine Welle des Mitleids für diesen Mann, der auf so grausame Weise ermordet worden war. Offensichtlich hatte er entsetzliche Angst und Demütigungen durchlitten, bevor ihm brutal der Hals zugeschnürt worden war. Caroline kannte sich aus mit Angst und Demütigungen. Sie wußte, was es hieß, jemandem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein. Mit dem Unterschied, daß sie überlebt hatte. Aber ums Überleben galt es tagtäglich zu kämpfen. Manchmal vergaß Caroline es beinahe. Dieser Anblick war für sie eine schauerliche und tragische Mahnung.
Ein kurzes Stück von Carolines Standort entfernt, innerhalb des mit gelbem Polizeiband abgetrennten Bereichs, waren zwei Detectives damit beschäftigt, gewissenhaft die Kleidung des Ermordeten zu durchsuchen, die in einem Bündel neben ihm lag. Außer den Leuten von der Spurensicherung waren ein halbes Dutzend Detectives, mehrere uniformierte Beamte, ein Videokameramann und eine Fotografin bei der Arbeit. Zwei Sanitäter, die neben einer Trage auf Rädern standen, und ein dritter mit einem Leichensack über dem Arm warteten darauf, das Opfer wegzubringen. Für sie alle reine Routine.
«Das ist nicht mein Patient», sagte Caroline, wobei sie Mühe hatte, die Worte deutlich auszusprechen. «Diesen armen Mann habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.» Sie hatte ein flaues Gefühl im Magen.
Amy DeSanto musterte sie eingehend. «Sind Sie sicher?»
«Absolut.» Caroline nahm die Schultern zurück und blickte DeSanto unverwandt an. Ihre Übelkeit ließ ein wenig nach.
«Okay. Reden wir über Ihren verschwundenen Patienten», sagte die Beamtin unbeeindruckt. «Der Bursche ist wohl nicht zufällig eine Schwuchtel? Eine Schwuchtel, die gerne Damenkleidung anzieht? Die auf Sadomaso steht? Auf das ganze perverse Zeugs? Könnte es sein, daß er und das Opfer sich so richtig aufgegeilt haben, bis unser bedauernswerter Freund gemerkt hat, daß seine Sie ein Er ist, und ausgerastet ist?»
«Mein Patient ist nicht schwul. Und er ist kein Transvestit», sagte Caroline. Aber Steve Kramer war ein Voyeur. War es möglich, daß er im Museum gewesen war und die Begegnung der beiden beobachtet hatte? Vielleicht sogar den Mord? Das wäre jedenfalls eine Erklärung dafür, warum er sie angerufen und so aufgeregt geklungen hatte.
«Ist Ihnen was eingefallen, Doc?» fragte DeSanto.
Caroline zögerte. «Nein.»
«Nennen Sie mir bitte den Namen», sagte DeSanto. «Von Ihrem Patienten.»
«Ich kann Ihnen seinen Namen nicht geben. Der unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht.»
«Ach ja? Hören Sie, ich habe hier einen verdammt abscheulichen Mord aufzuklären –»
«He, Lieutenant, ich habe was gefunden.» Der Uniformierte, mit dem Caroline sich kurz unterhalten hatte, kam herbeigeeilt. In der Hand hielt er einen durchsichtigen Plastikbeutel. Als er näher kam, sah Caroline, daß sich darin ein brieftaschengroßes Foto befand.
DeSanto zog sich einen Gummihandschuh über und nahm den Fund entgegen.
«Das ist eindeutig das Opfer», sagte der Cop. «Sieht auf dem Foto sehr viel besser aus. Auch die Frau ist nicht schlecht. Sehen Sie auf der Rückseite nach. Er hat ihren Namen draufgeschrieben …»
«Wo haben Sie das gefunden?» unterbrach DeSanto ihn.
«Auf der … äh … Damentoilette in der Eingangshalle, Lieutenant. Auf dem Boden in einer der Kabinen. Zwei unserer Leute suchen da nach Fingerabdrücken. Vielleicht waren sie ja zuerst da drin.»
«Die Damentoilette direkt neben den Telefonzellen?»
«Genau, Lieutenant.»
DeSanto betrachtete das Foto in ihrer Hand. «Gute Arbeit, Saunders.»
Den Beamten schien das Kompliment mit Stolz zu erfüllen. Er stand da, als erhoffte er sich mehr, bis DeSanto ihn ansah und dabei ihre hübsch geschwungenen Brauen hochzog. Nach kurzem verlegenen Scharren mit den Füßen machte er sich davon.
Jerry Vargas von der Bezirksstaatsanwaltschaft, ein großer, gertenschlanker Mann mit glatt nach hinten gekämmtem grauem Haar, kam zu ihnen. DeSanto gab ihm den Beutel mit dem Foto. Er nickte und ging mit dem Beweisstück davon.
«Ich bin hier nur im Weg», sagte Caroline und wollte hinterhergehen.
DeSanto zog einen kleinen Notizblock aus der Tasche. «Was ist mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse, Doc? Fallen die auch unter die Schweigepflicht?»
Carolines Miene verhärtete sich. «Ich bin Dr. Caroline Hoffman. Wozu wollen Sie meine Adresse?»
«Für den Fall, daß ich noch irgendwelche Fragen habe.» DeSantos Miene war so hart wie Carolines. Und in ihrer Stimme lag ein noch schärferer Unterton.
«Wir sind hier fertig, Amy», unterbrach sie ein Mann von der Spurensicherung mit einer Videokamera in der Hand.
Caroline nahm eine Visitenkarte aus ihrer Handtasche, ließ sie auf den Notizblock der Polizeibeamtin fallen und ging.
DeSanto studierte die Karte, steckte sie in die Jackentasche und sah nachdenklich hinter Caroline her.
DeSantos Kollege, Detective Alfonse Green, kam zu ihr. Er folgte DeSantos Blick. «Wer ist das?»
«Eine arrogante Ziege», brummte DeSanto.
«Meinst du, sie hat es getan?»
«Wer weiß», sagte DeSanto kühl. «Jedenfalls hat sie hier herumgelungert.»
Green, seit zwanzig Jahren bei der Polizei, gut zwölf Jahre länger als DeSanto, warf ihr einen Blick zu, sagte aber nichts.
Als Lieutenant DeSanto eine halbe Stunde später das Museum verließ, sah sie die Fernsehreporterin, die zuvor versucht hatte, ihr Informationen zu entlocken. Sie nickte ihr zu. Nugent gab ihrem Kameramann ein Zeichen, und sie kamen angerannt.
«Was können Sie mir sagen, Lieutenant?»
«Sie wollten doch den Namen von der Psychologin wissen, mit der ich gesprochen habe.»
Jill Nugent zeigte ein Lächeln wie aus der Zahnpastawerbung. «Ich habe ja gewußt, daß Sie was für mich haben würden, Lieutenant.»
«Ihr Name ist Dr. Caroline Hoffman.»
«Was hat sie mit dem Mord zu tun?» fragte Nugent, während sie die Information rasch auf ihrem Block notierte.
«Das wissen wir noch nicht, Jill. Möglicherweise war sie nur rein zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber andererseits fangen unsere Ermittlungen jetzt erst an.»
4
Caroline kam ihre Wohnung viel zu leer und still vor. Sie wünschte, Martin wäre noch hier. Sie hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als zu ihm ins Bett zu kriechen, seine Arme um sich zu spüren, sich von ihm halten und trösten zu lassen – zumindest durch die Wärme seines Körpers.
Sie überlegte, ob sie ihn anrufen und bitten sollte zurückzukommen, aber da fiel ihr ein, daß er in aller Frühe aufstehen mußte, um seine Maschine nach Pittsburgh zu kriegen. Martin wollte sich nach einer Wohnung umsehen. Er hatte vorgeschlagen, daß sie übers Wochenende nachkommen sollte, aber sie hatte erwidert, sie müsse arbeiten – was zwar stimmte, aber auch eine Ausrede war.
Martin hatte sie nicht gedrängt. Hatte sie gehofft, er würde sie drängen?
Caroline war jetzt nicht in der Stimmung, ihre Motive zu ergründen. Statt dessen konzentrierte sie ihre Gedanken auf ihren verstörten und verschwundenen Patienten und rief ihn zu Hause an.
Sein Anrufbeantworter sprang an. «Hier ist der Anschluß von Dr. Steve Kramer. Ich bin im Augenblick nicht erreichbar, aber wenn …»
Interessant, daß er sich noch immer als «Doktor» bezeichnete, dachte Caroline, während der Ansagetext durchlief.
Nach dem Pfeifton nannte sie ihren Namen und bat ihn, doch so bald wie möglich ihren Auftragsdienst anzurufen, damit sie ihn zurückrufen könne. Sie wiederholte, wie wichtig es sei, daß er den Termin am nächsten Morgen um zehn Uhr einhielt. Mehr konnte sie nicht tun.
Caroline ließ sich müde aufs Sofa fallen, streifte die schwarzen Lederpumps ab, legte die nackten Füße auf die Glasplatte ihres Couchtisches und ließ den hämmernden Kopf auf das weiche graue Velourspolster sinken. Sie schloß die Augen. Im gleichen Augenblick sah sie das entsetzliche Bild von dem toten Mann im Museum vor sich, und dann Steve Kramer. Sie riß die Augen auf.
Vielleicht würde sie doch am Freitag nach Pittsburgh fliegen und Martin überraschen.
«Langsam, Süßer. Laß mich doch erst mal zu Atem kommen.»
Jesse Baush, ein muskulöser Mann mit rotem, kurz geschnittenem Haar, blauen Augen und Sommersprossen, mit denen fast sein ganzer nackter Körper übersät war, hatte Amy DeSantos noch zugeknöpfte Bluse bis unter die Arme hochgeschoben und schmiegte bereits den Kopf an ihre Brüste.
«Wirklich, Jesse, nicht so hastig», murmelte Amy. «Ich hatte einen verdammt harten Tag. Ich wollte eigentlich gar nicht vorbeikommen, so fertig bin ich. Aber dann habe ich gedacht, daß es dumm wäre, direkt nach Hause zu fahren, um mir anzuhören, wie Vincent vor sich hin schnarcht.»
Baush hob widerwillig den Kopf von Amys vollen Brüsten und blickte der hübschen Brünetten ins Gesicht. «Ein schlimmer Tag? Dann erzähl Daddy mal alles», säuselte er, während er ihr die Bluse über den Kopf hochzog.
«Wir haben einen richtig harten Fall. Ein Toter im Bullfinch Art Museum. Hatte nichts an außer seinem Adamskostüm und einer Würgekette fest um den Hals. Kein hübscher Anblick.»
«Irgendwelche Spuren?» Baush glitt mit den Händen auf DeSantos Rücken, öffnete ihren BH-Verschluß. So leicht ließ er sich schließlich nicht ablenken.
DeSanto gab ihm neckisch einen Klaps auf die Wange, ließ sich aber dann ganz langsam die Bluse über den Kopf ziehen, wobei ihr die BH-Träger von den Schultern rutschten. «Ein Wärter hat gesehen, wie er, kurz bevor er das Museum schließen wollte, von einer kurvenreichen Lady in einem kurzen, hautengen schwarzen Kleid angesprochen wurde. Sie hatte was von einem Flittchen, sah aber toll aus. So die Worte des Wärters. Er hat sie für eine Professionelle gehalten.»
«Bestimmt eine Edelnutte», überlegte Baush und ließ ihren BH auf den Teppich fallen. «Arbeitet in Kunstmuseen. Glaubst du, die Nutte hat ihn kaltgemacht?» Da er im Sittendezernat arbeitete, wurde sein Interesse allmählich größer.
«Ich weiß nicht. Könnte auch sein, daß irgendein Psychopath der Killer ist.»
«Wie kommst du darauf?» Baush fingerte am Reißverschluß ihres Wollrockes.
«Weil am Tatort so eine Psychotante aufgetaucht ist. Hat nach einem ihrer Patienten gesucht, der sie vom Museum oder von irgendwo in der Nähe aus angerufen hat. Angeblich hat er sie etwa um die Zeit des Mordes herum angerufen.»
«Was weißt du über den Patienten?» Baush runzelte die Stirn. Der Reißverschluß klemmte.
«Absolut nichts.» DeSanto hielt inne, um ihm zu helfen. «Diese arrogante Ziege hat mir irgendeinen Scheiß von ärztlicher Schweigepflicht erzählt. Ich werde mich mal ein bißchen umhören. Und dann statte ich der Dame einen Besuch ab. Stell dir vor. Sie arbeitet in einer Klinik, die sich ‹Psychiatrisches Institut› nennt. Dr. Hoffman. Caroline Hoffman.» Amy stieg aus ihrem Rock und griff nach seinem halb erigierten Penis. «Willst du weiterquatschen, oder willst du ein wenig Action?» fragte sie neckend.
Baush hörte nicht zu. Er starrte ihr ins Gesicht, als wäre darin eine geheime Botschaft versteckt.
«Süßer?» Als sie keine Antwort bekam, flüsterte sie: «Jesse, was ist los?»
«Hast du gesagt, Caroline Hoffman?»
«Du kennst sie?»
«Das kann man wohl sagen.» Baush blickte jetzt über DeSantos nackte Schulter.
«Also. Erzählst du’s mir?»
Er antwortete nicht.
Amy bemerkte, daß ihr Liebhaber seine Erektion vollständig verloren hatte. «He, Baby. Anscheinend hat es dir nicht nur die Sprache verschlagen.»
Als Jesse ihr wegen der Stichelei nicht einmal einen bösen Blick zuwarf, wußte Amy DeSanto, daß sie genausogut nach Hause zu ihrem schnarchenden Mann fahren konnte.
Mittwoch
5
Jesse Baush trommelte mit den Fingerknöcheln gegen die Scheibe. Dann steckte er, ohne auf eine Reaktion von der anderen Seite der Tür zu warten, den Kopf ins Büro von Louis Washburn, dem Leiter der Mordkommission. Es war kurz nach fünf Uhr früh und nicht verwunderlich, daß Washburn Überstunden machte.
Der beleibte Mann trank gerade in großen Zügen aus einer Limodose. Weil er die vor dem Gesicht hatte, konnte er seinen Besucher nicht sehen. Er trank weiter, senkte ein wenig die Dose, blickte zu Baush hinüber und winkte ihn herein.
«Was machen Sie denn hier, Jesse?» fragte Washburn.
«Ich habe von dem armen Teufel gehört, den es gestern abend im Bullfinch erwischt hat», sagte Baush. «Es heißt, er wurde von einer Frau erledigt, möglicherweise einer Nutte. Ich dachte, Sie könnten vielleicht Hilfe von der Sitte brauchen.»
«Habt ihr irgendwelche Nutten, die auf Würgeketten stehen?»
«So auf Anhieb fällt mir keine ein. Wissen Sie schon mehr, Chief?»
Washburn drückte sich eine fleischige Faust in die Magengrube und rülpste. Dann kramte er aus dem Wust von Papieren auf seinem Schreibtisch ein paar Blätter hervor. «Ein vorläufiger Bericht vom Labor. Es gab am Tatort nicht nur keine Fingerabdrücke, der Täter oder die Täterin hat dem armen Kerl auch noch den Schwanz und die Eier mit Spiritus abgewischt, wie die Jungs vom Labor meinen. Was halten Sie davon?»
«Könnte bedeuten, daß der- oder diejenige schon mal was von DNS gehört hat.»
Der Chief senkte die Limodose. «Möglich. Aber die meisten Nutten belegen keine Seminare in Genetik.»
«Falls die Frau wirklich eine Nutte war», sagte Baush leichthin.
«Oder aber wir haben es mit einem Sauberkeitsfanatiker zu tun.» Washburn trank die Limo aus, zerdrückte die Dose in seiner großen, dicken Pranke und warf sie durch den Raum. Sie verfehlte den Papierkorb um Armeslänge und landete praktisch vor Baushs Füßen.
Baush betrachtete die Dose, überlegte, ob er sie in den Abfalleimer werfen sollte. Er rührte sich nicht.
«Die Untersuchung der Haare und Fasern ist noch nicht abgeschlossen, aber bislang stammen sie eindeutig vom Opfer», sagte Washburn und unterstrich seine Worte mit einem weiteren lauten Rülpser.
«Ist die Leiche schon identifiziert?» fragte Baush.
«Ja. Der Tote heißt Peter Korza. Wohnte in Somerville. Ein Geiger. Wie Nora Oswain, die Freundin, die ihn identifiziert hat. Wir hatten schon gedacht, daß sie vielleicht unsere Nutte sein könnte. Aber ein Nachbar hat ihr ein Alibi gegeben.» Washburn nahm sein halbgegessenes Sandwich, belegt mit Roastbeef, Cheddar und Paprika, und biß kräftig hinein. Dabei tropfte ihm ein Klecks Senf auf die Krawatte.
Baush versuchte, nicht auf den leuchtendgelben Fleck zu starren. «Haben Sie gehört, daß am Tatort eine Psychologin aufgetaucht ist, die nach einem verschwundenen Patienten gesucht hat? Weil sie meinte, er wäre vielleicht der Tote?»
«Woher in Gottes Namen wissen Sie das alles, Baush? Aber ich kann’s mir ja denken», brummte Washburn.
Baush lächelte zweideutig.
Washburn zeigte mit dem Finger auf ihn. «DeSanto sollte sich weniger über Sie als über ihren Papierkram hermachen, sonst kriegt sie’s mit mir zu tun. Bestellen Sie ihr das. Also, von welcher Psychologin ist hier die Rede?»
«Raten Sie.»
Der Chief warf Baush seinen allerbösesten Blick zu. Er mochte keine albernen Ratespielchen.
Obwohl Jesse wußte, daß es kein kluger Schachzug war, konnte er es sich nicht verkneifen, ihn weiter auf die Folter zu spannen. «Eine alte Freundin von Ihnen.»
«Ich habe viele alte Freundinnen, Baush.»
«Linny.»
«Ach du Scheiße.»
Auf Baushs Gesicht erschien ein Lächeln, bis er begriff, daß der Chief nicht wegen Linny geflucht hatte, sondern weil ihm der Senffleck auf seiner teuren Krawatte aufgefallen war.
«Sie erinnern sich doch an meine Stiefschwester, Chief. Caroline Hoffman. Sie haben sie vor vierzehn Jahren verhaftet. Und dann mußten Sie zusehen, wie man sie laufenließ. Sie ist jetzt Psychologin. Wenn das nicht dem Faß den Boden ausschlägt.»
Washburn brauchte ein paar Sekunden. «Und sie war am Tatort?»
«Kurz nachdem der Museumswärter gesehen hat, wie die Nutte sich an Korza rangemacht hat.»
Washburn wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
«Vielleicht ist sie ja die Täterin», sagte Baush. Sein sanfter Ton paßte nicht zu dem harten Glanz in seinen Augen.
«Halten Sie Ihre Schwester wirklich für so verkorkst?»
«Stiefschwester», korrigierte Baush rasch.
Washburn musterte den Detective skeptisch. «Es ist zwar lange her, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß Ihre Stiefschwester sich an wildfremde Männer ranmacht …»
«Da bin ich mir nicht sicher», sagte Baush.
«Andererseits», fuhr Washburn fort, als wäre er nicht unterbrochen worden, «gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht war Korza kein Fremder. Und vielleicht hat Linny nicht mit ihm gebumst. Vielleicht hat sie ihn dabei erwischt, wie er mit jemand anderem rumgemacht hat.»
«Nun ja, Chief, wir wissen beide, daß Linny ganz schön temperamentvoll ist.»
Caroline saß am Küchentisch und trank bereits die dritte Tasse Kaffee. Sie sah auf ihre Armbanduhr: 5.55 Uhr. Ihr erster Termin war erst um neun. Sie überlegte, ob sie wieder ins Bett gehen und versuchen sollte, noch ein wenig zu schlafen, aber sie wußte, daß ihr das auch jetzt nicht besser gelingen würde als im Verlauf der Nacht, in der sie fast ununterbrochen von Visionen des brutal ermordeten Mannes gequält worden war, sich Sorgen um ihren Patienten Steve Kramer gemacht und sich vorgeworfen hatte, nicht liebevoller zu Martin gewesen zu sein.
Sie blickte auf den kleinen Fernseher auf der Arbeitsplatte in ihrer Küche. Noch Zeit genug, um die Frühnachrichten mitzukriegen. Als Caroline um Punkt sechs auf Kanal Acht schaltete, erkannte sie in der Moderatorin sofort die blonde Reporterin, die sie vor dem Museum bedrängt hatte.
Bestürzt hörte sie, daß die Nachrichten mit ihrem Namen begannen.
«Dr. Caroline Hoffman, eine zweiunddreißigjährige Psychologin am Psychiatrischen Institut des Boston General Hospital, wurde gestern abend von Detective Amy DeSanto von der Mordkommission verhört, nachdem ein Wärter die unbekleidete Leiche von Peter Korza, Geiger bei den Bostoner Symphonikern, hinter einer Trennwand in einem unbenutzten Saal im hinteren Teil des Bullfinch Art Museum an der Huntington Avenue entdeckt hatte. Korza ist gestern abend irgendwann zwischen neun Uhr, als er zuletzt lebend gesehen wurde, und neun Uhr fünfundvierzig, als sein Leichnam aufgefunden wurde, erdrosselt worden. Nach unbestätigten Informationen wurde das Opfer möglicherweise vor der Erdrosselung vergewaltigt. Interessanterweise konnten wir in Erfahrung bringen, daß Dr. Hoffman auf die Behandlung von sexuell abweichendem Verhalten spezialisiert ist und eine wöchentliche Therapiegruppe von Männern und Frauen leitet, die an schwerwiegenden Formen sexuellen Suchtverhaltens leiden …»
Caroline stellte wütend den Fernseher ab. Sie hatte keinen Zweifel daran, wie die Moderatorin an ihren Namen gekommen war.
Aufgebracht starrte sie das Telefon an und überlegte, ob sie bei der Mordkommission anrufen und DeSanto gründlich die Meinung sagen sollte. Als es plötzlich klingelte, fuhr sie zusammen.
«Habe ich dich geweckt?» fragte Martin.
«Nein», sagte Caroline. «Ich war schon auf.»
«Ich habe gerade noch schnell ein paar Sachen in den Koffer gepackt und hatte den Fernseher an …»
«Laß mich raten. Jill Nugent und die Frühnachrichten?»
«Was hat das zu bedeuten, Caroline? Ist der Tote der Patient, den du gestern abend retten wolltest?»
«Nein. Den armen Mann habe ich noch nie im Leben gesehen.»
«Wieso hat sie dich dann in die Geschichte reingezogen? Dieser Patient von dir, was ist mit ihm?»
Caroline seufzte. Der typische Verhörton. Nein, das war nicht fair. Martin fragte, weil er um sie besorgt war. «Er kann unmöglich etwas damit zu tun haben. Mein Patient hatte nie homosexuelle Neigungen.»
«Hat er sich noch mal gemeldet? Dein Patient?» fragte Martin.
«Nein. Ich habe eine Nachricht auf seinen Anrufbeantworter gesprochen.» Ein Donnerschlag ließ es in der Leitung knistern. «Martin, bist du noch da?»
«Mist. Ich hoffe, das Unwetter hat sich gelegt, bis ich am Flughafen bin. Ich hasse nichts mehr, als an Flughäfen rumzuhängen und zu warten.»
«Ja, das nervt», stimmte Caroline zu. «Hör mal, Martin –»
«Ich muß los. Um diese Zeit ist im Callahan-Tunnel bestimmt Stau. Tu mir den Gefallen und handle dir keinen Ärger ein, während ich weg bin», sagte er heiter.
«Ich habe mir gedacht –»
«Behalte den Gedanken bis Montag. Ich muß los.»
Die Verbindung war unterbrochen.
Meg wurde von dem durchdringenden Klingeln des Telefons aus dem Tiefschlaf gerissen. Während sie nach dem Hörer tastete, warf sie blinzelnd einen Blick auf den Wecker. 6.10 Uhr.
Leises Weinen am anderen Ende der Leitung.
«Mutter? Bist du das?» Wer außer ihrer Mutter würde zu dieser unchristlichen Zeit anrufen und in den Hörer schluchzen?
«Ich bin … in Schwierigkeiten. Du mußt … mir helfen.»
Eindeutig nicht ihre Mutter. Die tränenerstickte, unbekannte Stimme eines Mannes.
«Wer ist denn da? Hören Sie, Freundchen, Sie haben sich verwählt.»
«Meg? Ist da nicht Meg Spaulding?»
«Wer ist denn da?»
«Sie haben mich … ins Gefängnis gesteckt, Meg. Ich kann nicht … O Gott, ich drehe hier durch. Bitte. Bitte … Ich muß hier raus. Du bist die einzige, Meg, die mir … die mir helfen kann.»
«Wer sind Sie, verdammt noch mal?»
«Steve.»
«Welcher Steve?»
«Steve Kramer. Du weißt doch. Aus der … Gruppe.»
«Himmel. Was machst du denn im Gefängnis?»
«Ich habe mich blöd angestellt. So unglaublich blöd …»
«Hast du was genommen? Du klingst, als wärst du high.»
«Ich brauche fünftausend Dollar, Meg.»
«Wie bitte?»
«Um hier rauszukommen. Kaution. Und einen Vorschuß für meinen Anwalt, diesen Blutsauger …»
«Es ist sechs Uhr morgens. Und ich verreise in zwei Stunden. Mensch, es tut mir leid, daß du im Knast sitzt, aber ich –»
«Sag mal, Meg, wissen deine Kollegen eigentlich, was für eine Kunstliebhaberin du bist? Weiß deine Chefin das? Und deine Familie? Dein Bruder hat doch eine Galerie, nicht wahr? Vielleicht würde er gerne wissen, daß seine Schwester seine Kunstleidenschaft teilt. Ja, wirklich, Meg, du bist eine sehr leidenschaftliche Frau.»
«Ich weiß nicht, wovon du redest.»
«Ein richtige Superfrau. Was soll’s. Du gehst eben auf die Damentoilette und nicht in eine Telefonzelle, wenn du dich zurechtmachst.»
«Du bist ein Schwein.»
«Nur wenn ich keine andere Wahl habe. Ansonsten bin ich ein ganz netter Mensch. Aber Meg, wenn ich nicht bald hier rauskomme, weiß ich nicht, was ich mache. Wirklich nicht.»
Meg starrte auf ihren grauen Flanellbettbezug. Er sah aus wie ein bedeckter Himmel. Als zöge ein Unwetter herauf.
Kurz nach halb sieben war Meg Spaulding in der vornehmen Stadthauswohnung ihres Bruders auf der Beacon Street; im Erdgeschoß war die Spaulding Art Gallery, und gegenüber lag der weltberühmte Boston Public Garden.
«Das soll wohl ein Witz sein», sagte Ned und rieb sich schlaftrunken die Augen, nachdem er seinen marineblauen Seidenbademantel zugebunden hatte.
Megs Bruder, ein schlanker, kräftig wirkender Mann, war fünf Zentimeter größer als seine Schwester und hatte die gleichen feingeschnittenen Gesichtszüge. Er war ausgesprochen gutaussehend, obwohl ihm jetzt die dunklen Haare zu Berge standen, wodurch er ein wenig an einen zerstreuten Professor erinnerte.
Meg folgte ihm in die moderne, durchgestylte Küche mit dem schwarzweiß gefliesten Boden, den ganz in Weiß gehaltenen Schränken und den grauen Arbeitsflächen. Sie selbst hatte die Neugestaltung geleitet.
Ned nahm den Kessel vom Herd und füllte ihn mit Wasser. «Tee?»
«Ned, ich hab’s eilig. Ich muß zum» – beinahe hätte sie gesagt: «zum Polizeirevier», aber sie besann sich rasch – «zum Flughafen, meine Maschine nach New York geht um acht.»
Er stellte den Kessel zurück auf den Herd und schaltete die Kochplatte an. «Wozu um alles in der Welt brauchst du in aller Herrgottsfrühe so viel Geld?»
«Das ist eine lange Geschichte.»
Ned lehnte sich gegen die Arbeitsplatte neben dem Herd. «Ich habe Zeit.»
«Ich aber nicht. Du sollst es mir doch nur leihen, Ned. Mein Gott, du weißt, du kriegst es wieder. Ich mache noch heute von New York aus die Überweisung. Okay?»
Seine Miene wurde ernst. «Natürlich gebe ich dir das Geld. Ich hab’s unten in der Galerie im Safe. Es dauert nur ein paar Minuten.»
Meg lächelte schwach. «Danke, Ned.»
Er trat auf sie zu und legte ihr sanft die Hände auf die Schultern. «Meg, steckst du in Schwierigkeiten?»
«Nein. Das ist es nicht.»
«Was dann? Du weißt, du kannst es mir sagen. Wir erzählen uns doch immer alles, oder?»
«Es ist für einen … Freund.» Sie konnte ihm nicht in die Augen sehen.
«Einen Freund? Ein Freund, der fünftausend Dollar braucht, bevor die Bank aufmacht?»
«Bitte, Ned …»
«Du siehst fertig aus, Meg.»
Sie versuchte zu lächeln, brachte aber nur ein Zucken zustande. «Die Arbeit, das ist alles. Ich brauche mal wieder Urlaub. Zur Zeit weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht.»
«Komm dieses Wochenende mit auf Martha’s Vineyard. Ich will Mom helfen, den Dachboden auszumisten. Vielleicht finden wir einen vergessenen Schatz.»
«Ich bin Freitag wieder zurück. Wenn ich mich loseisen kann, komme ich mit. Einverstanden?»
Ned strich ihr liebevoll über die Wange. «Wenn ich dir auch nur eine Minute lang glauben könnte, wäre das schön, Schwesterchen.»
6
Erpressung. Entdeckung. Schande. Erniedrigung.
Auf der Taxifahrt vom Polizeirevier zum Flughafen stellte Meg Spaulding sich vor, wie eine ungeheure Wasserwoge brausend über sie hinwegtoste und sie in den mächtigen Sog riß. Sie wirbelte hilflos herum, schnappte nach Luft, Flüssigkeit drang ihr in die Lungen. Sie konnte nicht atmen. Sie ertrank.
Die Erlösung kam in dem Augenblick, als sie in eine Kabine auf der Damentoilette am Logan Airport schlüpfte und ihr Geschäftskostüm auszog, als wäre es verseucht. Dann nahm sie aus ihrem Handkoffer den schwarzen Seidenslip, die Lacklederpumps mit den aufreizend hohen Absätzen, das hautenge schwarze Jerseykleid.
Die vollständige Verwandlung – Kleidung, Perücke, ein neues Paar Kontaktlinsen aus ihrem Vorrat, Make-up – vollzog sich binnen Minuten. Aber Meg nahm nicht einmal diese kurze Zeitspanne wahr. So sehr war sie in den rituellen Ablauf ihrer Verwandlung vertieft.
Martin Bassett sah die Zeitschriften an einem der Flughafenkioske durch, um etwas zum Lesen zu finden, bis das verdammte Unwetter vorbei war und die Flugzeuge wieder starten konnten. Sein Flug nach Pittsburgh war auf 8.25 Uhr verschoben worden, doch ohne eine deutliche Wetterverbesserung war nicht abzusehen, wann die Maschine wirklich starten würde.
Ein Mannequin auf der Titelseite der Zeitschrift ELLE erregte seine Aufmerksamkeit. Die Frau erinnerte ihn an Caroline. Das lag weniger an den augenfälligen Attributen – obgleich beide Frauen schulterlanges braunes Haar und einen ähnlichen dunklen Teint hatten –, sondern eher an dem betörenden Schimmer in den grauen Augen, der geschwungenen Form des vollen Mundes, dem trotzigherausfordernd geneigten Kopf.
Als Martin Caroline Hoffman kennenlernte, hatte er sie als verführerisch und reizvoll, aber dennoch einschüchternd empfunden. Und das hatte nichts damit zu tun, daß sie fünf Jahre älter war als er. Männer, die doppelt so alt waren wie er – und davon gab es einige am Institut –, hatten den gleichen Respekt vor ihr.
Martin spürte, wie Erregung in ihm aufstieg.
Er genoß den verblüffenden Gegensatz zwischen Carolines kühler Professionalität am Institut und der gierigen Leidenschaft, wenn sie mit ihm schlief. Meistens. Gestern abend war allerdings ein totaler Reinfall gewesen. Seine Schuld. Hätte er doch bloß den Mund gehalten. Und als sie langsam wieder in Stimmung kamen, ging ausgerechnet das dämliche Telefon.
Martin beschloß, ihren verkorksten Abend nach seiner Rückkehr am Montag wiedergutzumachen. Er würde Caroline Blumen mitbringen. Sie zum Abendessen ausführen. Sie verwöhnen. Ihr beweisen, daß er nicht nur an Sex dachte, wenn er mit ihr zusammen war.
Martin spürte, wie seine Erektion gegen die Hose preßte.
Plötzlich fiel sein Blick auf eine unglaublich sexy aussehende junge Frau in einem kurzen, hautengen schwarzen Jerseykleid, die ein paar Schritte von ihm entfernt stand und ungeniert auf die Wölbung in seiner Hose starrte. Langsam hob sie die Augen und blickte ihm ins Gesicht.
Martin war gefesselt von ihren Augen. Sie hatten einen ungemein auffälligen Grünton.
Ihre Lippen umspielte der Hauch eines Lächelns. Martin hatte das schwache Gefühl, sie zu kennen. Er konnte nicht sagen, wo er sie schon einmal gesehen haben mochte. Vielleicht lag es nur daran, daß die Frau mit den rabenschwarzen Haaren ein wenig Ähnlichkeit mit dem Mannequin auf dem Cover der Zeitschrift hatte, die er noch immer in der Hand hielt. Oder mit Caroline.
Der Blickkontakt hatte höchstens ein paar Sekunden gedauert. Dann drehte sich die Frau um. Langsam ging sie davon.
Martin zögerte nur kurz.
Was soll’s, dachte er und schob die Zeitschrift zurück ins Regal. Irgendwie mußte er doch die Zeit totschlagen.
Das Pochen beginnt zwischen den Schenkeln, wandert hoch zum Herzen, dringt ins Gehirn. Auch sie ist dort eingedrungen. Hat vollständig Besitz ergriffen von seinem Körper und seinem Verstand.
Atmet er überhaupt noch? Zunächst war der beißende Geruch in der klaustrophobisch engen Putzkammer überwältigend. Überdeckte den Duft ihres fruchtigen Parfüms. Jetzt läßt sein Geruchssinn ihn völlig im Stich.
Er hat nur noch den Sinn für Berührung. Ihre Berührung. Sie ist wie ein Droge. Er ist trunken vor Verlangen. In einem anderen Universum. Ihre feuchte Zunge flattert wie der Flügel eines Kolibris über seine Haut. Ihre Finger, wie die einer Bildhauerin, erforschen, streicheln, kneten seinen Körper.
Sein Kopf stößt hart gegen den Rand eines Metalleimers. Aber er empfindet keinen Schmerz …
In der stinkenden Kammer ist es zu dunkel, um irgend etwas zu sehen. Nur ein drückender Schmerz hinter den Augen. Und jetzt empfindet er doch Schmerz. Einen quälenden Schmerz im Kiefer, weil ihm der Mund mit Gewalt geöffnet wurde, bevor sein zusammengeknülltes Hemd hineingestopft wurde. Wenn er doch nur schlucken könnte. Wenn er doch nur hier rauskönnte.
Er ist vornübergebeugt, der Körper verdreht wie eine Brezel. Die schmerzhaft verrenkten Gliedmaßen lösen unerträgliche Krämpfe aus.
Er zittert haltlos. Vor Entsetzen ist sein schweißnasser Körper mit Gänsehaut bedeckt.
Dr. Martin Bassett ist von einer Sekunde auf die andere vom Himmel auf die Erde gestürzt. Er weiß, daß er in einer Putzkammer am Flughafen ist, aber er fühlt sich eingeklemmt wie ein Tier in der Falle.
Er spürt, wie sich die kalte Kette um seinen Hals zuzieht. Über das Dröhnen seines Herzschlages hinweg, der ihm in den Ohren hämmert, fallen ihm Fragmente aus den Nachrichten ein, die er am Morgen gehört hat …
Keine Luft. Die Lungen brennen. Der ganze Körper steht in Flammen. Die Metallschlinge schneidet immer tiefer. Martin ist Arzt. Er weiß genau, was sein Körper Entsetzliches durchmacht. Was für Entsetzlichkeiten ihm noch bevorstehen. Wie viele qualvolle Minuten es noch dauern wird, bis der Tod ihn erlöst.
Tränen strömen ihm die Wangen hinab; das blanke Entsetzen steht ihm in den glasigen Augen. Er weiß, daß der Tod seine einzige Hoffnung ist.
Bevor er das Bewußtsein verliert, flüstert er lautlos: «Verzeih mir, Caroline …»
7
Caroline fragte ihre Sekretärin über die Sprechanlage: «Mein Zehn-Uhr-Patient ist wohl noch nicht da, oder?»
«Nein. Tut mir leid, Dr. Hoffman. Aber Sie haben vor etwa zwanzig Minuten noch einen Anruf bekommen. Von Jill Nugent. Damit sind es bereits drei, die ich nicht durchgestellt habe.»
«Tun Sie mir einen Gefallen, Renée. Falls sie wieder anruft, sagen Sie ihr, daß ich heute nicht mehr ins Büro komme.»
«Mach ich.»
Caroline wandte sich ihrem Diktiergerät zu und wollte gerade ihre Gedanken zu der letzten Sitzung mit der Frau des Exrichters, der wegen seiner transvestitischen Veranlagung in ihre Gruppe gekommen war, aufs Band sprechen, als sich Renée über die Sprechanlage meldete. «Mr. Kramer ist da, Dr. Hoffman.»