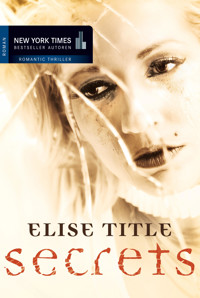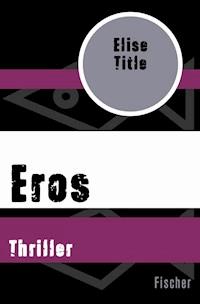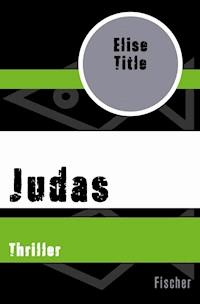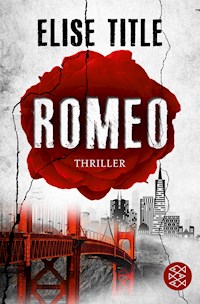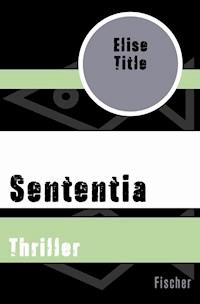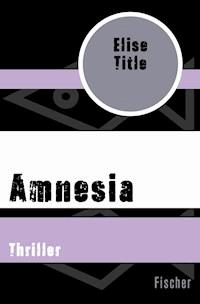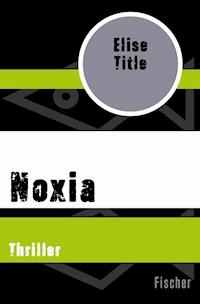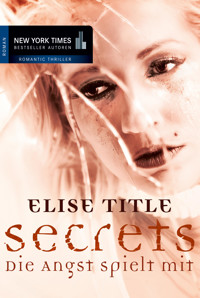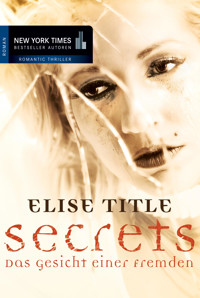4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Natalie Price
- Sprache: Deutsch
Die attraktive Sherry Buckley wurde ermordet. Ihre fünfzehnjährige Tochter Jenni steht unter Schock. Nicht nur, dass sie ihre Mutter verloren hat, jetzt ist sie auch noch ihrem brutalen Stiefvater Aaron Buckley ausgeliefert. Als dieser in Mordverdacht gerät, ist Jenni ganz auf sich gestellt. Und sie schweigt beharrlich ... ›Tacita‹ ist nach ›Judas‹, ›Amnesia‹ und ›Circe‹ der vierte Natalie-Price-Thriller von Elise Title. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Elise Title
Tacita
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER Digital
Inhalt
Prolog
Die dreiundachtzigjährige Rose Morrison zog sich ihre graue Häkeljacke enger um die knochigen Schultern und machte es sich auf dem geblümten Chintzsofa vor dem Fernseher bequem. Vierzehn Uhr. Zeit für ihre geliebte Oprah-Winfrey-Show und etwas Süßes – diesmal ein Preiselbeermuffin aus dem Korb mit Ware vom Vortag in ihrer Lieblingsbäckerei auf der Centre Street. Dazu gab es eine Tasse heißen Orange-Pekoe-Tee in der blau-weißen Porzellantasse, die ihre Tochter ihr aus Irland mitgebracht hatte.
Die Sendung fing in diesem Moment an. Rose nahm die Fernbedienung, die neben ihr auf der Couch lag, und wollte gerade die Lautstärke höherstellen – abends ließ sie den Ton leiser, um die Nachbarn nicht zu stören –, als sie in der Wohnung über ihr einen entsetzlichen Krach hörte.
Instinktiv blickte sie hoch, rechnete schon fast damit, dass irgendwas durch die Decke gekracht kam. Natürlich geschah nichts dergleichen, obwohl Rose einen neuen Riss im Putz entdeckte – oder war das nur Einbildung?
Ganz bestimmt keine Einbildung war der laute Knall, mit dem Sekunden später oben die Wohnungstür zugeschlagen wurde, und auch nicht die polternden Schritte, die gleich darauf durchs Treppenhaus tönten und nach unten verschwanden.
Rose wusste nicht viel über die Familie, die über ihr wohnte. Nur dass der Mann Polizist war, die Mutter Altenpflegerin und die Tochter, na ja, ein etwas missratener Teenager. Mit ihrer wilden Haarmähne und den grässlichen Metallringen, Steckern und – Gott bewahre! – Kreuzen, die sie an den Ohren und weiß der Himmel wo sonst noch alles trug, hätte sie auch im Zirkus auftreten können, fand Rose.
Sie verzog das Gesicht. Wenn das Mädchen ihre Enkelin wäre, würde es sich nicht so verstümmeln, garantiert nicht. Überhaupt, der ständige Krach da oben, das Geschrei, Gestampfe und Türenschlagen. Sie beklagte sich öfter bei ihrer Tochter darüber, wollte aber nicht, dass sie etwas unternahm. Schließlich war der Mann bei der Polizei. Und nach dem, was sie so alles in den Nachrichten und den Realityshows im Fernsehen mitbekam, war die Polizei nicht immer dein Freund und Helfer. Nicht auszuschließen, dass ihr Nachbar ebenso in kriminelle Aktivitäten verstrickt war wie die Verbrecher, die er verhaftete.
Die alte Frau wunderte sich. Zwei Uhr nachmittags. Um diese Zeit ging der Polizist doch sonst nie zur Arbeit. Und er hatte es auch nie so eilig. Überhaupt war er nachmittags selten zu Hause. Sie hatte ihn des Öfteren mit einer Sporttasche auf der Treppe getroffen. Normalerweise ging er am späten Vormittag aus dem Haus und kam nicht vor drei, vier Uhr zurück. Und dann verließ er die Wohnung wieder, wenn Rose zu Abend aß, so gegen fünf, und kam mit ruhigen Schritten die Treppe runter.
Vielleicht hatte er heute den Sport ausfallen lassen, weil er krank war. Vielleicht ging es ihm so schlecht, dass er schnellstens zur Notaufnahme ins nahe Faulkner Hospital wollte. Da Rose allein lebte, fand sie es beruhigend, dass es bis zum Krankenhaus nur ein Katzensprung war. Schließlich passierten ja die meisten Unfälle in den eigenen vier Wänden. Und falls der arme Mann sich verletzt hatte, war vermutlich niemand in der Wohnung, der ihn verarzten konnte, denn seine Frau arbeitete tagsüber und die Tochter war bestimmt noch in der Schule.
Gewissensbisse meldeten sich bei Rose, während die Schritte im Treppenhaus leiser wurden. Sie dachte, als gute Nachbarin hätte sie auf den Flur eilen und dem Polizisten ihre Hilfe anbieten müssen. Doch das Gefühl legte sich, als sie die Haustür ins Schloss fallen hörte. Gut, er war bereits unterwegs.
Später sollte sie es bereuen, dass sie sich nicht vom Sofa aufgerafft hatte, um aus dem Fenster zu schauen, wer da aus dem Haus gerannt war.
Die Fernbedienung noch immer in der blau geäderten, zittrigen Hand, drückte Rose den Lautstärkeknopf und ärgerte sich darüber, dass sie den Vorspann mit der Ankündigung der Gäste verpasst hatte. Egal, sie würde ja noch früh genug erfahren, wer diesmal in die Sendung eingeladen war.
Rose nahm einen Bissen von ihrem noch halbwegs frischen Muffin und kaute langsam, um den Genuss zu verlängern – und weil sie keine Lust hatte, ihre dritten Zähne einzusetzen. Kurz darauf hatte sie die kurze Unterbrechung vergessen und widmete sich ganz ihrer Lieblingstalkshow.
Es dauerte nicht lange – jedenfalls hatte Oprah noch nicht mal ihren ersten Gast ins Studio gerufen, das wusste Rose mit Sicherheit –, da hörte sie wieder ein Poltern, das diesmal aber nicht nach Schritten klang, sondern als würde irgendetwas Schweres von oben die Treppe runterfallen.
Rose fand das Geräusch weniger beunruhigend als vielmehr störend. Wahrscheinlich hatte die ungeratene Tochter auf dem Weg nach oben ihre vollgepackte Schultasche fallen lassen. Allerdings, sonst kam sie nicht so früh nach Hause. Bestimmt hatte sie die letzte Stunde geschwänzt. Die Eltern hatten das Kind wirklich nicht im Griff. Und es passierte häufig genug, heute Morgen war mal wieder ein Paradebeispiel gewesen, dass sie hörte, wie das Mädchen seine Eltern anschrie und dann die Wohnungstür hinter sich zuknallte, so laut, dass der Tisch in Roses Küche bebte. Und mit was für unflätigen Ausdrücken! Man sollte ihr den Mund mit Seife auswaschen.
Rose zuckte die Achseln. Und was da oben passierte, ging sie schließlich nichts an. Außerdem kam gerade George Clooney unter tosendem Applaus auf die Bühne spaziert. Oprah strahlte. Rose lehnte sich gemütlich zurück. Die Show fing vielversprechend an.
Einige Minuten später hörte Rose wieder ein Geräusch. Clooney erzählte gerade eine lustige Episode von den Dreharbeiten zu seinem letzten Film, und Oprah kicherte wie ein Schulmädchen. Rose versuchte, das Nebengeräusch auszublenden, was bei der Lautstärke des Fernsehers eigentlich kein Problem war. Doch so ganz gelang es ihr nicht.
Es war eine Art Kratzen, wie von Fingernägeln auf einer Schiefertafel. Aber natürlich gab es im Treppenhaus keine Schiefertafel. Kam das Geräusch etwa von der anderen Seite ihrer Wohnungstür? Rose wurde nervös. Einmal, vor Jahren, hatte sie eine Maus durch ihre Küche huschen sehen und fast einen Herzinfarkt bekommen. Und jetzt, wo das Bostoner North End gerade eine einzige Riesenbaustelle war, hörte man zunehmend Klagen über Ratten, die aus ihren unterirdischen Löchern vertrieben wurden und sich in der ganzen Stadt ausbreiteten, sogar hier draußen in Jamaica Plain.
Als das Kratzen aufhörte, entspannte Rose sich ein wenig. Dann fing ein Werbeblock an, und Rose nutzte die Pause, um einen nervösen Blick zur Wohnungstür zu riskieren. Sie glaubte zwar nicht, dass sich eine Ratte unter der Holztür hindurchzwängen könnte, aber dennoch –
Was Rose erblickte, als sie die Augen auf den schmalen Spalt richtete, war allerdings keine Ratte. Es war ein Rinnsal, eine leuchtend rote Flüssigkeit, die unter der Tür hindurch in den alten, aber ungemein strapazierfähigen blassbeigen Teppichboden sickerte. Kauft gute Qualität, und ihr werdet es nicht bereuen, predigte sie ihren drei erwachsenen Kindern stets, wenn auch vergeblich.
Die alte Frau legte die Stirn in Falten, die sich jedoch in der ohnehin schon runzeligen, pergamentdünnen Haut verloren. Der Fleck im Teppich breitete sich rasch aus. Binnen weniger Augenblicke hatte sich eine rote Lache gebildet, die größer und größer wurde.
Rose Morrison schnappte nach Luft. »O mein Gott …«
1
»Ach, komm, Jenni, ist doch nicht so schlimm.« Aber das Mädchen öffnet bereits den Reißverschluss der schwarzen, gelb abgesetzten Jacke ihres Freundes mit dem Emblem der Highschool-Basketballmannschaft, die sie jeden Tag trägt, seit sie fest miteinander gehen, also seit gut drei Monaten. Das heißt, sie zieht sie an, sobald sie das Haus verlässt, und wieder aus, bevor sie nach Hause kommt.
Will Burdett, der eine Daunenweste über einem Kapuzensweatshirt trägt, zieht den Reißverschluss der unförmigen Jacke wieder hoch und schiebt das junge Mädchen gegen eine große, kahle Ulme in dem Park gegenüber der Boston Tech Highschool. Gleichzeitig neigt der schlaksige Basketballspieler den Kopf und fährt seiner Freundin mit der Zungenspitze über das Ohrläppchen, an dem unter etlichen Steckern im untersten Loch ein kleines silbernes Kreuz baumelt. Wären sie an einem ungestörteren Ort, hätte er sich für seine Zunge lieber ein anderes Ziel gesucht: die kirschroten Brustwarzen mit den kleinen Silberreifen oder den hinreißenden Bauchnabel mit dem Diamantstecker darin.
Allmählich gehen dem Mädchen die Piercing-Stellen aus. Abgesehen von dem Ohrschmuck sind an den Ecken der Augenbrauen winzige Stahlhanteln durch die Haut gebohrt, im rechten Nasenflügel steckt ein Rubin, in den geschwungenen Lippen ein winziger Dreierring und aus der Zunge ragt ein glänzender Goldstecker.
Sie schimmert förmlich in der kühlen Spätnachmittagssonne.
Und sie zittert. Auch wenn die Sonne scheint, es ist die erste Woche im Dezember, und der Winter hat Neuengland fest im Griff. Vielleicht zittert sie aber auch vor Erregung und nicht vor Kälte. Will macht sich da so seine Hoffnungen.
Jennifer jedoch zieht seine Hand vom Reißverschluss der Mannschaftsjacke weg und hebt die Schulter, um seinen Mund von ihrem Ohr wegzuschieben.
»Es ist gleich vier, Will. Du kommst zu spät zum Training. Ich hab eigentlich gar nicht mit dir gerechnet.«
»Der Coach feiert krank. Ist nach der letzten Sportstunde nach Hause gegangen. Ich hab also frei, und wir …« Er legt seine großen, sommersprossigen Hände an ihre kühlen, weißen Wangen – am linken Mittelfinger trägt er einen gravierten Highschoolring mit einem in Gold gefassten Onyxstein – und beendet den Satz mit einem zarten, aber doch herausfordernden Kuss.
»Mann, quäl mich nicht so, Will.«
»Wenn du sauer bist wegen der kleinen Sache zwischen Megan und mir gestern, da war nix, Baby. Ich meine, die wollte doch bloß –«
»Ich weiß, was sie wollte«, fällt Jennifer ihm barsch ins Wort.
»Und ich weiß, was du willst, Jen.«
Er nimmt ihre Hand und führt sie nach unten, damit sie seine Erektion in der ausgebeulten Jeans spüren kann. »Quäl mich nicht so, Kleines«, flüstert er.
Sie reißt ihre Hand weg. »Ich muss los. Buck kommt bald vom Sport nach Hause, und ich –«
»Wir könnten kurz zu mir. Meine Alten sind wieder in Hongkong, auf einem ihrer endlosen Einkaufstrips. Ich fahr dich nach fünf nach Hause, dann ist er schon zur Arbeit.«
Jennifer schüttelt den Kopf. »Ich kann nicht, Will.«
»Du bist noch immer sauer. Du regst dich wegen nichts und wieder nichts auf. Ehrenwort.«
Noch während er versucht, sie zu überzeugen, weiß er, dass seine Worte auf taube Ohren stoßen. Jenni ist heute mal wieder ziemlich aufgedreht. Er sieht es ihr an, er spürt es. Aber, verdammt, er selbst ist auch ziemlich aufgedreht. Und nach ihrer SMS, er sollte in den Park kommen, hatte er gehofft, sie würde ihn ein wenig entspannen. Und umgekehrt.
Ein Jammer, dass es hier draußen so scheißkalt ist, denkt er. Hier im Park haben sie sich zum ersten Mal geliebt. Aber das war Mitte September, als die Sonne am frühen Abend noch warm war, und dank der noch grünen Bäume und Sträucher war es leicht gewesen, ein abgeschiedenes Plätzchen zu finden.
Natürlich könnte er mit seiner American Express ein Hotelzimmer nehmen, aber sein Vater überprüft die Belege immer haargenau …
Plötzlich packt Jenni seine Daunenweste und sieht ihn besorgt an. »Du hast Megan doch nichts gesagt, Will? Was ich dir erzählt habe, muss unter uns bleiben.«
Ihre Worte und der ängstliche Unterton in ihrer Stimme ersticken jeden Gedanken daran, dass es heute noch was werden könnte.
»Hey, Baby, ich dachte, du vertraust mir.« Seine sinnlichen Lippen verziehen sich fast zu einem Schmollmund, und er blickt sie mit diesen strahlend blaugrünen Augen an, die sie gleich am ersten Tag fasziniert haben – ihrem ersten Tag an der Boston Tech Highschool. Nie im Leben hätte sie gedacht, dass sie bei ihm überhaupt eine Chance hätte, dem beliebten Basketballspieler aus der Oberstufe, mit den rotblonden Haaren und dem Schlafzimmerblick. Aber nicht nur sie hatte das elektrische Knistern gespürt. Zwei Wochen später wurden sie ein Paar.
Jennifer bückt sich zu ihrem Rucksack auf dem Boden und entknotet die Ärmel ihrer schwarzen Secondhand-Motorradjacke, die sie an einen der Tragegurte gebunden hat.
»Ich fahr dich nach Hause.«
»Nein«, sagt sie schneidend, zieht sich die Sportjacke aus und drückt sie Will in die Hand.
»Weil der liebe Stiefdaddy da sein könnte? Der kann mich mal.«
»Er glaubt, wir haben Schluss gemacht.« Sie schlüpft rasch in ihre Jacke, denn die frostige Luft dringt sofort durch die dünne Bluse. »Und das soll er ruhig weiter glauben.«
»Er ist ein richtiges Arschloch.« Will zieht ein angewidertes Gesicht. Er lästert oft über ihren Stiefvater. Und meistens macht Jenni dabei mit.
Sobald der Cop von der Sitte Wind davon bekam, dass seine Stieftochter mit Will Burdett ging, sah er im Polizeicomputer nach und wurde prompt fündig: Will war aktenkundig. Er erzählte Jenni und ihrer Mutter brühwarm von Wills diversen Konflikten mit dem Gesetz, so zum Beispiel wegen des Verkaufs von Steroiden und allerlei Glückspillen an seine Mannschaftskameraden im letzten Jahr.
Will konnte Jenni davon überzeugen, dass die Verdächtigungen total aus der Luft gegriffen waren, schließlich hatten ihm die Cops rein gar nichts nachweisen können. Jenni hatte das Argument gegenüber Buckley angeführt. »Das ist noch lange kein Beweis für seine Unschuld«, hatte der entgegnet. »Aber auch nicht für seine Schuld«, hatte Jenni gekontert.
Aber eine Sache hatte man Will doch anhängen können. Letztes Frühjahr hatte er sich in den Ferien mit drei Mannschaftskameraden in einem schäbigen Hotel im nahen Watertown einquartiert, wo sie sich bekifft und dann in zugedröhntem Zustand das Zimmer demoliert hatten. Der Hotelmanager rief die Polizei, und alle vier Jungs wurden in Gewahrsam genommen. Während seine Kumpel für dreißig Tage in den Knast mussten, kam Will mit einem Jahr Bewährung und fünfzig Tagen gemeinnütziger Arbeit davon. Buck erklärte das damit, dass Will das verwöhnte Söhnlein reicher Eltern war, die sich teure Anwälte leisten konnten, um ihren Filius rauszuhauen.
Will hatte Jenni gleich zu Anfang von der Sache erzählt, weil er sich dachte, dass ihr Stiefvater darauf rumreiten würde. Eines hatte er ihr allerdings verschwiegen – sie erfuhr es dann von Buckley –, und zwar, dass zunächst noch weitere Vorwürfe gegen ihn und seine Freunde erhoben worden waren. An der kleinen Soiree in dem Hotel hatte auch eine junge Frau teilgenommen. Sie hatte zunächst gegen alle vier Jungs Anzeige erstattet, wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Als Jenni Will deshalb zur Rede stellte, beichtete er ihr, dass die Frau eine Prostituierte war und für ihre Dienste, die sie bereitwillig und überaus engagiert geleistet hatte, gut bezahlt worden war.
Sie hatte die Anzeige ja dann auch kurz darauf zurückgezogen. Buck wies Jennis Vorwurf, er habe ihr bewusst unterschlagen, dass die Frau eine Nutte war, vehement zurück. Die Frau sei keine Nutte gewesen, beteuerte er, schließlich kenne er alle Prostituierten in der Stadt. Will und seine Freunde säßen nur deshalb nicht hinter Gittern, weil Wills Eltern die Frau geschmiert hätten. Daraufhin bezeichnete Jenni ihren Stiefvater als dreckigen Lügner.
Aber dann machte sie Will zur Schnecke, weil er eine Nutte engagiert hatte. Er schwor ihr hoch und heilig, dass er das nur aus Jux getan habe, und nur das eine Mal, und dass es nie wieder vorkommen würde.
»Hör mal, Jen, wenn dein Dad aus dem Knast kommt und du bei ihm wohnst, kannst du diesem miesen Buckley sagen, er soll sich ins Knie ficken.«
Er sieht, wie ein Schatten über Jennis Gesicht huscht.
»Hey, genauso läuft das, wart’s nur ab. Hast du nicht gesagt, dass die Leiterin von dem Zentrum, mit der du dich ganz gut verstehst, auf deiner Seite ist?«
»Ich will jetzt nicht darüber reden«, sagt sie mit finsterem Blick.
Will weiß, das ist ein heikles Thema. Seit er Jenni kennt, redet sie ständig davon, dass sie, sobald ihr Dad aus diesem Entlassungsvorbereitungszentrum kommt, wo er den Rest seiner Strafe absitzt, für sie beide eine Wohnung suchen wird, damit sie bei ihm wohnen kann. Sie hat ihm auch erzählt, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater strikt dagegen sind und Jenni sich deshalb seit Monaten mit ihnen in den Haaren liegt.
Will weiß, dass Jennis Dad noch im Knast ist, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, aber er weiß nicht, weshalb Charlie Dunbar ursprünglich verknackt wurde. Darüber will Jenni einfach nicht reden. Und anfänglich hat sie sich auch dagegen gesträubt, ihm zu erzählen, weshalb genau er wieder eingesperrt worden war. Aber schließlich war sie doch mit der Sprache rausgerückt. Jennis Mom hatte eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex bewirkt, von dem sie sich hatte scheiden lassen, als er das erste Mal im Gefängnis war. Damals war Jenni acht Jahre alt. Laut Jenni war es purer Zufall, dass ihr Dad vor über drei Jahren, ein paar Monate nach seiner Freilassung auf Bewährung, ihrer Mom und Buck in einer Bar über den Weg lief. »Er wollte nur kurz mit meiner Mom reden, aber Buck ist ausgerastet. Er hat meinen Dad provoziert. Ich weiß, Buck hat ihn absichtlich gereizt, bis Dad sich nicht mehr beherrschen konnte und ihm eine reingehauen hat.«
Jenni, so hatte sie es zumindest Will erzählt, hatte ihrer Mom schließlich gedroht, sie würde von zu Hause weglaufen, wenn Buck ihren Dad anzeigen würde. Ein tätlicher Angriff gegen einen Polizeibeamten hätte ihrem Vater eine wesentlich schärfere Verlängerung seiner Haftstrafe eingebracht. Offenbar hatte ihre Mom die Drohung wohl ernst genommen, denn sie überredete Buck, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber trotzdem war nicht daran zu rütteln, dass Jennis Vater gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte: Erstens war er in einer Bar gewesen, und zweitens hatte er seine Exfrau angesprochen, was ihm aufgrund der einstweiligen Verfügung untersagt war. Seine Freilassung auf Bewährung wurde aufgehoben, und er musste erneut hinter Gitter. Für drei Jahre. Will weiß, dass das für Jenni ein schwerer Schlag war.
Aber Will weiß auch, wie glücklich Jenni war, als Charlie Dunbar vor zwei Monaten aus einer geschlossenen Vollzugsanstalt ins Entlassungsvorbereitungszentrum – dem Horizon House – in Boston verlegt wurde. Statt der einstündigen Fahrt mit dem Bus zur Strafanstalt Norton brauchte sie jetzt einfach nur in die U-Bahn zu steigen und war in zwanzig Minuten im Horizon House. Und auch die Besuchszeiten im Zentrum waren großzügiger. Jenni verpasste sie so gut wie nie – sie kam mittwochabends, samstagmorgens und sonntagnachmittags. Einmal hatte sie Will mitgenommen, aber da er nicht auf der genehmigten Besucherliste stand, durfte er nicht hinein. Er hatte draußen gewartet, aber Jenni hatte ihrem Vater beim Abschied gesagt, er solle gleich mal aus dem Fenster zur Straße hinausschauen. Sie hatte sich neben Will gestellt und seinen Namen für ihren Dad mit den Lippen geformt. Und der hatte ihnen zugezwinkert und den Daumen hochgestreckt. Will hatte die Geste erwidert.
Charlie soll am 14. März entlassen werden. Genau rechtzeitig zu Jennis sechzehntem Geburtstag. Sie schmiedet schon Pläne für eine Party. Aber Will weiß, was sie sich am meisten zum Geburtstag wünscht: dass ihre Mom und ihr Stiefvater ihr erlauben, mit ihrem Dad zusammenzuziehen.
Will sieht Tränen in Jennis Augen.
»Hey, Baby, ist ja gut. Das wird schon. Du musst nur dran glauben«, sagt Will und nimmt sie in die Arme. Er spürt, dass sie zittert.
Zuerst schmiegt sie sich an ihn, doch plötzlich weicht sie zurück. »Ich bin’s leid, mir dauernd irgendwelche Lügereien anzuhören, von dir, von denen –«
»Hey, ich versuch doch nur –«
»Ja, klar«, murmelt sie. Dann blickt sie ins Leere und sagt: »Heute Morgen hatten Mom und Buck einen Riesenkrach, und sie sagte: ›Ich weiß nicht, was schlimmer ist – mit einem Kriminellen verheiratet zu sein oder mit einem Cop.‹« Jennis Gesicht verdunkelt sich. »Ich mag das nicht, wenn sie über meinen Dad herzieht. Es macht mich stinksauer. Und das hab ich ihr auch gesagt.«
»Stimmt, sie ist echt nur am Motzen über deinen Dad.«
Will ist erleichtert, dass Jenni ihm diese Bemerkung durchgehen lässt. Normalerweise darf nur sie ihre Mom kritisieren. Aber wenn er dann mal was Positives über sie sagt, wirft Jenni ihm gleich vor, er hätte sich in ihre Mom verguckt. Schon vor einer Weile hat er deswegen beschlossen, sich möglichst jede Bemerkung über Sherry Buckley zu verkneifen.
»Worum ging’s denn bei dem Krach zwischen Buck und deiner Mom?«
»Dreimal darfst du raten.«
»Um den Doc in dem Seniorenheim, wo sie arbeitet? Glaubt Buck noch immer, dass zwischen den beiden was läuft?«
Jenni presst die Lippen aufeinander.
Den Blick kennt Will zur Genüge. »Okay, okay, vergiss es.«
»Ja, vielleicht sollten wir einfach alles vergessen.«
»Mensch, Jen, jetzt fang nicht schon wieder mit mir und Megan an. Übrigens, ich hab sie nach der letzten Stunde getroffen, und sie hat mir erzählt, dass du heute nicht in der Schule warst. Wo bist du gewesen?«
»Bist du neuerdings bei der Schulschwänzerpolizei, Will? Das geht mir echt –«
»Nun reg dich nicht gleich wieder auf, Jen. Ich hab mir einfach Sorgen gemacht, du wärst krank oder so.«
»Seh ich krank aus?«, fragt sie provozierend.
»Nein, du siehst genervt aus –«
»Und wo warst du heute Nachmittag?« Sie feuert die Frage ab wie einen Schuss.
»Ich hab donnerstags immer schon um zwölf Schulschluss. Das weißt du genau.«
»Ich hab nicht gefragt, wo du nicht warst. Ich hab gefragt, wo du warst.«
Er verdreht die Augen. »Ich war nicht mit Megan Richards zusammen, wenn du das meinst.« Er seufzt. »Na schön, wenn du’s unbedingt wissen willst: Ich hab ein paar Besorgungen für Freda gemacht. Sonst hätte sie das erledigen müssen und ich bei Grandma bleiben. Und du weißt, wie hart das für mich ist. Entweder hält sie mich für ihren Mann, oder sie weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Neulich hat sie gedacht, ich wäre der Lieferjunge vom Supermarkt. Ich schwör dir, wenn meine Eltern aus Hongkong zurück sind, red ich Klartext mit ihnen. Die alte Lady gehört in ein Pflegeheim. Wir wissen doch beide, dass Dad sie nur zu Hause behalten will, weil Grandma in der Firma, die Dad für sie leitet, noch immer die Aktienmehrheit hält. Und er hat sie bis jetzt nicht dazu bringen können, ihn statt ihren Anwalt als ihren Vermögensverwalter einzusetzen. Das muss er hinkriegen, ehe sie völlig den Verstand verliert.«
»Ich muss los«, sagt Jenni unvermittelt.
Will wirft die Hände hoch. »Von mir aus. Ich hab sowieso das Gefühl, mit einer Wand zu reden. Wenn du mal zurück zum Planeten Will möchtest, ruf mich an.« Er wendet sich ab, doch sie hält ihn am Ärmel fest.
»Hey, tut mir leid. Ich bin bloß –« Statt den Satz zu beenden, lehnt sie sich gegen ihn, zieht seinen Kopf nach unten und küsst ihn hungrig auf den Mund. Als sie sich voneinander lösen, blickt sie ihm in die Augen. »Ich liebe dich, Will. Ich glaub, ohne dich käm ich nicht mehr klar.«
Will sieht sie besorgt an. »Das musst du ja auch nicht, Jen. Aber ich mach mir Gedanken um dich. Du vermasselst dir alles, wenn du dauernd blaumachst.«
»Heute Morgen zu Hause, wo jeder jeden anbrüllt, das war total beschissen. Mir war einfach nicht danach, den ganzen Tag in der Schule zu hocken.«
»Wo warst du denn?«, fragt er wieder. »Ich hab ein paarmal auf deinem Handy angerufen, aber du bist nicht drangegangen.«
Jenni mustert ihn mit einem eiskalten Blick. »Ich werd schon zu Hause genug ins Verhör genommen.«
Er hebt kapitulierend die Hände. »Ich blick bei dir nicht mehr durch, Jen. Mal bist du heiß, dann wieder kalt.«
Jenni lehnt sich nach hinten gegen den Baumstamm, die blaugrünen Augen auf die Erde gerichtet, die mit trockenem braunen Laub bedeckt ist. »Das liegt an Buck«, murmelt sie. »Dauernd meckert er an mir rum. Ich hab’s satt.«
Will streichelt ihr windzerzaustes Haar. »Du darfst dich nicht davon fertigmachen lassen, Baby.«
»Keine Ahnung, was Mom an dem Arschloch gefunden hat.«
»Das kannst du laut sagen. Aber ich weiß, was er an ihr gefunden hat.« Die Bemerkung ist Will so rausgerutscht. »Oh, Scheiße. Jetzt steig mir nicht gleich wieder aufs Dach. Ich meine doch nur, dass sie gut aussieht. Was soll ich denn machen? So tun, als wär sie ’ne hässliche alte Schachtel?« Er blickt in Jennis Gesicht, hofft, ihr wenigstens den Anflug eines Lächelns zu entlocken. Aber ihr Gesicht ist wie versteinert.
»Meine Mutter kommt nicht deinetwegen zu deinen Spielen, Will. Vergiss das nicht.«
»Das hab ich nie gesagt.«
»Das musst du auch nicht sagen.«
Wills Stirn legt sich in Falten. »Lass uns nicht wieder damit anfangen, Jen.«
»Genau«, sagt sie. »Lieber nicht.«
Will nimmt eine lange Strähne von Jennis schrill pinkfarbenem Haar und dreht sie sich um den Finger. Die Farbe der Woche.
Seit er sie kennt, hat sie sich das lange glatte Haar schon in allen Regenbogenfarben getönt. »Du bist genauso schön wie deine Mutter«, murmelt er. »Auf deine Art.«
»Gar nicht«, sagt Jenni. »Sie ist tausendmal schöner.« Und dabei schwingt etwas in ihrer Stimme mit. Neid? Groll? Trauer? Will kann es nicht genau sagen. Manchmal ist Jenni Dunbar ein einziges Rätsel für ihn. Aber genau das macht sie umso verführerischer.
2
Jamaica Plain wird in den Medien häufig als das Schmuckstück von Boston bezeichnet, ein Stadtteil, der von herrlichen Parks und dem Jamaica Pond umgeben ist, einem See, auf dem man sogar segeln kann. Und das Viertel selbst hat so einiges zu bieten. In JP, wie die Einheimischen sagen, lebt ein buntes Völkergemisch, darunter die größte hispanisch-amerikanische Gemeinde in Boston. Eine Zeitlang waren die Mieten und Immobilienpreise hier niedriger als in anderen schicken Stadtteilen, was viele junge, aufstrebende Familien anlockte, die von einem eigenen Häuschen am Stadtrand träumten. Inzwischen tummeln sich Scharen von Kindern auf den Spielplätzen oder gehen mit Mommy oder Babysitter in den Streichelzoo im Franklin Park. Umweltbewusste, politisch engagierte Eltern besuchen Ökofestivals, Jugendliche spielen Basketball auf den diversen öffentlichen Plätzen oder treffen sich auf der Centre Street, der Haupteinkaufsstraße von JP.
Doch bevor die Yuppies anfingen, sich die schönen alten zwei- und dreistöckigen Stadthäuser in den engen Straßen unter den Nagel zu reißen und damit die Mieten in die Höhe zu treiben, war JP ein ziemlich ärmliches Viertel. Und etliche dieser Armen sind geblieben. Was Probleme mit sich bringt. Einbrüche, Drogen, Vandalismus, Bandenkriminalität.
JP hat bei weitem nicht die höchste Verbrechensrate der Stadt, dennoch hat das 13. Revier auf der Washington Street alle Hände voll zu tun. Mord allerdings ist wahrhaftig nicht an der Tagesordnung. Daher wurden, als um 14.16 Uhr der Anruf einging, sofort zwei Beamte, die in JP Streife fuhren, über Funk verständigt und zur Sedgewick Street 316 geschickt, wo sie eine Leiche und eine hysterische, zahnlose alte Dame vorfanden.
Um 14.38 Uhr biegt Lieutenant Leo Coscarelli vom Morddezernat in die Sedgewick Street. Glücklich ist er nicht darüber, denn der Anruf hat die kostbare Freizeit unterbrochen, die er gerade mit seinem kleinen Sohn verbrachte. Jakey, der im Februar sechs wird, geht noch in den Kindergarten, dienstags und donnerstags bis zwölf, an den übrigen drei Tagen auch noch nachmittags, damit Leos Mutter Anna, die bei ihnen wohnt, auch mal etwas unternehmen kann. Heute hatte Leo seinen Sohn ausnahmsweise selbst abgeholt, als Überraschung. Sie waren im Naturkundemuseum, als der Anruf kam, und Leo musste seinen in Tränen aufgelösten Jungen förmlich wegschleifen, noch ehe Jakey an der Reihe war, eine Schlange anzufassen.
Coscarelli hält vor dem blassgrünen dreistöckigen Haus, wo bereits sein neuer Partner wartet, der erst vor fünf Tagen im Morddezernat angefangen hat. Dan Silver, ein kräftiger und gutaussehender Sunnyboy mit braunen Augen und rotblondem Haar, ist sechsundzwanzig. Aufgewachsen ist er nicht etwa im sonnigen Kalifornien, wie man bei seinem Aussehen vermuten könnte, sondern auf einer Milchfarm im tiefsten Nebraska. Er ist Absolvent der Boston University und wechselte nach einem Jahr als Versicherungsmakler auf die Polizeiakademie, wo er sich sehr gut machte. Nach einem raschen Aufstieg bei der Bostoner Polizei war er endlich da gelandet, wo er hinwollte – im Morddezernat. Silver konnte seinen ersten Mordfall kaum erwarten, und wie es aussieht, hat sich an diesem Tag sein Wunsch erfüllt.
Der frischgebackene Detective betritt das Gebäude und eilt, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, in den ersten Stock. Coscarelli, mit seinen achtunddreißig Jahren ein alter Hase, folgt ihm. Er wollte zuerst noch ein paar Worte mit den beiden Kollegen von der Streife wechseln, aber die Cops haben alle Hände voll mit der noch immer hysterischen alten Lady zu tun sowie mit der wachsenden Zahl von Anwohnern, die aus den Nachbarhäusern kommen und wissen wollen, was passiert ist.
Im ersten Stock angekommen, sieht Coscarelli, wie sein neuer Partner zielstrebig die gut fünf Schritte zu der nackten Toten geht, die auf dem Bauch im Flur liegt.
Der ältere Detective nimmt die tote Frau mit routiniertem Blick in Augenschein, während er sich bewusst im Hintergrund hält. Gute Figur, lange Beine, muskulös, aber nicht zu durchtrainiert. Blondes, leicht welliges Haar, das ihr im Stehen über die Schultern fallen würde. Jetzt liegt es über ihrem Gesicht, das halb von ihm abgewandt ist. Könnte ihre natürliche Haarfarbe sein. Blasse Haut, wo sie nicht mit Blut bedeckt ist. Und das ist sie fast überall, vor allem am Rücken. Aus dieser Entfernung würde er sie auf ungefähr Mitte dreißig schätzen.
Unter dem Opfer ist eine Blutlache. Sie hat sich durch die geöffnete Tür auf dem beigefarbenen Teppich in der Wohnung der alten Dame ausgebreitet, die bei der Polizei angerufen und einen entsetzlichen Unfall gemeldet hat. Coscarelli schaut zu, wie Silver durchsichtige Plastikhandschuhe aus der Tasche seines gut sitzenden, grauen Garbadineanzugs fischt. Er zieht sie sich über wie ein Chirurg vor einer Operation. Da Coscarelli in seinem Rücken steht, kann Silver das schwache Lächeln im Gesicht seines älteren Kollegen nicht sehen. Und er weiß auch nicht, was der Lieutenant denkt: Mal sehen, wie lange du es schaffst, den Cop zu spielen, Danny-Boy.
Nicht lange. Keine dreißig Sekunden. Silver geht in die Knie, um sich das Opfer genauer anzusehen, wobei er aufpasst, keine Spuren zu verwischen, als er auch schon zur Seite kippt, ehe er ganz in der Hocke ist. Die Ohnmacht kommt so plötzlich, dass Silver keine Chance mehr hat, den Sturz abzufangen. Und Coscarelli ist zu weit weg, um zu verhindern, dass sein junger Kollege auf den abgelaufenen braunen Fliesenboden knallt. Zum Glück fällt er aus der Hocke nicht tief und schlägt zuerst mit der Schulter auf, nicht mit dem Kopf.
Das Lächeln verschwindet aus Coscarellis Gesicht, und er eilt zu seinem Partner, der schon wieder zu sich kommt.
»Ganz ruhig«, sagt Leo mitfühlend, als Silver gleich wieder aufstehen will. »Alles in Ordnung?«
Der junge Cop blickt seinen Partner benommen an. »Was ist denn passiert?«
Ehe Coscarelli antworten kann, verfärbt sich das Gesicht des Neulings von kreideweiß zu dunkelrot.
»Ach du Scheiße«, murmelt er und weicht Leos Blick aus. »Das kommt davon, wenn man das Frühstück ausfallen lässt.«
»Seien Sie froh. Bei meinem ersten Mal hatte ich gerade ein dickes Mittagessen intus. Ein Blick auf die Leiche, und ich hab alles wieder von mir gegeben«, erwidert Coscarelli. Ein wenig übertrieben, in Wahrheit hatte der damals frisch gekürte Detective lediglich angefangen zu würgen und hätte sich vermutlich übergeben, wenn sein älterer, erfahrenere Partner ihn nicht rasch von seinem ersten Mordopfer weggeschoben hätte, einem siebzehnjährigen Schwarzen mit einem riesigen Einschussloch in der Stirn.
Leo hilft seinem Kollegen auf die Beine, führt ihn ein Stück von der Toten weg. Silver protestiert nicht, sondern murmelt nur: »Ich hab bei uns zu Hause auf der Farm zig tote Tiere gesehen, und so was ist mir noch nie passiert.«
»Ja«, sagt Leo. »Aber eine nackte Frau mit einer Stichwunde im Rücken ist auch nicht dasselbe wie eine tote Kuh.«
»Stichwunde?«, murmelt Silver und riskiert einen zweiten Blick auf die Tote. Aus der Entfernung war es leichter.
»Natürlich müssen wir abwarten, was der Gerichtsmediziner sagt. Aber ich glaube nicht, dass ich falsch liege.« Er fügt nicht hinzu, dass die fünf Zentimeter breite Wunde zwischen den Schulterblättern der Frau Bände spricht. Der kurze, aber erfahrene Blick, den er aus der Nähe auf die Leiche werfen konnte, hat ihm verraten, dass es sich um einen sauberen und tiefen Schnitt handelt, wie von der Klinge eines Fleischermessers. Aber ob die sichtbare Stichwunde auch die Todesursache war, wird sich erst noch zeigen müssen. Schließlich ist nicht abzusehen, was zum Vorschein kommt, wenn der Gerichtsmediziner die Tote auf den Rücken dreht. Auf jeden Fall hätte sie schon allein den enormen Blutverlust nicht überlebt.
»Der Gerichtsmediziner müsste jeden Augenblick da sein«, sagt Silver mit noch immer leicht zittriger Stimme. »Und die Spurensicherung und der Krankenwagen. Ich habe alle vom Präsidium aus verständigt, nachdem ich Sie angerufen hatte.« Er zögert. »Ich habe Ihren Jungen im Hintergrund gehört. Tut mir leid, wenn ich –«
Leo hebt eine Hand. »So ist unser Job nun mal.«
Silver nickt.
»Haben Sie eine Freundin, Dan?« Leo sieht keinen Ehering, obwohl das nichts heißen muss. Viele seiner verheirateten Kollegen tragen keinen Ring. Das ist mitunter ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn besagte Kollegen sich in einer Bar ein bisschen außereheliche Abwechslung verschaffen wollen.
Silver antwortet nicht. Und er wirkt angespannt. Aber nicht so, als würde er gleich wieder aus den Latschen kippen. Eher verlegen, als wäre ihm das Thema unangenehm. Leo vermutet, dass der junge Mann vielleicht frisch getrennt ist. Oder vielleicht hat Leo auch ganz einfach die falsche Frage gestellt.
Leo zuckt mit den Schultern. Er wird nicht nachbohren. Das ist nicht sein Stil. Neugierig ist er nur von Berufs wegen. Oder wenn er meint, private Probleme könnten sich nachteilig auf die Arbeit auswirken. Bisher hat er mit seinen Partnern Glück gehabt. Sie konnten Privates stets von Beruflichem trennen. Leo versucht das auch. Aber nicht immer mit Erfolg.
»Geht’s wieder?«, fragt Leo.
Silver antwortet nicht. Vielleicht ist er noch nicht so weit oder vielleicht will er sich etwas von der Seele reden. Bis die übrigen Kollegen eingetroffen sind, ist ohnehin nicht viel zu tun. Im Haus sind nur drei Wohnungen. Sein Partner hat ihm am Telefon gesagt, dass die Mieter im Erdgeschoss, vier Studenten, nicht zu Hause sind und dass die alte Frau, die die Leiche entdeckt hat, allein lebt und nicht vernehmungsfähig ist. Die beiden Streifenpolizisten hatten in der Wohnung der Ermordeten nachgesehen und niemanden vorgefunden – weder tot noch lebendig.
Also wartet Leo, während Silver weiter schweigt. Eine gute Minute vergeht.
»Dreierlei spricht gegen mich«, sagt der junge Detective schließlich mit leicht geröteten Wangen.
Leos einzige Reaktion ist eine kaum merklich hochgezogene Augenbraue.
Silver zählt sie an den Fingern ab. »Landei aus dem Mittleren Westen, Jude und …« – eine deutliche Pause – »schwul.«
Leos Mundwinkel heben sich leicht. »Komisch, Sie sehen gar nicht aus wie …« – er hält bewusst inne – »ein Jude.«
Die Anspannung weicht aus Dan Silvers Gesicht. Er lächelt schwach. »Sie sind nicht der Erste, der das sagt.«
»Das kann ich mir denken.«
Silver schiebt die behandschuhten Hände in die Taschen seines Jacketts. »Ich bin mit jemandem zusammen, Lieutenant, aber wir haben Probleme, Michael und ich. Vor allem jetzt, wo ich beim Morddezernat bin. Offen gestanden, er hat eine Heidenangst um mich. Er sagt, jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, fragt er sich, ob ich heil zurückkomme … oder überhaupt.«
Leo nickt verständnisvoll. Dauerhafte Beziehungen sind bei Polizisten nicht die Regel, erst recht nicht beim Morddezernat. Ehefrauen, Ehemänner, Freundinnen oder Freunde kommen oft nur schlecht mit den Arbeitszeiten von Cops klar – und noch schlechter mit den grässlichen Dingen und den Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Es gab mal eine Zeit, da hatte Leo sich glücklich geschätzt. Er hatte eine Frau, die Verständnis für das Polizistenleben hatte. Das Glück ist ihm noch nicht völlig abhandengekommen. Aber es wird immer weniger. Er würde die Entwicklung gern aufhalten, aber er hat noch keine Idee, wie er das anstellen soll. Außerdem ist er nicht mal sicher, ob seine Partnerin das überhaupt will.
»Sehen Sie mal da«, sagt Silver und deutet die Treppe in den zweiten Stock hoch. Sein Ton hat sich verändert. Jetzt, wo er losgeworden ist, was ihm auf der Seele brannte, ist er wieder durch und durch Polizist.
Leo sieht eine noch glänzende Blutspur.
»Ich war schon mal oben, bevor Sie eingetroffen sind. Die Tür steht auf. Keine Angst, ich habe gut aufgepasst, aber ich kann nicht garantieren, dass die Kollegen von der Streife da nichts vermasselt haben.«
Leo nickt. »Und?«
»Jede Menge Blut in der Küche. Beistelltisch mit Marmorplatte im Wohnzimmer umgekippt. Keine Tatwaffe zu sehen. Die Blutspuren führen aus der Wohnung ins Treppenhaus. Die alte Dame hat gehört, wie etwas Schweres die Treppe runtergepoltert ist. Hat gedacht, es wäre eine Schultasche.« Er hält inne, verdreht die Augen, richtet dann den Blick wieder auf das Opfer. »Sie muss aus der Wohnung gekrochen sein, ist die Treppe runtergefallen und hat sich noch zur Wohnungstür von der alten Lady geschleppt, um sie zu alarmieren.« Er erzählt Leo, dass die alte Frau gedacht hat, eine Ratte würde an der Tür kratzen.
Silvers Blick ruht auf der Toten. Leo bemerkt, dass die Augen seines neuen Partners ein wenig wässrig sind, aber seine Gesichtsfarbe sieht besser aus. Er wird klarkommen.
Sie gehen hinauf in den zweiten Stock, achten genau darauf, wo sie hintreten. Diesmal geht Silver hinter Coscarelli.
»Wissen wir, wie das Opfer heißt?«, fragt Leo, als sie fast oben sind.
»Buckley. Sherry Buckley.« Silver räuspert sich. »Die alte Dame hat den beiden Kollegen erzählt, dass der Mann des Opfers – Polizist ist.«
3
»Da kommt sie. Das ist die Tochter.«
Jenni sieht die neugierige alte Ziege von unten mit einem Polizisten auf der Straße vor dem Haus stehen. Rose Soundso. Jenni kann sich nicht an den Namen erinnern. Sie kann ohnehin keinen klaren Gedanken fassen, weil die runzelige alte Schachtel sich an den Cop klammert und mit der anderen auf sie zeigt.
Jenni ist gerade um die Straßenecke gebogen, nachdem sie zwei Blocks entfernt an der U-Bahn-Station Forest Hills ausgestiegen ist. Noch ehe sie die alte Lady kreischen hörte, war sie bereits wie angewurzelt stehen geblieben, geschockt von den beiden Polizeiwagen und dem Krankenwagen vor dem Haus, das mit gelbem Plastikband abgesperrt ist. Außerdem sieht Jenni eine Schar von Gaffern hinter der Absperrung und auf der anderen Straßenseite.
Ein Mann kommt die Stufen der kleinen Eingangstreppe herunter, die oben neben der Haustür mit Fahrrädern von den vier Studenten aus dem Erdgeschoss zugestellt ist. Der Mann ist mittelgroß und schlank, trägt eine dunkelblaue Seemannsjacke und Jeans. Er geht auf den Streifenbullen zu, der jetzt versucht, die halb hysterische alte Frau von dem Haus wegzubugsieren. Während der Cop sie zu einem der Streifenwagen führt, weint und schreit sie. »Niemals … so was hab ich … noch nie erlebt … Ich geh da nicht wieder rein … Wie ist so was nur … Ach, das arme Kind …«
Während Rose lautstark weiterjammert, beobachtet Jenni, wie der Mann in der Jacke kurz mit dem Cop in Uniform spricht, sich dann umdreht und sie direkt ansieht. Sie sind höchstens zwanzig Schritte voneinander entfernt. Sie starrt den Mann an. Als er auf sie zukommt, spürt Jenni, wie ihr eine Panikwelle durch den Körper schießt und das Blut in den Ohren anfängt, so laut zu pochen, dass das Gezeter der alten Frau fast übertönt wird. Endlich ist der Polizist mit ihr am Streifenwagen und hilft ihr hinein.
Der Mann in der Seemannsjacke kommt weiter auf Jenni zu. Aus der Entfernung sah er jünger aus. Jetzt sieht sie sein abgespanntes Gesicht, die grauen Strähnen in dem dunklen Haar, die Falten in den Augenwinkeln. Seine Augen, findet sie, wirken besonders müde.
Als der Mann nur noch wenige Schritte von ihr entfernt ist, überkommt Jenni blankes Entsetzen. Sie dreht sich urplötzlich auf dem Absatz um und nimmt Reißaus, flüchtet um die nächste Ecke. Sehr weit kommt sie nicht, denn der Mann holt sie ein und hält sie am Ärmel fest.
»Jennifer? Ich bin Lieutenant Coscarelli.« Seine Stimme ist gelassen, ruhig, beruhigend.
Aber Jennis Panik ebbt nicht ab. Ehe er weiterreden kann, platzt sie heraus: »Wollen Sie mich festnehmen?«
Er lässt ihren Ärmel los, kneift leicht die Augen zusammen. »Weshalb?«, fragt er ohne hörbare Veränderung im Tonfall.
Die Spitze der gepiercten Zunge huscht über ihre trockenen Lippen, bis zu den goldenen Ringen im Mundwinkel. »Keine Ahnung.«
»Hast du denn irgendwas ausgefressen, Jennifer?« Leos Tonfall bleibt ruhig. Doch seine Augen kleben an der Jugendlichen.
Jenni schüttelt den Kopf.
»Wo kommst du jetzt her?«, fragt er.
»Schule«, murmelt sie.
Leo blickt auf die Uhr. Es ist kurz vor halb fünf.
»Was … was ist denn los?«
Für Leo ist es die unangenehmste Aufgabe überhaupt, den Angehörigen eines Opfers die traurige Nachricht zu überbringen, erst recht, wenn die Angehörigen noch halbe Kinder sind.
Doch ehe er dazu kommt, ertönt lautes Reifenquietschen, und Jenni blickt an dem Detective vorbei. Ihr ganzer Körper erstarrt, als sie einen funkelnagelneuen grauen Jeep Cherokee sieht, der mitten auf der Straße neben dem Krankenwagen zum Stehen kommt.
Ein Cop in Uniform läuft die Eingangstreppe herunter und will den Fahrer verscheuchen, den er offenbar für einen sensationslüsternen Gaffer oder Reporter hält. Doch der Mann im Jeep springt unbeeindruckt aus dem Geländewagen.
Jenni schnappt unwillkürlich nach Luft, als sie sieht, wie Aaron Buckley um den Krankenwagen herum zum Bürgersteig rennt. Falls er Jenni gesehen hat, lässt er sich jedenfalls nichts anmerken. Er steuert auf das Haus zu, doch der Uniformierte stellt sich ihm in den Weg. Buckley will sich an ihm vorbeischieben. Ein zweiter Cop kommt aus der Tür, und alle drei Männer prallen auf den Stufen zusammen.
»Lasst mich ins Haus, ihr Arschlöcher. Das da oben ist meine Frau –« Buckley, ein großer, stämmiger Mann, der sich mit seinen sechsundvierzig Jahren körperlich topfit hält, versucht, die beiden beiseitezustoßen, hat aber gegen die ebenfalls kräftig gebauten Cops nicht den Hauch einer Chance.
Aaron Buckley wehrt sich mit Händen und Füßen und flucht lautstark, als die Cops ihn die Treppe hinunterziehen. »Ihr verdammten Schweine, ich will sie sehen. Sie ist meine Frau, ihr Arschlöcher. Es ist mein verdammtes Recht –«
»Buck«, ruft der Detective, der neben Jenni steht.
Buckley dreht sich um, als er seinen Namen hört, und sein Blick fällt zuerst auf Coscarelli und dann auf Jenni, aus deren Gesicht alle Farbe gewichen ist. Der Beamte vom Sittendezernat blickt seiner Stieftochter einige Sekunden lang in die Augen. Sein breites, vor Wut und Frust bereits gerötetes Gesicht läuft dunkel an. Dann stürzt er wie ein wild gewordener Stier auf die beiden zu.
Coscarelli stellte sich instinktiv vor Jenni, aber mit seiner schmächtigen Statur hat er keine Chance. Buckley stößt ihn zur Seite, als wäre er eine Stoffpuppe. Coscarelli fällt in einen Maschendrahtzaun, der den mickrigen Rasen eines Vorgartens umzäunt, während Buckley Jennis Arme packt und sie ein gutes Stück vom Boden hochhebt, bis ihr kleines, verängstigtes Gesicht auf Augenhöhe mit ihm ist.
»Wieso, Jenni? Deine eigene Mutter. Sie hat dir das Leben geschenkt, und du machst so was?« Speichel fliegt ihr ins Gesicht, während er sie anschreit.
»Was … soll ich gemacht haben?« Jennis Stimme ist ein dünnes Piepsen. Dann drehen sich ihre Augen nach innen, und ihr ganzer Körper erschlafft. Sie ist ohnmächtig.
4
Natalie Price, Superintendent vom Horizon House, einem Entlassungsvorbereitungszentrum für Strafgefangene in der Bostoner Innenstadt, liest gerade den Bericht über einen Neuzugang, als Angelina Sanchez, ihre Sekretärin, die auch Insassin ist, sich über die Sprechanlage meldet.
»Hab ihn gerade reinkommen sehen«, sagt Angel, wie sie lieber genannt werden möchte.
»Danke.« Nat beendet den Aktenvermerk, den sie über den Insassen schreiben muss, der am Montag von CCI Norton, der Männerhaftanstalt mittlerer Sicherheitsstufe in Neuengland, ins Zentrum überstellt werden soll, und klappt die Akte zu. Dann verlässt sie ihr Büro, schreitet entschlossen über den Flur zum Büro ihres Stellvertreters und öffnet schwungvoll die Tür. Es ist fast halb fünf, und obwohl er höchstens zwei Minuten da sein kann, steht Jack Dwyer schon mit dem Rücken zu ihr am Fenster und telefoniert. Der Blick geht auf ein braunes Stück Rasen, der im Sommer als kleiner Garten für die Insassen dient. Er bricht mitten im Satz ab und wirft einen Blick über die Schulter.
»Mein Boss sieht aus, als würde sie jeden Moment Gift und Galle spucken. Ich meld mich später nochmal.« Er klingt völlig unerschrocken, als er das in den Hörer sagt, und beendet das Telefonat. Dann geht er mit humpelnden Schritten zurück an seinen Schreibtisch, der etwa drei Meter vom Fenster entfernt steht. Das Humpeln ist zwar echt, aber bewusst übertrieben.
»Versuchst du die Mitleidstour?« Die Frage klingt nicht ganz so sarkastisch, wie Nat es gern hätte. Schließlich ist es ihre Schuld, dass Jack Dwyer humpelt. Er hatte eine Kugel abgefangen, die für sie gedacht war. Knapp drei Monate musste er in einer Reha-Klinik verbringen. Eine unerträglich lange Zeit, auch für Nat, denn es stand in den Sternen, ob Jack je wieder ohne Hilfe würde gehen können. Heute war die schreckliche Geschichte fast auf den Tag genau ein Jahr her. Und dieser Tag würde Nat wahrscheinlich bis an ihr Lebensende verfolgen, aber nicht nur, weil Jack angeschossen wurde. An dem Tag hatte sie außerdem eine Fehlgeburt gehabt, das Baby verloren, das vielleicht von Jack war.
Aber nur vielleicht.
Ihr Stellvertreter grinst mit diesen sanften Augen, die so gar nicht zu seinem markanten Gesicht passen wollen. Jack Dwyer, neunundvierzig, ist ein etwas in die Jahre gekommener Marlboro-Mann. Er ist auch ein Mann, der zu viel trinkt. Mit diesem Problem schlägt er sich seit Jahren herum, und er ist schon so oft rückfällig geworden, dass seine Seele Hornhaut davon haben muss. Erschwerend hinzu kommt, dass man ihm, nachdem er angeschossen worden war, im Krankenhaus jede Menge Schmerztabletten verabreichte. Weiß Gott keine gute Idee bei einem Mann mit einem Suchtproblem. Und diese verhängnisvolle Kombination machte seinen Kampf gegen die Sucht mehr oder weniger zur Sisyphusarbeit.
Was auch der Grund ist, warum Nat jetzt im Büro ihres Stellvertreters steht. Und der Grund für ihre schlechte Laune.
»Ob du’s glaubst oder nicht, das am Telefon war meine Betreuerin«, sagt Jack, der sich denken kann, warum Nat gekommen ist. Auf seinem Schreibtisch verteilt liegen nicht nur lose Blätter und Akten, sondern auch die Reste eines McDonald’s-Mittagessen vom Vortag. Kann auch noch älter sein.
»Wir haben halb fünf«, stellt sie mit dem Tonfall eines Ausbilders fest, der einen aufsässigen Rekruten zusammenstauchen will.
Jack blickt auf die große alte Schuluhr an der Wand. »Dreiundzwanzig Minuten nach vier.«
»Du bist nicht ans Handy gegangen. Ich hab dich mindestens ein halbes Dutzend Mal angerufen.«
Jacks Lächeln wird leicht verführerisch. »Schön zu wissen, dass ich dir so gefehlt hab.«
Nat weiß, dass hinter dem Lächeln nichts steckt. Nicht mehr. Reine Gewohnheit, wenn sie sauer auf ihn ist. Seine Art, ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen.
»Wieso bist du nicht drangegangen?«, bohrt sie nach.
»Akku leer.«
»Und was, wenn –«
»Ich hab mich ein paar Mal gemeldet.«
»Du hast weder mit mir gesprochen noch bei Angel eine Nachricht hinterlassen.«
»Ich hab mit Hutch gesprochen. Er hat gesagt, es wäre alles ruhig.«
»Hutch hätte mir Bescheid geben müssen, dass du angerufen hast.« Hutch war Gordon Hutchins, der leitende Aufseher im Horizon House.
»Klär das mit ihm.«
»Worauf du dich verlassen kannst«, faucht sie.
Beide schweigen. Es stimmt, sie wird auf jeden Fall ein ernstes Wort mit Hutch reden müssen. Er ist seit über dreißig Jahren im Vollzug tätig, wie sie weiß, und hat sich nie so ganz daran gewöhnen können, dass eine Frau im Horizon House das Sagen hat. Und noch dazu eine Frau, die halb so alt ist wie er und weit weniger Erfahrung in dem Metier aufzuweisen hat. Den- noch, im Laufe der Zeit hat Nat es geschafft, Hutch für sich zu gewinnen. Sie ist überzeugt, dass er sie mag, auch wenn er zuweilen allzu väterlich mit ihr umgeht. Und es ärgert sie, wenn er eigenmächtig handelt, weil er meint, die Chefin braucht nicht damit behelligt zu werden, was er auch diesmal wieder sagen wird, wenn sie ihn deshalb zur Rede stellt. Nat predigt ihren Mitarbeitern immerzu, dass es in diesem Haus nichts gibt, mit dem man sie nicht behelligen muss. Und je früher …
Jack schnippt mit den Fingern, reißt sie aus ihren Gedanken.
»Was liegt an?«, fragt er munter.
Nat ist wieder bei der Sache, aber noch nicht bereit, das Thema, das sie eigentlich beschäftigt, zur Sprache zu bringen. »Dein Arbeitstag beginnt um neun Uhr morgens, Jack.«
»Es ist Donnerstag, Nat.«
»Ich weiß, dass –« Sie hält abrupt inne. »Ach ja. Stimmt.« Jetzt fällt es ihr wieder ein. In Framingham wird kommenden Monat ein neues Entlassungsvorbereitungszentrum eröffnet, und Jack war gebeten worden, den Dezember über einen Tag pro Woche bei der Personaleinarbeitung behilflich zu sein. Zwei Wochen zuvor hatten er und Nat sich auf den Donnerstag geeinigt. Und heute, am ersten Donnerstag des Monats, hat er seine Tätigkeit dort angetreten. Eigentlich hätte er gar nicht mehr im Horizon House vorbeischauen müssen, was das Ganze für Nat noch peinlicher macht.
Aber sie hat noch ein dringendes Problem mit ihrem Stellvertreter zu klären.
Jack, der an dem chaotischen Schreibtisch gelehnt hat, humpelt jetzt zu seinem lädierten Drehsessel, den er auf dem Flohmarkt entdeckt hat. Alles in Jacks Büro ist schäbig, der alte braune Ledersessel, ein verschlissenes Sofa, ein altersschwacher Schreibtisch, ein großer, rostiger Aktenschrank. Sogar das billige Rolling-Stones-Poster in dem Metallrahmen hängt schief an der Wand. Aber das Büro befand sich keineswegs von Anfang an in diesem Zustand. Als das ehemalige Frauenhotel auf der Providence Street vor über vier Jahren saniert und zum Horizon House umgebaut wurde, wirkte Natalie Price als frisch ernannte Chefin aktiv an der Innenausstattung mit. Das Zentrum war zwar ohne jeden Zweifel eine Strafanstalt, wenn auch ohne Betonmauern, Gitter oder Zellen, doch Nat konnte erreichen, dass das Innere nicht allzu sehr an ein Gefängnis erinnerte. Keine tristen grünen Wände oder das Behördenmobiliar. Trotz des mageren Etats sorgte Nat für etwas Farbe und Behaglichkeit. Und das galt auch für die Büros. Jack jedoch hatte sogleich die beiden Polstersessel, den Teakholzschreibtisch mit seinen klaren Linien und den Drehstuhl mit der Korblehne ausrangiert. Er nahm auch die Monet- und Degas-Drucke von den Wänden. Hab mich nicht wohlgefühlt, lautete sein knapper Kommentar, als sie die Umgestaltung bemerkte.
»Sonst noch was auf dem Herzen, Superintendent?« Sein überhebliches Lächeln verrät ihr, dass er die Antwort genau kennt. Aber er will es ihr nicht ganz so einfach machen.
Trotz seines Lächelns sieht Jack furchtbar aus, schlecht rasiert, die Haare ungewaschen und zu lang, dunkle Ringe unter den Augen. Und hatte er das blau-weiß gestreifte Hemd nicht gestern schon an? Ja, denkt Nat, als sie den Ketchup-Fleck direkt unter der Brusttasche sieht. O Gott, ist er verkatert?
»Warum warst du gestern Abend nicht bei dem Treffen?« Sie bemüht sich um einen neutralen Tonfall, hört aber den Vorwurf, der in ihrer Stimme mitschwingt.
»Das hat mich meine Betreuerin auch schon gefragt.« Er wirft einen Blick aufs Telefon.
»Nenn sie nicht immer deine Betreuerin«, faucht Nat.
»Wittere ich da Eifersucht?«
»Was du witterst, ist dein vergammelter Hamburger.« Sie starrt auf die McDonald’s-Packung.
»Na schön. Nick. Zufrieden? Nick hat mich das auch schon gefragt.«
Nats Lippen zucken. Wieso stört es sie so, dass Jack Nicki Holden Nick nennt?
Keine Eifersucht. So einfach ist das nicht. Aber was, denkt Nat, war in ihrem Leben schon einfach? Die kurze, aber desaströse Affäre mit ihrem Stellvertreter vor einem Jahr? Die Beziehung, die sie seit fast drei Jahren mit dem Mann hat, der Nicki Holdens Exliebhaber und der Vater von Nickis Kind ist? Noch dazu eine Beziehung, die das vergangene Jahr beschissen gelaufen ist. Ganz zu schweigen davon, dass Nick, wie sie so liebevoll von Jack genannt wird, eine ehemalige Insassin des Horizon House ist. Und womöglich Jacks derzeitige Geliebte. Nat weiß, dass sie die Liste an Komplikationen, die das Flickenmuster ihres Lebens bilden, fortsetzen könnte, doch vorläufig reichen ihr diejenigen, die sie im Kopf bereits abgehakt hat.
»Und, wer hat mich verpfiffen?«, fragt Jack, noch immer mit unbekümmertem Ton. »Nein, nicht verraten. Charlie, stimmt’s? Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit Dunbar reden. Was bei den Treffen so alles passiert, soll den Raum nicht verlassen.«
»Du warst nicht im Raum, Jack. Das ist es ja gerade.«
Jack blickt Natalie mit zusammengekniffenen Augen an und setzt ein sarkastisches Lächeln auf. »Dein Liebesleben liegt noch immer auf Eis, was?«
»Halt die Klappe.« Nat ist es unangenehm, dass Jack über ihre kaputte Beziehung Bescheid weiß. Aber daran ist sie selbst schuld. Und das ist nicht das Einzige, was sie sich vorwirft. Doch darüber möchte sie nicht nachdenken, sonst würde sie in eine so tiefe Verzweiflung stürzen, dass sie nie wieder rauskäme.
Jacks Miene wird freundlicher. »He, mach mich zur Schnecke, dann fühlst du dich besser.«
Sie wird sich nicht besser fühlen, und das weiß Jack genauso gut wie sie.
Sie wartet ein paar Sekunden, bis sie wieder klar denken kann. »Schläfst du mit Nicki?« Verdammt. Die Frage wollte sie nun wirklich nicht stellen. Anscheinend ist sie doch noch nicht ganz klar im Kopf.
Jack deutet auf das Sofa an der Wand – ein Fundstück vom Sperrmüll. Wo es auch hingehört. Nat beäugt das ramponierte, mottenzerfressene und vermutlich flohbefallene Möbel mit unverhohlenem Ekel. Sie würde sich eher in der Herrentoilette einer schäbigen Stripteasebar auf die Klobrille setzen als auf dieses Sofa. Andererseits ist es ihr unangenehm, so unschlüssig rumzustehen, daher entscheidet sie sich für die einzige andere Sitzgelegenheit im Raum. Sie muss erst einen Stapel Akten von dem Holzstuhl räumen, ehe sie Platz nehmen kann. Sie legt sich den Stapel einige Sekunden auf den Schoß, weil sie nicht weiß, wohin damit. Dann lässt sie ihn neben sich auf den Boden plumpsen.
»Wie kannst du bloß in diesem Chaos arbeiten?«, knurrt sie.
»Hast du Grund, dich über meine Arbeit zu beklagen, Boss?«
»Und nenn mich nicht immer Boss. Was soll das neuerdings?« Ihr Zorn wächst. Schlimmer noch, sie sieht Jack Dwyer an, dass es ihm Spaß macht, ihn zu schüren.
Nat versucht, die Fassung zu bewahren. Denk nach, ehe du den Mund aufmachst. »Wir hatten eine Abmachung, Jack.« Ihr Ton ist ruhig, gemessen. »Du hast mir versprochen, keines der Treffen zu verpassen, es sei denn, du hast einen ernsthaften Grund.«
»Und du kommst gleich hier reingestürmt, weil du felsenfest davon überzeugt bist, dass ich keinen ernsthaften Grund hatte.«
»Ich hab dich gefragt, warum du nicht hingegangen bist.«
Er lächelt gequält. Sie wissen beide, dass sie keine befriedigende Antwort erwartet hat.
Nat fühlt sich ertappt und seufzt. »Also schön, tut mir leid, wenn ich voreilige Schlüsse gezogen hab.«
»Wie die Schlussfolgerung, dass ich mit der Ex deines Freundes schlafe?«
Nat spürt, wie ihr die Hitze den Hals hochsteigt. »Das geht mich nichts an.« Aber dann blickt sie Jack ruhig in die Augen. »Nein, es geht mich sehr wohl was an. Nicki ist ein Exhäftling, Jack. Sie war sechs Monate hier bei uns. Sie ist –«
»Sie ist auch Jakey Coscarellis Mommy.«
»Ja«, sagt Nat ein wenig kleinlaut. »Das auch.«
»Dabei fällt mir ein«, sagt Jack. »Leo hat Jakey vor gut einer Stunde bei ihr abgeliefert, weil er zu einem Tatort in Jamaica Plain musste. Jakey war stinksauer, weil er nicht noch länger im Museum bleiben konnte. Jedenfalls, Leo hat sie vorhin vom Tatort angerufen, um zu fragen, ob Jakey sich wieder beruhigt hat. Und dabei hat er erwähnt, dass das Opfer eine Frau ist und der Mann des Opfers ein Cop, den Leo von früher kennt.«
»Hat Nicki gesagt, wer?«
»Einer von der Sitte. Der Nachname ist Buckley. Hab vergessen, wie er mit –« Er stockt mitten im Satz, als er sieht, wie Nat von ihrem Stuhl hochschießt.
5
»Was? Du kennst ihn auch?«, fragt Jack verwundert über Nats besorgtes Gesicht.
»Nein. Nein …« Sie dreht sich um und will zur Tür.
»Nat? Was ist los?« Jack ist aufgestanden, und als er auf sie zugeht, humpelt er nicht mehr so stark.
Sie bleibt an der Tür stehen und blickt ihn mit trüben, grünen Augen an. »Ich kenne seine Stieftochter. Du übrigens auch.«
Jacks Miene bleibt verwirrt.
»Jenni.«
»Jenni? Du meinst –?«
»Jennifer Dunbar. Die Tochter von Charlie Dunbar.«
»O verdammt«, sagt Jack. »Dann ist Jennis Mom das Opfer, das –« Wieder lässt er den Satz unbeendet und tiefe Falten zerfurchen seine Stirn.
Nat nickt langsam. »Und Charlies Exfrau.«
»Verfluchter Mist«, knurrt Jack, als er die ganze Tragweite begreift.
»Wo arbeitet Charlie?« Nats Tonfall ist jetzt alles andere als ruhig.
Jack runzelt die Stirn. »Keine Ahnung.«
Nat reißt die Tür auf, und als sie den Flur entlanghastet, stößt sie beinahe mit ihrem leitenden Aufseher zusammen.
»Wo brennt’s denn?«, fragt Hutch. Er sieht nicht übermäßig besorgt aus. In den vielen Jahren, die er schon im Geschäft ist, hat er alles gesehen und mehr erlebt, als ihm lieb ist, wie zum Beispiel die wilden Häftlingsaufstände im CCI Oakridge, dem Hochsicherheitsgefängnis, in dem Hutch fünfundzwanzig Jahre beschäftigt war, ehe er den Posten im Horizon House ergatterte. Wie er selbst öfter festgestellt hat, ist die Arbeit in einem Entlassungsvorbereitungszentrum im Vergleich zu Oakridge sozusagen ein Spaziergang im Park. Allerdings hat er diese Aussage schon einige Male relativieren müssen, wenn sich nämlich der Park in ein Minenfeld verwandelte.
»Wo ist Charlie Dunbar?«, schleudert Nat ihm entgegen. Dass sie ihn eigentlich ins Gebet nehmen wollte, hat sie ebenso vergessen wie die Frage, warum Jack am Vorabend das Treffen der Anonymen Alkoholiker geschwänzt hat.
»Arbeiten.« Hutch, untersetzt, breitschultrig und mit Bauchansatz, blickt jetzt beunruhigt.
»Wo?«, fragt diesmal Jack von seiner offenen Bürotür aus.
Bevor Hutch sein Schulterzucken beenden kann, fegt Nat an ihm vorbei und rennt zu dem Büro am Ende des Korridors, das Sharon Johnson gehört, ihrer Berufsberaterin.
Alle Häftlinge, die ins Horizon House kommen, werden in weniger als neun Monaten entlassen. Dieses Zentrum, wie auch alle anderen Einrichtungen seiner Art in Neuengland, wurde ins Leben gerufen, um Gefangenen durch die Vermittlung von Jobs die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern. Das Horizon House ist allerdings das einzige koedukative Entlassungsvorbereitungszentrum. Frauen und Männer sind zwar auf verschiedenen Etagen untergebracht, nehmen aber gemeinsam an internen Maßnahmen teil. Dank Natalies Überzeugungsarbeit gab der Commissioner, der Leiter der Strafvollzugsbehörde, schließlich grünes Licht für den Plan. Natürlich sind ihm das ein oder andere Mal Zweifel gekommen, ob seine Entscheidung klug war. Doch da die Rückfallquote von Natalies Schützlingen konstant niedriger ist als bei allen rein männlichen oder weiblichen Einrichtungen, ist der Commissioner nach wie vor auf ihrer Seite.
Für die Jobvermittlung und die laufende Betreuung der Männer und Frauen in ihren jeweiligen Jobs ist Sharon Johnson zuständig. Ein wichtiges Kriterium für den Erfolg des Entlassungsvorbereitungsprogramms ist die Bewährung in einem Job und die Bereitschaft, sich als verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu beweisen – wer zu spät zur Arbeit kommt, vorzeitig Feierabend macht, schlecht arbeitet, sich ohne Erlaubnis von der Arbeitsstelle entfernt und nicht zu vereinbarten Zeiten wieder da ist, hat Disziplinarmaßnahmen zu erwarten und muss unter Umständen damit rechnen, den Rest seiner Haftstrafe wieder hinter Gittern abzusitzen.
Nat betet, dass nicht schon wieder einer ihrer Insassen unter Mordverdacht gerät. Das könnte nämlich katastrophale Folgen für ihr Zentrum und für sie persönlich nach sich ziehen.
Sharon Johnson führt gerade ein Gespräch mit einer Insassin, als Nat in das kleine, fensterlose Büro gestürmt kommt, das dank der farbenfrohen, dynamisch abstrakten Gemälde an den pastellblauen Wänden hell und freundlich wirkt: Arbeiten von Sharons Lebenspartnerin Raylene Ford. Jetzt, da gleichgeschlechtliche Ehen in Massachusetts legalisiert wurden, wollen die beiden Weihnachten heiraten.
Die Berufsberaterin blickt überrascht zu Nat auf. Normalerweise kommt ihre Chefin nicht so hereingeplatzt. Dann sieht sie den verstörten Ausdruck in ihrem Gesicht.
»Miss Mendez, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen«, sagt Sharon höflich zu der Insassin. Die junge Latina springt nervös auf und geht mit niedergeschlagenen Augen zur Tür.
»Entschuldigen Sie die Störung. Sie können draußen warten«, sagt Nat zu der irritierten Frau. »Es wird nicht lange dauern.« Sobald sich die Tür hinter Miss Mendez geschlossen hat, kommt Nat zur Sache. »Du musst dringend für mich nachsehen, wo Charlie Dunbar arbeitet.«
»Das weiß ich auch so«, sagt Sharon. »Bei Goodman Printing in Brighton.«