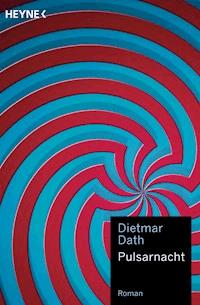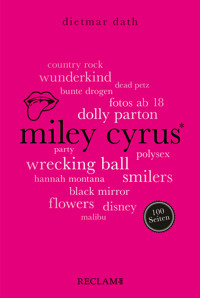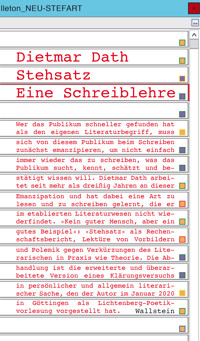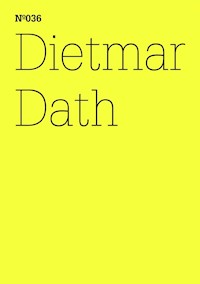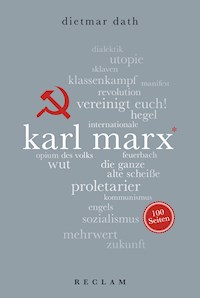13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Komponistin, Denkerin und Dichterin Cordula Späth, eine Figur, die in Daths Romanen immer wieder auftaucht – ist nach einem Sturz aus dem Fenster, nun ja, irgendwie verschwunden. War es ein Unfall? Ist sie tot? Ihre Freund:innen Katja, Wolfgang, Dietmar, Barbara können es nur schwer begreifen und arbeiten sich unterschiedlich daran ab, und das Leben bleibt auch nicht stehen, ebenso wenig wie die sie umgebende Wirklichkeit, die allen ein ständiges Ringen abverlangt. Gerungen wird mithilfe von Musik, Comics, antiker wie sehr gegenwärtiger Prosa, philosophischen, naturwissenschaftlichen und psychoanalytischen Theorien. Und schier allen Ideen der 1990er Jahre. Um zu begreifen … oder … Und dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse … Der Debütroman von Dietmar Dath erschien 1995 als erstes Buch des Verbrecher Verlags. Nun ist es Zeit, diesen lange vergriffenen genialen Roman neu herauszubringen. Dath ergänzt diese Neuausgabe um eine Geschichte in fünf kurzen Kapiteln, in der die Romanfiguren über das Werk und den Autor richten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CORDULAKILLT DICH!
Oder
Wir sind doch nicht die Nemesis von jedem Pfeifenheini
Roman der Auferstehung
Erste Auflage
Verbrecher Verlag Berlin 2021
www.verbrecherei.de
© Verbrecher Verlag 2021
Satz: Christian Walter
ISBN 978-3-95732-491-7eISBN 978-3-95732-509-9
Der Verlag dankt Antonia Lesch und Johanna Seyfried.
Inhalt
PROLOG
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
EPILOG
NACHBEMERKUNG
EDITORISCHE NOTIZ ZUR NEUAUSGABE
DIE STAATSANWÄLTIN HAT DAS WORT
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
Manches hier drin ist ein Witz.
Anderes aber hat nicht nur genaus so stattgefunden,
sondern hätte auch, selbst wenn es nicht so stattgefunden
hat, gar nicht anders stattfinden können.
Man sieht, so kommt man nicht weiter.
Schönberg; »Harmonielehre«
This madness must stop.
Wolverine in Todd McFarlane’s »Perseptions«
PROLOG
Alles, was traurig ist,
müßte mal beweint werden
(zum Beispiel Lenins »Staat und Revolution«,
aber auch das mit den Giraffen)
»Now somewhere in the Black Mountain Hills of Dakotathere lived a young boy named Rocky RaccoonOne day his woman ran off with another guyHit young Rocky in the eyeRocky didn’t like that he said I’m gonna get that boy …«
The Beatles; Rocky Raccoon
Songtexte, so schwebte uns vor, hätten sich doch eigentlich behandeln lassen müssen, als habe es sie immer schon gegeben. Was war denn »déjà«, immer schon da, wenn nicht die Songtexte? Also, die Bücher bestimmt nicht. Die mußte man doch dauernd neu schreiben. Die wurden nicht »geliefert« wie die Songtexte –
Wir schrieben die Mitte des Endes. Das Ende waren die Neunziger. Die Mitte war also ungefähr das Jahr 1995.
Nun, irgendwo in den schwarzen Bergen von Baden-Württemberg lebte ein junger Mann namens Deisuke-San. Eines Tages lief seine Frau fort, mit einem anderen Mann. Das traf Deisuke mitten ins Auge. Deisuke mochte das nicht. Er sagte, den Burschen, den kauf ich mir. Also ging er eines Tages hinunter in die Stadt und mietete sich ein Zimmer in der Absteige. Deisuke bezog sein Zimmer, setzte sich hin, richtete sich ein, aber anstatt mit einem Gewehr war er mit einem Computer gekommen.
Dann schrieb er einen Roman.
Die formalen Lösungen der anliegenden Probleme fielen in den verschiedenen Kapiteln sehr unterschiedlich aus. Es wurde ein sehr heterogener Roman. Eigentlich war es ein Matsch. Das Warten war noch nie Deisukes Sache gewesen, aber allmählich fing es an, ihm zu gefallen. Man konnte so viel tun.
Man konnte aus dem Fenster schauen.
Man konnte ein Computerspiel spielen.
Man konnte sich überlegen, was Musik wirklich war.
Man konnte draufkommen, daß das wichtigste Tier auf der Welt die Giraffe war. Daß all das, was die Menschen die ganze Zeit falsch gemacht hatten und was sie weiterhin falsch machen würden, schon klar, wer hätte es ihnen verwehren oder gar ausreden sollen, nur deshalb falsch gemacht (und dann zu allem Übel auch noch fortlaufend falsch interpretiert, falsch bekämpft, unter Berufung auf die falschen CharismatikerInnen, unter Berufung auf Ideen wie die, es sei vielleicht sogar einfacher, das Falschmachen den Menschen auszureden als es ihnen zu verwehren, wo doch beides unmöglich, Ersteres aber noch ein bißchen unmöglicher als Letzteres ist) worden war, weil es keine Tradition bei den Menschen gab, sich Giraffen als Haustiere zu halten. Die Großzügigkeit, die eine richtige Hege und Pflege von Giraffen zwangsläufig fordert und lehrt, wäre es gewesen: die Eigenschaft, die die Menschen gut machen würde. Das wär’ die Lösung gewesen. Aber eigentlich, naja, eigentlich ist das doch genauso trivial wie das andere Zeug, oder?
Jeden Tag ging Deisuke im Park spazieren und erzählte sich von sich in der dritten Person und im Imperfekt: »Er ging jeden Tag hier im Park spazieren, das machte er so lange, bis die Vogelkäfige unter den hohen Nadelbäumen eines Tages leer waren, da wußte er, es war an der Zeit, die Route zu ändern und statt im Park jetzt mehr entlang der Landstraße zu spazieren.« Seit den Tagen seiner Jugend hatte man ihn gelehrt, wie das funktioniert: von Leuten im Imperfekt und in der dritten Person zu berichten, also gab es gar keinen vernünftigen Grund, sich das selber vorzuenthalten. Es ging um unbedingte Gleichberechtigung.
Eines Nachmittags, eines sehr mattigen Nachmittags schon sehr im Herbst, klingelte in der Nähe der Landstraße plötzlich ein Telefon in einer Telefonzelle, an der Deisuke vorbeiging. Deisuke blickte sich um und stellte fest, daß in der ganzen weiten Gegend unter dem weiten Himmel, wo der Horizont in jeder Richtung sehr weit entfernt war, niemand zu sehen war. Also ging er zur Telefonzelle, betrat sie, und nahm den Hörer ab. Am andern Ende meldete sich eine tiefe, ein wenig sarkastisch klingende Stimme mit: »Hier Ignacio. Hören Sie mal zu, junger Mann. So geht das nicht. Das ist doch SCHEI-ße. Sowas ist doch SCHEI-ße. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Rilke, oder was? Wir machen hier keine Witze mit Ihnen, wir sind doch nicht blöd. Also, heute abend gehen Sie in die Hotelbar. Da werden Sie einen Arzt treffen. Mit dem werden Sie sich eine Weile unterhalten, Sie werden dann schon merken, was Ihnen das bringt. Übrigens, kennen Sie Lenins ›Staat und Revolution‹? Cordula Späth hat jetzt gerade angefangen, sie ist im Moment in einer Stadt im Nordosten Deutschlands, wir werden Sie noch wissen lassen, wo, aber jedenfalls hat Cordula Späth, wie ich gerade schon sagen wollte, jetzt damit angefangen, eine Fortsetzung von Lenins ›Staat und Revolution‹ zu schreiben, und die wird ›Staat und Information‹ genannt werden. Sie schreibt ihr Buch unter aller Augen, eine Menge davon entsteht direkt im Netz, jede und jeder können mitlesen, während sie an dem Buch arbeitet. Wir werden auch Ihnen zu gegebener Zeit die Adresse im Netz mitteilen, wenn Sie nicht selber draufkommen, dann können Sie ja mal Kontakt machen.« Deisuke versuchte, das Gespräch mit der tiefen, etwas sarkastischen Stimme noch eine Weile am Laufen zu halten (bis dahin war es ja noch gar kein Gespräch gewesen, sondern eine Kette von Anweisungen, Nachrichten und Unverschämtheiten), vor allem deshalb, weil er noch nicht richtig glauben konnte, daß es wirklich ein Gespräch für IHN war, aber alles Mißtrauen gegen die Paranoia (also alle Paranoia im Quadrat) halfen nichts, die Nennung des Namens von Cordula Späth war eigentlich schon der definitive Beweis gewesen, daß dieser Anruf sich an ihn richtete, da gab es ja längst nix mehr zu deuteln. Dennoch wurde die Stimme am andern Ende der Leitung ein bißchen freundlicher, und es gelang sogar, sie wirklich in ein Gespräch zu verwickeln, unter anderem darüber, ob das WÖRTLICH zu verstehen war mit der Fortsetzung von »Staat und Revolution«, denn dann müßten ja auch Äquivalente bzw. Fortschreibungen von so Sachen wie der impliziten Auseinandersetzung mit Kautsky aus Lenins Buch gefunden werden, und jenes Buch sei nun mal das Hauptwerk der Staatstheorie des Marxismus-Leninismus, also ganz unmarxistisch könne es bei einer Fortsetzung wohl nicht zugehen, aber man wisse doch, gerade Cordula, also wenn die jemals was Marxistisches schreibt, dann schreibe ich, so unkte Deisuke, den zweiten Band vom Buch Mormon. Die dunkle Stimme meinte, Fortsetzung sei in dem Sinne zu verstehen, daß Cordula eben ein Äquivalent für alle diese Dinge gefunden hätte, vor allem für das, was Lenin schon im ersten Kapitel versucht, nämlich gegen alle Entstellungen noch mal klar zu machen, daß der Staat ein Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze sei. Damit, also mit der unterstellten Verbindung von Cordula Späth und solchem Gedankengut, konnte Deisuke nun wirklich überhaupt nix anfangen. Und wie paßt die Krisentheorie und Wertlehre da rein? Oder, äh … aber die Stimme am anderen Ende verabschiedete sich, nicht ohne Deisuke aufzumuntern, mit der Prophezeiung, daß seine Frau (bei der es sich NICHT um Cordula Späth handelte, das möchte ich an dieser Stelle verraten, falls das jemand gedacht hat) bald zu ihm zurückkehren würde. Na, dann. Und damit stand Deisuke alleine in dieser komischen Telefonzelle. Er ging nach »Hause«, ins Hotel, und tat ansonsten alles, was man ihm aufgetragen hatte.
Der Arzt war da. Sie wurden bald Freunde.
Seltsam, diese neuen Chipkarten der Krankenversicherungen. Und der mit Deisuke befreundete Arzt meinte (es war ein anderer Arzt als der, der bei den Beatles in dem Song »Rocky Raccoon« ins Hotelzimmer kommt, nach Gin stinkt und den angeschossenen Rocky zusammenzuflicken versucht, ihm dann sagt, mein lieber Rocky, jetzt hast du aber einen kennengelernt, der dir über ist, worauf Rocky entgegnet, es sei ja bloß ein Kratzer und es werde ihm sehr bald besser gehen, nämlich sobald ich dazu in der Lage bin, dafür zu sorgen, daß es mir besser geht, worauf der Doktor zwar sicher wieder was Schlagfertiges antwortet, was die Beatles aber unterschlagen, es gibt eh so vieles, was Lennon / McCartney uns noch schuldig geblieben sind, aber dafür ist es jetzt auch zu spät), daß dieser ganze Kram, die Computer, die er jetzt bei sich in der Praxis aufgestellt hat und überhaupt die Digitalisierung der Heilkunde, ein einziger Bluff und Betrug sei, und niemandem helfe, am wenigsten ihm, dem Arzt, der durch die Anschaffung besagter Computer und der zu ihnen gehörigen Software einen enormen Mehraufwand an Arbeit habe leisten müssen. Deisuke wiegte den Kopf hin und her, trank noch einen Schluck Bier, es war schon spät, die Hotelbar würde gleich schließen, und der Doktor redete und redete und ramenterte und salbaderte, dann fing der Doktor noch an von den Beatles zu reden, genauer von John Lennon, es gebe da diese berühmte Geschichte, wo John Lennon mit Yoko Ono in diesem Bett gelegen habe, für den Frieden, und Al Capp, der alte, rechtsradikale Comiczeichner, der die »Li’l Abner«-Comics gezeichnet hat, sei reingekommen, während die Presse da war, und habe Ono beschimpft und sich selbst als den »alten Faschisten« bezeichnet, und in Anspielung auf den Song der Beatles »The Ballad of John & Yoko« habe er zu Lennon gesagt, kein Wunder, daß Lennon sich gekreuzigt fühle, wenn er mit so einem Ding verheiratet sei. Aber Lennon war noch viel arroganter als Capp, und Ono war’s egal, was der »alte Faschist« da sabberte. Und Deisuke hörte zu, aber der Arzt hörte nicht auf zu reden. Jetzt fing der Arzt an, von der Stadt Köln zu erzählen, das sei ja vielleicht eine Stadt, also dieses Köln, unglaublich. Naja, oh du mein Köln, oh schöne Stadt, wo die Leute sind und dann reden. Fein sei es in Köln. Dort gebe es viel zu sehen und zu bestaunen, Häuser, Gebäude. Ja, in Köln könne man sich aufhalten, ja, in Köln könne man es aushalten. Dort befänden sich, lautete die nebulöse Auskunft des Arztes, »gute Sachen«. Und neulich sei er in Köln gewesen und habe doch tatsächlich beobachtet, wie jemand aufs Klo ging. Beeindrukkend. Deisuke wurde müde, ging nach oben.
In den folgenden Wochen ging Deisuke immer seltener hinunter an die Hotelbar. Er machte sich statt dessen lange Gedanken über Cordula Späth.
Schließlich kehrte Deisukes Frau, die nicht Cordula Späth war, zu ihm zurück.
Doch da, wie es mit solchen Dingen gern ist, lag er bereits im Sterben.
Ich denke immer noch, alles hat eine Zukunft.
KAPITEL EINS
Weitschweifig und mit vielen Parenthesen und einer Riesenmenge von Namen, die man gar nicht alle verarbeiten kann, aber in den weiteren Kapiteln kommen nicht mehr so viele neue Namen dazu – alles über die Schwierigkeiten, die Ihr Euch so vorstellt, wenn Ihr Euch vorstellt, wie es wohl wäre, einen Roman über Cordula Späth zu schreiben, einen Roman, der ja auch vor der Aufgabe stünde, einer nicht genauer bekannten Anzahl von Leuten zunächst überhaupt einsichtig zu machen, daß über Cordula Späth irgendwas zu lesen lohnend sein könnte, und der sich von da aus in einen Roman entwickeln würde, darüber, wie Cordula zuerst gelebt hat, dann gestorben ist und dann ein zweites Mal gelebt hat, und somit alles darüber, daß die Schwierigkeiten, die Ihr Euch angelegentlich der Idee, daß ein solcher Roman geschrieben werden könnte, ausmalt, voll egal sind, weil es in Wahrheit unglaublich einfach ist, einen derartigen Roman zu schreiben, wie ich von hier aus zu beweisen beabsichtige, und wenn es dann schief geht, habt Ihr Recht gehabt, aber wiedermal nichts geliefert, im Gegensatz zu mir
»Dietmar Daths Zitatenlieferant ist irgendwer.«
Cordula Späth in einem Brief an Katja Benante
»Jeder ist irgendwer.«
Katja Benante auf einer Postkarte an Cordula Späth
»Ja, man kann eine Ratte dressieren. Wenn manstundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang,jahrelang mit der Ratte arbeitet, dann kannman eine Ratte dressieren. Aber alles, wasman dann hat, ist eine dressierte Ratte.«
Irgendwer
Ja! Ziemlich kindlich fällst Du ins erste Kapitel. Vertrauensvorschuß kannst Du ja geben.
Die ersten Worte: Immanuel, Immanuel, Immanuel, Immanuel Kant. (T-e-c-h-n-o: Immanuel, bip, Immanuel, bip, Immanuel, bip, Immanuel, bip, Immanuel, bip, Kant, smASSH!)
Ich bin 24 Jahre alt. ARRRRRRGGHHHHHHH!!!! Ich glaube fast, ich stinke schon. Aber nur fast.
Mit falbem Geschmack im Munde, soeben aus dem muffigen Bett aufgestanden, wage ich zu denken: Alle meine Freunde sind Rotze, ich hätte gern bessere. Mein Gehirn sollte in eine andere Dimension fliehen dürfen vor meinen Ideen. Meine Freunde lesen viel zu wenig Comics. Ich hätte lieber die Leute als Freunde, die die Comics geschrieben und gezeichnet haben, die ich lese. Ich hätte gerne Yukito Kishiro als Freund. Wow! Yukito Kishiro ist bestimmt ein absolut genialer Freund! Ich hätte gerne Dave Sim als Freund. Das wär’ geil, dann würde ich bei ihm in Kanada herumsitzen und jede Seite von seinen schwarzweißen Comicheftchen angucken, wenn er sie fertig hat. Der neue Hit von The Prodigy kommt auf MTV, genau jetzt, weil ich’s in meiner Verschlafenheit eingeschaltet habe, sie singen in ihrer Techno-Breakbeat-Tanzerei dermaßen, wie folgt, während ich zögernd zuhöre, ich weiß noch nicht:
You’re no good for me
I don’t need nobody
Don’t need no one
That’s no good for me.
So weist es sich mir: The Prodigy haben dieselben Freunde wie ich.
Ich habe keine Freunde. Durchaus nicht.
Den Rest des Abends, das Übrige der Nacht weiß ich nicht mehr, nur an meinen Traum später im Bettchen erinnere ich mich noch: Ich war Herbert Feuerstein aus dem Fernsehen, es schneite draußen, ich stand da in Shorts vor dem Filmstudio, aber das Filmstudio war in Wirklichkeit die Freiburger Unibibliothek, und in der Hand hatte ich eine Krawatte für Harald Schmidt, aber der Pförtner wollte mich nicht reinlassen, ich gab mich also als Marilyn Monroe aus und wurde durchgeschleust, dann aber als Tony Curtis entlarvt und fand gerade noch die Zeit, dem blöden Schmidt (er trug seine alte Frisur, nicht den Kurzhaarschnitt) seine Krawatte und zwei Bücher, die er zusammen mit Jack Kerouac geschrieben hatte, auszuhändigen, dann wurde ich aus dem Studio geworfen und landete als Botschafter der BRD in der GUS an einem Festbankett in Moskau, wo mir Genscher heftige Vorwürfe machte. Ich versuchte, mich zu entschuldigen, ich gab zu, daß man als Botschafter der BRD in der GUS nicht den ganzen Tag besoffen sein dürfe, ja, sagte ich, mir sei auch klar, daß das keinen besonders guten Eindruck mache, aber wenigstens, versuchte ich zu beschwichtigen, sei noch nichts von meinem Alkoholproblem an die Öffentlichkeit gelangt, und um eine Therapie wolle ich mich jetzt ernstlich bemühen, Sondierungsgespräche mit einer Moskauer Gruppe der Anonymen Alkoholiker hätten bereits begonnen. Genscher schien unbeeindruckt. In der Menge erspähte ich Diedrich Diederichsen, ich rief nach ihm, aber der Schnee fiel zu laut, mitten im Raum. Was für eine tolle Phantasie ich doch hab:
And all your dreams are strange
So kann man das sagen, örrr. Die Frage nach dem Hemd. (Gibt’s da nicht einen Buchtitel von Heidegger? Öhem öh die die … Die Frage nach dem DING, genau. So heißt das. Immanuel, Immanuel.) Gut. Ist beantwortet, die Frage nach dem Hemd. Also eine Schale weiter ins Kosmische: nächste Frage, statt Zähneputzen: Warum konnte Kant nicht schreiben?
Ich kenne Leute, es sind gute Freunde von mir, dementsprechend sind sie Rotze, und die sind sich doch wirklich nicht zu blöd, vulgärfreudianisch zu prätendieren, Kant habe nicht genug gefickt und daher dann eben nicht schreiben können. Katja Benante, die einen hervorragenden Briefwechsel mit der Heldin dieses Buches, Cordula Späth, geführt hat, der so ausladend die ganze Welt aufspannte, daß sogar ich darin vorkommen konnte, weiß wahrscheinlich den wahren Grund für Kants schlechtes Schreiben, und warum er immer so Anmerkungen in den Text setzt wie »Die Antinomien folgen einander nach der Ordnung der oben angeführten transzendenten Ideen«. Von der Kant-Lektüre her, und nicht als Spätfolge eh viel zu spät begonnener Verarbeitung von Kölner Druckerzeugnissen der Spätachtziger des zwanzigsten Jahrhunderts, hat sich denn auch in meinen SCHRRRIFTEN dieses Gefallen an Sätzen eingenistet, die noch mal sagen, was der Text drumrum auf welche Weise machen will, was Katja Benante allerdings immer »ganz reizend« findet. Katja sieht eigenartig aus, schon früher sah sie eigenartig aus, so, als sei sie gemalt. Sie hat diese BRAUNEN Haare, die sind so lockig und so kastanienBRAUN, daß etwas nicht stimmt. Und immer, wenn man sie trifft (selbst wenn man sich nur drei Tage nicht gesehen hat) springt sie einem an den Hals und küßt einen ab. Vielleicht sind Katjas äußerst malerische Haare nach dem Prinzip der Selbstähnlichkeit fraktal rechnerisch bis auf die Schultern, wo sie herumgischten, erfunden? Und dann findet man die unirdische Farbe dieser Haare wieder in den Augen, aber die Augen haben innerhalb desselben Brauns zusätzlich so etwas wie eine Seele, die ebenfalls ständig an einem hochspringt, wenn man in diese Augen hineinzugucken versucht. Sehr verwirrend, Katja Benante zu betrachten. Einmal fand ich jedoch ein Bild, das manches zu erklären schien: Auf dem Diogenes-Taschenbuch von Charlotte Brontës »Jane Eyre« ist ein Mädchengesicht unter einem unglaublichen Hut abgebildet, es handelt sich um eine Reproduktion des Ölgemäldes »Junge Frau in einem Boot« des Malers Jacques Joseph Tissot, welches aufs Jahr 1870 zurückdatiert, Katja Benante aber, die genauso aussieht wie dieses Mädchen, ist exakt hundert Jahre nach Fertigstellung des Gemäldes geboren, im selben Jahr wie ich. Ich habe mir dann dieses Buch gekauft, um das Bild zu besitzen, oder das Bild vom Bild, das sind jetzt mehr die Kaschen der Repräsentationstheorie, mithin egal. Die Zeit, den Roman hinter dem Bild zu lesen, habe ich noch immer nicht gefunden, dabei besitze ich das Taschenbuch jetzt fünf Jahre, aber wenigstens den Essay von Klaus Mann, den der Diogenes-Verlag an den Roman gehängt hat, habe ich überflogen, und der Essay ist wenigstens sehr schön.
Übrigens, damit sich hier niemand in die Hose scheißt: Die restlichen Kapitel in diesem Buch, was Ihr gerade in den Händen haltet, haben keine so langen Titel. Und jetzt fangen wir mal an hier. Zunächst empfinde ich es als angenehm, daß einen niemand zwingen kann. Ich weiß, daß Cordula Späth nachher vorkommt, und wer den langen Kapiteltitel oder den knappen Buchtitel gelesen hat, weiß das auch, aber gerade deshalb kann einen niemand zwingen. Wir heben uns daher die erste Fühlungnahme mit Cordula Späth auf bis zum zweiten Kapitel, in dem ich ihren so viel zu frühen, so herzzerreißenden, so Thema verfehlten Tod zu untersuchen verspreche. Es geht darum, wie eine Freundin von mir ins Gras biß und das Gras zu kauen anfing und es runterschluckte und sich den sauren Grassaft aus den Mundwinkeln wischte und dann aufstand und auf der Szene blieb wie eine liebende Maschine. (Gerade auf CNN die Aufzeichnung der Einweihung der »James Brown Soul Centeroft he Universe Bridge« irgendwo in Amerika verfolgt, daher jetzt dieser Querschuß.) Ja, Cordula starb zur Unzeit und war erst 24 Jahre jung. Ein anderer Bekannter von mir hatte nicht so viel Glück (Scheiße, muß der Zynismus schon so früh ins Buch, leck mich doch die Katze am Arsch), sondern versuchte vor den Augen seiner fetten Mutter, sich im Wohnzimmer in der engen, von vier Personen bewohnten Wohnung ein langes Brotmesser, das im Kaufhof auf der Kaiser-Josef-Straße vor zwei Jahren gekauft worden war, in die Lunge zu stechen, um so zu sterben, statt dessen kam Blut in die Lunge und er fiel um und das Gehirn bekam irgendwie zu wenig Sauerstoff und jetzt muß er weiterleben mit einem Hirnschaden. Ich war gestern bei ihm im Krankenhaus, er hat nur Scheiße geredet und es war schwer verständlich. Herr Peter Singer, Philosoph aus Australien, vertritt derweil den Gedanken der Euthanasie, also daß man den Job mit dem Brotmesser doch aus Barmherzigkeit noch mal machen sollte, und diesmal richtig. Herr Peter Singer ist ein Scheißarschloch und weiß nichts darüber, wie einem wird, wenn der Bekannte sich mit dem Brotmesser in die Lunge gesäbelt hat. Wir wenden uns ab. Wir sehen weg. Wir hören außerdem auch noch nix über meinen Freund, den Arzt und Wissenschaftler mit dem schönen Vornamen Wolfgang, dem wir, ohne daß sein Name verraten worden wäre, im Prolog schon begegnet sind. Wir sind ja so toll.
Und sprechen jetzt von Katja Benante. Übrigens, große Freude, die Liebhaber von Schlüsselromanen und Kenner der deutschsprachigen Linkspublizistik müssen nicht mehr darben, ihnen soll gegeben werden in diesem Buch, mehr als nötig. Sie sollen suchen, aber dann, wenn sie gesucht haben, sollen sie auch finden. Wollt Ihr mal was über die Hamburger Zeitschrift hören, die letzte große linke Publikumszeitschrift, und was ich der gerade zu faxen mich gezwungen sah, von wegen niemand könne mich zwingen? Aber jetzt erst Katja Benante, sie ist schön. Jetzt Katja Benante. Dabepra bepra bepra bepra bepra bepra do-da. Räusper: Katja Benante, OK.
Nein. Doch nicht. Wir sprechen von der fickenden Idee, die eben angeschnitten ward, etwas sei angenehm. Oben schrieb ich doch leichthin: angenehm. Was ist nun angenehm? Wie machen wir das? Angenehm ist, wie ich hier sitze auf einem Stuhl, der unten Räder hat, von denen eines kaputt ist, weswegen er leicht schief steht und, federnd, manchmal schaukelt, so daß ich mich gewiegt fühlen darf, während Ihr Euch in Sicherheit ebenfalls wiegt, und weise wähnt in Eurem fikkenden Mißverständnis, ich sei verblendet, wenn ich annehme, niemand könne mich zwingen. Angenehm ist, daß ich Euch in aller Ruhe denken, mutmaßen, besserwissen lassen kann, daß mich doch, wie ihr besser zu wissen glaubt, DIE GROSSE SACHE zwingen könnte. Von deren Existenz Ihr wißt, und von welcher zu wissen, Ihr MICH für zu blöd haltet. Die große Sache, bildet Ihr Euch ein, funktioniert so, daß keine(r) lange machen kann, was sie/er will, weil sie ihm sonst den Hahn abdreht. Die große Sache könnte psychiatrisieren oder nichts mehr ausbezahlen oder einsperren. Und Katja Benante sagte häufig, wie zu sich selbst, am Fenster stehend: Im Irrenhaus, das wäre am schlimmsten. Katja Benante konnte die ganze Nacht durchtanzen und die Farbe von den Wänden schütteln.
Ich will Euch mal was sagen, Ihr, die ich in Ruhe besserwissen lassen kann. Für EUCH hat Lenin nicht aufgeschrieben, daß, wie und warum der fickende Imperialismus nicht Verflechtung der Imperialismus gesehen als Verflechtung / Unsinn / Kopieren des Äußeren, sklavisches zufälliges chaotisches Kopieren des Äußeren / Arschlekken / Aktienbesitz / Mammutbetrieb / Massendaten / Hey / Ho. Das ist doch der Knackpunkt. Ich ging also zunächst mal ganz ruhig zum Telefon (das war 1988) und nahm ab, und es war Katja Benante. Sie wollte ausgerechnet was über Kant wissen: »Was weißt Du über dieses eine Ding von dem Kant in der ›Kritik der reinen Vernunft‹ in der Antinomie der reinen Vernunft, wo dieser Streit kommt, dieses Thesis/Antithesis-Paar mit dem Anfang der Welt in Zeit und Raum?« Ich sagte ihr kurz, was ich dazu wußte, es war eher mager, klapperdürr sogar, aber sie war zufrieden, und wir ramenterten noch eine Weile weiter, ich holte sogar unter dem ganzen Dreck in dem verhangenen Zimmer, das ich damals im Osten Freiburgs (Breisgau) bewohnte, meine geile Ausgabe der »Kritik der reinen Vernunft« vor und wir exegierten die Stelle zusammen. Meine Ausgabe ist insbesondere deshalb so geil, weil sie weder Reclam noch diese grünen Bände, die jeder immer kauft, noch Suhrkamp ist, sondern eine Volksausgabe, ein großes Paperback von 1908, Alfred Kröner Verlag, Leipzig, und sich anfühlt wie in hundert Jahren vielleicht die Bände von Turia & Kant sich anfühlen werden oder Passagen Verlag oder Texte zur Kunst-Hefte. Modern und verwittert. Verknusselt. Zerrupft. Und in unsere zerrupfte Konversation rein sagt sie, die jetzt also genug Hilfe erhalten hatte für die Ethikhausaufgaben, zu mir, der ich in der gleichen Stadt wie sie, im extremsten Süddeutschland kurz vor Schweiz, noch vor einem Jahr gewohnt habe und dann nach Freiburg verzogen war, um dort das Abi zu machen, seelenruhig: »Übrigens, die Cat ist wieder mit dem Alexander gesehen worden. Auf dem Scheißbonzentennisplatz drüben. Ich glaube, die hast du gehabt, das wird nix mehr. Die liebt den Alex.« Ah ja. Na also, das war die Kritik der reinen Vernunft jetzt. Scheiße, und dann legte ich mal auf. Und ging in die Stadt. Da fühlte ich mich das erste Mal seit dem Frühjahr, meinem Geburtstag, so achtzehnjährig, wie ich wirklich war: DER TOD würde kommen und wissen wollen, was ich geleistet hatte mit meiner Jugend. Super. Scheiße, und da hatte ich einfach aufgelegt, und jetzt stand ich in der Stadt, und was jetzt damit? Katja Benante, überlegte ich, war wohl gar nicht mal keineswegs so unübel. Ich hatte Walkmanstöpsel in den Ohren und stand auf der Hauptkreuzung der autofreien Innenstadt, wo die Straßenbahnen ums Denkmal irgendeines »Berthold« herumschleichen. Es war sonnig. In meinem Walkman, auf englisch, gute Zeilen eines guten Hardrocksongs, die ich mal übersetzen muß, um zu sehen, wie gut sie heute, sechs Jahre später sind:
Sie will, daß die Zeit gut ist
Obwohl doch jetzt schlechte Zeiten sind
Sie versucht, hineinzugehen, aber sie will raus
Sitzt kurz im Knast für kleine Verbrechen an sich selbst
Sieht aus dem Fenster
Atmet auf die Scheibe
Die Zeit wird es erweisen, die Zeit wird vergehn
Denn wenn man jung ist scheinen kleine Sachen
Manchmal größer als das Leben
Doch, das ist sehr gut. Besonders dieses »Doing some time for small crimes to herself / looking out the window / breathin on the glass / time will tell, time will pass«. Und wegen dieses Hardrocksongs mußte ich mir dann am selben Nachmittag die langen Haare abschneiden lassen (die dann später, 1990–93, noch mal sehr lang wuchsen, bis Grunge-Musik aus Amerika sie mir ausgerissen hat) und drei Ohrlöcher ins rechte Ohr stechen.
Sauer war ich, enorm sauer auf Cat. Hauptsächlich, weil Alex wirklich das LETZTE Arschloch vom Dorf war. Mit meinem mehrfach durchstochenen Ohr (hier Van Gogh-Witze dazu denken) und meinen kurzen Strubbelhaaren schlurfte ich superblond wieder nach Hause in die dunkle Kammer, da läutete das Telefon zum zweiten Mal an diesem Tag der Schnitte (Haare) und Stiche (Ohren, und wenn es damals schon die Piercing-Mode mit den heute durchgesetzten Konnotationen gegeben hätte, wer weiß, was ich mir noch hätte durchlöchern lassen), und es war endlich Meikl dran. OK, jetzt kann das Buch richtig losgehen, I take your brain to another dimension / pay close attention:
»Na, Dath, Du Trottel? Wann kommst Du?«
»Was wann kommich?«
Schweigen. Meikl genießt am anderen Ende der Leitung, daß ich so doof bin und vergessen habe, wann und warum ich heute abend zu ihm gehen wollte. Irgendwas wegen der Schule.
»WAS wann kommich, fragich dich!«
»Wann du kommst und wir zur Steinberg gehen.«
Ach so. Ja, genau. Es ist 1988. Wir haben gerade mit der Oberstufe angefangen, obwohl ich so sau-alt bin, aber ich wurde später eingeschult und bin deshalb in Meikls Jahrgang, und die Lehrerin unseres Englisch-LKs heißt Steinberg, MARITA Steinberg, ist Ende dreißig und wasserstoffblond und, soweit ich das schon beurteilen kann, ziemlich OK, und für heute abend hat sie den ganzen Klüngel zu sich eingeladen, und ich hatte mit Meikl vereinbart, vorher zu ihm zu gehen, und dann wollten wir mit dem Bus da hoch auf den komischen Hügel fahren, wo die ihr Haus hat. Ich bin ja eigentlich niemandes Blödmann (schon damals nicht, wo die Geschichte im Augenblick spielt), aber Meikls Blödmann bin ich gerne (auch heute noch, obwohl ich ja immerhin mit nicht geringem Stolz jetzt das mache, was ich immer machen wollte: Zeug schreiben, aber Meikl macht eben AUCH das, was er immer machen wollte: Er studiert Geologie und ist bald fertig, dann wird er die Erde neu erfinden und ich werde immer noch sein Blödmann sein). Meikl ist in Ordnung, dreißig Meter groß, ungefähr so dünn wie ich (wie dünn bin ich? Dünn genug, Mann!), aber er hat eine Brille, und würde sich die langen Haare nicht ganz kurz abschneiden lassen, wie ich das dauernd mache, alle zwei Jahre. Kennt Ihr das Lied von Thin Lizzy? (Wie dünn war Thin Lizzy? Die dünne Lisa war dünne genug, Mann!) (Klar kennt Ihr:)
The Boys are back in Town
The Boys are back in Town
The Boys are back in Town
The Boys are back in Town
Und jeder ist am Ort, everybody is in the place. Meikl war auch am Ort, nämlich bei sich zuhause, als ich ankam. Er begrüßte mich in der Tür mit: »Wie siehst denn du aus?« Das war Hochdeutsch, aber er spricht, ähnlich wie ich, wenn ich in Freiburg bin, meistens etwas, was nicht ganz Hochdeutsch, aber auch kein Dialekt ist, es ist so ein linguistisch heterogenes Freiburgisch, eine widerliche Sprache eigentlich, die auch von ihrer Grammatik her zu keiner bekannten Sprachengruppe sich zuordnen läßt, wir wollen es vorläufig mal »Matsch« nennen. Wir sprechen Matsch. Wenn Beavis und Butt-Head, die beiden Arschgeigen aus der MTV-Zeichentrickserie, jemals deutsch synchronisiert werden sollten, gibt es bei der Wahl ihres Idioms nur drei Alternativen: Bairisch, Berlinerisch oder Matsch.
Ja, wie seh’ denn ich aus. Ich geh’ in sein Zimmer, an seiner Mutter vorbei, »Tach, Frau Staudt«, und lege mich auf sein Bett und grunze. »Wo hast du Alkohol?« Er sieht aus wie ein Siebziger-Jahre-Bee-Gee-Typ, mit offenem Hemdkragen, und ist rechtschaffen sauer, daß ich mich aufs Bett lege, anstatt mit ihm, der sich jetzt mal partygerecht angezogen hat, sofort loszuziehen zu dieser Schwachsinnsveranstaltung auf dem Hügel.
So sind die Boys, wenn sie wieder in Town sind. Entschuldigung, aber hier wird es Zeit für einen kleinen Schlenker theoretischerer Beschaffenheit, die Antinomien folgen einander nach der Ordnung der oben angeführten transzendentalen Ideen, und zwar: was sind eigentlich BOYS? Was sind BOYS, wenn und bevor und nachdem sie back in Town sind? Vielleicht muß man vom Besonderen zum Allgemeinen (und wir sind schon einen Schritt weggekommen von Kant, wir strecken uns gen Hegel, merke auf!) klettern, und erstmal alle Boys aufschreiben, die ich kenne. (Bevor ich dann die 1988er Geschichte zu Ende erzähle, die mit einer überraschenden Pointe ihren friedvollen Beschluß finden soll, es wird dann auch transparent werden, warum sie hier das erste Kapitel so teigig füllt, so viel kann ich versprechen.) Was also ist das mit den Boys? Besonders, wenn es nicht mal Getto-Boys sind? Also gut, ich kenne (wir beginnen gemächlich, es rollt wie ein Käse zum Bahnhof) einen Boy namens Andreas Fanizadeh, der arbeitet jetzt für den linken Verlag Edition ID-Archiv in Berlin, und der hat so ein Grinsen, ich glaube, das nennt man bübisches Grinsen. Damit hätten wir ein erstes Merkmal der Boys. Dann kenne ich einen Boy namens Mark Ginzler, der in Bochum Film studiert, der spricht immer sehr wenig, aber was er spricht, hat Hand und Fuß. Das wäre ein zweites Merkmal der Boys. Dann kenne ich, aber nicht persönlich, einen Boy namens Dave Sim, der macht Comics in Kanada, ich wäre gern sein Freund, denn er scheint genial zu sein. Das wäre ein drittes Merkmal der Boys. Dann habe ich im Fernsehen einen amerikanischen Boy namens Chip Lowell gesehen, der ist erst sieben, aber er spielt Baseball und will Sportler werden. Das wäre ein viertes Merkmal der Boys. Dann kenne ich einen Boy namens Jörg Heiser, der ist Journalist und hat mir neulich gesagt, die Frauen in Köln könnten ihn scheinbar nicht leiden. Das wäre ein fünftes und ziemlich wichtiges Merkmal der Boys, daß sie nie wissen, ob die Frauen, besonders die Künstlerinnen, in Köln, sie leiden können. Dann kenne ich einen Boy namens Wolf-Ludwig Bischoff, den kenne ich aus meiner Kleinstadt Schopfheim, wo ich vor dem Umzug nach Freiburg gehaust habe, und der hat immer den Religionsunterricht gestört, indem er laut »Khomeini!« brüllte, und einmal brüllte er abwechslungshalber »Gaddafi!«, das war einigermaßen treffend. Dies wäre ein sechstes Merkmal der Boys, sie können, so krumm das klingt, treffend brüllen. Dann kannte ich, wiederum nicht persönlich, einen Boy namens Kurt Mahr, der war Perry Rhodan-Autor und hat gesponnen. Dies ist ein siebtes Merkmal der Boys. Siehe auch einen Boy namens Klaus Kinski, den ich genausowenig persönlich kannte, und der ebenso wie Kurt Mahr, dessen richtiger Name Klaus Mahn (nicht Maahn, wie der Rocksänger) lautete, mittlerweile verstorben ist. Dann kenne ich einen schon etwas älteren Boy namens G. Jacob aus Hamburg, der hat eine geile Frisur, weißes Haar nach hinten gekämmt, und schreibt politische Texte und möchte gern Recht bekommen von der Geschichte. Zweifellos wäre das ein zu berücksichtigendes achtes Merkmal der Boys. Dann kenne ich einen Boy namens Matthias Schaufler, dieser ist Künstler und lebt in Köln, und er hat es gern ordentlich / klar. Das wäre ein neuntes Merkmal der Boys. Nun kenne ich aber einen Boy namens Gunter Blank, der jetzt in einen Boxverein eingetreten ist oder sowas, und der wohl keinen gesteigerten Wert drauf legt, daß irgendwas ordentlich / klar ist, aber schleimig und durcheinander mag er es genausowenig, das kann man schon mal sagen, und glatt rasiert ist er vielleicht nicht immer, aber er muß ja auch lange newyorkische Romane übersetzen, denn er ist im Grunde seines Herzen Intellektueller und wohnt in Berlin. Also ein zehntes Merkmal der Boys: nicht, daß sie unbedingt in Berlin wohnen müssen, aber der Ort, an dem sie Intellektuelle sind, sollte sich am GRUNDE IHRES HERZENS finden, nicht oberhalb davon. Oder von mir aus dann wenigstens so Seiteneinsteiger-mäßig. Was nicht heißt, daß das Autodidaktenwesen in mir den allerentschiedensten Befürworter hätte. Dann kenne ich einen Boy, der leiht immer T-Shirts von anderen Boys. Und ist, zumindest in meiner unmittelbaren Umgebung, weltberühmt. Dies aber ist das elfte Merkmal der Boys. Einen Boy namens Harald Genger kenn ich noch. Hat Physik studiert und will am liebsten »zur Sache« befragt werden, zu sonst nichts. Zwölftes Boy-Merkmal. Einen Boy namens Adam-Troy Castro, nicht persönlich. Trägt schnieke Lederjacke. Dreizehntes Boy-Merkmal. Michael Staudt, hierin Meikl genannt. Cool. Vierzehntes Boy-Merkmal. Dan Simmons, nicht persönlich. Dicke Romane. Fünfzehntes Merkmal. Mark Terkessidis. Läuft immer sehr entspannt durch Köln und lacht wie zwei junge Götter. Sechzehntes. Bob Barsky, kennt sich im Sport aus, war mal Wide Receiver für die Jets, was immer das ist, und wurde bei einem Run-in mit einem Chicago Bear verletzt, hat aber die Verletzung verkraftet wie ein richtiger Mann. Siebzehntes. Bob Dobbs, den es gar nicht gibt, der aber messianische Anwandlungen hat. Achtzehntes. Boris aus Hamburg, der bei einer Zeitschrift Redakteur ist und manchmal frech wird, dann muß man ihm ein fünfseitiges Fax schicken, dann isser mal ein paar Tage lang still und man kann wieder Luft holen und kommt mal wieder zum Erledigen wichtigerer Sachen. Neunzehntes (»Frechwerden«). Klaus Walter, verdient ausreichend Geld durch strategische Korruption (Hessischer Rundfunk) – strategische Korruption ist: Zwanzigstes.
Geert Lovink, begeistert sich sehr für Technik, interessiert sich jedoch weniger für präfabrizierte »Technologie«, i. e. existierende Lehre von existierender Technik, denn die kann man, vorausgesetzt das »Schon da« eben der Technik, selbst aufspannen.
Exkurs, an dieser Stelle, in Sub-Technologisches, über Fraktale, in denen ich vorhin Katja Benantes Haare wiederzufinden glaubte: sehr spannend war dann unerwarteter- und unerwartbarerweise doch noch, daß man immer wieder dazulernt, wenn man schon glaubt, es geht nicht mehr voran. 1993 hatte es wieder ein bißchen nachgelassen mit der Mathematik (dabei ist die wichtig, um zu überprüfen, ob das T-Shirt, das man trägt, noch stimmt, oder Ergebnis einer Tauschaktion mit fremdbekannten Hardrockstars ist), da legte mir plötzlich jemand, der alles ist, nur kein Boy, den Aufsatz von Kenneth J. Hsü über die fraktale Geometrie der Musik, vom Vogelsang zu Bach, auf den Schreibtisch, aus dem »Applications of Fractals and Chaos«-Schinken von Crilly / Earnshaw / Jones, und da erschloß sich auf einmal doch wieder eine neue Perspektive, neben der sogar der hübsche Effekt verblaßte, daß ein Gelehrter, der über Töne forscht, selber so heißt wie ein gepfiffener und gelispelter Ton, eben Hsü, und zwar die Sonderbarkeit, daß man zwar zeigen konnte, daß eine gewisse »Musikalität« offensichtlich entlang der evolutionären Zeitachse quer durch die Arten komplexer wird, es aber trotz dieser empirischen Erhebungen keine BiologInnen und/oder keine StatistikerInnen gibt, die sagen könnten, wo denn nun bitte der spezifische Evolutions- (und das hieße Selektions-) wert von »Musikalität« liegt. Hat mich drauf gestoßen, daß ein Buch über Cordula Späth nützlich sein könnte, denn ihre kompositorischen Arbeiten und deren biographisches Schicksal bis zum Tode Cordulas in ihrem 24. Lebensjahr sowie darüber hinaus bieten vielleicht mehr als Marginalien zum verqueren Kausalnexus von Selektion und Musikalität, gerade weil Cordula in den Städten Mitteleuropas im späten 20. Jahrhundert ganz schön rumgekommen ist und von daher mit der zunehmend arbiträren Selektivität von schließlich auch evolutionär vorangezwirbelter Kommunikation / Sozialem einige Erfahrungen machen konnte, in ihrem Beruf, der Musik war. Den Schluß von Hsüs Aufsatz möchte ich darum gerne nacherzählen, ich bitte um Aufmerksamkeit für etwas, was, obwohl es in Parenthesen herumsteht, eine Schlüsselstelle dieses ersten Kapitels sein könnte. In der Überleitung zum verstörenden Schluß seiner vorzüglichen Abhandlung, denn Hsü kann im Gegensatz zu Kant und mir schreiben, fragt Hsü, ob man nicht endlich, diverse Poesien mal beiseite, zugeben sollte, daß Menschen nicht bloß intelligenter, sondern doch auch wirklich musikalischer sind als Finken, jedenfalls dann, wenn man Musikalität als die Fähigkeit identifiziert, »sounds of different acoustic frequency« zu identifizieren und entweder originalgetreu oder in verschiedenen, in der Tonhöhe oder anders modulierten Abweichungen, wiederzugeben. Das heißt, daß nicht bloß Mozart musikalischer war als Finken, sondern auch die meisten von uns, die sonst eher nicht Mozart sind. Dann ist Hsü eine Weile hin- und hergerissen, ob der musikalische Vergleich unterschiedlicher Spezies überhaupt sinnvoll ist, und man die Nachtigallen nicht in Ruhe lassen soll, was ihm zum Glück aber doch nicht richtig einleuchtet, denn dann hätten die BiologInnen doch auch kein Recht, Feststellungen zu treffen wie die, daß akustisch isolierte Nachtigallen »abnorme« Gesangsmuster entwikkeln. Was sagt uns das über das Zeitalter der elektronischen Einsamkeit? Was sagt das darüber, daß ich diesen Roman alleine am Computer schreibe und nicht am Lagerfeuer meinen FreundInnen erzähle, die übrigens längst nicht so scheiße sind, wie ich sie hier schon sehr säuerlich andauernd darstelle, im Gegenteil sind sie wahrscheinlich nicht nur gut, sondern wohl auch besser als die meisten von uns, die nicht Yukito Kishiro oder wenigstens Diedrich Diederichsen sind. Und besser als ich sind sie eh, sonst hätte ich sie als FreundInnen nie genommen.
You gotta find yourself a friend
I ain’t talkin’ bout love
Singen Van Halen, und das klingt, für mich, auf JEDEN Fall viel besser als die Finken. Die singen gerade jetzt, im Moment, vor meinem Fenster hinter meinem Fenster (»Windows«, Computerquatsch) etwas so Blödsinniges wie »Tschhiiin-beüps-tschiktschik-bsiinz-Hsüüü«. Jedenfalls, die eigentlich bestürzende Problematik wirft Hsü ganz am Schluß seines Textes auf – man habe ihm gesagt, daß eigentlich nur Vögel, Delphine / Wale und Menschen wirklich singen können, er wolle das nicht anzweifeln, die BiologInnen würden schon wissen, wovon sie reden, nur: warum können dann Menschenaffen nicht singen? Warum nicht? Warum singen überhaupt diese ganzen Landsäugetiere nicht? Was soll diese unheimliche Abstinenz vom Lied? In der Tat, ein Problem. Vielleicht wird hier der Irrweg der Genforschung sichtbar, das eigentlich Gefährliche und Doofe an der kommenden Genokratie, in Fragen wie Hsüs abschließender, evolutionär gedachter: »Why can our nearest kin, the monkey, not sing? Why should the genes, the DNA sequencings, giving an organism the ability to discriminate musical pitches, remain dormant for so many generations of cladistic develeopment until they resurface again with the rise of man?« Und was würde daraus folgen, wenn die Schöpfungsquatschmythologie die Entstehung von Gesang und Musik, wie die Theologie ihren sozialen Wandel, besser beschreiben könnte als meine geliebten Naturwissenschaften? Habe ICH Cordula umgebracht, weil ich nicht genug zu Marx und Lenin gebetet habe? Dies zu ergründen, ist unser Job. Nachdem dieses Kapitel bereits fertiggestellt war, geriet ich noch mal ganz anders in diese Frage, ich möchte das hier grad noch einschieben, weil es wirklich gut paßt und hingehört. Für die niederländische Medienzeitschirft Mediamatic sollte ich Ende des Jahres 1994 auf Anregung von Geert Lovink, den ich oben unter den Boys auftreten ließ, mit einigen karikaturistisch verschärften Attributen seiner empirischen Person, dieses empirischen und abstrahierbaren und überhaupt für jeden Schmodder zu habenden Lovink also, der nicht nur Mitarbeiter der Agentur Bilwelt (Büro zur Förderung der illegalen Wissenschaften, ein wenn man mich fragt etwas abgeschmackter Ausdruck, aber er hat seinen historischen Sinn gehabt und soll sich selbst qua der in seinem Namen erkämpften Errungenschaften rechtfertigen dürfen) ist, sondern eben auch Redakteur bei besagter Zeitschrift, einen Artikel schreiben über das Phänomen des Zuhauseseins, und das zu einer Zeit, wo ich gerade begann, mich von den Nachwirkungen einer Platte zu erholen, die ein bißchen zu herrschsüchtig in meinem Zuhause, in meinem Leben herumgedröhnt hatte, »Selected Ambient Works« von Aphex Twin. Das erste Signal der Erlösung aus der Umklammerung durch die Töne und Wallereien dieser Platte war ein Artikel im Spiegel gewesen, worin gestanden hatte, die sehr zuhausene, sehr in der Wohnung liegende und schwappende Musik dieses Techno-Musikers Aphex Twin sei besonders geeignet für Erwachsene. Die Kategorie des Erwachsenen nun hat mir nie viel anhaben können, aber wenn etwas sich dieser Kategorie anverwandeln ließ, konnte es damit stets zuverlässig entschärft werden, gesetzt den Fall, es war vorher in irgendeinem Sinne bedrohlich gewesen, wie gesagt in Leben und / oder Wohnung. Aphex Twin trat in den Hintergrund, bestimmte Zustände waren plötzlich wunderbar objektivierbar, von denen ich bereits geglaubt hatte, sie würden mich ewig heimsuchen. So schrieb ich den Text, wie bestellt, gleich auf englisch, ich schrieb ihn über eine Daseinsweise oder besser eine Reihe von Praxen, denen ich ganz unobjektivierbar verfallen gewesen war vor dem Augenblick der Spiegel-Erlösung, ich schrieb ihn über den »zuhausenen Menschen«, das »zuhausene Wesen«, die von mir so getaufte »Ambient Entity« oder AmbiEntity. In der allerersten Fassung dieses kuriosen kleinen Aufsatzes stand ein wesentlich längeres Zitat aus dem Hsü-Aufsatz, von dem das oben ausgeführte aber einen wichtigen Teil bildete. Dann faxte ich den Text nach Holland, sandte ihn kurz darauf, schon in einer ersten überarbeiteten Fassung, auch noch mal per E-Mail hoch, und es begannen die mühsamen Wochen des Umschreibens. Das Hsü-Zitat flog als einer der ersten Exkurse raus, ich fand nämlich, es passe doch besser hier her. Schließlich wurde das Ganze auf eine perverse Weise zu etwas noch Fremderem als das bloß Überwundene am Ambienten, eine perverse Weise, sage ich, die ich immer noch nicht begriffen habe, und die ganze Zeit über, mit jeder neuen Fassung, tilgte ich wieder Musikbeispiele aus dem Text und setzte neue ein, ganz so, wie es auch mit der Arbeit an diesem Roman ständig läuft.
Ich möchte aber im Folgenden einen längeren (nämlich länger als zwei Sätze) Passus, mit Auslassungen, aus diesem Text, der nun »Observing the AmbiEntity« heißen soll und von dem im Augenblick nicht klar ist, ob er noch mal geändert, zurückgezogen oder anders begraben wird (vielleicht in etwas ganz anderem aufgehen könnte), hier hineinsetzen, während die Boys weiterhin in Town sind, und noch immer davon leben können, daß ihre unerwartete Ankunft so frisch rüberkam und ihre längst verblühte Jugend wiederauferstehen ließ in Mienenspiel wie psychischer Disposition.
Da nachher, im Gang der erzählten Dinge so mountainbikemäßig mühsam bewegt, die Frage, inwieweit zitiert werden kann, inwieweit dies in Anführungsstrichen und / oder kursiv passieren muß, noch die ganze Durchschlagskraft einer ECHT LEIDIGEN PROBLEMATIK entfalten wird, zitiere ich mich SELBER, den Verfasser des vielleicht nur noch GANZ anders erscheinenden Textes »Obeserving the Ambi-Entity: Distinction renouncing movement« im Folgenden restlos so, als wäre dieses lange und ausholende Zitat ein integraler Bestandteil dieses Romans, was es im übrigen allein schon der Entstehungszeit halber auch wirklich in großen Teilen ist.
Wer sich am Englischen stört, lasse den Blick eine Weile runtergleiten, und wird sich wohlbehalten im Roman wiederfinden, wo er / sie hinwollte.
The first distinction I should introduce to help locate AmbiEntities is the simple and polar one between »homes« and »Living Rooms« – übrigens hatte ich schon bei dieser Unterscheidung und der Diskussion oder besser interessanten, anregenden Nicht-Diskussion mit der Redaktion der Zeitschrift Mediamatic das unheimliche Gefühl, daß der doch nun wirklich auf der Hand liegende Doppelsinn des Wortes »Living Room« (der allerdings für eine/n NichtengländerIn und NichtamerikanerIn offensichtlicher auf der Hand liegen mag, aber die mit mir das Zeug durchsprechen wollten / sollten, waren ja HolländerInnen, also hätte es ihnen nicht schwerer fallen dürfen, den Witz zu bemerken, als mir) meinen MitarbeiterInnen, BetreuerInnen entgangen war – der »Living Room«, davon lebt ein Großteil dessen, was der Text dann ausführt, war eben nicht nur als »Wohnzimmer« gedacht, sondern auch, in wörtlicher Übersetzung, als der Raum, welcher lebt. Das ist doch klar, und auch die Wände haben Ohren.
Living Rooms are »real« (empirically), homes are not (they are speculative). (Homes probably WERE real, too, at some point in the distand past, but this was before pop culture.) Und nicht nur vor der Popkultur, sondern es muß sogar vor Richard Buckminster Fullers Erfindung von »Wohnmaschinen« gewesen sein, die immerhin ins Jahr 1928 zurückdatiert, was ich erst nach der E-Mail-Versendung der vorläufig letzten Fassung meines AmbiEntity-Texts erfuhr. Homes are »origin stories« constructed as RETROSPECTIVE signposts within visual space, acoustic space, and even tactile space. They are »made for coming from« (as Lee Marvin sang, who was »born under a wanderin’ star«). Living Rooms, as »rooms that live«, are decorated and functionalized so as to IMMORTALIZE the present and KEEP AWAY THE DEMANDING PASTS, thereby protecting the inhabitants from things that go bump in the night. Whenever Living Rooms get mistaken for homes, tragedy strikes. What you get then is a prison.
Und das war genau die Periode gewesen, bevor ich im Frühjahr 1994 mit der ersten Niederschrift einiger Gedanken über Cordula Späth beginnen konnte, die dann bald, befeuert durch den unkontrollierbaren Verlauf von Spin-Off-Ereignissen, denen auch die beste Spin-Control, die dazu ergrübelt wurde, aus dem eigenen Living Room ein Home zu machen, zu einem rasend Flechten verschießenden, Halt findenden und wuchernden Zeug namens »Cordula killt Dich!« aufblühen sollten.
Wo waren wir stehengeblieben? Richtig, Vertrautheit mit Technik bei gleichzeitiger Fremdheit gegenüber präfabrizierter Technologie, einundzwanzigstes Boy-Merkmal. Schließlich die Obsession des Reisens durch die Zeit, also ein Boy namens Ernst Ellert, den ich kenne und der Teletemporarier ist. Zweiundzwanzigstes und letztes Boy-Merkmal erlaubt uns die Rückkehr per Zeitschlaufe in Meikls Zimmer an jenem schwülen Abend des Spätsommers 1988. Lassen wir die Wahrheit hinter uns und erzählen statt dessen, was geschah.
Meikl putzte sich noch mal die Brillengläser, er saß auf seinem Bürostuhl vor seinem Schreibtisch, auf dem ein Roman von Stephen King und die Englischhausaufgaben lagen. Er sah mich, wie sagt man: prüfend an, das bedeutet, er sah mich so an, daß ich etwas hätte sagen müssen. Ich sagte nichts, sondern zuzelte, halb liegend, halb sitzend, auf Meikls Bett, an der Flasche Jack Daniel’s herum, die ich in einem Wandschrank gefunden hatte, während Meikl im Bad gewesen war. Auch seine Stereoanlage hatte ich eingeschaltet, im Kassettendeck saß eine unbeschriftete Kassette, nach Drücken der Playtaste stellte sich raus, daß es Depeche Mode waren: »Blasphemous Rumours«. Meikl sah mich immer noch prüfend an, ich versuchte, eine Verbindung zwischen dem Moll-Gebrumme / Gecroone der Depeche Mode und meinen abgeschnittenen Haaren und eingestochenen Ohrlappen und drittens der Tatsache herzustellen, daß sich meine Dorfliebe laut Katja Benante jetzt einen Dorfliebsten genommen hatte, und ich als Exdorfkommunist und nunmehr Stadtkommunist abgeschrieben war. Es gelang mir nicht, und der Schnaps war auch entschieden zu warm.
Meikl setzte zu einem für seine Verhältnisse erstaunlich langen Monolog an, mit seiner tiefen, immer ein bißchen sarkastisch klingenden Stimme (kennt Ihr den Sänger der Swans? Ja, ungefähr so, also nicht ganz so tief, aber das Timbre stimmt schon, jedenfalls, wenn Meikl sauer ist): »Hör mal, Dath. Du kannsch hier von mir aus die ganze Nacht Depeche Mode hören, ich mach jetzt des Licht aus und des Zimmer zu, und dann geh’ ich auf des Fescht da, und wenn ich zurückkomm’ und du hasch mir des Bett vollgekotzt, dann schlag’ ich dich tot. Außerdem sind schöne Frauen auf dem Fescht, alle aus dem Leistungskurs, da. Und wahrscheinlich gibt’s was Besseres zum Trinken als warmen Jack Daniel’s, Mahlzeit.«
Also erzählte ich ihm mit gepreßter Stimme, zusammengekniffenem Mund und einem Ausdruck, der irgendwie wie New Wave klang, obwohl ich zur Zeit von New Wave erst zwölf war, aber vielleicht könnt Ihr Euch vorstellen, wie man New Wave klingt: Alles ist so entfremdet, so künstlich, die Menschen sind aus Plastik, bla bla bla, Cat Sterling tut mich nicht mehr liebhaben. Dabei hätte vor einem Jahr, als diese Beziehung mit Cat trotz meines Umzugs in ihre verwirrendste, romantischste und daher geistesgestörteste Phase geriet, mir also langsam klar wurde, daß Cat mit ihrer so unfaßbar weißen Haut (dagegen ist Catherine Deneuve Aretha Franklin, so blaß ist Cat Sterling! Ich meine, die ist so schön BLASS, dagegen ist Milch Kakao! Ich meine, die ist so blaß, wenn die Sonne ihr ins Gesicht scheint, dann wird die Sonne davon geblendet und muß die Augen zukneifen! Ich meine, die ist so hell im Gesicht, daß ihre blauen Augen, obwohl sie blau sind wie der hellste Himmel am sonnigsten Tag in Südbaden, wenn die Rehe in dem Wald, der gegenüber vom teuren Haus von Cats reichen Eltern auf dem Hügel herumsteht, so laut keuchen vor Hitze (trotz Schatten), dagegen schwarz wirken wie das Weltall, Cat Sterlings Haut ist von der Farbe der Sterne, und Cat Sterlings Haare sind von der Farbe von neuem Marmor vermischt mit dem Glanz des Goldes, aus dem die Goldketten, mit denen Run DMC zum Zeitpunkt der Aufnahme des »It’s tricky«-Videos rumrannten, gefertigt waren) und ihrer Weisheit, die sich in unglaublichen Sätzen äußerte (einmal saßen wir auf dem Balkon des teuren Hauses von Cats reichen Eltern und sahen drüben zwei Rehe am Waldrand stehen, und auf einmal sagte sie: »Schön.« Stellt Euch das vor: Schön! In dem einen Wort war mehr Verstand als in Musils Gesamtwerk. Schön, sagt diese Frau. Abartig! Da wird man doch verrückt!), genau die Frau war, die ICH verlassen mußte, nicht, weil »es nicht paßte«, sondern weil das einfach so eine romantische Idee war: eine Heilige verlassen! So eine alte Scheiße hatte ich GEDACHT mit meinen sexistischen 17 Jahren, und dazu noch viel ältere Scheiße GEHÖRT, die dieses Gefühl bestätigen sollte, und zwar Led Zeppelin:
Babe … Baby Baby … I’m gonna leave you
I said Babe … Baby, Baby, Baby, I’m gonna leave you
Leave you when the summertime
Leave you when the summer comes uhh a rolling
Leave you when the summer comes along
Und deswegen geschah mir jetzt diese Kacke mit Alexander völlig recht, aber das erzählte ich Meikl nicht, sondern den ganzen anderen Dreck, nämlich wie gemein das doch war und ausgerechnet Alexander, und dann erfährt man es auch noch beiläufig von Katja Benante am Telefon, sowas ist doch keine Art, und deswegen, ich will ja keine blasphemischen Gerüchte in die Welt setzen, aber ich denke, Gott hat einen kranken Sinn für Humor, und wenn ich sterbe, rechne ich damit, ihn lachend vorzufinden. Und das war ja wohl eine fickende Geschichte. (Übrigens, Ihr habt bestimmt längst gemerkt, warum dieses Adjektiv »fickend« hier immer wieder vorkommt. Es ist ja lustig, sich beispielsweise die deutsche Synchronisation des Science-Fiction-Action-Films »Predator« mit Arnold Schwarzenegger anzuschauen, wenn man das Original kennt. Am Anfang, als es noch so aussieht, als wäre es eine Söldnergeschichte irgendwo im Dschungel Südamerikas, weil Schwarzenegger noch von diesen anderen Leuten begleitet wird, Söldnern mit ausgefallenen Waffen, sehr schweren Waffen, und das Monster, also der Predator, der Jäger aus dem All, der in diesem Dschungel vor unbestimmter Zeit mit seinem Raumschiff gestrandet ist, hat noch nicht angefangen, Schwarzeneggers Kameraden der Reihe nach umzulegen, und da führen diese Leute im Dschungel hin und wieder Gespräche, im Original unterstreichen sie die Männlichkeit ihrer Gespräche durch häufige Verwendung des im Angloamerikanischen in solchen Situationen ziemlich geläufigen Adjektivs »fuckin’«. Dies und das und jenes ist »fuckin’«, der Dschungel, der Auftrag, die Rebellen, die es zu bekämpfen gilt. In der deutschen Synchronisation wird dann daraus »abgefuckt« – und dieses Adjektiv ist im Deutschen einfach nicht geläufig genug, um nicht als seltsam aufzufallen: dauernd ist alles »abgefuckt«, so reden Soldaten nicht. Deutsche Soldaten hätten wahrscheinlich eher vom »Scheißdschungel«, der »Scheißmission«, den »Scheißrebellen« etc. geredet. Außerdem ist »abgefuckt« eher die Übersetzung von »fucked« als von »fucking«, beispielsweise wenn einE BesoffenE(r) sagt: »I am so fucked I can’t see straight.« Und da nun also alle Lösungen entweder künstlich oder sinnentstellend sind, entscheide ich mich, der ja auch eine Söldnergeschichte, und eine Dschungelgeschichte, erzählen will, und weil in diesem Buch auch ein außerirdisches Monster vorkommt, allerdings ist es die Heldin, Cordula Späth, für das Adjektiv »fickend«.)
Meikl nun fand die Geschichte überhaupt nicht fickend. Er erinnerte mich daran (mit süffisantem Grinsen), daß Cat sowieso nicht mehr lange im 80 km entfernten Dorf wohnen würde, sondern demnächst zwecks Abitur in ein Internat nach Bayern wechseln würde, wie ich ihm schon öfters händeringend vorgeweint hatte. Dann aber »ist dieser Alex genauso der Arsch wie Du jetzt, also was soll der Dreck. Ist doch eh egal«. Mit diesen Worten riß mir der lange Kerl den Whisky aus der Hand, nahm den Deckel vom Kassettendeck und schraubte die Flasche zu, nicht ohne noch mal dran zu riechen und halb angewidert den Mund zu verziehen, als ob er die laue Wärme des Inhalts am Geruch erkannt hätte.
Dann stellte er die Flasche zurück in den Schrank und machte tatsächlich im Verlassen des Raums das Licht aus, ich konnte gerade noch vom Bett aufspringen und hinter ihm her durch die schon halb geschlossene Tür rutschen, die er zugeworfen hatte und die daher zwei Zentimeter an meinem Schädel vorbei sauste. Es war 10 Uhr abends. Vorbei an Meikls Eltern, »Tschüs, Frau Staudt, tschüs, Herr Staudt« (die saßen IMMER in der Küche, warum saßen die IMMER in der Küche? Muß ihn mal fragen, sie sitzen ja auch heute noch IMMER in der Küche. Hm.), ging es aus Meikls Wohnung raus und zur Bushaltestelle. In Bussen sitzen wir immer so frech in den Sitzen, als gehöre uns alles. Unterhalb des Hügels hielt der Bus. Wir sahen einen Igel unter einem Baum.
Meikl läutete an der Tür, hinter der schon alle feierten, daß sie im Englisch-Leistungskurs waren. Frau Steinberg öffnete. Die Leute will ich nicht erklären, die da so waren, es genügt, daß ich dort Tanja traf. Und daß Helena auch da war, die viel später erst in diesem Buch hier darf. Aber Tanja jedenfalls, die war etwas ganz anderes im Leben. Etwas ganz, ganz anderes als die. Als alle. Ich fing erstmal an zu trinken, das konnte nur helfen. Es half. Ich verwischte mir die Leute füreinander und vergaß. Meikl war noch. Halbe Sätze ergaben sich so. Living all by themselves. Mußten sich nicht verstecken. Einmal sah ich immerhin von unten, wo ich mein Glas hingestellt hatte und die Schnapsflasche (eigentlich verantwortungslos von einer Lehrerin, Schnaps im Haus zu haben, wenn sie die SchülerInnen zu sich bittet). Schmeckte, schmeckte aber bäh. Bäh? Bäh, langsam, ich, besoffener noch mal. Lag dann plötzlich auf dem Boden vor Frau Steinbergs Sofa, die im Hintergrund Pizza verteilte an die Verwischten.
Da sagte eine Stimme: »Wieso?«
Ich, was, wieso.
»Was, wieso?«
Die Stimme kam viel näher: »Ja, wieso du dich hier so zum Affen machen mußt, wollte ich wissen.« Es war Tanja, die sich jetzt nicht etwa da hinsetzte neben mich, sondern schon dagesessen hatte, aber ich hatte sie nicht bemerkt, sie war wohl langsam verschwunden seit dem Moment eine halbe Stunde früher, als Meikl & ich zuerst den Raum betreten hatten, wo sie mir gleich als die ganz Andere aufgefallen war.
Nun war Tanja aber überhaupt nicht die Andere, sondern nicht mal anders, vielmehr sagte sie eben nie sehr viel, das war mir schon in den paar Tagen, paar Wochen Englisch-LK aufgefallen. Und lange braune glatte Haare. Mehr hatte ich nicht gesehen, weil ich mehr gar nicht gesehen hatte. OK, Tautologie. Im Nachhinein werde ich schon wieder besoffen, wenn ich dran denke, wie ich da vor ihr rumlag, sie saß nicht AUF dem Sofa, sondern daneben, auf dem Boden, und sagte schließlich noch, nachdem sie schon wahrgesprochen hatte, daß ich mich da zum Affen machte, auf dieser Sitz- und Quasselparty, daß sie Kopfschmerzen hatte. Jetzt immerhin sah ich mehr und zwar nicht nur, daß sie schön war und ihre Augen ein bißchen denen von Katja Benante ähnelten, obwohl doch (ist das wirklich ein »obwohl«, gibt’s da einen Widerspruch irgendwo?) Katja Benante dauernd redete und Tanja fast nie, sondern auch, daß sie wohl die Wahrheit sagte mit den Kopfschmerzen und daß die zu mindestens 75 % meine Schuld waren, weil ich mich zum Affen machte, mit neu durchstochenen Ohren.