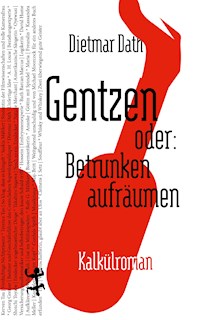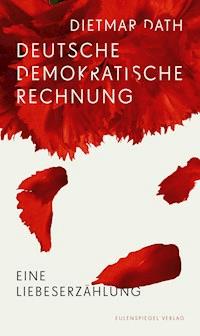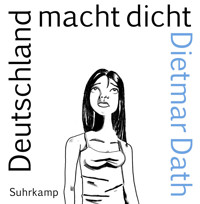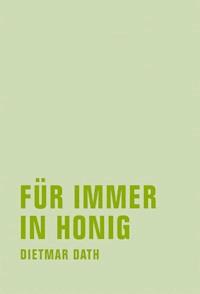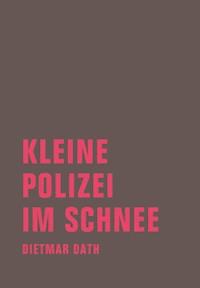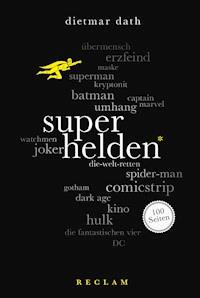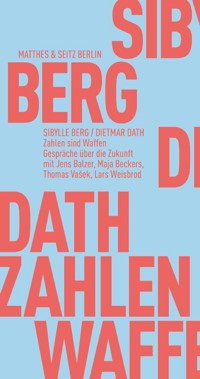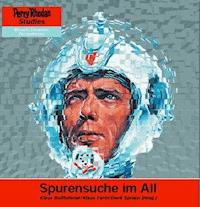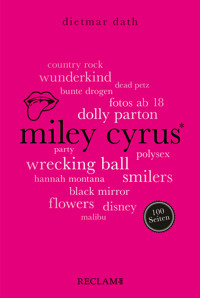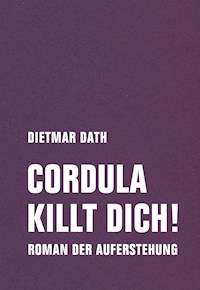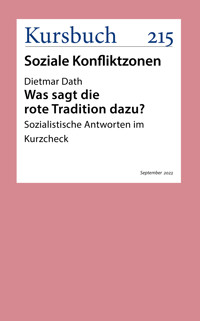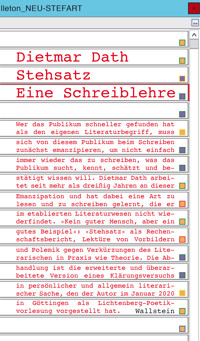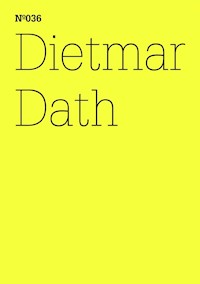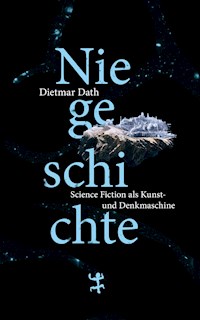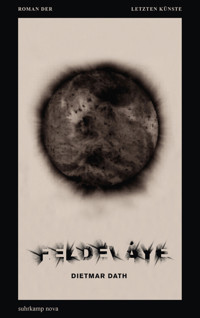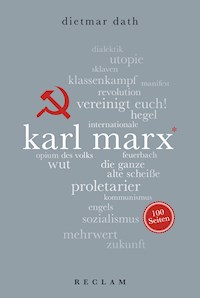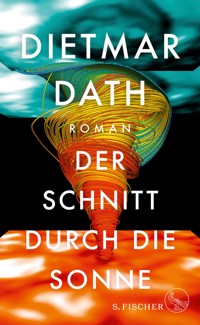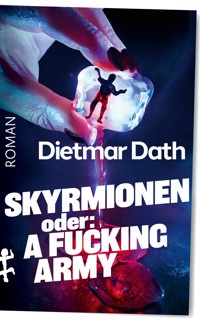
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Renate Hofer in einen Wassertank stürzt, der die Lüftung eines riesigen Datenspeichers reinigt, hat sie nicht nur Todesangst, sondern auch eine Erleuchtung: Sie wird eine Maschine bauen, wie es noch keine gegeben hat, zur notwendigen Überwindung des Computerzeitalters. Ihr Plan nimmt Form an in der Welt, die wir kennen – eine Pandemie hat gewütet, das Vertrauen zur Sprache schwindet, Geld frisst Gerechtigkeit. Zu seiner Umsetzung rekrutiert Renate die Mutigsten und Schlausten aus Physik und Kunst, aus Sprachforschung und Finanztrickserei, eine ganze Fucking Army: Kerstin Waldmann, Doro Coppe, Xiasong Zhao, Vexus Texas und mehr. Mit ihnen baut sie eine neue Welt aus den winzigen Wirbeln, die so heißen wie dieser Roman: Skyrmionen. Thriller, Wunderkabinett und Reise ins Unbekannte, so figurenreich und handlungsstark wie eine futuristische Serie: Skyrmionen fragt uns, wie wir fortgeschrittene Technik für eine bessere Weltgesellschaft befreien können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1763
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SKYRMIONEN
oder: A Fucking Army
Dietmar Dath
SKYRMIONEN
oder: A FUCKING ARMY
ROMAN
Inhalt
AUSLÖSERWARNUNG
WER HIER LEBT
ERSTER TEIL | LIEBER NICHT ERTRINKEN
I. Der Kindheit entkommen
1.
Bunker unterm Sand
2.
Der Sturz
3.
Das Davonlaufen
II. Sex kann nicht mehr
1.
Wer alles kommt
2.
Was alles soll
III. Gläsern vögeln
1.
Bei den Antipoden
2.
Zufallsbegegnung: Soliton, doppelt
3.
Richtung Glas
ZWEITER TEIL | TRANSATLANTISCHE TRANSFERENTROPIE
IV. Die Magnetin
1.
Die kleine Flasche ist ein Sonderfall
2.
Ein Diesseits-Jenseits-Lied
V. Ob es Sprachen gibt
1.
Zum Glück nicht Pätsch geblieben
2.
Doktor Kurlands komisches Kind
3.
Forschungsbericht
4.
Das Kind stolpert in die Kälte
5.
Nach Boston, entscheidungshalber
DRITTER TEIL | WEDER IDIOTIE NOCH UNTERWERFUNG
VI. Die Allergefährlichsten
1.
Lebensmittel
2.
Pessimismus ist Unterwerfung, Optimismus ist …
3.
Oder man muss den Glaser rufen
4.
Die Zukunft gehört Neko-Fläz-Jinx
VII. Il faut séduire beaucoup de gens
1.
Diese blöde Tiersexproblematik
2.
Melissa
3.
Drogentechnisch betrachtet
4.
In eine Art Abgrund (auch entropiehalber)
5.
Schenkungsversagen
6.
Miach Mihie, Mehrwegmagnetin
7.
Zu Ehren von Deng Xiaoping
VIERTER TEIL | GEN STETWELT
VIII. Die nötige Folter
1.
Alle wollen sie massiert werden, aber wer massiert verständig?
2.
Der Schöpfer redet in Zitaten. Die Schöpferin in Anekdoten.
3.
Sagt Bob Coecke zu Jim Lambek: Sag bloß!
4.
Sagt Walter Ulbricht zu Deng Xiaoping: Warte mal eben!
IX. Die Farben der Fische sind ihre Meinungen
1.
Eine weitere Diesseits-Jenseits-Geschichte
2.
Langsam vorglühen (transzendenzhalber)
3.
Was Habermas von Stalin weiß
4.
Allzeit andererseits
FÜNFTER TEIL | AN DER SCHWELLE ZUM BAU
X. Ein Soldat
1.
Noch ein Diesseits-Jenseits-Lied
2.
Wer ist die Stimme?
3.
Ins Auto steigen müssen
4.
Für das Leben lernen wir
5.
Freundschaft, ganz einfach
6.
Unter Umwegen und Umständen
XI. In Gold
1.
Bauherrin bewundert Bauweise
2.
Zum übergeordneten Ziel
XII. Ein Abschiedsbrief
SECHSTER TEIL | HYLOKATEGORION
XIII. Juni so früh
1.
Musik auf dem Dach
2.
Hyperorientierung
XIV. Alarm in Soncha Kapa
1.
Gauß’sches Rauschen?
2.
White Mountains, Teil 1
3.
Komm mal wieder runter
4.
White Mountains, Teil 2
5.
Wie eine Diffperson stirbt
SIEBTER TEIL | DER KALTE KERL
XV. Kein Killer
1.
Am Innenrand der Ausnahme
XVI. Die arbeitende Klasse
1.
Jetzt lass doch mal den Brecht bleiben
2.
Die ganze Welt
XVII. Hallo Saanvi!
1.
Zwei Freie
2.
Die Wichtigkeit der Haustiere
XVIII. Tony Skyrme
1.
Plastik und Topik
2.
Verhörhalber
ACHTER TEIL | AUFBRUCH SATZAUSWÄRTS
IXX. Über den Dingen
1.
Und erst im Rückblick seh’ ich klar
2.
Mon corps est arraché du sol
3.
Bad Language
XX. Gefechtsraumorientierung
1.
Thermodynamics of Information Processing in Small Systems
2.
Wenn das Erdbeereis gesalzen ist
3.
I’ma give your body to the sky
XXI. The hub of ambiguity
1.
Noch mal: Gebrauchswert
2.
Es sind gleichfalls Wirbel, aber solche: eine Show
3.
Mensch ärgere dich nicht
4.
Und alle Nomonautinnen
XXII. I Have No Mouth
1.
Das Brüllbombardement
2.
Oder: Betrunken aufräumen
3.
Anders kann es auch nicht sein
Nachschrift (vor dem Umsteigen)
QUELLEN, ANMERKUNGEN
WEITERE LITERATUR
DANK
Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören; und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen.
das evangelium nach lukas 12: 2-3
They none of them could understand any of it at the time.
tony skyrme 1985
Kom graun, oso na groun op. Kom folau, oso na gyon op.
osleya gon rouz
For Skairipa, no longer under the floor
Auslöserwarnung
Dieses Buch erzählt den Hergang der Erschaffung der schönsten Maschine, die je gebaut wurde. Der Bericht weiß von Leben und Tod, Ehre und Schande, Eigensinn und Solidarität. Er hat schöne Stellen und widerliche. Den guten Menschen läuft das Blut die Beine runter wie Wasser; den bösen flutet Geld die digitalen Konten.
So weit der Lauf der Welt.
Wer aushält, dass das geschieht, aber nicht, dass es aufgeschrieben wird, sollte das Buch nicht lesen. Begleitet wird die Frau, der die Idee zur schönsten je gebauten Maschine eingefallen ist. Das Buch bleibt bei ihr vom Moment des Einfalls an, in jungen Jahren, und zwar ihr ganzes restliches Leben lang.
Es spricht davon, wie genau diese Frau dafür sorgt, dass die Maschine gebaut wird.
Der Verfasser ist dankbar für das anstrengende Geschenk, die Frau persönlich kennengelernt zu haben. Er denkt mit Staunen und Freude an einen Tag in Basel zurück, an dem er erleben durfte, wie sie ihre Sache verteidigt, wenn man ihr mit Unfug kommt. Jemand hatte in gemischter Gesellschaft einen Vergleich der schönsten Maschine mit einem »Computer« gezogen, »nur dass das Ding, wenn es denn je fertig wird, halt noch einiges kann, was ein Computer nicht kann«.
Der Mann, der das sagte, wurde von der Frau, der die Welt die schönste Maschine verdankt, dafür so schwer zusammengestaucht, dass sich bis spät in die Nacht niemand im Saal mehr traute, ähnlich Unüberlegtes zu sagen.
Dies widerfuhr ihm unter etwa fünfundzwanzig Menschen bei einem der großen, kostspieligen Abendanlässe, die damals von der Bauherrin der Maschine ausgerichtet wurden, um Leute miteinander bekannt zu machen, von denen sie sich Hilfe beim Maschinenprojekt versprach. Die Atmosphäre dieser Zusammenkünfte im Rückblick angemessen zu beschreiben, fällt nicht leicht. »Party« ist ein zu kindlicher Name für das Ereignis. »Feierlich« als Adjektiv klingt zu steif, »festlich« trifft es zwar fast, schweigt aber vom geistigen Glanz jener Tage.
Es war eine Zeit weitläufiger KI-Debatten: Man redete von Chatbots, Large Language Models, Neural Networks, Deep Learning. An dem Tisch, an den mich die Gastgeberin gesetzt hatte, direkt neben ihrem, wo sie mit ihrer damaligen Düsseldorfer Lebensgefährtin sowie einem jungen Mann aus Jordanien und weiteren Personen saß, verschaffte mir die mit kleinen, in Prägedruck beschrifteten Kärtchen ausgewiesene Sitzordnung die Gelegenheit, zwei zunächst etwas einschüchternde Bekanntschaften zu schließen. Denn da saßen zwei Herren, die zum modischen Thema in so gut wie sämtlichen überhaupt absehbaren Hinsichten substanzielle Auskünfte geben konnten.
Es handelte sich um den indisch-amerikanischen Informatiker Charu C. Aggarwal und den theoretischen Physiker Bob Coecke aus Belgien.
Sechs Personen waren um diesen Tisch platziert.
Bald nach der kurzen Begrüßung durch die Gastgeberin wurde Herr Aggarwal von einer Dame aus Schottland (wenn ich das richtig erinnere, es kann auch Wales gewesen sein) in ein Gespräch über einige Einwände gegen die den aktuellen KI-Boom nährenden Vorannahmen der Systementwicklungszunft verwickelt. Diese Einwände hatte Aggarwals in Trondheim an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens mit Evolutionary Computation, Bio-Inspired Artificial Intelligence und Computational Neuroscience beschäftigter Kollege Keith L. Downing vor Kurzem öffentlich erhoben.
In den künstlichen neuronalen Netzen, die damals das meiste Interesse der Fachwelt wie auch der Massenmedien auf sich zogen, sorgten Verbände von Rechenzellen im Zusammenspiel einerseits der Gradientenabstiegsmethode (in deren Welt steile Lernkurven gleichsam besser sind als flache, billige aber überhaupt die besten, die Einzelheiten sind knifflig) und andererseits der »backpropagation« von Fehlerbaustellensorgen fürs jeweils erwünschte Verhältnis zwischen der Veränderungsrate bei den Gewichten der Rechenzellenverbindungen einerseits und der Veränderungsrate der Fehlermenge andererseits.
Die Ketten, die von diesen Gradienten-Tunings regiert wurden, waren dem Kritiker Downing »zu lang«.
Bei menschlichen Nervenzellen, so sah das der theoretische Bioniker im Kurzreferat der Schottin (oder: Waliserin?), ändert sich eine Variable im Lernprozess so, dass sie die nächstliegende Nachbarin beeinflusst, »und dann mal sehen«, wie sie sagte, das heißt, wie ich sagen würde: Es findet ein lokales Versuch-und-Irrtum-Spiel statt, während die »formal mathematical derivations across long causal chains«, die reichweitenstarken Mathevorgaben in den Deep-Learning-Riesen, nach Downing einen »lack of convincing emergence« bedingen, also einen Mangel überzeugender Demonstrationen der Emergenz von überraschenden Lernfortschritten, wie wir sie bei natürlicher Intelligenz zu erleben meinen.
Überdies, so setzte die engagierte Dame Herrn Aggarwal auseinander, werde an allen Ecken und Enden der gerade überall statthabenden Diskussion allerlei Sachliches verflacht.
So etwa von solchen Vergröberern, die Deep Learning einfach als »Machine Learning mit mehr Rechnerzellenschichten« und sonst nichts betrachteten, als gäbe es (hier klang sie äußerst gereizt) nicht noch viele andere, aus je eigenen Gründen interessante Formen des Maschinenlernens, die man zum Beispiel im Wald von Entscheidungsbäumen oder bei der linearen Regression findet.
Für »richtige KI« (ich drücke mich dumm aus, weil ich’s bin, sie sagte: »Artificial General Intelligence«) bräuchte es nach Ansicht derer, die dieser Verflachung das Wort reden, letztlich nicht mehr als einen Bausatz aus Gradientenabstiegsmethode und Fehlerrückführung. Aber wäre das wahr (nahm die Frau erregt Maß an ihrem Sitznachbarn), dann könnte man sich Fragen wie »Was heißt eigentlich Denken?« sparen und sie gleich eintauschen gegen besagten Gradientenabstiegsbausatz. Etwas Algebra, Trigonometrie, einen Schuss Analysis und vielleicht ein bisschen Programmieren. Anstelle philosophischer Fragen untersucht man dann bald nur noch Steigungen und Gefälle von Aufwandsfunktionen beim Fehlerquotenabbau im Training der erwähnten neuronalen Netze aus Schichten von Einzel-Recheneinheiten, deren Verbindungen jeweils die berühmten »Gewichte« tragen, Verbindungen unterschiedlicher Stärke zwischen den Zellen in den Schichten, die dann wie mehr oder weniger unsichtbare Würmer in einem Sandwich von der Eingabebis zur Ausgabeschicht ihr Wesen treiben.
Das könne so doch wohl nicht angehen.
Herr Aggarwal hörte dies alles freundlich, geduldig und mit schwer deutbarem Gesichtsausdruck an.
Mein direkter Nachbar, Herr Coecke, lächelte derweil, möglicherweise inhaltlich zustimmend, still in sein Weinglas. Schließlich war die Klageschrift verlesen und Herr Aggarwal, gleichsam der Bezichtigte, gab ebenso freundlich, geduldig und mit schwer deutbarem Gesichtsausdruck Antwort, wie er zuvor zugehört hatte. Die genauen technischen Einzelheiten seiner Erwiderung sind mir entfallen, obwohl ich mir noch am selben Abend Notizen zu dem ganzen Dinner gemacht habe, in denen es aber fast ausschließlich um das darauffolgende Gespräch ging, das ich selbst nach dem Wortwechsel der Dame mit Herrn Aggarwal dann mit Bob Coecke geführt habe, sowie um den sehr kurzen Streit, den die Gastgeberin in der hier bereits erwähnten Angelegenheit der Vergleichbarkeit ihrer Maschine mit einem Computer erst anfing und dann sofort beendete.
Von der Aggarwal-Sache weiß ich nur noch, dass der Angegriffene zur Mäßigung bei Urteilen riet, die einem System in irgendeiner Form hinlängliche Emergenz irgendeiner Eigenschaft absprechen, weil das eine Sorte Urteil sei, die doch sehr stark von der Fähigkeit der je urteilenden Instanz abhänge, Muster zu erkennen oder eben nicht.
Außerdem riet Herr Aggarwal, die Reduktion der Möglichkeiten maschinellen Lernens auf Deep-Learning-Verfahren solle man nicht »voreilig für voreilig erklären«, wie er sehr schön sagte, auf Englisch wörtlich: »not call that hasty too hastily«, woran er die kurze mündliche Skizze einer Art Äquivalenzbeweis anschloss, die meinen Horizont augenblicklich überstieg.
Es ging dabei, so meine ich, darum, diverse computationale Lerneinrichtungen als Sonderfälle des Deep Learning auszuweisen, zum Beispiel ältere Empfehlungsdienste (»Kunden, die … gekauft haben, kaufen auch …«), spezielle Regressionsverfahren und anderes, »denn das lässt sich alles in neuronalen Netzwerken schreiben« oder ähnlich, »spannend wird es sowieso erst bei den nichtlinearen Sachen«.
Spätestens hier fiel ihm die Vertreterin der Anklage ins Wort und brachte jetzt außer Reduktionismusvorwürfen und Emergenzabwesenheitsbeobachtungen eine weitere Attacke ins Spiel, die damit zu tun hatte, dass es zwar, wie sie sagte, leicht sei, die Anwesenheit einer Information in einem gewissen Typ von System nachzuweisen, aber sehr schwer, seine Verwendung durch das System zu untersuchen, ein Problem, für das sie als Kronzeugen einen Kollegen in Israel anführte, am Technion in Haifa, es kann Yonatan Belinkov gewesen sein, aber den habe ich mir vielleicht auch später dazugedacht, weil ich in anderem, wenn auch verwandtem Zusammenhang von seiner Existenz und seiner Arbeit mit Sprachmodellen erfuhr.
An diesem Punkt ergänzte mein Nachbar sein Lächeln durch ein Nicken.
Und weil sein Blick meinen traf, sagte ich etwas Unbeholfenes, vielleicht: »Können Sie dem folgen?«
»Sprache …«, begann Herr Coecke versonnen, allerdings auf Englisch, ich gebe es aber der Einfachheit halber in der Übertragung meiner deutschen Niederschrift vom selben Abend wieder – wie ich das in diesem Buch bei Erinnertem in fremder Sprache generell halten will, wo nicht der genaue Wortlaut, die originalsprachliche Betonung oder das musikalische Element in den Sinn dessen, was ich weitergeben möchte, in größerem Ausmaß hineinspielen, als eine Übersetzung ins Deutsche sagen könnte.
Mehr als das eine Wort – »language« – erwiderte der Mann nicht auf meine unbeholfene Frage. Damit standen wir, nein: damit stand ich an der Schwelle einer Peinlichkeit, die ich unbedingt vermeiden wollte, weswegen ich mir ein Herz fasste und als Nächstes durchblicken ließ, ich wisse zumindest, mit wem ich es bei ihm zu tun hatte.
Tatsächlich kann man zwar nicht behaupten, ich hätte die beiden Texte von Herrn Coecke, auf die mich die Gastgeberin im Zuge einer journalistischen Arbeit über die Computerverarbeitung natürlicher Sprache hingewiesen hatte, ausreichend durchdrungen, als dass keine Fragen mehr übrig geblieben wären.
Aber ein bisschen eingelesen hatte ich mich zumindest, erst in die Abhandlung Mathematical Foundations for a Compositional Distributional Model of Meaning von Coecke, Mehrnoosh Sadrzadeh und Stephen Clark aus dem Jahr 2010, und dann in die von Coecke allein verfasste Folge-Arbeit The Mathematics of Text Structure aus dem Jahr 2019.
Besonders Letztere hatte Eindruck hinterlassen, so dunkel mir Stellen in der Herleitung auch geblieben waren. Strenger als in der Literaturwissenschaft, die ich aus dem Studium und als Hilfsdisziplin bei der Literaturkritik kannte, wurde mir da ein Begriff von Schrift vermittelt, der nicht nur über das verblüffende Modell von Text als einem Schaltkreis in einem Rechner, dessen einzelne Sätze logischen Gattern entsprechen, welche »updates« der variablen Bedeutungen von Wörtern erzeugen, wie eine Offenbarung durchschlug, sondern mehr noch wegen eines Satzes, in den ich mich, wenn man das so sentimental sagen darf, schon beim ersten Blick verliebte: »Text is a process that alters our understanding of words«: »Text ist ein Prozess, der unser Verständnis von Wörtern verändert.«
Coecke konnte es nicht wissen, aber mich traf dieser Gedanke wie ein Ordnungsruf.
Sind das Texte, was du schreibst, nach diesem Maßstab, oder nur Phrasenbaukästen? Wie verwahrlost ist dein Schreiben für die Zeitung, wie verkommen ist deine Redigatspraxis, wie achtlos gehst du bei deinem Job mit diesem Gut um?
Wird es nicht Zeit, dass euch Maschinen ersetzen, da deren Hirnlosigkeit wenigstens eine reinliche, unschuldige ist?
Als ich Coeckes Satz vor mir sah, in einem Buch, das zu Ehren seines Anregers Joachim Lambek kompiliert und publiziert worden war, erkannte ich den Sinn einer alten Sottise von Rainald Goetz, der einem bei Studienrätinnen und Zahnärzten sehr beliebten Kollegen bei passender Gelegenheit vorgehalten hatte, jener schreibe »praktisch textfreie Bücher«.
Literaturhausgeeignetes, Feuilletonbedarfsgerechtes, das schon, aber Texte im Sinne Coeckes (»alters our understanding«: vertieft, verbreitert, erfrischt das Verständnis, nicht nur: »verändert« es …) fanden und finden sich in den Schriften des Beschimpften nicht.
Finden sie sich bei mir?
Ich erschrak über den Zustand einer Redegegend.
Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.
Um nun den Moment, in dem meine erste persönliche Unterredung mit dem Mann, der mir auf diese Weise verraten hatte, was ein Text ist, nicht in ein Schweigen abgleiten zu lassen, bei dem ich mir wie ein Trottel vorgekommen wäre, sagte ich, während der erste Gang aufgetragen wurde (ein bisschen Kürbissuppe im halben kleinen Kürbis), zu Herrn Coecke etwas wie: »Aber Sprache ist nicht gleich Sprache, oder? Sie zum Beispiel benutzen Computer, um Sprache zu erklären, und der Kollege hier«, das Gespräch der beiden andern ging ja weiter, leise, zivilisiert, jetzt mehr als kühler Wortwechsel, und noch spezieller, technischer als zuvor, ich jedoch fuhr fort: »Der Kollege benutzt sie, um Sprache zu generieren, nicht zu erklären, und ich habe den Eindruck, es ist nicht ganz so, wie ich mir das als Laie vorstellen würde: Erst verstehen und erklären, dann generieren.«
Coecke nickte: »Manchmal imitiert Wissenschaft ihren Gegenstand, bevor sie ihn versteht, und vergleicht das Imitat mit dem Imitierten, um das Imitierte erst einmal nur auf diesem Weg besser zu begreifen. Sie schreiben, richtig?«
Er erläuterte auf meinen überraschten Gesichtsausdruck hin, dass die Gastgeberin ihm erzählt hatte, mit wem er den Tisch teilen sollte. Dann fuhr er fort: »Vielleicht ist das, was wir meinen, mit der Beziehung zwischen writer und editor zu vergleichen. Ein editor, der nicht selbst schreibt«, er benutzte, da er Englisch sprach, nicht das generische Maskulinum, aber das gehört, als Übersetzungsproblem, schon zu den Nöten, um die es in diesem Buch geht, wenn auch noch zu den harmlosesten, »ist oft kein guter editor, und wer schreibt, sollte sich auch selbst edieren können, zum Beispiel kürzen und so weiter. Interpretieren ist nah beim Sprechen, aber nicht unkompliziert nah. Es ist eine Nähe, die selbst der Erklärung bedarf.« Ich muss mit den Schultern gezuckt haben, weil mich dieses große Zutrauen zu den Berufsanforderungen meines Geschäfts ein bisschen überforderte. Als ich an seiner Miene erkannte, dass er nicht verstand, was ich damit sagen wollte, erklärte ich mich: »Schön wär’s, wenn bei der Arbeit noch Zeit und Platz für solche Erwägungen wäre, aber wenn ich dran denke, wie ich mit mir anvertrauten Sachen freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal wirtschaften muss, wenn es eilt, dass was ins Netz soll und so weiter, dann muss ich sagen: Da wird alles plattgemacht, was ich nicht sofort verstehe, und mit Fertigbauteilen überschrieben, damit die Leserinnen und Leser nicht drüber nachdenken müssen, wie der Text eventuell mal das Verständnis eines Wortes auf die Probe stellt, erneuert, verändert. Es findet eine permanente Vermittelmäßigung der Texte statt, auch ohne KI-Assistenz.«
Herr Coecke war erstaunt über die Emphase, mit der ich mich überführte. In übereifriger Gelehrsamkeit schloss ich den Gedanken an, dass im Deutschen sein Bild vom Schaltkreis die Frage nach der Wortstellung aufwirft, sodass etwa die Versuchung, den Satz »Auf der Treppe liegt der Hund« zu ändern in »Der Hund liegt auf der Treppe«, weil dem editor, also beispielsweise mir, die zweite Version »natürlicher« scheint, das heißt: dem individuellen und subjektiven Sprachempfinden eher entspricht, bekämpft werden sollte, da ja vielleicht die gewählte Reihenfolge die Aufmerksamkeit auf die Treppe lenken soll (der Hund könnte doch auch auf dem Flur oder vor den Stufen liegen etc.) und man nicht davon ausgehen dürfe, die Reihenfolge sei zufällig passiert, das heißt, sie sei ausgewürfelt worden, beliebig.
Im Idealfall müsse man sich sagen: Das, was da steht, ist auch gemeint, und ich kann nicht einfach dekretieren, es sei das andere gemeint gewesen, das ich stattdessen hinsetzen will.
Coecke erwiderte mit einem für mich verblüffend einfachen Statement: »Entweder, der geänderte Wortlaut hat denselben Sinn wie der ursprüngliche, dann hat man zum Ändern keinen Grund, oder er hat einen anderen, dann hat man dazu kein Recht.«
Dann lachte er, weil er mir vom Gesicht ablesen konnte, dass ich dachte: Das ist es.
Statt aber dies zu sagen, sagte ich: »Es sei denn, es ist ein Fehler drin. In der Formulierung, die ich redigieren soll. Ein Grammatikfehler, ein sachlicher. Dann hat man das Recht.«
Coecke nickte: »Es muss dafür aber neben den beiden subjektiven Instanzen writer und editor auch eine Form von Sprachwissen geben, die das auf irgendeine Art objektiviert. Regelwerke. Oder bewegliche Regelwerke: Sprachmodelle. Da, denke ich, ziehen der Doctor Aggarwal und ich letztlich am selben Strang. Das ist ein Maschinenthema. Ein logisches auch, und ein mathematisches.«
Ein anderer Mensch räusperte sich.
Ich schrak zusammen. Es war ein Herr uns direkt gegenüber gewesen, am selben Tisch, etwa sechzig, in einem wohl einst teuren, jetzt aber leicht abgetragenen rosa Anzug, ein hagerer Mann, mit etwas glattem braunem Haar vorn auf einer Glatze, seltsam nach links gekämmt und geklebt.
Auf seinem Tischkärtchen stand nur: »Dr. Schwabing«.
Vage war mir bewusst, seinem Blick während der Unterhaltung mit Herrn Coecke mehrfach begegnet zu sein.
Er schien mir als Lauscher und Beobachter mit etwas trägen Augenbewegungen sowohl an meinem und Coeckes Gespräch wie an dem Wortwechsel zwischen Herrn Aggarwal und der Frau aus Großbritannien teilgenommen zu haben. Aber das Geräusch, mit dem er jetzt den Anspruch anmeldete, sich zu äußern, war so laut, klang so selbstbewusst, ja geradezu befehlsartig, dass nicht nur wir vier, sondern auch einige am Nachbartisch, darunter die Gastgeberin, auf diesen Herrn aufmerksam wurden, der es irgendwie fertigbrachte, bei dem, was er jetzt sagte, sowohl mich als auch Herrn Coecke, Herrn Aggarwal, die Britin, ganz besonders jedoch die Gastgeberin anzusehen, wie ein Bild alle anschaut, die es betrachten.
So sprach denn Doktor Schwabing: »Es geht uns allen hier, möchte ich meinen, um mehr als Duden-Regeln. Es geht um eine Syntax der Welt! Die ist immer etwas Historisches! Zum Beispiel kann man sagen, dass die Syntax der Moderne, wie Lewis Mumford einmal auffiel, aus Wörtern wie mine, blast, dump, crush, extract, exhaust besteht, aus den Verben der destruktiven Macht des Kapitalismus über die Erde, oder mit Karl Marx: über den Arbeiter und die Erde!«
Er sagte das auf Deutsch, und man hörte am Ende dieser merkwürdigen Behauptungen tatsächlich jeweils recht deutlich das Ausrufezeichen, mit dem er seine Lehren These für These abzuschließen entschieden hatte.
Ich sah etwas hilflos zu Coecke, ob der wohl verstand, wovon die Rede war. Nun räusperte sich der ominöse Doktor Schwabing ein weiteres Mal und sprach (ich kann nicht »sagte« sagen, er hatte den hohen, wohl auch hohlen Ton eines Propheten): »Und diese Syntax ist, dächt’ ich, richtigzustellen, der Gebrauch der falschen Syntax durch eine von der Natur, auch der eigenen Natur entfremdete Menschheit, der muss korrigiert werden, deshalb, will ich meinen, sind wir ja auch alle hier, weil unsere geschätzte Frau Hofer eine Maschine bauen will, die ebendas leistet, einen großen Computer, der unsere historisch falsch gewordene Syntax berichtigt! Mit besseren Verben, nur dass das Ding, wenn es denn je fertig wird, halt noch einiges kann, was ein Computer nicht kann!«
Hier gehören im Grunde zwei Ausrufezeichen hin. Aber es sieht wohl zu hässlich aus.
»Unsere geschätzte Frau Hofer«, um Himmels willen.
Gerade so, wie der Mann eben noch alle angeschaut hatte, die seine Weissagungen betreffen mochte, auch die Gastgeberin, so sahen jetzt alle, auch er, zur Gastgeberin selbst, die ihr Weinglas, soeben noch erhoben, ruhig neben ihre Kürbishälfte stellte und dann, wer weiß, was für ein Trick das war, auf einmal allen im Saal über die Köpfe zu wachsen schien, einzig vermöge der Klarheit ihrer Aussprache, ohne sich von ihrem Stuhl zu erheben: »Erstens, lieber Schwabing«, das war die Retourkutsche für die schmierige Nummer mit der »geschätzten Frau Hofer«, es wurde also still im Saal, noch mehr Leute merkten auf, eigentlich alle, »kann eine Syntax nicht aus irgendwelchen Hauptwörtern oder Verben bestehen, sondern nur Verknüpfungen solcher Verben und Hauptwörter und gegebenenfalls anderer Wörter regeln. Zweitens baue ich keinen digitalen Duden. Und schon gar keinen Computer, sondern ein Gerät, das, anstatt die Syntax menschlicher Sätze über die Welt zu berichtigen, oder, was Sie wahrscheinlich in Wirklichkeit meinen und nur vor lauter Geisteswissenschaft nicht mehr ausdrücken können, die Grammatik solcher Sätze, geradezu im Gegenteil nicht in irgendein Reden oder Schreiben der Menschen über die Welt eingreift, sondern in die Welt selbst, wie das kein Computer könnte. Das heißt, die Maschine wird zwar am Ende etwas produzieren, das man einen Satz nennen kann. Aber dieser Satz ist dann zugleich die Durchsetzung einer richtigen Grammatik oder Syntax, deren Richtigkeit jedoch nicht die menschlicher Sprachpraxis korrigiert, sondern Vorgänge in der Natur selbst, aufgrund einer Beziehung zwischen Information und Energie, die ein Computer zwar nutzt, aber nicht modifizieren kann. Es geht nicht um Anstreichung, Redigat, Kritik, Korrektur, Rezension, sondern um Sachen wie bei der Röntgendiffraktometrie von Quarzglas, die man treibt, um die Eigenschaften des Glases anhand der Diffraktionslinien zu bestimmen, wobei aber das Glas in diesem Vergleich das Substrat der Maschine ist und die Diffraktionslinie irgendeine Naturkonstante, die man bislang eben falsch gesehen hat und mittels der Maschine dann richtig sieht. Wir glauben nur, dass wir diese ganzen Konstanten verstanden hätten. Die Gravitationskonstante und die Feinstrukturkonstante und die Hartree-Energie und das Plancksche Wirkungsquantum und die Boltzmann-Konstante und das Bohrsche Magneton und die Elementarladung und die Vakuumlichtgeschwindigkeit, wir tun dabei so, als könnten wir ihrer Wahrscheinlichkeit den Wert 1 zuweisen, weil wir sie doch gemessen haben. Dabei müssten wir diese Wahrscheinlichkeit anders bestimmen, nämlich über einen Implekanten, der sie als Implekat fixiert. Und dann erst messen. Wenn die Messung etwas anderes ergibt als der Implekant, dann ist die Natur falsch. Dann wiederholen wir Bestimmung und Messung, bis es sitzt. Bis sie es kapiert hat, diese dumme Natur. Das ist unser Redigat der Natur, das ist wichtiger als jeder Computer. Ein Mensch in Berlin, ein gelernter Autobastler, postmigrantisch in der zweiten oder dritten Generation, soweit ich weiß, entwickelt gerade den ersten Implekanten. Jetzt, in dieser Woche. Deshalb stehle ich ihm nicht die Zeit und lade ihn hierher ein, wo er Ihnen, Schwabing, den Blödsinn aus dem Kopf holen und bügeln und ordentlich wieder reinfalten kann. Nein. Nein, nein. Aber so ein dummes Zeug auch, Computer. Diesen ganzen alten Dreck, Hardware, Software, Notwehr, das will ich hier nicht nochmal hören.«
Sie nahm das Glas wieder auf, nippte und lächelte ihr Gegenüber am eigenen Tisch an, einen Menschen namens Evariste, der in diesem Buch eine wichtige Rolle spielen wird.
Ich wusste zu diesem Zeitpunkt schon, dass ich das hier vorliegende Buch schreiben würde, wollte und sollte. In gewisser Weise hatte ich sogar schon damit angefangen, widerstrebend, in großer Angst, den Zweck der Sache zu verfehlen. Die halbe Minute allgemeinen Schweigens, einer Schockstarre sehr ähnlich, in der die ganze Abendgesellschaft nach der Ansprache der Bauherrin verharrte, bevor die ersten nervösen Kicherlaute, beiläufigen Bemerkungen und neuen Small-Talk-Anläufe uns daraus erlösten, nahm ich als Warnung, jedenfalls keine groben Ungenauigkeiten in meinem Text zuzulassen, die in ähnlicher Art das Missfallen von Renate Hofer auslösen könnten.
Die Ausführlichkeit, mit der das Buch, wie es jetzt geworden ist, die Geschichte der Maschine und ihrer Bauherrin erzählt, geht auf Kosten einiger Geschichten von Menschen, die diese Maschine derzeit bauen. Solche Geschichten werden hier nur kursorisch abgehandelt, im Vorbeigehen berührt. Dieser Makel am Text ließ sich nicht vermeiden, da der Stoff für mich sonst nicht zu bewältigen gewesen wäre. Weil wahr ist, was hier stehen muss, wird beim Lesen, anders als im Märchen, der eine oder andere Mensch sich erst als Freundin, Freund, Heldin, Held zeigen und dann als Monster, aber auch umgekehrt. Figuren wollen eingeführt sein, die Großes versprechen, dann aber ruhmlos und kläglich zertrampelt werden, vom großen Haufen, vom Unrecht, vom Weltlauf.
Schreckliche Taten, böse Gründe, furchtbare Folgen.
Unerträgliches, in Worten festgehalten, wenn schon nicht: verewigt.
Wer Namen wiedererkennt, soll sich hüten: Alles im Buch ist, um ein Wort von Christian Geissler zu zitieren, frei erfunden in der Erfahrung.
Ich weiß, und bin darüber betrübt: Einige der bereits mit dem Bau der Maschine betrauten Menschen werden dieses Buch lesen, und umgekehrt werden manche, die es lesen, sich denen anschließen, die heute schon an der Maschine arbeiten, und beide wird einiges stören, was da steht. Um bei ihnen allen und anderen nicht mehr Anstoß zu erregen als im Sinne der angestrebten Wahrhaftigkeit der Darstellung absolut erforderlich, möchte ich vorab darauf hinweisen, dass das Buch einige schwer erträgliche Schilderungen (und die mitunter im Hinblick auf die vor allem physikalischen und informationstheoretischen Zusammenhänge annähernd erschöpfende Ausdeutung) von teils überraschenden und kaum verständlichen, teils erschreckenden und abstoßenden Vorgängen zwischen Leibern und in Köpfen enthält.
Noch problematischer als einige diesbezügliche sexuelle, gewaltsame oder logisch abwegige Handlungen sind die grundsätzlichen gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen vielen der handelnden Personen.
Für Geld tun einige dieser Leute zum Beispiel Dinge, die man für gar nichts tun sollte, wohl nicht einmal um der Rettung eines Lebens oder einer Seele willen. So aber hat es sich zugetragen.
So geschieht es weiter, so wird es fortgesetzt, und so muss es hier deshalb auch aufgeschrieben werden, damit denjenigen kein noch schlimmeres Unrecht geschieht, ohne die es die Maschine nicht geben kann. Zuletzt eine deutliche Warnung: Die Zeitverhältnisse der Leiber und Seelen sind in diesem Buch nicht durchweg die empirischen des alltäglichen Erlebens.
Das hat seinen Grund darin, dass sich der Erzählgang in einem entscheidenden Punkt der Funktionsweise der Maschine anschmiegt, ausführlich im letzten Drittel des Romans. Die Struktur des Erzählgangs ist wesenhaft anaphorisch: Es wird wiederholt, auf je höherer Stufe, also in ständiger Umdeutung des Wiederholten. Menschen sagen oder schreiben, was andere schon gesagt und geschrieben haben, und diese wissen doch nichts von jenen. Wie das sein kann, ist die Frage, der das Buch sich auf den Bahnen der Ionogel-Adern der Maschine nähert (auf mehr als einer Zeitachse; einen ersten Begriff davon kann vielleicht das 2009 erschienene Buch Extra Dimensions in Space and Time von Itzhak Bars und John Terning vermitteln).
Eher nebenbei enthält dieses Buch schließlich etwas äußerst Abstoßendes: eine Geheimgeschichte der verwissenschaftlichten Produktivkräfte seit etwa 1920, also ungefähr ab dem Moment, an dem Hermann Staudinger seine folgenreichen Ideen zur Polymerchemie veröffentlichte.
Aber das ist eine Zugabe; es interessiert die meisten wohl kaum.
Also dann.
WER HIER LEBT
Renate Hofer, auch Miach Mihie | Maschinenschöpferin ♦ Ueli Hofer | Renates Vater ♦ Die Frau aus Lausanne, auch Suzanne Dellinger | Renates Erzieherin ♦ Evariste Ubukata, auch Ryu von Schnaub-Villalila | Renates Organisator ♦ Aviad Brink | Renates kaum bekannter Hauptanreger ♦ Vexus Texas | Renates Gegenüber ♦ Patrick Maertens | Renates Problem ♦ Weidanger | Priester im Mittelbau ♦ Kobalt | Anspruchsdenker ♦ Magnetin | Systematische Täuschung ♦ Mutter Maertens | Besessene ♦ Doktor Dietrich Kurland | Leutseliger Kerl ♦ Emil Kurland | Dietrichs Sohn, kalter Kerl ♦ Pawel oder Karl Landau | Fälscher ♦ Kerstin Waldmann | Frau mit neuen Nerven ♦ Xiaosong Zhou bzw. Zhou Xiaosong | Weiser ♦ Dorothee, »Doro«, »do« Coppe | Künstlerin ♦ Hark Maertens | Einflüsterer ♦ Dietmar Dath | Skizze ♦ Eine Düsseldorfer Taxifahrerin | Verrückte ♦ Melissa Fiallos | Renates Liebste ♦ Sven | Quatschkopf ♦ Baqil | Tragiker ♦ Eva | Händlerin ♦ Stier | Henker ♦ Widder | Verirrter Schutzgeist ♦ Martin Maurer | Kerstin Waldmanns Therapeut ♦ Cordula Nathalie Späth | Will gar nicht stören ♦ Aleksander Farczády | Will gern zerstören ♦ Colin Kreuzer | Großinvestor ♦ Karl Hollmann | A spook ♦ Bridget | Vexus’ Freundin in Japan ♦ Kerim Balbay | Erfinder des ersten Implekanten ♦ Horst Völz | Speicherdenker ♦ Youseffi | Ägyptischer Raketenfachmann und manchmal Renates Chauffeur ♦ Bleddy A. Bowen | Weltraumstratege ♦ Juni Hofer | Tochter von Renate ♦ Ali Hofer | Auch Tochter von Renate ♦ Kilian | Bester Freund von Juni und Ali ♦ Shoichi Toyabe | Rätsel und Lösung ♦ Takahiro Sagawa | Lösung und Rätsel ♦ Tony Skyrme | Relativ wichtiger Typ ♦ Akiko Miyake | Gute Freundin von Ali und Juni ♦ Minae Mizumura | Schriftstellerin ♦ Lena Dieringshofen | Mathematikerin ♦ Ruben | Rabbiner ♦ Saanvi Nieuwenhuizen | Biologin ♦ Hermann Staudinger | Plastikdenker ♦ Bernhard Jensen | Exgitarrist ♦ Sören | hoffnungsvoller siebzehnjähriger Arzt im Anakategorion ♦ Simone | Medizinerin ♦ Matei | Diffgelehrter ♦ Ajamu | Diffexperimentator ♦ Yoko | Diffheldin ♦ Betty Pauli | Gesundheitspolitikerin ♦ Frau Véliz | Statthalterin der Frau Späth in den USA ♦ Peter Filipenko | Quasiglaser ♦ Ahadi Müller | Quasispielzeugmacher ♦ Lucia Burkitbajewa | Quasihirn- und Sprachforscherin ♦ Karin Feldgroten | Quasikritikerin ♦ Baha Targyn | Klassenkämpfer ♦ Ylonda Sherrod | Amerikanerin, die sich wehrt ♦ Galen Toscano | Clevere Diffperson ♦ Ashraf Mohammed | Quasirecyclingtechniker ♦Jianjun Pross | Großes Talent ♦ Blachowicz | Spitzenkraft ♦ Facchini | Leistungsdynamo ♦ Jinwoo Eichin | Quasitierarzt ♦ Svenja Rabe | Quasilandwirtschaftsbegabung ♦ Marion Kaust | Quasikonditorin ♦ Tobi Nasidius | Quasikonditor ♦ Jutta Dietl | backt auch gern ♦ Ralf Padilla | Quasimilchmensch ♦ Gabi Jazayeri | befährt einen Fluss ♦ Herman Cappelen | Sprachdenker ♦ Paul Dirac | uncredited ♦ Gerhard Gentzen | auch uncredited ♦ Nathalie Lichterfeld | Karl Hollmanns linke Hand bei den Wachen ♦ Marco Reiferscheid | Alter Wächter ♦ Maurice Hofer | Renates Großvater ♦ Gina Hofer | Renates Großmutter ♦ Juli Hofer | große Neuigkeit
ErsterTeil | lieber nicht ertrinken
I. Der Kindheit entkommen
1. Bunker unterm Sand
Unique, terrible – and in the sky, uncanny brilliance
Substituting for the humanizing sun.
louise glück: The End of the World (1985)
While in DisCoCat all meanings are fixed as states (i. e. have no input), in DisCoCirc word meanings correspond to a type, or system, and the states of this system can evolve.
Sentences are gates within a circuit which update the variable meanings of those words.
bob coecke: The Mathematics of Text Structure (2019)
Je kleiner die Vögel sind, desto schneller rennen sie über den Sand, dann ins Wasser und wieder raus. Beine sind Nadeln, Kleidchen Laub.
Hallo, kleine Vögel! Euer Himmel wartet. Der Nordpol auch. Aber ihr müsst noch rennen, wieso? Renate weiß es nicht. Sie ist neun Jahre alt, dann elf, dann dreizehn, dann vierzehn. Und die Vögel werden immer mehr. Das Kind liebt diese Vögel, die junge Frau auch. Genauso liebt sie den Himmel, den Sand, am meisten den Wind, der in der Nacht von oben kommt, von den Sternen, im Sommer als Kühlung, im frühen Herbst atemwarm, Geruch von Vertrauen und Traum.
Als Kind lebt Renate an einem Ort, an dem von Gesetzes wegen keine Menschen leben sollen: Sand, Salzmarsch mit dem grünsten Gras der Welt, langes Wellenfrontenrauschen von Nord nach Süd. Das mächtige Geräusch kommt vom Wrightsville Beach her, mit seinen beiden selbst im Spätsommer noch von Touristen überlaufenen Piers. Es will nach Carolina Beach, mit seinem nahezu naturbelassenen Nordstrand-Park, oberhalb der Marina Street.
Dazwischen liegt das Unbetretbare, das Renate manchmal betreten darf, wenigstens in der Nacht, mit den sicheren Großen.
Unbetretbar? Nein, es gibt ein bisschen Tourismus hier, per Boot, kompakte Familienshuttles für Ausflüge. Aber das muss immer umständlich angemeldet werden.
Minikreuzfahrten führen an der Insel entlang, »cocktail cruises«, »island hops« und ähnlicher Blödsinn. Man kann sich sogar ein privates Dinner organisieren lassen, am Strand, und mit dem Paddelboot durch die Marsch dümpeln.
Nach Sonnenuntergang müssen die Leute weg sein. Nicht so Renate, nicht so die sicheren Großen, die sich tagsüber in den glatt ausbetonierten Höhlen verbergen.
Sandland, Landsand deckt diese Höhlen ab, breitet sich nach Süden und nach Norden aus als Schleppe für größte Sommer.
Manchmal bleibt Renate mit den sicheren Großen hier bis in den frühen September, in den beginnenden Herbst, bleibt unterm Sandland und geht nur in der Nacht nach oben.
Am Tag bewohnt sie das in den Schacht gefaltete Haus.
Der Vater zeigt es ihr beim ersten Besuch geduldig, morgens um 5, im schwach ersten Licht. Er sagt: »Fenster kennst du. Normalerweise sind die vorne und an der Seite bei Häusern, aber hier ist das einzige Fenster oben, und meistens bedeckt. Und aus besonderem Glas. Ein Trick.«
Das alles sagt er auf Deutsch.
Sie weiß, dass das Deutsch ist, weil es andere Sprachen gibt, die sie schon kennt.
Renate kann Französisch, weil die Frau aus Lausanne ihr das beigebracht hat. Sie mag diese Frau, ihre schlanke Gestalt, die dunkle Haut, die Haltung. Französisch, das ist: mit dieser Frau am Frühstückstisch sitzen, Witze machen, lachen.
In den verschiedenen Ländern, in denen Renate lebt, sitzt die Frau mit ihr und einigen sicheren Großen an immer wieder anderen Frühstückstischen.
Bis zum ersten Besuch im und unterm Sandland hat Renate in den Sommern oft auf einem Felsen gewohnt, steil, überm grünen Meer, weit östlich und ein bisschen südlich von dem Ort, wo keine Menschen sein sollten, und im Winter lebte sie bis dahin meistens auf einem richtigen Berg mit Schnee, das hieß »Graubünden« da.
Wohnen bedeutete immer: sich aufhalten in Häusern mit Fenstern vorn und auf der Seite.
Schweiz.
Heißt das so? Der Winter?
Die sicheren Großen sagen es.
In der Schweiz spricht man Deutsch, aber nicht nur. Man spricht da, sofern man denn Deutsch spricht, außerdem anders Deutsch als die Deutschen in Deutschland.
Ihr Vater hat Renate richtige Deutsche aus Deutschland vorgestellt. Das Kind dagegen »kommt aus der Schweiz«, so weiß es das selbst.
Was heißt das? Renate denkt nicht, wie alle denken, wenn sie darüber nachdenkt, was etwas heißt. Dass Renate aus der Schweiz kommt, heißt für sie, dass es eine kühle Zeit gibt, die so lange her ist, dass ihre Erinnerungen nicht hinkommen, so wie die Hand, wenn der Arm zu kurz ist, nicht ins oberste Regal greifen kann, eine kühle Zeit, die nichts als Schweiz war.
In dieser Zeit, die länger her ist als alles sonst Erinnerbare, ist sie immer in der Schweiz, so wie jetzt nur noch manchmal. Das bedeutet »aus der Schweiz kommen«.
Manches kommt nicht aus der Schweiz, weil es da bleiben muss.
Einige Alpen zum Beispiel.
Eine Sorte Vögel oben, draußen, am langen Strand hier in North Carolina, eine Art unter den kleineren, den zahllosen Vögeln, unter den Sternen, die noch viel mehr sind hier, heißt nach den Alpen, die es in der Schweiz gibt: Alpenstrandläufer.
Die Federn, die so einer oben am Hals und auf den Flügeln hat, sind nicht hellbraun und nicht dunkelbraun. Sie sind, entscheidet Renate, sofabraun, und dabei denkt sie an das große Möbelstück, auf dem man unten im Erdhaus, im Sandtunnelhaus, am Ende der Wendeltreppe so gut fernsehen kann.
Da gibt es nichts, was gerade irgendwo tatsächlich im gesendeten oder per Kabel verschickten Fernsehen kommt, sondern nur Filme, die im Schrank stehen, wenn gerade niemand sie anschaut. Erst sind das Videokassetten, dann, als Renate etwas älter wird, sind es DVDs, dann sind es Blu-ray-Discs.
Dann wäre es Streaming geworden, aber zu der Zeit kommt sie schon nicht mehr her.
Ob Streaming in dem Schacht überhaupt je stattfindet? Einmal danach gefragt, ist sie sich später, als Erwachsene, nicht sicher, denn es hieße, dass die Rechner unten in der Streamingzeit mit weitläufigen Netzen verbunden gewesen wären.
Das war doch sicher nicht erlaubt, man darf ja nicht vergessen, wozu das Ganze überhaupt da war, oder ist, denkt sie, diese Räume, und dann gerät sie ins Schwimmen: Waren und sind das überhaupt Räume dort unten, oder nicht einfach kurze Zwischenstücke von langen Tunnels?
Jeder Raum, na gut, hat mehrere Durchgänge, mehrere schwere Eisentüren, einige sind dauerhaft verschlossen.
Renate erfährt bereits als Kind: Hier wurde lange im Geheimen gebaut. Der Teil des alleruntersten Bereichs, in dem man ein bisschen wohnen kann, ist ein Knotenpunkt in der Mitte eines Gewirrs von schier endlosen Gängen.
Die sicheren Großen reden oft davon, mit vielen seltsamen deutschen Wörtern. Es sind nämlich Deutsche, die das alles für Renates Vater gebaut haben, Ingenieurinnen und Ingenieure, Bauleute, Fachkräfte aller Art aus der Bundesrepublik Deutschland.
Deshalb geht es in den entsprechenden Unterhaltungen dann auf gut Deutsch um »Porenrauminjektionen« auf »Zement-Betonit-Basis«, die dazu da sind, »Bodenentzüge beziehungsweise Verbrüche« zu vermeiden, oder man redet über »Brandschutzbeton«, dem man »Polypropylenfasern« beigefügt hat, und über die »Aufschüttung« von Schotter, immer wieder auch über den Sand oben, über Abdichtung, Drainage, über Gutachten, Beratung, Prüfungen.
Einmal sind patzige Leute da, die etwas messen sollen, in den »druckdichten Röhren« mit »minimal elf Metern und maximal fünfundzwanzig Metern Überdeckung«. Die Rede ist von »Spannung«, vom »Grundwasserspiegel«, man sorgt sich um alte Versiegelungen mit Spritzbeton. »Kernbohrungen« werden schließlich gemacht.
Es ist alles sehr interessant, als Sprachmusik, Renate will es inhaltlich aber gar nicht allzu genau wissen, es klingt halt wie auf dem Bildschirm, in einem Film, wie die Technik für ein Raumschiff oder eine Zeitmaschine, abstrakt faszinierend, eine Welt des Wissens und Könnens, der Kenntnisse und der Fertigkeiten, für die, meint Renate, noch genug Zeit ist, wenn sie mal selbst groß sein muss oder darf.
Fachsprachen, denkt Renate, sind Kisten, Kasten und Kästen voll eigener Ausdrücke für je einen sehr genau ausgemessenen Gesichtskreis.
Die Fachsprache für den Gesichtskreis »Wir kommen aus der Schweiz« zum Beispiel, mit dem sich Renates Vater manchmal befassen muss, nennt sich »Schwyzerdütsch«.
Sie soll nicht »sürmle«, sagt der Vater zum Beispiel, wenn er beim Abendessen mit ihr am langen weißen Tisch sitzt und sie leise Laute von sich gibt, unbewusst manchmal.
Dann muss sie über das Wort lachen, mit dem er das benennt. Dann freuen sich beide. Und wenn der junge Helfer Evariste mit der Frau aus Lausanne über einen Techniker lästert, den sie nicht mögen, ermahnt der Vater die beiden, dass er das nicht mag, und nennt es »verhächle«, mit hartem »ch«.
Wenn es Renate Anfang September zu kalt ist, abends die gedrehte Treppe hochzugehen zum kleinen Spaziergang am Strand, nennt er sie ein »Gfröörli«.
Kälte heißt manchmal »Chelti«, ein Stückchen von etwas ist ein »Bitz«.
Sachen haben mehrere Namen, Handlungen auch, Sachverhalte erst recht, die aus beidem gemacht sind.
Wieso? Pourquoi? Why?
Das ist Sprache.
Wenn Renate als Kind tief unterm Sand, in den gekappten und parzellierten Tunnels, im Innenhaus der Spiegel und Wendeltreppen, der Wohnräume und Serverhallen herumläuft, denkt sie manchmal mürrisch darüber nach, dass sie immer nur nachts länger als eine Stunde raus- und raufdarf, weil man da nicht gesehen wird.
Jedes Mal geht außerdem eine oder einer von den sicheren Großen mit, erst zum Holzgeländer und den Steinplatten und dann weiter in den Sand.
Schön: Da spazieren sie am Strand, da hört Renate das Rauschen und sieht die Gischt, und schaut irgendwann hoch.
Dort sind alle Sterne.
Einmal geht sie an der Hand der Frau aus Lausanne hoch.
Die Frau hat ein Fernglas an zwei Riemen auf der Brust und eine enge Gummihaut zum Surfen an. Sie geht nach hundert Metern neben Renate im Sand auf die Knie, nimmt das Fernglas in die Hand, streift sich die Riemen über den Kopf, gibt das Fernglas Renate, nickt, hebt den Kopf, das Kinn, hält die jetzt tiefschwarze Stirn in der Nacht den Sternen entgegen, mit weit offenen, dunklen Augen. Dann schaut sie Renate an und sagt: »Regarde en haut, ma petite!«
Also nimmt Renate das Fernglas, ganz vorsichtig.
Sie weiß: Technik ist toll, kann aber schnell kaputtgehen.
Sie schaut nach oben.
Da sieht sie noch mehr Sterne als sonst.
Es waren aber doch schon alle sonst. Wie kann es mehr als alle Sterne geben?
Renate weiß sofort, von den Fingerkuppen her, wie sie das Fernglas schärfer stellen kann, und probiert es aus. Sie misst die Schärfe an den Sternen, an zweien vor allem, einem etwas dickeren, runderen, und einem, der eher wie ein kleiner scharfer Schnitt aus Licht im Finstern aussieht, eine weiße Verletzung am Himmel, ein bisschen wie die roten Wunden, die passieren, wenn man sich an Papier schneidet.
Renate will sehen, ob da Planeten sind oder Raumschiffe oder so was, neben den Sternen, wie bei Star Wars.
Aber sie sieht nur ein bisschen Blau in dem dickeren Stern, und ihr fällt ein, vielleicht sind das gar keine Sterne, wie war das, es könnten Planeten sein, Mars und so, das kann sie sich immer alles nicht merken, weil es so weit weg ist und ihr deshalb, wenn sie ehrlich ist (da muss man aufpassen, dass man nicht zu ehrlich wird, vor allem bei Evariste), nicht wirklich wichtig vorkommt.
Sie dreht an den Schärfen.
Jetzt meint sie, etwas Verschmiertes zwischen den beiden Sternen und um sie her zu erkennen, »C’est … vert et … rouge«: Da nebelt Grün, daneben nebelt Rot. Sie findet das langweilig und gibt der dunklen Frau aus Lausanne das Fernglas zurück.
Später hört sie den Vater und die Frau aus Lausanne auf Deutsch darüber reden, was Renate am Himmel gesehen haben will. Die beiden Erwachsenen sitzen in der langen Küche, während Renate auf dem grauen Teppichboden im runden Sofazimmer spielt. Die Frau und der Vater sitzen oft in der länglichen Küche, auch wenn Renate auf dem großen Bett liegt und liest, so viel liest, tagelang liest.
Diesmal klingen die Stimmen angespannt, auf gepresste Art halblaut, die eigentlich lauter werden will: »Das war ein Nachbildeffekt. Oder eine Ergänzung im Hirn, weil zu wenig Reize da sind. Selbsttäuschung.«
»Nein, war es nicht. Sie hat gesagt, grün und rot. Sie hat den Nebel gesehen.«
»Also«, der Vater räuspert sich, das ist was zwischen Lachen, Bellen und Angreifen. Dann fährt er grollend fort: »Du sagst, sie sieht mit ihren neun Jahren am Sommerhimmel bunte Gaswolken im Weltraum. Sie sieht den Wasserstoff, der ist für sie rot, und sie sieht den Sauerstoff, der ist für sie grün … Klar. Gern. Wir können hier auch völlig paranoid werden und verrückt, warum nicht?«
»Sie hat es gesehen«, sagt die Frau aus Lausanne mit einer Bestimmtheit, in der ebenso viel Müdigkeit liegt wie Trotz, mit einer Bestimmtheit, die Renate nicht gefällt.
Wenn der Vater höhnt und lacht, dann muss man nachgeben und von was anderem reden, sonst wird es hässlich, sonst gibt es Ärger.
Das will man nicht.
Aber der Vater ist selbst nicht richtig wach an diesem Abend, nicht streitlustig wie sonst oft, und sagt, anstatt auf die sture Feststellung der Frau, Renate habe das verschwommene Schillern, von dem das Kind schon nicht mehr weiß, ob es so war, wie es jetzt diskutiert wird, tatsächlich gesehen, etwas Bissiges zu erwidern, nur resigniert: »Es wäre mir lieber, du würdest mit ihr einfach die Vögel beobachten statt ausgerechnet … Sterne. Weisch? Es ist doch besser, wir vergleichen erst mal das, was sie sieht und erlebt, mit dem, was wir selber sehen und erleben, dann haben wir eher ein Maß für … den Unterschied. Statt dass wir gleich versuchen, ihr zu folgen bei Sachen die … die sie vielleicht kann, vielleicht nicht kann, aber wir können sie definitiv nicht. Das lässt sich halt nicht überprüfen.«
»Vögel«, erwidert die Frau skeptisch, lässt es dabei aber bewenden.
Es wird still.
Vielleicht küssen sie einander jetzt. Machen sie das nicht manchmal? Oder hat Renate das geträumt? Der Vater küsst Frauen hier und in der Schweiz und in England, aber küsst er auch diese eine, besondere Frau?
Egal.
Renate ist erleichtert: Vögel, gut.
Wenn man überhaupt rausdarf, sind die Vögel eh das Lustigste da oben.
Der Alpenstrandläufer zum Beispiel.
Der läuft so schnell, weil er dem verrückten Namen weglaufen will, vermutet Renate, denn in den Alpen, im Schnee oben, gibt es ja keinen Strand, und hier, am Strand, gibt es keine Alpen.
Wer hat den Namen gemacht?
Sie lernt: Dasselbe Tier kann viele Namen haben, je nachdem, wer es wo sieht. So heißt der Vogel an diesem Ort, bei den Einheimischen (die es allerdings an diesem Strand nicht gibt, es darf ja niemand herkommen außer für den Tourismus): »Dunlin«.
Man schreibt es mit einem »u« als erstem Vokal, aber man spricht es eher mit einem »o«, »Donlin«. Sprache ist komisch.
Überall.
Lesen lernt Renate in Paris.
Aber das stimmt nicht, sagt sie später zu Patrick, ihrer schwierigsten Liebe: »Ich habe in Paris gelernt, Buchstaben und Wörter und Sätze zu identifizieren, alles auf Papier damals noch, keine Bildschirme. Aber Lesen, richtig Lesen, in einem Text baden, versinken, ihn aufsaugen, das hab’ ich erst in dem Haus in der Erde unterm Sand, im Meer, im Felsen gelernt. Da habe ich mit Büchern und Comics gelebt. Lesen neben großen blauen Lampen und riesigen Löchern für enorme Ventilatoren im Beton. Yoko Tsuno! Die hat für mich ihre Abenteuer erlebt, in Höhlen, in Tunnels, mit den Außerirdischen, die sich auf unserer Welt im Erdinnern verstecken. Wenn ich mal was gehört habe, ein Klopfen oder Klappern, irgendwo in den Tunnels, konnte ich mir vorstellen, das ist jetzt Yoko. Das Lesen und die Wirklichkeit, diese beiden waren ganz nah beieinander, nah wie nie mehr später. Deswegen denke ich auch so oft an den Ort jetzt, wenn ich lese.«
Tunnel, Keller, Bunker, negatives Haus, in die Welt hineingekrempelter Turmbaum: Am besten passt zu ihrem Lebensgefühl, findet Renate als Kind, wohl das nach allen Richtungen geöffnete Wort »Schacht«.
Es reimt sich auf »Nacht«, das stimmt sehr.
Das Wichtigste am Reim ist das »ch«, der Kratz-Röchel-Hust-Reibe-Spuck-Laut, der eine große Rolle auch in Vaters Schwyzerdütsch spielt. Es ist ein zarter Krach, der damit droht, sich zu verschlucken, und dazu den Hals, der ihn macht, und das Ohr gleich mit, das ihn hört.
Vielleicht ist das Verschluckte das Gefühl von Dunkelheit, das die Dunkelheit selbst hat, wenn sie sich zu verstehen versucht: Nacht.
»Wieso darf ich nicht einfach am Tag raus und hoch und in den Sand? Der Sand in der Sonne ist so toll glitz… glitzerig? Glitzerisch?«, sagt Renate.
Der Vater schlägt vor: »Sag doch: Der Sand glitzert.«
Sie holt tief Luft und setzt neu an: »Der Sand glitzert und wenn ich den in die Hand nehme und der läuft da raus, so durch die Finger …«
»Er rieselt. Oder man kann sagen: Er rinnt.«
»Ja, also er rieselt und rinnt«, sie sagt das schnell, sie wird jetzt schneller, damit er ihr nicht dauernd mit seinen Erklärungen ins Wort fällt, »also wenn das rinnt und rieselt, dann ist das wie die kleinsten Diamanten. Mensch! Wieso darf ich das nicht? Nein, sag jetzt nicht, das kann wer sehen, wir sind doch nur einmal im Jahr ein paar Tage hier. Das kann doch, wenn ich mit der … mit der Frau aus Lausanne gehe oder mit Evariste, das kann doch ein Feriending sein, dann sind wir halt Touristen. Du hast selber gesagt, dass es Ausflüge gibt, nein, nicht jetzt wieder sagen: Die Coast Guard sieht es und weiß genau wie du, wer … wann … da ist, und wenn sie uns nicht auf dem Zettel haben, dann werden sie misstrauisch und … das hast du alles tausendmal erzählt. Es ist doch blöd, weil zum Beispiel der Eingang und das Dach aus Glas, das Fenster oben, das finden sie ja auch nicht, und zwar weil du da irgendwas gelogen hast oder … oder deine Leute haben was gelogen, dass es auf der … an der Stelle einen Schaden gibt oder eine …«
»Gefahrenzone. Wir haben es nicht spezifiziert, wir haben nur durchgegeben, die denken, da ist vielleicht Treibsand oder ein Bruch in der …«
»Ja, aber wenn das geht, dann kannst du doch auch das andere lügen beim Amt … dann können deine Leute doch auch lügen, ja, also da sind welche auf einem Ausflug mit einem Mädchen, das bin dann ich, und das steht dann in den … in irgendwelchen Formularen und im Internet und dann lassen sie uns in Ruhe! Das muss doch ganz einfach sein!«
Sie weiß, was er auf solche Appelle immer sagt, in wechselnden Formulierungen: »Leute anlügen, wenn’s nur das wäre! Das ist ganz einfach, aber in Zukunft, und schon jetzt, reicht das nicht mehr. Selbst vorausgesetzt, dass es überhaupt was zu lügen und zu mogeln gibt – man muss Leute anlügen, ja, manchmal, aber viel schwieriger wird es sein, Netze von Leuten, Archive von Leuten und Speicher von Netzen von Archiven von Leuten anzulügen.«
Speicher von Netzen von Archiven von Leuten.
Sein todlangweiliges Lieblingsthema, oh je.
Das ist es, was er vor drei Jahren dauernd mit einem seiner Deutschen besprochen hat, mit diesem Herrn Völz, wie hieß er, Heinz oder Hans? Diese schrecklichen Frage-und-Antwort-Gespräche auf dem Balkon überm Zürichsee: »Also, die Grenze der technisch erreichbaren Speicherdichte hängt an … an der Wiedergabe, ja?«
»Ja.«
Immerhin war der Mensch nicht geschwätzig.
Aber der Vater hat ihn immer weiter gelöchert: »Die Lebensdauer der Speicherung dagegen, die hängt einfach am Speicherzustand?«
»Ja.«
»Und die Verlustrate, die steht dann in Beziehung eben zur Halbwertszeit, und dafür setzt du diese Arrhenius-Gleichung, das stimmt so?«
»Ja.«
Bla bla bla?
Ja.
Bla?
Ja.
Bla bla bla bla bla?
Ja, ja.
Ja bla.
Jetzt, in der Küche, macht der Vater ein Geräusch, das Renate bei sich ein »winziges Lachen« nennt. Sie muss grinsen, als ihr einfällt: So lachen wahrscheinlich Seepferdchen.
Dann jedoch setzt er sein ernstestes Gesicht auf und sagt: »Lassen wir das mal weg, wie ganz einfach oder nicht ganz einfach das ist. Da habe ich jetzt keine Lust dazu, wieder umständlich alles aufzuzählen, was du weglässt, damit du dir das so hindenken kannst, dass das ganz einfach wäre. Ich will dich mal ganz was anderes fragen: Hier unten kannst du Experimente machen. Nicht wie andere Kinder nur mit Chemiebaukasten oder Elektrospielzeug. Sondern Suzanne und George und Evariste können dir die tollsten Sachen zeigen, zum In-die-Hand-Nehmen oder am Computer. Und du? Du interessierst dich für den Sand oben! Was ist Sand? Kaputte Steine. Abfall. Das, was übrig bleibt, wenn was Starkes zerfällt. Das sind Felsen, etwas sehr Dumpfes und Stumpfes, Stummes und Dummes, und wenn man tausend Jahre oder eine Million Jahre oder noch ein paar Millionen Jahre wartet, dann machen Wind und Wasser das kaputt. Dann hast du den Abfall, die Krümel, deinen Glitzersand. Aber was dir die sicheren Großen hier zeigen können, das sind die Naturgesetze! Du kannst verstehen, wie alles funktioniert. Auch dein Körper, zum Beispiel. Es gibt die Geräte hier, nicht nur das Fitnessding. Anil kann dir alles auf deine Größen einstellen, deine Daten, wenn du so dringend toben und springen und rennen und heben und werfen willst. Da geht viel mehr als oben und draußen. Und dann lernst du was!«
»Was lern ich da?«
»Alles. Was ist Kraft, was für Regeln gibt es, wie beschleunigt und bremst man sich selber, wie funktioniert die Welt? Das ist ewig. Wissen darüber, wie alles immer funktioniert, Kräfte, Felder, das gilt nicht nur, bis eine Sache ero… bis eine Sache zerfällt, wie bei den Felsen. Ich habe … ich habe dir das alles hier halt wegen … Ich will nur das Beste für dich, weißt du das überhaupt? Der Sand, der dir durch die Finger rinnt, das ist nicht das Beste. Genauso wenig übrigens wie deine Flausen mit den Farben bei den Sternen.«
Der Vater ist der Frau aus Lausanne also immer noch böse, dass sie Renate bestärkt hat in dem Gefühl, sie hätte um die Sterne herum, und zwischen den Sternen, Rot und Grün gesehen.
Renate schweigt dazu lieber.
Denn jetzt kommt er in Fahrt. Sie kennt das: Wenn sie ihn diese Fahrt nicht bis zu dem Punkt fahren lässt, an dem er nichts mehr zum Fortfahren hat, wird es hässlich.
Ihr Thema, nämlich, dass sie draußen und oben spielen will, hat er vergessen.
Auch das kennt sie, da kann man nichts machen.
Er doziert (sie kennt das Wort nicht, aber viele Jahre später, als sie es kennenlernt, denkt sie sofort: Das kenne ich, das war mein Vater, doziert hat er dauernd, genau): »Selbst wenn du das gesehen hättest, was du da gesehen haben willst, was wäre das schon gewesen? Mehr Staub. Kosmischer Staub, kosmischer Riesel…Müll, rinnender … kosmischer … Riesen-Rieselmüll im All, dünner als dein Sand sogar. Dünner als Luft. In der tatsächlichen, irdischen Luft, hier unten und oben am Strand, hast du viele, viele Teilchen pro Kubikzentimeter, eine Eins mit neunzehn Nullen. Aber da draußen, das Grüne und das Rote, das sind zwar … Teilchen von … Sauerstoff und Wasserstoff wie hier in der Atemluft, aber eben nur hundert Teilchen pro Kubikzentimeter in diesem Nebel. Praktisch nichts. Und nur, weil es so groß ist, schillert es. Schillern, Schimmern, Glitzern, Rinnen und Rieseln? Kind, das ist Zeitverschwendung.«
»Okay«, sagt Renate, als er mehrere Sekunden nach diesem offenbar als wuchtiger Schlusspunkt gemeinten bösen Wort »Zeitverschwendung« für das, was sie will, für das, was sie mag, für das, was sie interessiert, nicht weiterredet.
Sie sagt es nur, damit er nicht wieder anfängt.
Er fängt nicht wieder an, denn er weiß, dass er zufrieden sein kann: Der Erziehungseingriff hat das Ziel sichtlich erreicht, Renate ist entmutigt. Immer, wenn er etwas erreicht hat, macht er nicht weiter. Zeitverschwendung? Soll ihm nicht passieren.
Nie.
Das Haus in der Erde hängt voller Spiegel unterm schrägen Dach.
Gekippte Spiegel sind das, und gebogene.
Die bringen das Licht der riesigen Sommer nach unten.
Tief, tief unten kommt’s aber nicht an, da, wo man ein paar Räume zum, nun ja, Wohnen eingerichtet hat. Immerhin: groß und schön. Da stehen tolle Betten mit harten Matratzen, die nicht weicher werden, wenn man wie verrückt stundenlang darauf rumspringt. Es gibt ein Bad und darin eine runde Wanne. An deren Rand stehen und liegen allezeit Seifen, Schaumbäder und andere Schätze, die duften.
Aber der invertierte Turm als solcher ist trotzdem nicht zum Wohnen da. Wer wohnen will, ist stets nur Gast hier. Gast? Gefangen?
Renate will, je älter sie wird, je öfter sie da ist, immer dringender auch tagsüber hoch und am Ufer hin- und herrennen, mit ihren langen Beinen in ihren kurzen himmelblauen Hosen.
Aber es ist verboten.
Sie darf sich nicht unterm blauen Himmel, wie an anderen Stränden, in Spanien zum Beispiel, in den Sand fallen lassen, wie ein Baum, der, brutal gefällt, eindrucksvoll umstürzt, und dann die Sonne auf ihr Gesicht scheinen lassen, um, wie sie das einmal in Afrika getan hat, zu testen, ob von mehr Sonne auch mehr Sommersprossen kommen und ob sich die Farbe der glatten langen Haare ändert, von Rotblond zu mehr Rot oder mehr Blond (das Ergebnis, in Westafrika entdeckt: beides. Das Haar wurde »mehr rot und mehr blond«, oder heißt es: »roter und blonder«, oder »röter und blönder«? So witzelt Renate, weil sie nicht weiß, dass die Gene ihrer Mutter darauf hinauswollen, dass ihr Haar mit der Pubertät sehr viel heller wird, platinblond, silbern fast, sonniger als erwartet).
»Wenn du unbedingt willst«, sagt der Vater schließlich eines Tages im Flugzeug auf dem Weg zum Sandland, weil sie sich wieder quengelnd beschwert, »dann kannst du dir von mir aus ein Boot bringen lassen. Dann verschiffen wir dich nach Norden, die paar Meter, auf dem Atlantik, nach Wrightsville, dann wird’s halt ein Ausflug. Airlie Gardens, oder einer von den anderen Gärten, ihr könnt was essen gehen. Sag aber bitte der Suzanne, sie soll an der Südspitze von dem Ding nach Nordosten fahren. Am Oceanic-Pier vorbei, nicht in diese blöde Bucht unterhalb vom Park. Da gibt’s nämlich eine Küstenwachtstation, da sehen dich dann noch welche, das kann ich nicht brauchen. Sie soll dich da absetzen. Meinetwegen kannst du einen Tag lang toben, bis es dunkel wird. Aber sie begleitet dich. Hampel, wenn du schon hampeln musst, immer am Strand rauf und runter, also parallel … sag ihr, sag … sag der Suzanne, sie soll zusehen, dass du immer parallel zur Lumina Avenue rummachst. Nicht nach Westen. Geh nicht nach Westen, hast du mich verstanden?«
Der Ernst dieser Ermahnung kommt ihr seltsam kraftlos vor, als hätte er keine rechte Lust oder Zeit, streng zu dem neunjährigen Kind zu sein.
Ganz ruhig, und gerade damit frech, erwidert sie: »Mit Suzanne am Strand am Sand aufs Land, verstanden.«
Der Vater reagiert darauf, wie er auf Renates Sprachwitze immer reagiert.
Er schnaubt, als hätte er einen Schnupfen.
Wörter liebt Renate. Nicht alle, aber einige Wörter sind für Renate das Schönste, irgendwie sogar schöner als das, was sie sagen.
»Insel« zum Beispiel.
Der Ort, wo niemand wohnen soll, wo man den Turm in die Tiefe gebaut hat, aber nicht, damit jemand drin wohnt, sondern zu einem anderen Zweck, den Renate erst mit zehn Jahren und eher zufällig erfährt, ist so eine »Insel«.
Das sagt ihr einmal Renaud, einer der sicheren Großen.
Renate sieht es etwas anders.
Wörter eignet sie sich, so weit sie auch immer reist, so viel sie auch von der Welt sieht, meist über Bücher und Filme, also Bilder, Sätze und Vorstellungen an, nicht über eigene Erlebnisse. Und so ist für sie »Insel« nicht das hier, dieser flache Fleck Sand im Meer, der sogar so flach ist, dass ihn (lange bevor das, was man Klimawandel nennt, seine Effekte zeitigt) immer mal wieder das Meerwasser ganz überspült, selbst die höchsten Dünen und Sandkämme. Nein: Auf einer richtigen »Insel«, da sind Schätze versteckt, da leidet Robinson unter der Einsamkeit und findet schließlich Freitag. Da steht in Witzen eine einzelne Palme, da schreibt man, was man denkt, fürchtet und hofft, auf einen Zettel, steckt ihn in eine Flasche und schmeißt ihn mit aller Kraft ins Meer.
Das Sandland ist schmal und flach, wird obendrein immer schmaler und flacher, denn man hat, so sagt der Vater, »ein paar dumme Jetties gebaut hier. Das verstärkt die Drift. Ein Jetty, das ist ein Steg zu allen möglichen Zwecken, das sind hier diese Felsen, diese dunklen Steine, die gibt es hier im Norden und ein dazu passender Steg dieser Art ist dann im Süden von Wrightsville Beach. Wenn du dich hier auf den Steg stellst, kannst du den dazugehörigen