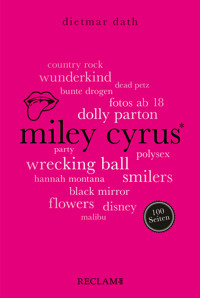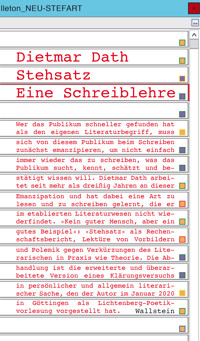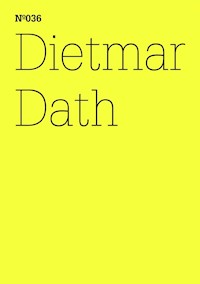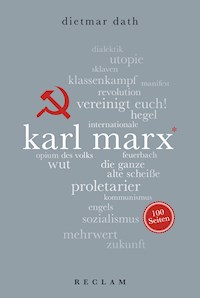Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein rasanter Roman, der ein Jahrhundert umfasst und den Leser in die Zukunft schleudert Der deutsche Logiker Gerhard Gentzen zählte zu den genialsten seines Fachs. Doch wer erinnert sich an ihn? Dietmar Dath macht sich in diesem erstaunlichen, mitreißenden Roman mit Laura und Jan auf die Suche nach jemandem, an den sie sich nicht mehr erinnern. Der Leser betritt einen Denkraum, in dem nicht nur Gerhard Gentzen aufritt, sondern auch noch ganz andere Figuren: Dietmar, der seit zehn Jahren an einem Roman über einen berühmten Logiker schreibt, aber auch Frank Schirrmacher, der sich den Kopf über das Internet zerbricht, Jeff Bezos, Ruth Garrett Millikan, eine schiefe Tante und ein geheimnisvolles Wesen, das das Leben auf der Erde erheblich in Gefahr bringen wird. Das ganze Personal dieses großen Romans stellt sich in den Dienst der Suche nach der Grundlage unseres Lebens in der Gegenwart: der schier unendlich scheinende Rechenleistuneng der Computer. Sie ermöglicht die Flugbuchungen, die Verteilung von Impfstoffen oder Hilfsgütern, die Steuerung der Atomwaffenarsenale oder die detaillierte Abbildungen eines Lebens durch Likes und Kommentare in den sozialen Medien, die es nicht gäbe, wenn Programme nicht die Funktionsweise von Programmen überprüfen könnten. Dass sie das können, hat wiederum mit Gerhard Gentzen zu tun. Kunstfertig und temporeich, humorvoll und immer wieder überraschend schreiben diese vielen Erzählstränge selbst ein Programm – If Then GoTo –, das uns die Chancen und Möglichkeiten der Rechentechnik der Gegenwart erleben lässt und unerwartete Ergebnisse ausspuckt: Science Fiction eben, was sonst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dietmar Dath
Gentzen
oder: Betrunken aufräumen
Kalkülroman
INHALT
1Schmerz und Programm
2Zettel fallen lassen
3So ähnlich sah Gerhard Gentzen mal aus
4Brezeln
5Eine Idee
6Seuchensteuerung und Selbstauskunft
7Geschöpfe des Himmels
8Ein Posten steht vor manchem Haus
9Ein Affe mit rotem Gesicht
10Fuchsaugen und Menschensinn
11Wie sich das anfühlt, wenn ein Mensch weg ist
12Keine Szene
13Verarschte Eltern
14Stärke oder Defekt?
15Friedenspfeife
16Grummeln über Zufälle
17Westkredite
18Unhörbar, aber deutlich zu laut
19Politische Fortbildung der Elite
20Von Logik umgebracht oder gerettet
21Waffenwetter
22Der Mann heißt Herbst
23Erforschung des Publikums
24Ein anderes deutsches Genie
25Nach den Regeln und um die Regeln herum
26BASIC gegen Armut
27Aha! oder Ein ins fertige Buch über Ludwig Feuerbach und den Ausgang der klassischen deutschen Philosophie dann doch nicht aufgenommener Abschnitt von Friedrich Engels
28Auf keinen Fall langweilig
29Was ist mühselig?
30Hoffnungen, die früh sterben
31Fern von Göttingen
32Eigenschaften, die gleich bleiben, wenn man
33Negation oder Vermittlung?
34Mülltrennung
35Nichts Wichtiges
36Hauptsache, nicht hingehört
37The Invisibles
38Lady Gaga geht mit Gerhard Gentzen ins Kino
39Schlafplatz
40Printmedien
41Krank
42Du kommst
43Hustekuchen und Pustensaft (fast was für Kinder)
44Ein Idiot voll Abstiegsangst
45Halma statt Go
46So ähnlich sah Shvaughn Erin mal aus
47Sohnesgehorsam
48Die grauen Eichhörnchen der Organisationsforschung
49Möglich
50Schön mit Moral
51Die Sorge des Herausgebers
52Hand an Wange
53Black Lives Matter
54Ad absurdum
55Sie hat sich hingelegt
56Sterne
57Ein auffallend Uninteressanter und die Geschichte mit den Kronkorken
58Ein Buch an die Wand hauen
59Zeitungsvoodoo
60Was sie noch zu sagen hätte, dauert eine Operette
61Danke, Schatz
62Stoppen oder retten
63Im abjekten Bereich des Horrors
64Draußen wahr, daheim weniger
66Europa
67Dachrinne!
68About the machine
69Ohne Kontakt mit menschlicher Praxis
70Mappenkontrolle
71Was kein Mensch liest
72Eine Kuh
73Tod des Reiches
74Was nennst du selbstverständlich?
75Was Schreckliches
76Faire Zurechtweisung des Autors
77Die Liebe hat er sich gemerkt
78Feuer in Erde
79Liberalismus am Abend
80From this machinery hums come
81Denn der Mensch
82Sortierenwollendürfenmüssen
83Sonntag
84Schlüsse und Beweise im Politischen
85Die Deutschen
86Variatio delectat
87Das Leiden oder die Kunst
88Ganz winzige Splitter
89Sommerhühner
90Biosemantik
91Müssen wir
92Die Schranke
93Im Kontinuum wird dir schwindlig
94Ein Selbstmordgefährdeter ruft bei einer Hilfshotline an und gerät ausgerechnet an die Studentin Laura Giarizzo
95Das schlechthin Unverständliche
96Schreibereien
97Ich kann das nicht erzählen
98Keine Entschuldigung
99Vergleich und Unterschied
100Reverse Engineering
101Dran gehalten
102Welches Unternehmen?
103Wer sie nicht ist
104Totaler Atomkrieg oder so
105Aber Rassismus
106Zeltdach
107Jan Imhofs peinliche und riskante Forschungsmethode
108Geschenk
109Heuristisch
110Was unbedingt gilt
111Assez!
112Sonst fällst du selbst durch
113Ein Denkbild
114Deformationskennungen
115Welche?
116Mehr als Anekdoten
117Am Herzen
118Wozu der Rückvergleich nicht taugt
119Nur einmal noch
120To lessen my troubles
121Macht das was?
122It’s no Game
123Der Soziologe erklärt
124Elektrizitas Pulsipher
125Wie man es lässt
126Ein Vortrag in einer Zelle
127Der Preis von allem, der Wert von nichts
128Bakterien lachen nicht
129Die Wirbel
130Terror
131Der hat mich nur runtergezogen
132Kaskadenstrafe
133Ein wahrer Irrtum
134Schlechter Beichten
135Inhalt ist auch nicht ohne
136Korrekturlesen
137Ausgleichshalber
138Die Kreisläufe, die Spiralen, die Vektoren, die Skalare
139Drümmelig
140Insekten
Quellen, Anmerkungen und Dank
Weitere Literatur
Es gibt kein Chaos.
HANS HEINZ HOLZ (1997)
Jede Negation hat eine Aura von Langweile.
PETER HACKS (1998)
Computers aren’t the thing. They’re the thing that gets us to the thing.
JOE MACMILLAN (1983)
Für Maria
und alle Nomonautinnen
WER HIER LEBT
Gerhard Gentzen | Deutsches Genie * Susan Akrofi | Verlassene * Amtspersonen | Ziemliche Unmenschen, leider * Der Verschwundene | Angeblich Forscher * Frank Schirrmacher | Mitherausgeber einer Zeitung * Benjamin Diehl | Sohn verarschter Eltern * Laura Giarizzo | Biologin * Jan Imhof | Programmierer * Jan Arrah | Ein ganz anderer Jan als Jan Imhof, in einem ganz anderen Problem daheim * Jan von Plato | Noch ein anderer Jan, fleißig und klug wie die beiden übrigen * Xiaowei | Klontechniker * Namenlos | Total verkehrtes Leben * Edsger W. Dijkstra | Schutzpatron * Vera Ulitz | Schwer auffindbar nach den Wirren * Jeff Bezos | Geldheini * Jonas | Ein Mann, der eine Frau und einen Mann liebt * Michael Biehlau | Deutscher Soldat und depressiver Kriegsverbrecher * Shvaughn Erin | Polizistin * Rima Abadi | Junge Frau an der Brezeltheke * Constance Griffith | Amerikanische Informatikerin und Pädagogin * Kerim Balbay | Deutscher Ingenieur mit türkischen Großeltern * Kerims Schwester | Journalistin * Gregory Chaitin | Algorithmenmaus * Elektrizitas Pulsipher | Anfang einer Religion * Lady Gaga | Amerikanische Sängerin * Eva Papachristou | Hirnexpertin * Eine schiefe Tante | Sehr seltsam * Bettina | Für die Internationale unterwegs * Doris Achelwilm | Kritikerin * Felix Hausdorff | Ein anderes deutsches Genie * Kerven Tau | Verdächtige Nichtpräsenz * Terence Tao | So klug, dass es klingelt * Saskia Mählert | Studentin der Filmwissenschaften und tolle Kamerafrau * Georg Greiner | Besitzer und Geschäftsführer des Comicladens Superdoppelduper * Dietmar Dath | Unfertige Idee * A. H. Louie | Beziehungsexperte * Shoichi Toyabe | Entdecker ungeheuerlicher Dinge * Takahiro Sagawa | Noch so ein Entdecker * Natalie Merchant | Amerikanische Sängerin * Oyewusi | Versicherungsmathematiker und Selbstbetrüger, den kaum Schuld trifft * Hossein | Embryonenexperte * Ruth Barcan Marcus | Logikerin * David Hume | Aufklärer * Walter Dath | Gut im Mühlespielen * Ruth G. Millikan | Biosemantikerin * Ananke | Göttin mit Spindel * Maria | Freundin * Kassandra Meller | Komplett klar im Kopf * Cordula Späth | Musikmaus * Maj-Britt | Weitgehend unschuldig und von Michael Moorcock für ein anderes Buch erfunden * Tina | Wissenschaftlerin, glaubt aber an Ufos * Clemens J. Setz | Souffleur * Whisky und Whiskey | Zwei überwiegend gute Geister
Vollständigkeit ist weder versprochen noch angestrebt. Die Reihenfolge und überhaupt die Entscheidung über An- und Abwesenheit von Namen im Buch in dieser Liste folgt der geheimen, privaten Geschichte, deren öffentliche, durch gestaltende Eingriffe in eine erzählbare Chronologie gebrachte Fassung das Buch ist.
Gegenüber der zeitlichen Abfolge, den Personen-, Sach- und Tatverhältnissen der Wirklichkeit erlaubt sich das Buch auch sonst einige (nicht immer künstlerische) Freiheiten.
1
|Schmerz und Programm
Er isst nicht genug. Diejenigen, die ihn eingesperrt haben und bewachen, geben ihm kaum Essbares und sehr wenig Wasser. Die Arbeit, zu der sie ihn zwingen wollen, kann er nicht länger tun. Appetit hat er keinen mehr, aber immer schlimmeren Hunger. Er versteht genug von sich und seinen Zuständen, um Appetit und Hunger zu unterscheiden. Diese Klugheit nützt ihm nichts. Er weiß seit Tagen, dass er an seinem Hunger wird sterben müssen.
Der Magen tut ihm weh. Er spürt, wie seine Glieder schwächer werden. Oft ist ihm übel. Er weiß, dass das, wie die medizinische Wissenschaft sagt, von tonischen Kontraktionen des leeren Magens kommt. Er friert manchmal, dann ist ihm wieder fiebrig heiß. Die grob gemauerte Wand, auf die er seine gesunde Hand legt, ist kalt und feucht. Diese Kühle beruhigt ihn. Beruhigung schadet ihm. Auch das weiß er. Die Kühle ist blau wie kupfernes Erz, das er einmal in der Hand gehalten hat, vor Jahren. Sinne und Sinn des Gefangenen blühen ineinander wie Träume oder verkettete Lügen.
Das Eisenblau, das dem Gefangenen vor Augen steht wie ein übergroßes Straßenschild, sieht müde aus. Das schwache Licht, das es blau macht, verbietet ihm den Schlaf. Dieses Licht ist böses Flüstern von weit draußen her, durch alle Mauern. Es wohnt im Weltall. Dort ist es ein Brüllen. Da sind Sonnen und Ringe aus Gas, junge Feuer und alte. Sie alle spürt und sieht und hört der Gefangene hier, wenn auch nur als Gerücht und Echo der in sich selbst verdrehten Wahrnehmung von anderen Wahrnehmungen anderer Intelligenzen im Kosmos. Sie sind nicht menschlich; das macht nichts. Der Gefangene ist gewohnt, dass das, was zu ihm spricht, nicht menschlich ist.
Ein sumpfiger Planet spuckt Metalle ins All. Meine Brille weint deinen Tee. Ein Tieranatom streichelt nachdenklich die Schwungfedern des Eichelhähers.
Ein Fuchsblick blinkt wie ein Licht am Computer.
Das Ganze (die Stimmen, die Farben, die Überlegungen) könnte beginnender Wahnsinn sein, diese frierende und übernächtigte Wissensungeduld, die sogar Temperaturen sehen zu müssen meint. Oder es ist die Synästhesie eines Verstandes, der mit allen Mitteln darum kämpft, nicht zu zerfallen. Wahrscheinlich beides.
Obwohl man ihm fast alles Werkzeug seiner Forschung weggenommen hat, sieht der Gefangene sich noch als Wissenschaftler. Er kennt nicht nur sein Fach, sondern auch andere Wissenschaften. Seine eigene stellt ihre Versuche in seinem Kopf an, in anderen Köpfen und auf Papier, demnächst in Maschinen. Das andere Fach, das ihm sagt, was mit seinem Körper passiert, unternimmt Versuche lieber mit Hunden, auch mit Kaninchen, mit Meerschweinchen und Ratten. Manche der Forscher, denen der Hungrige sein Wissen über Hunger verdankt, haben an sich selbst experimentiert. Gestorben sind sie nicht, die Tiere, die sie zwangen, wie Menschen zu fasten, manchmal schon.
Der Hungrige weiß von den Beobachtungen der Forscher, dass einen Menschen der Hungertod, wenn man bescheidene Wasserversorgung voraussetzt, in siebzehn bis sechsundsiebzig Tagen ereilt. Wann genau das geschieht, hängt unter anderm von der Menge Fett ab, die im Leib zu Beginn der Hungerzeit vorhanden ist.
Was dem Gefangenen fehlt wie allen Hungernden ist ATP, Adenosintriphosphat, der Energieträger irdischen Lebens. Am Anfang der Qual verlor der Mann etwa zwei Wochen lang bis zu einem Kilogramm Biomasse am Tag. Inzwischen sind es noch zwei- bis dreihundert Gramm täglich. Alles in ihm hat sich verlangsamt, selbst das Sterben.
Fortwährend freilich büßt er Proteine ein. Die ersten Organe beginnen bereits zu versagen. Seinem Fettgewebe gehen mehr und mehr Triglyzeride ab. Wenigstens sein Hirn und seine Nerven erleiden bis jetzt keinen messbaren Gewichtsverlust. Der Körper tut für sie, was er kann. Der Gefangene ist dankbar dafür. Vom Hirn hat er, so lang er denken kann, gelebt.
Glukose und Ketonkörper werden dem Organ, das denkt, soweit noch möglich zugeführt. Der Körper hält das Denken, wie der Geist, für die Hauptsache. Aber der Herzmuskel schwächelt. Leber und Nieren verabschieden sich. Schlechter Blutdruck begünstigt Hungerödeme.
Das Immunsystem versagt.
Hunde, weiß der Gefangene, sterben spätestens nach achtunddreißig Tagen, Katzen nach zwanzig, Kaninchen nach fünfzehn, Meerschweinchen nach acht, Ratten nach zwei bis drei.
Der Gefangene verdankt anderen Forschern und Technikern so viel Wissen, dass er noch immer staunt, wenn er dran denkt. Andere wiederum verdanken ihm mehr.
Er hat mit Leuten, die das können, was er kann, nur schlechter, sehr weitgehend geklärt, wie sich wichtige Voraussetzungen und Regeln für Verknüpfungen von wahren Sätzen zueinander verhalten. Wäre diese Arbeit nicht getan worden, so wüsste man zum Beispiel nicht genau, wie und warum man rechnet; kaum genau genug jedenfalls, um diese Arbeit, das Rechnen, den Maschinen zu übergeben, die sie bald leisten werden.
Was dem Kopf des Gefangenen entsprungen ist, wird helfen, Computer zu programmieren. Von denen weiß er nichts. Es gibt noch keine. Er weiß von Beweisen.
In einem wichtigen ästhetischen, dann einem ethischen und endlich sogar einem gewissen wissenschaftlichen Sinn ist die bestmögliche Überprüfung eines Computerprogramms formal gesehen der Beweis der Richtigkeit des Beweises eines mathematischen Satzes, ein Beweisbeweis.
Dass du mit Wasser und Strom versorgt wirst, dass der Verkehr in deiner Stadt fließt, dass die Atomraketen, die auf deine Gegend zielen, und die Atomraketen, deren Silos in deiner Gegend untergebracht sind, nicht ohne Grund losfliegen, dass das System, in dessen Rahmen man alles Mögliche, was gebraucht wird, andauernd kauft und verkauft, nicht kollabiert: Diese Umstände stellen Programme sicher, von denen man ohne die riskante Probe, die man Wirklichkeit nennt, nicht durchaus wüsste, ob, wie und warum sie das alles überhaupt zur menschlichen Zufriedenheit tun können.
Sind es die richtigen Programme? Sind ihre von Menschen entwickelten Zweckbestimmungen korrekt? Ist das, was sie tun sollen, das Gute? Man kann’s nur hoffen. Aber es gibt eine genauso wichtige Frage, die sich leichter klären lässt als die, ob das, was sie tun sollen, gut ist, nämlich die Frage, ob sie das gut tun, was sie tun sollen. Das lässt sich prinzipiell ohne Test in der Wirklichkeit, rein im Kopf, auf Papier oder in einem Rechner überprüfen, seit der Gefangene und andere wie er ihre Arbeit getan haben. Die Sache hat mehrere Namen, einer ist »Curry-Howard-Lambek-Korrespondenz«, das meint eine Entsprechung zwischen »Typen« (Bestandteilen gewisser Programmiersprachen), Aussagen (in der Logik) und Objekten eines hinreichend genau definierten mathematischen Kosmos, einer »Kategorie«. Man kann die Typen als Sätze behandeln und Ausdrücke, die dies oder das in den Rechner setzen, als Beweise der Aussage, die zu den Typen gehören, und umgekehrt.
Ohne Leute wie Haskell Curry, William Alvin Howard, Joachim Lambek, ohne Leute wie Kurt Gödel, Alan Turing oder den Gefangenen dürften du und ich und all diejenigen, die später leben als der Hungrige, den Maschinen in einem sehr grundsätzlichen Sinn eigentlich nicht vertrauen, mit denen wir arbeiten, Handel treiben, Forschung, Politik und Kunst, mit denen wir Meinungen machen und sie verbreiten.
An einer davon schreibe ich, was du jetzt liest.
Vom Gefangenen, von seinem Tod und von seiner Arbeit wissen die meisten unter uns in unserer so stark von Computern abhängigen Gesellschaft nichts. Wenn man uns Nachgeborenen sagt, dass es da eine Geschichte zu erzählen gibt, davon, wie längst Verstorbene diesen Mann gequält und getötet haben, wenn man uns erzählt, dass es einen anderen gab, der ähnlich wichtig für uns bleibt und dem ebenfalls Grauenhaftes angetan wurde, und dass es weitere gab, nicht nur Männer, viele Menschen, die uns leichteres, wahreres, schöneres und schlimmeres Handeln, besseres Forschen, andere Kunst und Politik ermöglicht haben, dann verstehen wir diese Geschichten nicht.
Sie sind uns zu voraussetzungsreich, historisch wie sachlich.
1. Historisch: Der Gefangene ist in seine tödliche Lage geraten, weil einige unserer Vorfahren, zu denen er gehörte, unfassbare Scheiße im Kopf hatten. Diese Scheiße handelte von »Deutschlands Größe«, von der »arischen Rasse« und anderen in der Sache völlig uninteressanten und absolut unfruchtbaren, aber schwerst giftigen Ideen. Der Gefangene glaubte nicht übertrieben innig an dergleichen. Er widersetzte sich dem Zeug aber auch nicht stärker als die meisten seiner Landsleute. Er trat sogar in einen Verein von Arschlöchern namens Sturmabteilung ein, abgekürzt SA, weil er sich selbst einredete, dass man in »Deutschlands Größe« wohl gar nicht mehr zum Rechnen, Denken, Arbeiten kommen würde, wenn man nicht einem Arschlochverein angehörte, der die genannten Wahnideen mit Gewalt gegen zusehends Wehrlose propagierte und umsetzte. Die Scheiße, die jene Vorfahren glaubten, und die Scheiße, die sie anrichteten, genügte, so idiotisch undurchdacht sie war, für einen Weltkrieg und millionenfachen Mord.
Über diesen Zusammenhang kann man inzwischen ohne die Befangenheit reden, in der sich unsere überlebenden Vorfahren noch ein paar Jahre lang moralisch wanden, als die Katastrophe unmittelbar hinter ihnen lag. Es gibt heute, jetzt, hier, da ich dies schreibe, in dem Land, wo all das ausgebrütet wurde, immerhin eine Art Kultur, in der man das Gespräch darüber führt. Menschen machen ernste Gesichter und langweilen sich zumindest nicht offen dabei.
2. Sachlich: Fängt man unter kultivierten Personen, sagen wir: im Seminarraum an der Akademie oder auf dem Gang im vierten Stock bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, damit an, von der Arbeit des Gefangenen zu reden, gähnen die ersten bald. Die Ehrlicheren sagen, das sei alles zu schwierig, auch zu abstrakt. Man hört: »Du musst mir schon sagen, wie das jetzt genau mit den Computern zusammenhängt, damit mich das beeindruckt. Und du musst es sagen ohne Sätze wie: ›Ein algorithmischer Befehl ist eine Aussage, und im Kontext eines Programms steht jede derartige Aussage für die Absicht, eine bestimmte mathematische Konstruktion durchzuführen, die den entsprechenden Zweckbedingungen genügen soll, derart, dass die Überprüfung, ob der Satz hält, die Frage nach der Möglichkeit der Verwirklichung der betreffenden Konstruktion ist, also eine Beweisanforderung, weshalb man die Überprüfung des jeweiligen Computerprogramms leicht leisten kann, wenn man weiß, wie man diese Art Beweis formalisieren und überprüfen kann.‹ Du solltest auch auf Feststellungen verzichten wie: ›Wer Verfahren entwickelt, um Sätze zu beweisen, entwickelt damit immer zugleich Verfahren, die Leistung gewisser Programme zu prüfen, ohne sie ablaufen lassen zu müssen.‹ Wenn du sowas sagst, bist du mich los. Erkläre mir das Thema ohne Worte, ohne Gedanken und Satzkonstruktionen, die ich nicht kenne.«
Ein altes Dilemma: »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.«
Das kann ich nicht.
Will ich, statt das zu tun, was ich nicht kann, von der Tragödie erzählen, die in dem Abstand zwischen der historischen und der sachlichen Dimension des Themas ächzt, sagen fast alle, die ich darauf anspreche, Sachen der Art: »Um eine Tragödie zu erzählen, brauchst du eine große menschliche Geschichte. Das Große an ihr muss das Menschliche sein. Zur richtig großen Geschichte fehlt aber bei dem abstrakten Kram, den du da vorbringst, die Anschaulichkeit. Wo sind die Konflikte zwischen menschlichen Herzen? Die braucht man für das echte Drama, den richtigen Roman. Mach’s lieber als Essay, wenn dich so sehr interessiert, was der Gefangene gedacht hat. Denk dich halt rein in diese Gedanken, und vielleicht in die historischen Umstände, wenn du sie so wichtig findest. Du kannst sie mit dem Inhaltszeug ja irgendwie verflechten.«
»Abseitig«, sagt man mir, sei der Stoff, »verstiegen« das Thema.
So reden die Wohlmeinenden. Andere werden grob.
Mit »abseitig« meinen die Wohlmeinenden: Das, worum es hier geht, passiert am Rand dessen, was sie interessiert. Es stimmt. Wie stehen die meisten zu Wissenschaft und Technik, wenn sie nicht beruflich auf diesen Feldern beschäftigt sind? Wir schmarotzen blind und taub an nackten Resultaten. Wie man zu denen kommt, ist uns, sind wir nur ehrlich, egal.
Mit »verstiegen« meinen die Wohlmeinenden: Da wollen wir nicht hochklettern. Die Gipfel dessen, was der Kopf bauen kann, erschrecken uns. Im Schlamm ist es wärmer. Wir sind nicht so dumm, wie das klingt. Wir sind nur unfassbar verdorben.
Der Gefangene zittert beim Sterben. Er ist schwer erkältet. Eine seiner Hände kann er nicht mehr richtig bewegen. Sie ist zerbrochen, als man einen Stein dagegen warf. Der Werfer war ein Idiot. Davon gibt’s immer überall sehr viele.
Der spezielle Idiot mit dem Stein fühlt sich beim Werfen im Recht, weil Leute, die so sprechen wie der Gefangene, einen Ausrottungskrieg gegen Leute geführt haben, die so sprechen wie der Steinwerfer. Der Mann, der jetzt vor Hunger stirbt, ist kein Idiot.
Seine Geschichte lässt sich als Krimi erzählen. Er selbst hat etwas Ähnliches notiert, nicht über sein Leben, aber über seine Arbeit. Der genaue Wortlaut der betreffenden Notiz von seiner Hand bezieht sich auf ein Buch, das zu schreiben er sich vorgenommen hatte: »Spannend wie ein Kriminalroman!« Das rührende Ausrufezeichen gehört dazu.
Vieles, was seine Arbeit und sein Leben war, gerät in der Zeit zwischen seinem Hungertod und der ersten Ära der computerisierten Gesellschaft in Vergessenheit, einiges in den Keller, anderes auf Dachböden.
Das ist die Tragödie: Anstatt ein Buch – spannend wie ein Kriminalroman – zu schreiben, das der Gefangene im Frühjahr und Sommer 1939 plante, musste er im September seinen Dienst bei der Wehrmacht antreten. Für Verbrecher und Verrückte wurde er ein Krieger. Das hielt er nicht lange aus. 1942 brach er seelisch zusammen.
Leute, die seine Arbeit verstehen, sagen, danach habe er nichts mehr vollendet, das seinem Niveau gerecht wurde. Das heißt nicht, dass er überhaupt nicht mehr gearbeitet hat. 1945, in dem Jahr, in dem er hungert, bis er stirbt, ist er fünfunddreißig Jahre alt.
Zwei Mappen, »dünn« nach Auskunft des besten Kenners seiner Arbeit, eines holländischen Gelehrten mit dem schönen Namen Jan von Plato, fand man 1984.
Die Mappen enthalten Notizen aus den Jahren 1931 bis 1944.
Den Kriminalroman hat niemand zusammensetzen können. Das Buch, das hier anfängt, das Buch, das ich schreibe und das du jetzt liest, ist keiner.
In den Stoff und ins Thema geraten bin ich allerdings ganz so, wie in einigen Kriminalromanen ein Ermittler in einen Fall gezogen wird, nämlich unvorbereitet.
Es geschah auf einem Treffen am Zentrum für Kunst und Medien, ZKM, in Karlsruhe, einer Gedenkveranstaltung für den österreichischen Mathematiker Kurt Gödel. Der hat auf dem Forschungsfeld, dem der Gefangene bis zu seinem Tod diente, Ergebnisse erarbeitet, die vieles ermöglicht, aber auch vieles abgesperrt haben, das die Menschen angeht. Gerüchte von der Epochenwende, die damit eingeleitet war, raunt unsere dergestalt zur Welt gekommene Epoche bis heute in ihren Wissenschaften, ihrer Philosophie, sogar in ihrer Popkultur.
Die Veranstaltung zu Ehren Gödels in Karlsruhe fand am Sonntag, dem 06. Oktober des Jahres 2002 statt.
Ich hatte das Glück und die Ehre, einen der wenigen geistigen Erben Gödels kennenzulernen, den Amerikaner Gregory Chaitin, Schöpfer der von ihm selbst so getauften »Algorithmischen Informationstheorie«. Am Rand der Tagung durfte ich außerdem die Bekanntschaft eines anderen Informatikers und Mathematikers machen, der mir davon erzählte, wie Gödel zu seinen berühmten Beweisen der Existenz einer unausweichlichen Klemme für alle formalen Denk- und Schlusssysteme gelangt war.
Dabei erfuhr ich erstmals, was es mit einem Deutschen auf sich hatte, von dem Gödel gesagt haben soll, er halte jenen für einen besseren Logiker als sich selbst. Dieser Deutsche war der Mann, der im Prager Gefängnis verhungert ist. Ich dachte: Das will ich genauer wissen.
Ich erzählte meinem damaligen Chef Frank Schirrmacher davon. Er war seinerzeit der fürs Feuilleton zuständige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Als ich mit dem Erzählen fertig war, sagte er: »Schreiben Sie das so! Schreiben Sie auch das mit dem Krieg und dem Tod! Schreiben Sie’s mit dem Titel: Ein deutsches Genie verhungert im tschechischen Knast.«
Mein Chef wollte das in der Zeitung sehen, die er mitherausgab.
Er ist jetzt eine Weile tot. Ich werde nie wissen, was er zu diesem Buch sagen würde.
»Schreiben Sie das so«?
Ich schreibe es völlig anders, als er wohl wollte.
Alles, was dazugehört, kommt zwar vor, auch der Mann, der gesagt hat, ich sollte es »so« schreiben. Aber. Aber? Wie lautet der unheimlichste Satz in den Notizen des Gefangenen?
»Hier nur noch einiges vielleicht Verwendbare.«
2
|Zettel fallen lassen
Namenlos sitzt in einer Einkaufspassage auf orangefarbenem Kunstleder. Sie weiß nicht, wie sie hergekommen ist. Datum, Uhrzeit: Zu viele Koordinaten sind unterbestimmt. Was ist das für ein orangefarbenes Kunstleder?
Es gehört zu einer Sitzgruppe, die von freier Innenarchitektenhand locker um eine Art Riesentopf angeordnet wurde, als könnte das hübsch sein. Es ist nicht hübsch.
Aus dem Topf streben große, grüne, wächserne Blätter ins Kunstlicht. Sie sind Natur, wirken aber wie Plastik. Man hat sich das Arrangement als Freizeiterlaubnissignal gedacht: Hier sollen Menschen verschnaufen, die nicht mehr oder noch nicht wieder einkaufen können. Zwei Sitzplätze neben Namenlos sind leer, dann kommen rechts zwei weitere (»zweitere«, denkt Namenlos und wundert sich übers Wort). Auf denen sitzen junge Frauen.
Sie reden komisch über Komisches: »Ich hab’ mir ja jetzt die Wimpern nochmal verlängern lassen«, sagt die eine. »Du und nur ja, aber Hairdresser als Ausbildungsberuf gibt’s ja erst seit sieben Jahren«, sagt die andere, woraufhin die erste sagt: »Die Frau, die mich ausbildet, die ist über fünfzig, aber die hat null téchnique.«
Sie spricht das letzte Wort französisch aus. Namenlos merkt daran: Hier stimmt Grundsätzliches nicht. Was ist das, was nicht stimmt?
Meinen diese Frauen den Unsinn, den sie sagen, wirklich so, wie sie ihn sagen, und was hieße das? Oder ist es ein Spiel? Namenlos erinnert sich an ein Spiel.
Wann? Wo? Wie?
Beim Spielen, denkt sie, hat sich einer bei ihr beschwert. Das geschah in einem Hauptquartier von irgendetwas Wichtigem, wo Maschinen um Türme kreisten wie Vögel, am blauen Himmel, zwischen Wolken, die zwar distinkte Umrisse hatten, aber keine inneren Wölbungen, keine Grübchen, überhaupt keine Strukturen.
Wolken wie gestempelt.
Der Mann, der sich bei ihr beschwerte, was sagte der gleich?
Ach ja: »Du kannst jetzt aufhören.«
Dann, meint sie zu wissen, sagte er den Namen, den Namenlos damals trug und an den sie sich nicht erinnert. Nach diesem Namen fuhr er fort: »Ich habe dich eingeladen, damit du mit mir spielst, nicht, damit du mich vernichtest.«
Was war ihre Erwiderung gewesen? Sie weiß es noch, wenigstens ungefähr: »Ich bin nicht mit Aufgeben dahin gekommen, wo ich jetzt bin.«
Dann hat sie seinen Namen gesagt, richtig? Den weiß sie auch nicht mehr. Außerdem stimmt etwas nicht an dieser Erinnerung: »dahin, wo ich jetzt bin«, nein, das hieß anders, wie hieß das? Hatte sie da nicht ihren Job genannt, ihren Arbeitgeber auch, war dieses »dahin« nicht in Wirklichkeit ein Wort für eine soziale Position gewesen, oder, wie sagt man, ein Wort für einen … Ausbildungsberuf? Hairdresser?
Sie hört sich weitersprechen, damals: »Dabei ist dieses brutal alte Videospiel, das die Chefin gefunden hat, ja voll superniedlich. Du bist nur sauer, weil ich dich jetzt neunmal hintereinander besiegt habe.«
War das so, hat sie »die Chefin« gesagt? War da nicht ein weiterer Name genannt worden? Namen für Menschen: für sie selbst, den Mann, die Chefin. Alles weg.
Wenn Namenlos sich nur erinnern könnte.
Die Wimpernfrauen stehen auf und gehen. Ihr Geschwätz bleibt noch ein, zwei Minuten auf den Plätzen sitzen. Es glänzt. Es glotzt Namenlos an, die deshalb den Kopf nicht in diese Richtung zu drehen wagt. Sie erinnert sich an das Computerspiel, das sie auf Anhieb so gut spielen konnte, dass der Mann, dessen Namen sie, wie zu vieles, vergessen hat, neunmal das Nachsehen hatte: Das kleine gelbe Törtchenviech, das Punkte auf seinem Weg frisst, Punkte, aus denen dieser Weg besteht, und dann die bunten Monster, die es verfolgen, es sei denn … Es sei denn, das gelbe Viech frisst eine spezielle Sorte Punkte, dann kann es plötzlich die Monster verschlingen, die sonst umgekehrt sein Leben auslöschen wollen. Ein riesiger Bildschirm, größer als sie und der Mann zusammen, größer als das Schaufenster direkt gegenüber jetzt, mit dem blauen Geschirr und den anderen Haushaltswaren dahinter.
»Spiel nur weiter!«
Das hat der Mann damals erwidert, nicht? Und dann hat er noch einmal ihren Namen gesagt, nein, den anderen Namen, den der Chefin, nein, wieder anders, ja: »Erwähn’ diesen Namen mir gegenüber nicht.« Das war’s gewesen: eine Ermahnung. Aber danach kam wieder ein Name, als Anrede, der nämlich, den Namenlos damals hatte.
Hat sie ihn nicht immer noch? Sie hat ihn, nimmt sie an, aber eben: vergessen. Damals war ihre Antwort gewesen: »Reagierst du nicht ein bisschen zu heftig?« Dann sein Name, dann der Name der Chefin, dann: »Sie hat dich bei der Wahl, wer den Laden führen soll, nach den geltenden Regeln fair besiegt. Und du hast es abgelehnt, ihr Stellvertreter zu sein. Reicht dir das nicht? Es wird andere Wahlen geben.«
Brüsk hatte er erwidert: »Nicht für mich. Ich lass’ mich nicht mehr aufstellen.«
Namenlos verlässt das orange Kunstleder und sieht sich dabei nicht im Schaufenster, auf das sie zugeht.
Das liegt weder an den Augen noch am Glas. Es liegt an der Welt, an ihrer Beweisnot.
Namenlos trägt eine enge Jeans und knöchelhohe Turnschuhe, dazu ein kariertes, warmes Herrenhemd, darüber eine alte, hirschrote Lederjacke.
Namenlos greift sich an die Brust, in die Brusttasche am warmen Herrenhemd, unter der Jacke. Da ist was, da hat sie was vergessen. Schließlich findet sie es. Das braucht sie, denkt sie vage, das ist ein – was? Marschbefehl? Eine Karte? Eine Liste?
Es ist ein Zettel, kariert, aus einem Ringbuch gerissen.
Darauf steht in schwungvoller, weiblicher Schrift (vielleicht ihrer eigenen, denkt Namenlos, sie weiß es nicht, sie kennt ihre Schrift nicht mehr):
A body of art that contained nothing about the laws of electromagnetism, gravity, and quantum mechanics, nothing about the physical grounding of consciousness, and nothing about the process by which we’ve learned the rules that govern everything around us, would be like a body of art depicting present day earth that contained no mention of any human law or custom, no tension between the individual and society, and no representation of a city, a village, a forest or a river. Art that’s blind to the true landscape we inhabit – physical reality in the widest sense – is just absurdly, pathetically blinkered and myopic.
Darunter steht, in derselben Schrift, die Übersetzung:
Ein Kunstschaffen, in dem man nichts über die Gesetze des Elektromagnetismus, der Schwerkraft und der Quantenmechanik findet, nichts über die physischen Grundlagen des Bewusstseins und nichts über den Prozess, mittels dessen wir die Regeln gelernt haben, die alles um uns her regieren, wäre wie ein Kunstschaffen, das die gegenwärtige Erde darstellte, aber keine Erwähnung irgendeines menschlichen Gesetzes oder einer menschlichen Sitte enthielte, keine Spannung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, und keine Darstellung einer Stadt, eines Dorfes, eines Waldes oder eines Flusses. Kunst, die blind ist für die wahre Landschaft, die wir bewohnen – die physische Wirklichkeit im weitesten Sinne –, ist nichts als auf absurde, erbärmliche Weise scheuklappenbelastet und kurzsichtig.
Namenlos findet das, was da steht, nicht hilfreich. Sie zerknüllt den Zettel und lässt ihn zu Boden fallen. Dann verharrt sie da, wo sie starr steht, noch einmal gut fünf Minuten.
Endlich geht sie geradeaus, verkleidet als niemand, tief unerinnert, nirgendhin.
3
|So ähnlich sah Gerhard Gentzen mal aus
4
|Brezeln
Die junge Frau hat dunklere Haut als du, eine schlechtere Ausbildung und mehr Geschwister. Sie will hier nicht arbeiten, in dieser Einkaufspassage, keine zehn Schritte von der Sitzgruppe, auf der Namenlos vor fünfzehn Minuten (leider nur teilweise) zu sich gekommen ist. Die junge Frau hinter der Glastheke wäre lieber woanders. Sie hat es aber im deutschen Schulsystem nicht lange ausgehalten und daher nichts Besseres zum Geldverdienen gefunden als den Kettenbäcker.
Sie fragt: »Was willst du?«
Dir ist nicht recht, dass sie dich duzt. Du würdest auch von diesem Text lieber mit »Sie« angeredet. Schlimm genug, dass das Plakat auf der anderen Straßenseite plärrt: »DU! Bist anders als die anderen. Du verdienst was Besseres. Im yourfone-Shop auf yourfone. de nur 9,99 €/Monat.«
Es wird alles immer zudringlicher. Wildfremde Leute, die dich beruflich heimsuchen, schicken »ganz liebe Grüße«. Es wird alles immer brüllender, aber es lispelt dabei.
Du bestellst: »Eine Brezel, bitte.«
Der Haufen Brezeln auf den Holzlatten unter der Maschine ist ungleichmäßig gebacken. Einige Brezeln sehen hell aus, andere dunkler. Eine ist komplett verbrannt. Mit ihrem Greifer fischt die Frau ausgerechnet die verbrannte Brezel aus dem Haufen. Bevor sie das Ding in die Papiertüte fallen lässt, hast du die Wahl: Maulst du in dem Ton, in dem man Sklaven zurechtweist, über die blöde Brezel, dann wird die Frau den typischen Rassismus mühelos wiedererkennen, den sie von Leuten längst gewohnt ist, die aussehen wie du.
Woher weiß ich, dass du so aussiehst, wie du aussiehst? Ich weiß es nicht. Ich rate. Es ist Statistik. Wenn du selbst dunklere Haut hast als die Frau an der Theke, oder eine noch schlechtere Ausbildung, oder noch mehr Geschwister, dann habe ich mich geirrt. In dem Fall musst du dir beim Lesen vorstellen, du wärst eine Person, die aussieht wie die Leute, von denen die Frau hinter der Glastheke Rassismus gewohnt ist. Das Spiel heißt Identifikation. Es ist nicht ungefährlich. Wenn du über die Brezel maulst, weist du die Frau zurecht.
Nimmst du aber, falls du aussiehst wie diejenigen, von denen die Frau Rassismus gewohnt ist, einfach die Brezel, die du nicht willst, stumm an, dann behandelst du diese Frau wie ein defektes Gerät, mit dem man nicht reden kann.
Also?
5
|Eine Idee
Frühmorgens, am 21. Mai des Jahres 2018, um genau zwei Minuten nach sechs, steht eine siebenundzwanzigjährige Frau an einer ganz anderen Kettenbäckereitheke als derjenigen, um die es eben ging. Die andere Bäckerei, um die es jetzt geht, befindet sich im Berliner Bahnhof Friedrichstraße. Die Siebenundzwanzigjährige bestellt etwas, das wie »Mesbesess« klingt.
Sie bekommt eine Brezel. Sie wollte aber einen Espresso. Mit leicht verlegenem Lächeln korrigiert sie den Nuschelfehler: »Einen Espresso, Entschuldigung.«
Der Mann hinter der Theke lacht gutmütig. Er nickt und nimmt die Brezel zurück. Er heißt Kerim Balbay und ist in Berlin geboren, genau wie sein Vater. Dessen eigener Vater, Kerims Großvater, kam 1961 nahezu mittellos aus Ankara. Zurzeit denkt Kerim, der vier Jahre jünger ist als die Frau, der er den Espresso aufbrüht, darüber nach, den Job hier zu schmeißen und stattdessen »was mit Autos« zu probieren, wie er’s vor Jahren schon mal geplant hatte.
Was dazwischenkam, war ein Riegel in seinem Herzen, eine Sperre in seinem Kopf, ein Kummer seiner Familie.
Für Kerim schrumpfte die Welt schlagartig und schmerzlich zusammen, als sein Vater über Kerims Schwester Gericht hielt. Die Schwester hatte nichts Strafbares oder auch nur Dummes getan. Aber dem Vater ging ihr Handeln gegen die innersten Überzeugungen. Kerims Welt blieb danach jahrelang zu klein, zu eng. Kerim denkt nicht mehr oft an diese Geschichte. Aber die maue Stimmung spürt er noch, die sie ihm aufgezwungen hat, vor allem, wenn er allein ist mit seinen Gedanken.
Hätte Kerim die Mittel gehabt, den Riegel in seinem Herzen, die Sperre in seinem Kopf von einer Seelenärztin oder einem Gemütsmediziner untersuchen zu lassen, dann wäre die Verengung seines Möglichkeitssinns, die Schrumpfung seiner Welt, die maue Stimmung wohl als zeitweilige klinische Depression diagnostiziert worden.
Er hat sich selbst aus dieser Depression herausgearbeitet, soweit das ohne therapeutische Unterstützung ging. Es gelang ihm nur dank seiner Liebe zu Autos und allgemein zu Maschinen. Er hat seine seelische Verfassung mit regelmäßigen Besuchen bei Freunden aufgehellt, die ihre Autos auch dann reparieren, wenn die eigentlich nicht kaputt sind. Kerim lächelt die Frau an, deren Bestellung er zuerst nicht richtig verstanden hat.
Sie nickt und dankt. Die Frau heißt Eva Papachristou.
Sie kommt aus Athen und denkt gerade darüber nach, dass sie das wissenschaftliche Problem, dessen Lösung über ihren weiteren Berufsweg und damit vermutlich über ihr ganzes Leben entscheiden wird, nicht mehr, wie während der letzten vier Monate, nur als Frage mit einer simplen Binärantwort behandeln sollte. Ja oder Nein, diese beiden Wahlmöglichkeiten reichen nicht. Die Art Antwort, die man mit einem dieser beiden Wörter ausdrücken kann, ist, glaubt die Forscherin jetzt, gar nicht das, was sie sucht.
Stattdessen will sie die Schritte abzählen, die nötig sind, um bei der Frage, die sie beschäftigt wie eine anhaltende Magenverstimmung, zu jenem »Ja« oder »Nein« zu gelangen.
Eva Papachristou möchte eigentlich wissen, ob die kleinen neuronalen Feuerstöße in der lateralen Habenula, mit der sie und ihre beiden Berliner Kolleginnen sich auseinandersetzen, das Depressionsgeschehen in den untersuchten Gehirnen wirklich beeinflussen oder nicht, und wenn ja: in welcher Weise. Dass die das tun, war Evas Arbeitshypothese.
Eva arbeitet an einem Leiden, von dem Kerim einiges versteht.
Diese sachliche Nähe zueinander können beide nicht erkennen, weil ihnen wichtige Informationen fehlen. Wo Informationen fehlen, helfen der Wissenschaft Wahrscheinlichkeitskalküle. Eines davon stellt Eva Papachristou jetzt an, indem sie den Möglichkeitsraum ihres Problems erstmals als Kontinuum abzählbarer Abbildungsschritte auf einen abgefragten Zustand hin betrachtet.
Falls das Resultat der Überprüfung der Arbeitshypothese ganz sicher wahr ist und die Antwort folglich »Ja« lautet, dann braucht es keinen weiteren Schritt mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit genau »1«. Wenn die Hypothese nur beinahe stimmt, braucht man wenige Schritte, bis sie stimmt, und zwar desto weniger, je näher die Antwort »Ja« der Wahrheit kommt. Wenn hingegen die Antwort »Ja« auf die Frage »Stimmt die Arbeitshypothese?« falsch ist, braucht man unendlich viele Schritte, bis das stimmt, was dieses »Ja« bestätigt; dann ist die Wahrscheinlichkeit genau »0«.
Eva fällt ein Bild für diese Denkweise ein, das sie in London gelernt hat, vor drei Jahren, in einer anderen Forschungsgruppe als derjenigen, zu der sie inzwischen gehört.
An einer grünen Tafel stand eine Kollegin aus Austin in Texas, African American, hochgewachsen, mit wunderschönen, schlanken, schmalen Händen, und unterstrich gestisch jeden Gedanken ihrer Erklärung des Ansatzes, Wahrheitswerte an Wahrscheinlichkeitswerte zu binden: Okay, falls jemand schon auf dem Treppchen mit dem Metallgeländer ins Schwimmbecken steigt, braucht es wenige Schritte, bis die Frage »Schwimmt die Person?« mit »Ja« beantwortet werden kann. Wenn der betreffende Mensch sich aber gerade noch auf dem Rasen neben dem Becken auszieht, könnte es auch sein, dass er nur in der Sonne herumliegen will, und wenn dieselbe Person zum Beispiel tot ist oder nur ausgedacht, braucht es unendlich viele Schritte, bis sie schwimmt.
Treppchen.
Rasen.
Ausgedacht.
Schmale, schlanke, wunderschöne Hände.
Eva Papachristou bezahlt ihren Espresso und will kein Rückgeld. Sie probiert vorsichtig einen winzigen Schluck. Ihr Blick trifft noch einmal den von Kerim Balbay. Sie findet den Mann spontan sehr attraktiv. Dann fällt ihr unvermittelt Ruth Barcan Marcus ein und deren berühmte Möglichkeitsformel. Vieles fügt sich in diesem Moment ineinander.
Passt.
Ausgedacht.
Eine erfundene Person springt ins Becken und schwimmt. Wahrscheinlichkeit, Modalität, Hirnelektrochemie, Möglichkeit, Perspektive und das Vermögen oder Unvermögen depressiv Erkrankter, sich bestimmte Dinge vorzustellen oder nicht.
Eva denkt etwas Neues. Sie wird sich damit helfen, und vielen anderen.
6
|Seuchensteuerung und Selbstauskunft
Come down and waste away with me.
DAVE GROHL (1997)
Die Privatisierung hat inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass Deutschland heute mit der Zahl der privatisierten Krankenhausbetten an der Spitze der Welt steht, noch vor den USA. Krankenhausschließungen sind nichts anderes als Vernichtung von Gemeineigentum. Das geschieht völlig planlos, nicht nach Bedarf, sondern nach Bilanz. Krankenhausprivatisierungen sind Verschleuderung, und Dividenden sind Diebstahl von Gemeineigentum.
BERND HONTSCHIK (2020)
Erst wird einer krank. Dann noch einer. Dann erwischt’s eine, dann wieder einen. Noch einer folgt, noch eine, dann sind sogar ein paar mehr als fünf oder acht auf einmal dran.
Das alles passiert im Frühjahr 2020.
Es sperrt sich gegen ein Erzähltwerden in der Sprache, die dieses Buch hier sonst spricht, weil es nicht auf den Tag genau, nicht auf die Straße genau bestimmbar ist, was in diesem Buch sonst bei wichtigen Dingen zumindest versucht wird. Der Sachverhalt sitzt zitternd an einer stofflich ausgedünnten, unklaren Stelle der räumlichen und zeitlichen Koordinatenordnung dieser moralischen Erzählung.
Nichts Wildes geschieht eigentlich: Ein paar Körper werden krank und melden sich deswegen bei Amtspersonen, soll sagen, bei Individuen an den Keyboards und Keypads der sozialen Administration, bei Angestellten des Staates, die Geld verwalten, das der Allgemeinheit gehört. Von diesem Geld müssen einige der kranken Körper leben. Sie leben meist nicht gut, ob krank oder gesund.
Das liegt daran, dass diese Körper für das Geld, das in ihrer Welt alle Menschen beherrscht und das sie nach gewissen Leistungen bewertet, nur Schatten sind. Sie leben in hässlichen, graugelben Scheißwohnblocks, wo wenig sich abspielt, das legitimes Geld abwirft.
Man hat die ekelhaften Bauten größtenteils aus einem Verbundwerkstoff gemacht, der mit grobem Zeug verstärkt ist, das zwar Keramik heißt, aber ganz und gar nicht aussieht wie das schöne Geschirr, das andere Körper als die hier wohnhaften besitzen, andere Körper, die es besser haben. Verbundwerkstoff: Das bedeutet, aggregierte Partikel, Kies und Sand, werden mit Zement gebunden, chemische Reaktionen sorgen für Festigkeit, es ist auch eine Menge Wasser drin, wie in lebendigen Körpern, gesunden und kranken.
Der Werkstoff heißt Beton.
Die Körper, die dieses Zeug in der Nacht fast immer, oft auch am Tag einschließt, wissen im Normalfall nichts darüber, wie Beton gemacht wird, was Chemie ist, wieso sie krank oder gesund sind, wie Statistik funktioniert, in der ein kleiner Prozentsatz einer großen Zahl eine größere Zahl sein kann als ein großer Prozentsatz einer kleinen Zahl, wie Epidemie und Pandemie funktionieren und dass vor einigen Tausend Jahren ein Blitz in Kalk fuhr und damit, weil damals wache Leute den Vorgang beobachteten, eine Entwicklung in Gang setzte, an deren Ende die Menschen schließlich gelernt hatten, mit Beton zu bauen.
Außer den Körpern, die das alles nicht wissen, gibt es in der Situation, um die es hier geht, noch andere Körper, die in besseren Häusern mit hübscherer Einrichtung leben und, wie schon erwähnt, manchmal von schönem Geschirr essen. Diese anderen Körper sind, auch das ist bereits gesagt worden, besser weggekommen, und sie verachten die Leute in den Scheißwohnblocks. Letztere wissen allerdings etwas, das die besser Weggekommenen nicht wissen: Wie man sich durchschlägt, wenn man in den Beton sortiert wurde.
Sie schreien einander im Beton an, oder sie hocken berauscht drin, oder sie lungern davor und dazwischen. Das ist Überleben.
Sie nennen einander »Arschloch« und »Fettsau« und »Hure« und »Hurensohn«, sie rufen einander auf dem Spielplatz bei solchen Namen. Nicht immer tun sie das in deutscher Sprache, obwohl der Beton in Deutschland steht, in den sie einsortiert wurden. Sie beleidigen einander und sie beleidigen die besser weggekommenen Körper, die selten hier sind, ziemlich oft in anderen Sprachen, auch das ist Durchkommen.
Selbst die Amtspersonen werden von den verachteten Körpern beleidigt.
Indem sie die Amtspersonen beleidigen, können die verachteten Körper zum Ausdruck bringen, dass sie, wenn ihre bescheidene Wohlfahrt denn schon an den Amtspersonen hängt, wenn sie also von jenen schon gefüttert werden wie Haus- oder Nutztiere, immerhin doch eben mehr sind als bloße Körper, die von den Amtspersonen gezählt, geordnet, begutachtet, versorgt und abgetan werden können. Beleidigend melden die verachteten Körper den Amtspersonen ihren Anspruch darauf an, als Menschen wahr- und ernst genommen zu werden. Beleidigend, unter Verwünschungen, melden sie auch, dass einige von ihnen erkrankt sind.
Die Amtspersonen wiederum nehmen die beleidigend vorgetragenen Mitteilungen vom Fieber oder davon, dass eine nichts mehr riecht und einer nichts mehr schmeckt, zunächst keineswegs wichtig.
Die Amtspersonen hegen ein Misstrauen. Sie sind sich grundsätzlich nicht sicher, ob die Leute in den Scheißwohnblocks so wichtig genommen werden können, so wichtig genommen werden sollen oder so wichtig genommen werden dürfen wie Menschen sonst. Die Amtspersonen zweifeln zumindest indirekt daran, dass die Leute in den Scheißwohnblocks eigentlich Menschen sind. Von diesem merkwürdigen Bruch in der Wahrnehmung der Amtspersonen legen sie selbst sich nur eingeschränkt Rechenschaft ab. Das heißt, sie denken nicht bewusst, dass die Leute in den Scheißwohnblocks keine Menschen seien, sie behandeln sie nur, als wären es möglicherweise keine. Wann immer ihnen dämmert, dass sie das tun, legen sie sich die Sache so zurecht, dass das Ganze etwas mit Unterschieden zwischen ihnen einerseits und den Leuten in den Scheißwohnblocks andererseits zu tun hat, die man objektiv beobachten und benennen kann.
Die Amtspersonen denken zum Beispiel, dass die Leute in den Scheißwohnblocks andere Namen haben als ihre, dass diese Leute komische Namen haben, die nicht wie »Haberer« oder »Lutz« oder »Dath« oder »Gentzen« oder »Thienemann« klingen, sondern fremdartige, jedenfalls fremd für Leute, die eben »Haberer« oder »Lutz« oder »Dath« oder »Gentzen« oder »Thienemann« heißen und aus mehr oder weniger zufälligen Gründen gewohnt sind, sich eher für das Gesundsein oder die Krankheiten von Leuten zu interessieren, die auch so oder ähnlich heißen, als für den Gesundheitsstatus von Leuten wie denen in den Scheißwohnblocks.
Es hängt aber nicht restlos an den Namen.
Es gibt andere, genauso zufällige Kriterien. Das Glaubensleben und die Bräuche einiger der verachteten Körper etwa. Das kreist unter anderem um »Allah«, »Ramadan« oder »Familienehre«, statt, wie das Glaubensleben der Amtspersonen, um »Bausparvertrag«, »Pfingsturlaub« und »Ehegattensplitting«.
Die verachteten Körper ahnen, nachdem ihre Meldungen und Beleidigungen bei den Amtspersonen nur auf mäßiges Interesse stoßen, was sie nach dem Dafürhalten der Amtspersonen und der noch Mächtigeren, denen die Amtspersonen dienen, tun sollen, wenn sie erkranken: Sie sollen in ihren aus preisgünstigem Kunststein patzig hingestellten Scheißwohnblocks erst einmal abwarten, ob die Erkrankungen milde oder sensationell verlaufen, am besten still und, wenn sie wollen, von irgendwas berauscht.
Falls die Erkrankungen milde verlaufen, sollen die verachteten Körper sich nicht mehr melden. Falls die Erkrankungen sensationell verlaufen, sollen die verachteten Körper ruhig und bescheiden in diesen graugelben, aus preisgünstigem Kunststein aufgestellten Scheißwohnblocks am Fieber eingehen oder am Blut in der Lunge ersticken.
Das wollen sie aber nicht.
Sie beschimpfen die Amtspersonen also erneut und teilen zwischen den Beschimpfungen noch einmal mit, dass sie krank sind.
Die Amtspersonen wissen genauso wenig wie die kranken Körper, woraus man auf genau welche Weise den Kunststein macht, der die verachteten Körper, die jetzt krank sind, an leicht bewachbaren Orten zusammenfassen und festhalten soll. Sie wissen nicht, dass das Zeug billig ist, weil Kies und Sand wenig kosten, jedenfalls verglichen mit dem Portlandzement, der die eigentliche Pointe dieses Werkstoffs ist. Die Amtspersonen sind selbst vergleichsweise billig. Der Staat des Kapitals zahlt ihnen jedenfalls nicht genug, dass es sich für die Amtspersonen lohnen würde, sich mit Beton auszukennen, mit Epidemiologie, mit vergleichender Religionswissenschaft oder überhaupt mit irgend etwas außer der primitivsten Abspeisung und Überwachung verachteter Körper.
»Staat des Kapitals« ist keine linke Leerformel.
Der betreffende Staat und seine Amtspersonen sind konkret für die Sicherheit, die Bildung, die Gesundheit und überhaupt das Leben irgendwelcher Staatsbürger oder Gäste auf ihrem Hoheitsgebiet nur insoweit verantwortlich, als diese Verantwortung zum Zweck der Aufrichtung, der Pflege und des Erhalts einer Besitzordnung halt wahrgenommen werden muss, die unter anderem dazu führt, dass die Scheißwohnblocks aus hier in Rede stehenden Gebäuden in Göttingen einer Firma gehören, die vielleicht »Coreo AG« heißen könnte, ihren Sitz in Frankfurt am Main haben mag und sich über das Vorhandensein von möglichst vielen, gerade auch verachteten Körpern im Bannkreis der besagten Eigentumsordnung freuen dürfte, sofern diese Körper selbst kein Eigentum besitzen und sofern sich eine Firma freuen kann.
Wo sich viele um Lohnarbeit drängen, kann man sie schlecht bezahlen. Wo sogar so viele da sind, dass einige gar keine Lohnarbeit abkriegen oder, mit Gründen, keine haben wollen, dann aber von Almosen leben müssen, kann das Kapital auf deren perspektivloses Leben zeigen und denen, die immerhin eine Lohnarbeit abgekriegt haben, durch seine Medien ausrichten lassen: »Wollt ihr so vegetieren wie die?«
Allen, die das dann nicht wollen, kann das Kapital weniger zahlen, als es müsste, wo es nicht in der Lage wäre, ihnen mit dem Verweis auf das Los der Verachteten einen Schrecken einzujagen.
Wo sich viele um Wohnraum drängen, kann man für wenig Bequemlichkeit viel verlangen; wie bei den paar Hundert von der vielleicht in Frankfurt ansässigen Firma erworbenen sogenannten Mikroapartments in den Scheißwohnblocks, um die es hier geht, das heißt: Wohnungen mit jeweils nur ein oder zwei Räumen auf 17 bis 39 Quadratmetern.
Die Bauten, in denen man besagte Rattenlöcher findet, sind heruntergekommen.
Die Firma hat, hört man, mit dem Versprechen, diese Bauten zu sanieren, diverse Menschen daraus vertrieben, die sich, wie abzusehen war, die nach der avisierten Sanierung natürlich etwas höheren Mieten nicht mehr würden leisten können. Der Staat des Kapitals, hier in Gestalt der Stadtverwaltung, grummelte, sagt man, ein bisschen, als das ruchbar wurde, hielt kurz den Zeigefinger hoch, nein, so könne man das eigentlich nicht machen, siehe Verantwortung für Eigentum, stand doch in irgendeinem Dokument, einer Verfassung vielleicht.
Aber unternommen wurde nichts, so wenig wie später von den Amtspersonen, bei denen die verachteten Körper ihr Erkranktsein meldeten.
Weil der Staat des Kapitals den Amtspersonen nicht übertrieben viel bezahlt, wissen sie also, ich wiederhole, nicht erheblich mehr als die Kranken darüber, wie eine Epidemie funktioniert, wann so eine Epidemie eine Pandemie wird, welche Geschwindigkeiten und anderen Größen dabei eine Rolle spielen. Die Amtspersonen und die Kranken können beide nicht sagen, was die Inzidenz ist, nämlich die Zahl der jeweiligen Neuerkrankungen (hier zum Beispiel: der aus dem Beton gemeldeten Fälle) geteilt durch die mittlere Gesamtzahl der Bevölkerung (etwa der Stadt, zu der das Areal gehört, auf dem die Scheißwohnblocks stehen), und sie wissen auch nicht, was die Prävalenz ist, nämlich die Zahl der überhaupt Erkrankten geteilt durch die mittlere Gesamtzahl der Bevölkerung. Ebenfalls unbekannt ist ihnen, was man unter der Letalität versteht, nämlich die Zahl der an der jeweiligen Krankheit Gestorbenen geteilt durch die Zahl der ausgestandenen Erkrankungen. So kennen sie dann auch den Unterschied dieser Letalität zur Mortalität nicht, welche wiederum die Zahl der Gestorbenen geteilt durch die Gesamtzahl der Bevölkerung ist.
Sie werden sich aufgrund dieser umfassenden Unwissenheit natürlich niemals überlegen, dass die Mortalität folglich in etwa die Inzidenz multipliziert mit der Letalität ist, noch je zu der Überlegung Anlass finden, dass eine Krankheit, die nicht sehr tödlich, aber sehr ansteckend ist, genauso gefährlich sein kann wie eine, die zwar sehr tödlich, aber nicht ganz so ansteckend ist, vielleicht sogar gefährlicher als jene.
Ein kleiner Teil einer sehr großen Zahl kann eine größere absolute Zahl sein als ein großer Teil einer kleinen. Wen interessiert das? Nur Leute, die mit einem solchen Wissen und Denken etwas anfangen können, etwas unternehmen, für sich oder andere. Die verachteten Körper in den Scheißwohnblocks aber könnten rein gar nichts tun, wenn sie das alles wüssten.
Die Amtspersonen allerdings haben interessanterweise auch nicht viel mehr Handlungsfreiheit als die Verachteten. Es geht ihnen damit wie der übel beleumundeten Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die am Ende der Geschichte dieses Staates einerseits alles über alle wusste, vor allem über diejenigen, die wollten, dass dieser Staat kaputt gemacht werde, aber andererseits von Mächtigeren, darunter Amtspersonen aus der Sowjetunion, die es auch bald nicht mehr gab, dazu angehalten wurde, nicht viel Schreckliches mit diesem Wissen anzustellen – nichts jedenfalls, was die entsprechenden Kräfte bei der Umsetzung ihrer politischen Ideen hätte aufhalten können. Jener Staat sollte kaputtgehen, seine Macht war müde geworden, mürbe, brüchig, hohl. Er ging kaputt.
Die Amtspersonen in Göttingen sind noch besser beieinander. Sie werden, wir erinnern uns, nicht dafür bezahlt, irgend etwas von irgend etwas zu verstehen, außer davon, wie man verachtete Körper mit Almosen abspeist, wie man sie halbwegs in ihren Scheißwohnblocks festhält und ganz grob weiß, was sie so treiben.
Die Amtspersonen beschließen nach den beleidigenden Mitteilungen über die Erkrankungen, zweimal am Tag in den Scheißwohnblocks anzurufen und sich zu erkundigen, ob die Erkrankten entsprechend den einschlägigen Vorschriften schön in den Scheißwohnblocks bleiben, damit sie zum Beispiel keine weniger verachteten Körper anstecken können.
Was nicht stattfindet: Vernunftregelung, Kommunikation, Respekt, Anstand. Was stattdessen stattfindet: Gerüchtebildung, Angst, verschmierte Daten.
Es heißt, in den Betonbauten werde gefeiert.
Vom Fastenbrechen ist die Rede, von familiären Zusammenkünften auch.
Mehr Leute werden krank.
Einige Herrschaften, die an Bausparvertrag, Pfingsturlaub und Ehegattensplitting glauben, darunter Verwandte und Bekannte der Amtspersonen sowie Verwandte und Bekannte von Besitzenden in der Gegend, nämlich allerlei gehobenes Kleinbürgertum und lokale Winzigbourgeoisie, dazu auch demoralisierte und verhetzte Teile der Arbeiterklasse, fühlen sich von den erkrankten Körpern in den Betonbauten allmählich bedroht.
Sie sehen die Scheißwohnblocks jetzt als »Infektionsherde«, »Seuchenzentren«, potenzielle Leidensquellen für ihresgleichen.
Der soziale Friede, sprich: die reibungslose Durchführung der Produktions- und Reproduktionsweise in der bestehenden Besitzordnung, scheint bedroht.
Da endlich handelt der Staat des Kapitals. Er schickt Bewaffnete. Die sprechen Warnungen aus. Sie riegeln die zwei Scheißwohnblocks ab. Dafür werden sie, heißt es in gewissen Medien, mit Gemüse beworfen und mit Staubsaugerteilen, sogar mit Schuhen.
Einige der Kranken und Gesunden raufen sich angeblich mit den Bewaffneten. Die Medien kriegen etwas mit, machen Bilder und Töne davon. Sie versenden und archivieren diese Bilder und Töne, stellen sie online. Texte darüber werden gedruckt. Davon, wie die Kranken und Gesunden in den Scheißwohnblocks heißen, erfährt man da nichts, deshalb weiß ich es nicht. Ich kenne keine Leute in diesen Scheißwohnblocks. Sie heißen hier aus diesem Grund nur »Körper«.
Sie stehen mir fern, so fern, wie Leute mir stünden, die auf dem Mond wohnen. Ich kann sie nur sehen, wie man sie mir zeigt und erklärt. Alles, was ich über sie weiß, handelt von Unruhe, von Unvernunft.
Dabei war ich ihnen kurz vor Beginn der Sauerei räumlich sehr nah.
Ich hielt mich nämlich, bevor die ersten Leute in den Scheißwohnblocks erkrankten, ein paar Tage lang in Göttingen auf, um an einem Ritual teilzunehmen, das zur Kultur gehört, zum Literaturleben, wo man ans Lesen und Schreiben, ans Erzählen und Begründen, an freie und gebundene Rede glaubt wie in anderen bürgerlichen Sphären an Bausparvertrag, Pfingsturlaub und Ehegattensplitting.
Man hatte mich eingeladen, interessierten Leuten was von mir und meinem Zeug zu sagen. Das Ritual schien geeignet, meine Existenz als Schriftsteller zu bestätigen. Es nannte sich »Lichtenberg-Poetikvorlesung« und fand an zwei Abenden im Februar in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Ich stand da in fürstlicher Kulisse, mit Bildnissen toter Adliger in Öl rechts und links hinter mir, an einem Pult, bei einer Art Altar und sollte, nein, viel schlimmer: durfte erklären, was ich mache und wieso. Selbstauskunft war verlangt. Ich sprach also, um mich zu rechtfertigen, unter anderem über Angriffe anderer auf meine Arbeit, über Vorbilder wie Anne Garréta und Nicky Drayden, über meine vielen Fehler und darüber, dass ich seit Jahren zwei Bücher zu schreiben versuche, ein Sachbuch und ein Erzählbuch, die ich beide nicht bei ihren Titeln nannte (die sind geheim, bis diese Texte endlich funktionieren), sondern mit zwei Kürzeln zusammenfasste, zwei Buchstaben in eckigen Klammern – das Sachbuch kam in Göttingen als [A] vor, das Erzählbuch als [R].
Alles, was ich seit 2015 treibe, drückt sich mit viel Aufwand um [A] und [R]. Die beiden sind mir so wichtig, sie verlangen derart viel von mir, dass jede andere Mühe, jede andere Pflicht und jede andere Kür daneben Erholung sind.
Am zweiten Abend, als ich mit meinen Einwänden gegen die Kritik an meinem Zeug fertig war, sagte ich zum Publikum und zu den Ölbildern:
Falls es jetzt für Sie so aussieht, als hielte ich mich für die einzige Person, die ein Buch von mir verwerfen darf, und spräche allen andern Recht und Kenntnisse ab, die nötig sind, darüber zu urteilen, möchte ich diesen Eindruck korrigieren, mit der Offenlegung einer peinlichen Erfahrung.
Meinen Roman Dirac aus dem Jahr 2006 hat, Jahre nach der Veröffentlichung, ein Kritiker, dessen Urteil ich ernster nehme, als ich mein eigenes je nehmen könnte, weil er sich besser als irgendwer mit dem Genre auskennt, zu dem das Buch nach meinem Willen gehören soll, in unterrichteter Runde dafür getadelt, dass der Titelheld, der einem wirklichen Physiker nachempfunden ist, darin auf merkwürdige Weise figuriert: Sein Leben, fand der Kritiker, werde zwar mit hohem Aufwand poetisiert, aber seine tatsächliche Präsenz bleibe blass. Es stimmt. Eine Absicht steckt zwar dahinter, aber die hat sich dem Mann nicht erschlossen, und das ist meine Schuld.
Wenn Nicky Drayden im Anhang zu The Prey of Gods (2017) erklärt, das Buch arbeite mit Motiven einer Reise nach Südafrika, die sie unternommen habe, behandle aber nicht das Land selbst, sondern das Verhältnis der Autorin zu ihm, ist damit eine literarische Technik beschrieben, die man sehr behutsam einsetzen muss, weil sonst ein absichtliches Verschwimmenlassen von Konturen aussieht wie eine Unsicherheit beim Schreiben. Auf einem vagen Bild von Gerhard Richter erkennt man sofort, dass das Vage gewollter Effekt ist; bei einer dilettantischen Fotografie, die ein ungeübtes Auge angefertigt hat, erkennt man nichts dergleichen.
Viel hängt, musste ich lernen, von der Motivwahl ab.
Der von Drayden in The Prey of Gods gestaltete Stoff ist, wie eigentlich immer bei dieser Autorin, sehr sicher gewählt, den Zweck der Stoffwahl, die bei Dirac vorliegt, hat dagegen selbst ein Kenner ganz offensichtlich nicht gesehen.
Ich sitze unterm Eindruck dieser verdienten Schelte für Dirac derzeit an einem neuen Buch, das eine Art Seitenflügel zum [R]-Text werden soll.
Dieses Seitenflügelbuch verlangt von mir unter anderem, das Leben des Logikers Gerhard Gentzen zu gestalten, aber (wie damals bei Paul Dirac) nicht seine tatsächliche Präsenz. Ich hoffe sehr, dass bei diesem Buch klarer wird, was bei Dirac dem klügsten denkbaren Leser nicht klar wurde.
Aufgrund einiger Unterschiede zwischen der historischen Person Paul Adrien Maurice Dirac und der historischen Person Gerhard Gentzen bin ich leidlich zuversichtlich. Ob’s klappt, ist aber nur praktisch zu ermitteln.
Sachfehler, Namensfehler, Grammatikfehler, Stilsorgen, Formfehler, Kompositionsfehler, falsche Stoff- und Themenwahl, ungenügende Durchführung eigentlich stimmiger Ansätze, verkehrte Antworten auf schiefe Fragen – fast nichts davon, wie gesagt, hat je eine im Literaturbetrieb wirkende Kritikerin oder ein Kritiker gemerkt.
Diese Fachleute werfen den Texten lieber vor, dass sie etwas anderes behandeln als das, was ihresgleichen interessiert. Liegt es womöglich daran, dass sie das, was mich interessiert, gar nicht sehen? Gegenfrage an mich: Warum schreibe ich nicht über das, was sie interessiert? Sehr platt: Weil ich das nicht will und nicht muss.
Mein Glück besteht darin, dass (zumindest derzeit: noch) genug Leserinnen und Leser auf der Welt herumlaufen, die interessiert, was mich interessiert, um Verlage die Veröffentlichung nicht scheuen zu lassen.
Ich weiß: Es gibt literarische Texte, bei deren Abfassung man keine Mathefehler machen kann, weil keine Mathe drin vorkommt. Aber spätestens bei Texten, bei deren Abfassung man keine Grammatikfehler machen kann, weil keine Grammatik drin vorkommt, wird mir übel. Vielen nicht. Dafür gibt es Gründe.
Einer davon, um den derzeit viel kulturpessimistisches Theater veranstaltet wird, ist die Tatsache, dass Medien, die heute für eine wachsende Anzahl von Leuten das Schreiben und Lesen formatieren, gleichzeitig einerseits chaotisch (etwa jenseits von Rechtschreibung, Grammatik und Anstand) funktionieren, andererseits aber dieser Regelarmut zum Trotz keineswegs Maschinen der Freiheit und Entgrenzung, sondern Instrumente der Erzwingung von nie zuvor in solchem Umfang erlebtem Konformismus sind.
Alle auf Twitter sind originell bis zum Umkippen, aber jede und jeder dort klingen mehr nach Twitter als nach irgendeinem Subjekt. Das hat eine kurze, böse Vorgeschichte.
Erst kamen die Blogs. Das waren muffige Zelte aus alten Plastikfolien, in die einen jemand hineinrief, der einen neunteiligen Vortrag über den Zusammenhang zwischen Liebe und Syphilis halten wollte. Dann kam Facebook. Das war eine Hütte aus modrigen Brettern und Wellblech. Da stand einer drin, der fragte: »Willst du mit mir schlafen? Kann aber sein, du holst dir dabei die Syphilis.«
Dem folgte Youtube. Das waren Filmchen über Versuche an Menschen, die man mit der Syphilis infiziert hatte.
Und jetzt haben wir Twitter, das ist, wenn man angebrüllt wird: »Hier ist deine Syphilis, oder passt dir was nicht?«
Da soll man dann jubeln oder motzen.
Der Wert, den das Gemeinwesen einer schriftlich öffentlichen Äußerung unter den derzeitigen Medienbedingungen zumisst, ist einer auf Skalen der Ablehnung oder Zustimmung, jedenfalls der Aufmerksamkeit.
Argumentiert wird nicht: Klickfrequenz ist Werbenutzen ist Profit. Märkte für Texte gibt es schon länger. Jetzt aber rattert deren Spiel schneller, affektgesteuerter und effektversessener als je zuvor ab.
In Göttingen über den Roman Dirac zu reden, gerade in Göttingen damit zumindest indirekt auch über Paul Dirac zu reden, der diesem Roman den Titel und ein Gutteil Stoff vermacht hat, war eine seltsame Erfahrung. Dirac in Göttingen: eine Heimkehr. Hier hatte er studiert, der wirkliche Dirac.
Die Figur hatte mich ursprünglich fasziniert, weil dieser Physiker in den zu seiner Zeit zentralen, stark überhitzten Kämpfen um den epistemischen Gehalt seiner Wissenschaft keine Partei ergriff – er war der wohlbegründeten, aber damals von kaum einer anderen Größe der Disziplin geteilten Ansicht, man könne nur über Dinge streiten, die man weiß, nicht über solche, die man noch nicht weiß oder gar niemals wissen zu können vermutet.
Wissen?
Noch mal: Die Leute in den Scheißwohnblocks wissen nichts über Beton, Epidemiologie und Verwaltung, die Amtspersonen, die sie beaufsichtigen, wissen darüber auch nichts, und ich weiß im Grunde nicht viel mehr über die Leute in den Scheißwohnblocks und die Amtspersonen als irgendwer, inklusive diese beiden Gruppen selbst.
In der Physik muss, vermuten Kundige, zu Diracs Zeiten etwas kaputtgegangen sein, weshalb das Verhältnis zwischen Wissen und Streiten so in Schieflage geraten konnte, dass die völlig vernünftige Position, die Dirac bezog, dermaßen Minderheitenstandpunkt war.
In der Gesellschaft, die ich mit den Leuten in den Scheißwohnblocks und den für sie zuständigen Amtspersonen teile, ist das Verhältnis zwischen Wissen und Streiten, wie nicht nur die Quarantäneschweinerei zeigt, mindestens genauso schief, und auch hier scheint irgendwas kaputtgegangen.
Am Abend nach der zweiten und abschließenden Lichtenberg-Vorlesung fragte mich im Foyer des Prunksaals Janet Boatin, gute Freundin, kluge Germanistin und beim Göttinger Wallstein-Verlag beschäftigt, nach einer Bemerkung, die ich über Diracs Geist und den genius loci der Stadt gemacht hatte, ob das ein angenehmes oder unangenehmes Geisterheimsuchungsgefühl sei, von dem ich da redete. Ich besann mich kurz und sagte: »Ich bin ihm halt nicht gerecht geworden. Dem Mann. Dem Geist. Das Problem, um das es mir damals irgendwie ging, ist noch nicht fertiggedacht bei mir. Ich bräuchte vielleicht eine andere Figur für das alles, eine andere Trägergestalt, jemand, der … ein Wissen produziert hat, das noch weniger auf die Erfahrung, auf die Tatsachenwirklichkeit gerichtet ist oder scheint als das physikalische, ein Mathematiker, was weiß ich …«
Ich sprach dabei heimlich von einem neuen Anlauf, einem neuen Vorspiel, einer neuen Propädeutik für [A] und [R], ich sprach von Gerhard Gentzen und wollte nicht wissen, dass ich von alledem sprach.
Es ist immer dasselbe: Selbst die ganze Wahrheit ist allenfalls ein Teil der ganzen Wahrheit. Das ist ein Satz, der stimmt, nicht obwohl oder weil, sondern indem er nicht logisch ist.