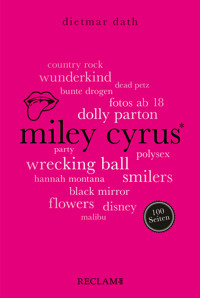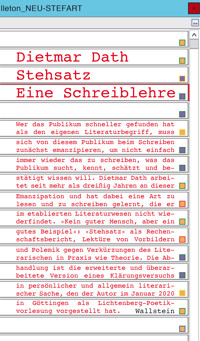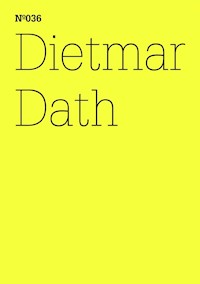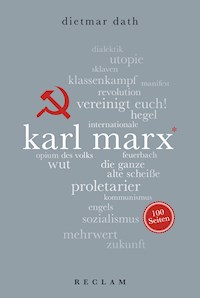6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
»Als Kind brauchte ich diese Figuren. Will ich sie heute wiedertreffen, kann ich mir aussuchen, in welchem ihrer Lebensabschnitte das geschehen soll: Meine Comic-Bibliothek hat Türen zu ihren schlechtesten und ihren besten Zeiten.« Meist maskierte Doppelexistenzen mit unglaublichen Muskeln und Kräften, die keine Angst kennen und nicht totzukriegen sind: das sind Superhelden. Es gibt sie schon lange: Superman, Batman, Wonder Woman, Black Widow, Die Fantastischen Vier, Cat Woman, Spiderman, Green Lantern, Hulk oder die X-Men (Superman etwa erblickte bereits 1938 das Licht der Welt). Seither schlagen sie ihre Fans gedruckt und im Kino in den Bann. Warum bedeutet »dieses Zeug« aber manchen Menschen so viel? Was macht die Faszination der Superhelden aus? Dietmar Dath sieht in ihnen Vergrößerungsgläser der populären Kunst, die Affekte, Emotionen, Phantasien übersteigern und verzerren, bis sie aussehen, als wären sie Tatsachen – und eigentlich sind sie das ja auch, so Dath, »nur eben solche, die im Kopf passieren.« Dath, der schon als Kind Großteile seines Taschengelds in den Erwerb von Superhelden-Comics steckte, betrachtet das Phänomen von verschiedensten Seiten, beleuchtet Herkunft, Entwicklung, Vermarktung und Verfilmung der Superhelden – und natürlich die Superschurken und Monster als Gegenspieler, die Besten der Bösen. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dietmar Dath
Superhelden. 100 Seiten
Reclam
»Eternally my story never goes as planned.
And it’s bigger than the man.«
Anthrax: Superhero
Für Polly Urethan
Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe:
www.reclam.de/100Seiten
2016 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Coverabbildung: FinePic®
Infografiken: Infographics Group GmbH
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2017
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961157-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020420-7
www.reclam.de
Inhalt
Vorab: Schule der Übermenschen
Wenn Erwachsene sich lange nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Abschluss der Pubertät wieder (oder immer noch) mit den erfundenen Gestalten beschäftigen, die ihre Fantasiewelten bevölkerten, als diese Erwachsenen Kinder und Jugendliche waren, dann behauptet das küchenpsychologische Klischee gern, der Reiz dieser Beschäftigung läge darin, dass jene Gestalten nicht altern. Sie bleiben sich treu, auf dem Papier oder in anderen Medien. Sie bewahren unsere kindliche Energie, Begeisterungsfähigkeit und Naivität als externe Festplattenspeicher des Herzens. Sie heben das Staunen für uns auf, den Ehrgeiz der frühesten Welterschließung als Weltverwandlung, die vielgestaltigen Hoffnungen.
Das Klischee klingt triftig.
Bei mir stimmt es aber nicht.
Meine Kinderidole sind nicht jung geblieben. Die Lebenserfahrung hat sie nicht geschont: Batman war inzwischen mehrfach in Rente, außerdem unter anderem tot und querschnittsgelähmt. Superman hat geheiratet, Spider-Man auch. Die X-Men sind nicht wiederzuerkennen, Green Lantern hat im Zustand geistig-moralischer Verwirrtheit schwere Verbrechen begangen, die Avengers hatten mehr Vorsitzende als die KPdSU (die es im Gegensatz zu den Avengers nicht mehr gibt).
Das alles ist dokumentiert, in Comics, Büchern, Filmen, durch mehrere Datenträgerwechsel hindurch – auch die Medien nämlich, die das alles festhalten sollten, sind nicht dieselben geblieben.
Superheldinnen und Superhelden haben also seit den 1970er Jahren ärgere Wandlungen und schlimmere Niederlagen erlebt als der Erwachsene, der ich geworden bin. Als Kind brauchte ich diese Figuren, als Jugendlicher mochte ich sie, dann habe ich sie eine Weile vergessen. Will ich sie heute wiedertreffen, kann ich mir aussuchen, in welchem ihrer Lebensabschnitte das geschehen soll: Meine Comic-Bibliothek hat Türen zu ihren schlechtesten und ihren besten Zeiten. Und wenn das nicht reicht, kann ich ins Kino gehen, den Fernseher einschalten, im Netz kramen oder einen Datenträger in irgendeinen Player legen. Die Lebensläufe dieser Leute, die es nie gegeben hat, sind Menüs für mich geworden: Ich kenne sie als übermütige Kinder, launische Jugendliche, widersprüchliche Erwachsene oder tapfere Greisinnen und Greise.
Selbst einer, von dem der Comic-Kanon sagt, dass er sehr viel langsamer altert als die meisten Lebewesen, der Mutant Wolverine, der sich bereits im Zweiten Weltkrieg bewähren konnte, noch in ferner Zukunft seine grässlichen Zigarren schmauchen wird und im Kino das Gesicht von Hugh Jackman hat, ist mir im Seniorenstand begegnet; sogar in mehreren Varianten, von Chris Claremonts Days of Future Past (Zukunft ist Vergangenheit, 1981) bis zu Mark Millars Old Man Logan (2008).
Ich habe trotzdem nicht vergessen, wie das alles am Anfang war. Auf dem Spielplatz hielten wir die Superheldinnen und Superhelden wirklich für unveränderlich, unsterblich, unverwüstlich – und uns selbst gleich mit, denn die angemessene Form der ersten Liebe zu solchen Gestalten ist die der Identifikation. Wir kannten sie besser als einander, das heißt: Wir teilten sogar Geheimnisse mit ihnen, zum Beispiel die berühmten »Secret Identities«, die Wahrheit über das Doppelleben, das viele dieser Figuren führten – der gehbehinderte Arzt Donald Blake ist »in Wirklichkeit« der nordische Donnergott Thor, der verklemmte Zeitungsjournalist Clark Kent ist der unzerstörbare Superman. Weil wir Kinder waren, die von sich wussten, dass man ihnen äußerlich nicht ansehen konnte, was alles in ihnen steckte, leuchtete uns unmittelbar ein, dass die farbenprächtige und mächtige Seite dieser Leute, das, was man nicht übersehen konnte, wenn es sich enthüllte, ihr Eigentliches war, nicht die schäbige Hülle des Allzumenschlichen, in der sie doch vermutlich mehr Zeit verbrachten, ja, Tag für Tag fristen mussten, wie man eine Gefängnisstrafe absitzt. Was Kindern eine Wahrheit der Hoffnung darauf bedeutet, wer sie einmal werden können, ist für erwachsene Leserinnen und Leser solcher Comics aber zugleich ein großes Gleichnis auf das Subjekt-Selbstempfinden moderner Menschen allgemein: Weil ihr öffentliches Wesen rechtlich und politisch allen anderen gleichgestellt ist, also »nichts Besonderes« mehr, nicht von Geburt an wichtig wie bei den Adligen der vormodernen Zeit (deren Wappen in den Insignien der Superhelden, dem großen »S« oder der Fledermaus-Ikone weiterleben), müssen sie umso mehr Wert auf ihr reiches Innenleben legen. In diesem Sinn war Petrarca im 14. Jahrhundert der erste Superheld, denn der Verfasser von »Secretum Meum« entwickelte in diesem Werk die Anschauung, der nichtssagende Alltagsmensch könnte Hülle für etwas Ungeheuerliches sein (für einen Superdichter und Superphilosophen etwa), so wirkungsvoll, dass noch heute die über unsere modernen und nachmodernen Tiefenpsychologien vermittelten Reste davon den Menschen, nicht nur den Kindern, ein bisschen narzisstische Spannung zurückgeben für die Strapazen der formellen Gleichheit in modernen Gemeinwesen.
An irgendetwas ablesen können, so schlau waren wir Kinder allerdings schon, sollte man aber eben doch, wer wir eigentlich waren, in unseren Menschenmasken. Man steckte sich also das Taschenmesser, ein Pelikan-Tramp-Minibuch für eine Mark, die Lupe und zwei Kugelschreiber in den Hosenbund, weil Batman einen Multifunktionsgürtel hat, in dem er Sprengstoff, Fingerabdruckpulver und einen zusammengefalteten Hubschrauber aufbewahrt. Sollte ein anderes Kind behaupten, Thor sei stärker als der Hulk, wurde gestritten, erbitterter als später jemals über Politik.
Wollten die Erwachsenen wissen, warum man sich nicht für Fußballsammelbildchen begeisterte, sondern das Taschengeld lieber zuerst für Superman und Batman ausgab, wenig später dann für alles, was Marvel hieß, musste man ihnen beibringen, wie man Comics überhaupt richtig liest: Hier, mit diesem Hochformat links oben musst du anfangen, dann geht’s da diagonal südöstlich weiter, nein, nicht einfach nach rechts, und diese gegenüberliegende Seite musst du sogar kippen, die ist nämlich quer gemeint.
Vor allem der Zeichner Neal Adams hat es Laien vor lauter Layout-Experimentier-Furor damals manchmal wirklich schwer gemacht. Noch heute gehört, weil ich als Kind der 1970er bei Adams in die Sehschule gegangen bin, mein größter Respekt Künstlerinnen und Künstlern, die sich selbst bei den wildesten Bildmontagen auf souveräne Blicklenkung verstehen (bei Dave Sim zum Beispiel, einem engagierten Adams-Schüler, weiß man jederzeit, wo man sich gerade befindet und wo es weitergeht, selbst wenn das, was da jeweils erzählt werden soll, vom Wahnsinn mehr als nur gestreift ist).
Im Sommer 1982 besuchte ich zum ersten Mal die Vereinigten Staaten. Mein Anfängerenglisch und ich hatten mehr Glück als Verstand, wir waren nämlich zur rechten Zeit am rechten Ort: Chris Claremont, damals leitender Autor der Marvel-Heftserie Uncanny X-Men, befand sich auf dem Höhepunkt einer Kampagne zur Umwertung aller Werte im Kosmos jener Gruppe von Mutanten, die eine Welt beschützt, von der sie gehasst und gefürchtet wird.
Mr. X-Men Chris Claremont (* 1950), hier an der Columbia University 2014.
Im vorangegangenen Jahr erst hatte er die Fans mit der Enthüllung schockiert, einer der gefährlichsten Gegner der Gefolgschaft des edlen Professors Charles Xavier, der radikale Menschenfeind und »Master of Magnetism« Magneto, habe sich keineswegs aus Lust und Laune zu seinem Partisanenkrieg gegen die Menschheit entschlossen. Denn wir, die Angehörigen der Gattung Homo sapiens, diskriminieren und verfolgen bei Claremont die Mutanten, und Magneto ist nur deshalb Terrorist geworden, weil er schon einmal hat erleben müssen, wie eine Gemeinschaft, zu der er gehört, ausgegrenzt, unterdrückt und schließlich mit Ausrottung bedroht worden war. Magneto, Erik Magnus Lensherr, ist bei Claremont nämlich ein Überlebender der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten.
Diese Enthüllung war ein Tiefschlag gegen die moralische Sandkastengewissheit, in der die Bösen von Anfang an und von Grund auf böse waren und die Guten unbedingt gut. Es sollte nicht der letzte derartige Schlag bleiben – bald würde man heranwachsenden Comicfans erzählen, dass symmetrisch zum Leiden des Bösen am Unrecht, das ihm geschehen ist, auch ein Held imstande ist, die eigene Rechtschaffenheit zu verletzten. Ausgerechnet der standhafte Verbrecherjäger Batman entpuppte sich ab Februar 1986 in Frank Millers The Dark Knight Returns (Die Rückkehr des Dunklen Ritters) als autoritärer Psychopath, und Superman verabschiedete sich im September desselben Jahres in Alan Moores Whatever happened to the Man of Tomorrow (Was wurde aus dem Mann von Morgen) von seiner langen Laufbahn als tadelloser Verteidiger von »truth, justice and the American Way« mit dem Bruch des Tötungsverbots, das er sich als Hauptgrundsatz des eigenen Ehrverständnisses Jahrzehnte früher auferlegt hatte.
Anzahl der Personen, die der Marvel-Gangsterjäger The Punisher seit seinem ersten Auftritt 1974 in Comics und Filmen absichtlich umgebracht hat:
Etwa 49 000
Anzahl der Personen, die Superman bis zur »letzten Superman-Geschichte«, die Alan Moore als Zukunftsszenario 1986 unter dem Titel Whatever happened to the man of tomorrow (Was wurde aus dem Mann von Morgen) veröffentlichte, absichtlich umgebracht hat:
1
An Claremonts X-Men freilich faszinierte weit mehr als nur der Dammbruch im sittlichen Erzählgefüge. Nicht nur das, was dieser Autor inhaltlich vorbrachte, sondern auch die Art, wie er seine Figuren inszenierte, stieß Gewohntes um. Es gab bei ihm mehr Dialoge als anderswo, und in manchen Monaten standen nicht mehr die Kämpfe der Guten wider die Bösen im Heftmittelpunkt, sondern deren private Beziehungen und Sorgen, Freundschaften und Liebesnöte.
Beim Lesen fiel mir in Miami auf, dass diese Geschichten mehr mit meinem deutschen Schüleralltag zu tun hatten, als ich aus Comics bis dahin gewohnt war: Die Eifersüchteleien, einander abwechselnde Phasen von Hochstimmung und Niedergeschlagenheit, die Cliquen, zusammengewürfelt aus grundverschiedenen Individuen, das Gefühl, man werde von den Erwachsenen nicht verstanden (»fighting for a world that fears and hates them«), die Auflehnung gegen deren Ordnung … Die X-Men, das waren wir.
Natürlich entgingen mir die Unterschiede nicht: Niemand von uns konnte fliegen, durch Wände gehen, Gedanken lesen, Dinge willkürlich in Brand stecken oder gefrieren lassen. Aber die Parallelen zwischen Claremonts Kitty Pryde und der wirklichen Stefanie, zwischen Claremonts Ororo Munroe und der wirklichen Claudia, zwischen Claremonts Rogue und der wirklichen Cathrin waren eben auch nicht zu übersehen – sicher, Kurzschlüsse, aber eben: zündende.
Ich habe also bei Claremont gelernt, wie man menschliche Kleinigkeiten im Vergrößerungsglas von Heldengeschichten studiert, und konnte bei meinen ersten eigenen Erzähltextversuchen die Leute, die ich in meiner Umgebung fand, daher nicht nur in allerlei Abenteuer werfen, die sie von ihren besten und schlimmsten Seiten zeigten, sondern wusste auch, was das überhaupt ist: Figuren, Charaktere.
Von Menschen zu erzählen, verlangt Aufmerksamkeit für leicht fassliche, einprägsame Typenzüge einerseits, für etwas unverletzlich Eigenes, Besonderes andererseits. Wer jemand wirklich ist, zeigt sich am deutlichsten unter Beschuss, im Feuer, in Not. Die zweite Lektion, die ich Chris Claremont verdanke, ist die Einsicht, dass Übertreibung nicht notwendig im Gegensatz zur Auseinandersetzung mit der (vor allem sozialen und psychologischen, also menschlichen) Wirklichkeit steht, sondern sie gegenüber der planen Abschrift des Vorhandenen entscheidend verbessern kann.
Will man nämlich eine soziale und psychologische, also von Menschen gemachte, nicht einfach nur natürliche Wirklichkeit schildern, dann spielt nicht nur das eine Rolle, was diese Menschen sind und tun, sondern auch das, was sie sich dabei vorstellen: Manchmal fühlt man sich eben, als könnte man fliegen oder die Gedanken der anderen lesen (gerade dann, wenn man das gar nicht will). Manchmal fühlt man sich, als wäre man vereist oder stünde in Flammen, als wäre man unsichtbar oder tonnenschwer.
Die Vergrößerungsgläser der populären Kunst übersteigern und verzerren Affekte, Emotionen, Fantasien, bis sie aussehen, als wären sie Tatsachen, aber der Witz daran ist: Es sind ja wirklich Tatsachen, nur eben solche, die im Kopf passieren und sich von außen nicht ohne Weiteres messen lassen.
Das bedeutet keineswegs, dass sie der Wertung oder dem Urteil entzogen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel deutlich, wie ich Anfang der 1990er mit einem Freund auf einer Bank vor einem alten Bauernhaus im Umland von Freiburg saß und wir uns eine ganze Nacht lang darüber unterhielten, welche klassische X-Men-Story aus der Claremont-Ära wohl die beste sei, und aus welchen Gründen: Die Dark Phoenix Saga, weil sie so traurig endet? Asgardian Wars, der gigantischen Kulissen wegen? Days of Future Past (Zukunft ist Vergangenheit), weil der Meister hier lupenreine Science-Fiction geschaffen hat? Oder doch The Trial of Magneto, wegen der scheinbar anstrengungslos in einer Actionerzählung integrierten Auseinandersetzung mit politischen Zeitfragen?
Spätestens gegen drei Uhr morgens entglitt den beiden, die da diskutierten, jeder Vorwand der objektiven Debatte über technische, also schriftstellerische und visuelle Vorzüge des in Rede stehenden Materials, und wir redeten einfach wie Fans: Wir waren, stellte sich heraus, zehn Jahre früher unabhängig voneinander eine Weile in Kitty Pryde verknallt gewesen, und fragten uns, wie das möglich war – der Freund wunderte sich schließlich: »Wenn es wenigstens ein Film wäre, das könnte man ja noch nachvollziehen, da liegt es dann halt an der Schauspielerin. Aber Kitty Pryde als Comicfigur, die sieht ja nicht mal immer gleich aus, je nachdem, wer sie zeichnet. Wie kann man sich in so jemanden verlieben?«
Weitere 20 Jahre nach dieser Unterhaltung saß ich 2014 in einer Frankfurter Pressevorführung von Bryan Singers X-Men: Days of Future Past (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit) und sah Kitty Pryde, das heißt: Ellen Page als Kitty Pryde, auf der Kino-Riesenleinwand, und dachte: Ja, das ist sie.
Es war, als träfe man einen Menschen wieder, den man einmal gut gekannt hat – die eigentümliche Mischung aus Rührung, Irritation und Befremden zu beschreiben, ist fast unmöglich; es müsste ein Aufsatz dabei herauskommen, der sich mit Sigmund Freuds Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis von 1936 messen könnte.
Ich schreibe ihn nicht. Das vorliegende Bändchen versucht stattdessen, zumindest den Umriss einer Antwort auf eine dem geschilderten Problem eng verwandte Frage zu skizzieren: Warum bedeutet dieses Zeug manchen Menschen so viel?
Um ihr näherzukommen, muss natürlich zuerst eine andere beantwortet werden: Was ist dieses Zeug überhaupt für Zeug?