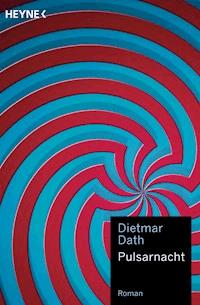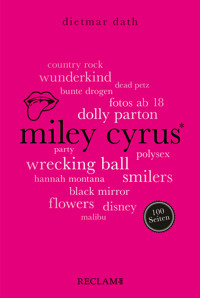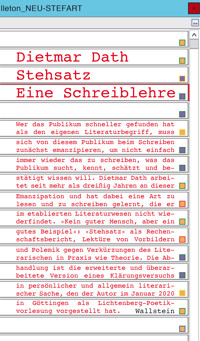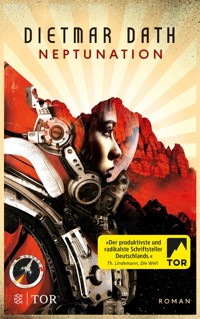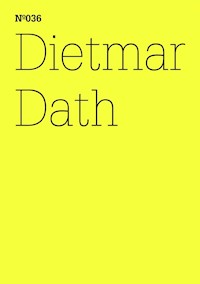9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft in Flammen – der Roman einer großen politischen Feuerprobe für die Menschheit unserer Epoche Überall ist Politik. Sechs Menschen werden zusammengerufen, um zur Sonne zu reisen: eine Schülerin, ein Koch, ein Finanzberater, eine Mathematikerin, ein Gitarrist und eine Pianistin. Sie erfahren, dass es dort eine Zivilisation gibt, die anders ist als alles, was Menschen kennen. Mit neuen Körpern sollen sie drei große Aufgaben bewältigen und geraten dabei zwischen die Fronten eines gewaltigen Konflikts. »Der Schnitt durch die Sonne« steht in der Tradition von H.G. Wells, Stanislaw Lem und Arno Schmidt. Ein abenteuerlicher, philosophischer und politischer Roman, der sich den drängenden Fragen unserer Gegenwart stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dietmar Dath
Der Schnitt durch die Sonne
Roman
Über dieses Buch
Überall ist Politik. Sechs Menschen werden zusammengerufen, um zur Sonne zu reisen: eine Schülerin, ein Koch, ein Finanzberater, eine Mathematikerin, ein Gitarrist und eine Pianistin. Sie erfahren, dass es dort eine Zivilisation gibt, die anders ist als alles, was Menschen kennen. Mit neuen Körpern sollen sie drei große Aufgaben bewältigen und geraten dabei zwischen die Fronten eines gewaltigen Konflikts. »Der Schnitt durch die Sonne« steht in der Tradition von H.G. Wells, Stanisław Lem und Arno Schmidt. Ein abenteuerlicher, philosophischer und politischer Roman, der sich den drängenden Fragen unserer Gegenwart stellt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS - Visuelle Kommunikation, Münster
Coverabbildung: Wedemeyer-Böhm et al. (2012)
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490462-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
I. Hier
Erste Aufgabe
Entführung
Sendungen
Konfrontation
Fälscher
Nebelgitarre
Bestimmung und Auswahl
Entrückung
II. Dort
Zweite Aufgabe
Ankunft in Wellen
Hausgast
Leben in Kantennähe
Sternenküche
Geschmackssinn
Mensch und Modell
Veras Voraussicht
Im Ungeheuer
Schwimmen
III. Dort und Hier
Dritte Aufgabe
Entfremdung
Lebensecho
Gefängnis
Absturz
Böse Lösung
Widerstand
Angriff
Unterredung
Stolpern
Ermittlungen
Dinner
Geflecht
Tines Bitte
Ein Brief
Zum Gedächtnis
Noch ein Brief
Die Tiere
Dank
for A.T. – lifting me higher
unser neues europäisches kommunistisches manifest
wird also offenbar sein ein analytisches rechnendes
bilderbuch mit musik.
Christian Geissler
makkura de akari mo nai kuzure kaketa kono michi de
aru hazu mo nai ano toki no kibou ga mieta kiga shita
Supercell
I.Hier
I never watch the stars, there’s so much down here.
Lorde
Erste Aufgabe
Denk dir:
Du spürst nur deine rechte Hand. Du bist blind und taub.
Leute mit Namen wie Vo und Gro haben in dein Hirn gegriffen. Sie haben es verändert, mit Nadeln, Elektromagnetismus, Schall und bitterem Geschmack, als Licht verkleidet. Dein Orientierungssinn schweigt.
Du spürst nicht, wohin deine Körpermasse will; ob der Rücken oben ist oder die Brust. Die rechte Hand ist dein ganzer Leib geworden.
Du erkennst, dass diese Hand eine andere hält. Deine Finger sind fest um Handballen und Handrücken der anderen Hand geschlossen. Ihre Finger sind ebenso fest um deine Hand geschlossen. Zwei ringen hier.
Du weißt, dass beide überm weit geöffneten Maul hängen, dem Tod. Die obere in ein Gerüst gespannt, die untere an der oberen, zusammen sind sie zu schwer für die Aufhängung, sie wird brechen.
Tief unten wühlen bauchig verbeulte, mehrdimensionale Schatten einander in den Innereien. Nichts ängstigt sie. In ihrer Mitte wälzt sich ein Ungeheuer, verlagert seine Falten träge, brüllt.
Es heißt Einhundertsechsundneunzigtausendachthundertdreiundachtzig.
Ihr beide, überm Abgrund, macht ihm Appetit.
Die obere Hand muss die untere loswerden.
Die untere muss sich festhalten, auf die Gefahr hin, dass beide fallen.
Du weißt nicht, welche du bist.
Lässt du los? Drückst du fester zu?
In dieser Lage lebt man auf der Sonne.
Entführung
Schritt für Schritt, blind, fügsam, müde.
Der Gefangene denkt an seinen Hund. Was für Menschen sind das, die einem schuldlosen Tier das Genick brechen, um den Halter einzuschüchtern?
Die Empörung weicht einer Trauer, die mit dem toten Tier still Zwiesprache hält: Ich habe dich vor einem schlimmen Schicksal bewahrt, nur um dich diesem würdelosen Ende auszuliefern. Deine Eltern waren Kampfhunde. Du durftest nicht mal kämpfen.
Der Gefangene hat den Welpen bei seinem letzten Türkeibesuch auf dem Hof eines Cousins entdeckt. Eyup und Aykut: Freunde. Eyup: einfach liegengelassen, auf feuchten Blättern im kalten Wald.
Jemand nimmt dem Gefangenen die Augenbinde ab.
Er betrachtet, was er vor sich hat: zwei Stühle, eine Tafel dazwischen, bedeckt von einem weißen Tischtuch, so hell, dass es den Augen weh tut. Das Gedeck darauf: zum Kegel gefaltete weinrote Serviette, Glas Wasser, gefüllter Whisky-Tumbler, Teller, Messer, Gabel, Löffel. Aykut Cevahir befindet sich in einer Halle, die bis auf die Lichtinsel vor ihm stockdunkel ist und wohl recht groß: Der Gefangene hat Echos der Schritte gehört, als die Entführer mit ihm aus dem Aufzug kamen. In der Tischmitte flackert eine Kerze. Die schlanke Flamme setzt kaum Rauch frei, atmet Tannenaroma aus.
Der rechte der beiden Entführer, wie sein Partner links in teurem italienischem Herrenanzug und spitzen Lackschuhen, weist mit dem Kinn auf den Stuhl vor Aykut. Der Gefangene setzt sich. Nasenkitzel: salziger Duft, der zum Zischen von Fett passt, das er hört. Jemand kocht, irgendwo rechts von ihm.
Aykut will den Kopf dorthin drehen.
Der linke Scherge legt ihm die Hand auf die Schulter und brummt: »Geradeaus gucken.«
Aykut hat den Befehl verstanden, aber etwas daran war ungewöhnlich, fremd.
Er blinzelt, dann begreift er den Grund seiner Irritation: die Sprache. Nicht Englisch, nicht Türkisch, dennoch verständlich, obwohl Aykut nur diese zwei Sprachen spricht – gut, ein paar Worte Spanisch noch, mit mexikanischem Einschlag, berufshalber.
Aber Spanisch war das auch nicht.
Aykut denkt an den Überfall, vor ein paar Stunden: Da war’s ihm genauso gegangen – er verstand die Männer zwar, aber in welcher Sprache sie redeten, war ihm dabei nicht klargeworden. Wie leichter Gleichgewichtsverlust in der geistigen statt räumlichen Orientierung: Wörter und Gedanken schwanken, nicht Vertikale und Horizontale.
Aykut senkt den Blick: Porzellan als gefrorene Milch.
Rechts klirrt Steinzeug, klappert eine Pfanne. Flinke Hände richten eine Mahlzeit her. Dann hört Aykut Fingerschnippen. Der größere Bewacher greift an ihm vorbei den Teller mit Daumen und Zeigefinger am Rand. Er geht damit fort.
Schritte entfernen sich. Schritte kommen näher, kürzer, leiser.
Die neue Person, rät Aykut, ist kleiner als die Schläger.
Als sie ihn erreicht, geht sie um den Tisch herum und nimmt ihm gegenüber Platz: eine junge Frau von höchstens sechzehn Jahren. Sie trägt eine weiße Kochjacke, ein blaues Halstuch. Ihr Haar ist kupferrot, sehr kurz, kunstvoll zerrupft, glänzend von Gel. Sie ist blass, hat große, dunkle Augen, eine schön gewölbte, glatte Stirn, Sommersprossen rechts und links der hübschen Nase.
Das Mädchen lächelt.
Aykut fragt: »Who are you?«
Die junge Frau schließt die Augen, deutet ein Kopfschütteln an.
Der Scherge kehrt mit dem Teller zurück, stellt ihn vor den Gefangenen.
Die Mahlzeit duftet, sieht verlockend aus: Zwei Medaillons auf einem dunklen Klecks Sauce, zartes Fleisch, innen rosa, außen kross braun, in der Mitte zwei Mulden, mit Nussartigem gefüllt, bestreut mit feinen Rosmarinnadeln, gesäumt von gehackten Schalotten, etwas Knoblauch, dazu Morcheln, Frühkartoffeln und junges Grünzeug. Was riecht so pfeffererdig? Gewürzte Steinpilze?
»Bon appétit«, sagt die junge Frau.
Aykut öffnet den Mund. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Er holt Luft, schluckt. Dann spricht er doch: »Ich habe keinen Hunger. Ich will wissen, warum man mich …«, er unterbricht sich, etwas stimmt nicht. Er wiederholt: »Ich will wissen … was …«
Aykut erkennt die Wörter nicht, die er ausspricht.
Die Fremde sagt: »Die Sprache. Sie haben es bemerkt. Wir verstehen einander hier alle. Wundern Sie sich nicht. Sagen Sie, was Sie auf dem Herzen haben.«
Nicht zum ersten Mal seit heute Mittag fragt sich Aykut, ob er träumt.
Träumt man Düfte? Träumt man so deutliche Farbkontraste wie auf diesem Teller? Träumt man die kleine Wachsträne an der Kerzenbasis, den Speichel im Mund, das leise Atemgeräusch des linken Wächters, die Sommersprossen? Aykut wiederholt in der ungewohnten Sprache das, was er schon auf Englisch wissen wollte: »Wer sind Sie?«
Als die Frau nicht reagiert, stellt er eine zweite Frage: »Wer hat mich hierherbringen lassen?«
Sie sagt: »Ich. Wer ich bin, darüber reden wir später.«
»Ein Name, wenigstens?«
Wieder das Lächeln.
Dann doch eine Auskunft: »Teiresias. Jetzt probieren Sie. Ich habe mir Mühe gegeben.«
»Ist das Schweinefleisch?«, fragt Aykut.
Die Person, die sich mit einem sehr alten Namen vorgestellt hat, erwidert: »Nein. Ich spiele nicht mit Ihnen, Herr Cevahir. Ich lade Sie zum Abendessen ein.«
Wie nennt man diesen Tonfall? Verbindlichkeit?
Der türkisch-amerikanische Unternehmer fühlt sich ans Gangsterfilmklischee vom »Angebot, das man nicht abschlagen kann« erinnert. Aykut nimmt Messer und Gabel. Er schneidet ein Stück Filet ab, führt es zum Mund und kostet. Es ist ausgezeichnet. Teiresias scheint damit gerechnet zu haben, dass es ihm schmeckt. Sie sieht amüsiert aus. Er setzt die Mahlzeit fort, nun doch hungrig. Die weiche Pilzfüllung gefällt ihm besonders.
Das Mädchen fragt: »Was, denken Sie, habe ich in die Sauce getan?«
Er rät kauend: »Mmhömm … Glace de Viande? Rotwein, Portwein … und Rosmarin …«
»Bravo«, fast ein Flüstern. »Und der Whisky?«
Aykut nippt, trinkt, schließt die Augen und sagt: »Sultaninen, Enzian … Mindestens zwanzig Jahre alt. Glenlivet? Gut. Sie wissen, was ich schätze. Was wollen Sie? Geld?«
Das Lächeln verschwindet: »Herr Cevahir. Sie beleidigen Ihre Intelligenz und meine. Würde ich mir die Mühe machen, Sie zu bewirten, um Sie auszurauben?«
Aykut verzieht den Mund, als habe er auf Saures gebissen: »Ihre Leute haben meinen Hund getötet. Es sind Verbrecher.«
»Vielleicht hat jemand wirklich den Hund getötet. Vielleicht glauben Sie das aber auch nur. Tun wir das für den Moment beiseite. Was, glauben Sie, will ich von Ihnen, wenn es nicht Geld ist? Warum weiß ich, was Ihnen schmeckt?«
»Da Sie offenbar wissen, wer ich bin«, sagt Aykut, »wissen Sie auch, dass ich aufs Essen Wert lege. Ihnen ist bekannt, womit ich reich wurde.«
Die Augen des Mädchens lachen, der Mund bleibt ernst: »Was weiß ich also?«
Er ärgert sich: »Ach, alles wahrscheinlich. Die türkische Kindheit, 1989 Oberschulabschluss, in Ankara und in Amerika studiert …«
»Erst Baruch College, New York, dann University at Albany-SUNY«, bestätigt Teiresias und setzt hinzu: »Ich weiß, dass die Geschichte mit dem Tellerwäscher-Klischee anfängt. Catering. Dann die erste Idee: Sie haben Käse importiert. Eine Pause, Ende der Neunziger.«
»Meine Mutter war krank. Sie starb. Ich ging zurück in die Türkei. Mein Vater starb auch.«
»Und wieder in die Vereinigten Staaten, diesmal für immer. Dann die erste kleine Käsefirma, Kredit aufgenommen, diese alte Fabrik gekauft, Joghurt für Bio-Supermärkte …«
Aykut ist satt. Er nimmt einen kleinen Schluck Whisky, einen großen Schluck Wasser.
Teiresias sieht ihn an.
Aykut sagt: »Türkischer Joghurt, griechischer Joghurt. Rohstoffe und Maschinen aus der Türkei und Wisconsin. Die Leute dachten, Cevahir ist verrückt. Aber dann sagten die Store-Manager, man reißt uns das Zeug aus den Regalen. Ich hatte Cashflow-Probleme. Die Nachfrage war größer als erwartet. Kredite. Profite. Ich wurde reich. Obama hat mir die Hand geschüttelt. Was weiter? Ich werde nach Deutschland eingeladen. Man bietet mir Deals an. Gastronomie. Ich komme ins Hotel, gehe mit dem Hund joggen, diese beiden Kriminellen hier stellen sich mir in den Weg, bringen meinen Hund um und verschleppen mich in dieses … was immer das hier ist, eine … alte Industrieanlage … Lagerhalle. Noch mal: Wer sind Sie?«
Eine stark behaarte Hand nimmt Aykut den leeren Teller weg.
Teiresias sagt: »Sie müssen von mir nur wissen, was ich brauche. Dann können Sie mir sagen, ob Sie mir helfen wollen.«
Aykut versucht, reserviert auszusehen.
Sie sagt: »Ich brauche Ihren Geschmack.«
Er lacht unwillkürlich. Sie wartet, bis er aufhört. Dann erklärt sie: »Die Not ist groß. Ich brauche mehrere, spezialisierte Leute. Wenn Sie nicht mitkommen …«
»Man bittet nicht um Hilfe, indem man jemanden entführt oder sein Haustier tötet«, sagt der Millionär streng. Der Blick des Mädchens wirkt auf Aykut, als studiere sie ihn, wie man etwas Winziges auf einem Objektträger unter einem Mikroskop betrachtet.
Sie sagt: »Sind Sie sicher, dass Sie gesehen haben, wie Ihr Hund getötet wurde?«
Blut schießt ihm ins Gesicht. Er wird laut: »Was soll das? Natürlich bin ich sicher. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen!«
Am liebsten würde er auf seiner Armbanduhr nachsehen, welche Zeitspanne seit dem Angriff verstrichen ist, und ihr mitteilen: vor wenigen Stunden erst. Aber dann fällt ihm ein, dass die Schergen die Uhr konfisziert haben.
Teiresias sagt: »Das ist so sicher, wie Sie wissen, was Sie eben gegessen haben, ja?«
Er nickt wütend. Sie fragt: »Was war das denn? Ihr Essen?«
Er hustet vor Ärger, dann sagt er: »Sie haben mir da ein gefülltes Rinderfilet mit Pilzen gebracht, mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Zucchini oder … und Frühkartoffeln dabei, aber …«
»Kein Geflügel?«, fragt sie. Ihr Gesichtsausdruck ist unlesbar: Scherz? Bosheit?
Aykut will sie zurechtweisen. Aber dann stutzt er, zieht die Stirne kraus, denkt nach, mit halboffenem Mund. Endlich sagt er: »Nein, ich, Sie … hören Sie … Sie haben recht, es war … es waren zwei … zwei Wachtelbrüstchen. In so einer … Kruste, in …«
Er erinnert sich an den Mandelmantel. Toastbrotkrümel? Das Fleisch – wunderbar, dazu Spargel, sehr frisch, in etwas wie Riesling-Essig angemacht, untermischt mit – womit? »Schnittlauch, oder …« Es ist kein Reden mehr, das ihm über die Lippen weht, nur ein Hauch.
Dann schüttelt er den Kopf und sagt: »Nein, nein. Moment. Unfug. Ein Rinderfilet, zwei Rinderfilets in … in Rotweinsauce, denn …«
»Ist noch etwas vom Geschmack in Ihrem Mund?«
»Ich …«, er spürt der Frage nach. Bewegt die Zunge. Dann: »Ich habe … der Whisky ist zu stark. Ich kann es nicht genau sagen.«
»Verstehe ich das richtig? Sie sind unsicher, was Sie gegessen haben? Schließen Sie die Augen. Überlegen Sie, was Sie auf dem Teller vor sich sehen.«
Aykut entspricht der Bitte widerwillig. Er sieht das Rinderfilet, die leuchtend gelben Kartoffeln. Aber er sieht auch den Teigmantel um die Wachtelbrüstchen und den grünen Spargel. Den glasigen Glanz. Er sieht Kerbel.
Aykut öffnet die Augen: »Ich … ich weiß es nicht. Es kann beides … gewesen sein. Rind oder Geflügel.«
»Und der Hund? Schließen Sie die Augen. Denken Sie an den Hund.«
Er versucht es. Ihm fällt ein: Sie haben den Hund an einen Baum gebunden. Und dann? Dann zeigten sie ihm sein Handy, mit dem Bild seines Sohnes, und sagten ihm irgendetwas. Nein. Er öffnet die Augen und sagt: »Sie haben dem Hund nichts … getan. Die Drohung … mein Kind, hieß es, sei in Sicherheit, wenn ich keine … kein Aufsehen mache … und mitkomme. Sie haben meinen Sohn … in …«
Er wird wieder wütend, bezähmt sich aber. Die Erinnerung an Eyups Tod, an den Klammergriff um seinen Hals, in dem einer der Handlanger das arme Tier gequält hat, fordert ihr Recht, verwirrt ihn. Teiresias sagt: »Sie sind also hier, weil wir Ihren Hund getötet haben. Oder Ihren Sohn bedroht. Und Sie haben hier Wachtelbrüstchen im Mandelmantel mit grünem Spargel gegessen. Oder gefülltes Rinderfilet mit Pilzen. Mehrere Möglichkeiten.«
Aykut ist ratlos: »Ich weiß nicht … es kommen mir in … in beiden Fällen … beide Alternativen … gleich richtig vor. Gleich … wahr. Es ist wie einer dieser optischen Tricks. Wie mit dem Würfel, dessen Vorderseite entweder vorne oder hinten ist, oder … die beiden Köpfe im Profil, zwischen denen … nichts ist, und wenn man länger hinschaut, denkt man, da ist eine Vase, und dann verschwinden die Köpfe.«
Teiresias sagt: »Zu der Gruppe, die ich zusammenstellen möchte, wird eine Mathematikerin gehören. Sie könnte Ihnen erklären, welche Beziehung zwischen, sagen wir, den beiden Mahlzeiten und Ihrem jetzigen Zustand besteht. Sie würde etwa sagen: Man kann beide Mahlzeiten, die zu Ihren Lieblingsgerichten gehören, auf den jetzigen Zustand abbilden. Das wäre dann eine Abbildung der Menge der möglichen Menüs auf eine Menge aus Zuständen, die Sie nach dem Essen einnehmen könnten. Kommt man von diesen Zuständen wieder zurück zu der Menge der Gerichte? Es gibt mehr Gerichte als mögliche Zustände nach dem Essen. Sie können zufrieden sein oder unzufrieden mit dem Essen, und dann gibt es vielleicht noch ein paar feinere Varianten. Die Abbildung von den Gerichten zu den Zuständen gruppiert die Gerichte nach Geschmack, im Groben in die zufriedenstellenden und die nicht zufriedenstellenden. Wir können jetzt versuchen, Abbildungen zu finden, die das Ganze rückgängig machen: vom jetzigen Zustand zu den Gerichten. Das wäre eine Auswahl, ein Schnitt. Wir nehmen Geschmackswerte von salzig oder süß oder andere Sorten Würze. Wir bilden die Zufriedenheit und die Unzufriedenheit und die Varianten davon auf Gerichte mit einer bestimmten Würzmischung ab. Wenn es aber auch nur einen einzigen Zustand gibt, der mit der Würze nichts zu tun hat, gelingt dieser Schnitt nicht.«
»Ich verstehe kein Wort.«
»Das habe ich davon, wenn ich es so allgemein wie möglich erklären will. Was hätten Sie auch damit anfangen können, wenn ich Ihnen erzählt hätte, man hat eben immer verschiedene mögliche Ursachen für den jetzigen Stand der Dinge? Sie sind hier, weil wir Ihren Hund getötet oder weil wir Ihren Sohn bedroht haben. Sie denken, Sie haben gut gegessen, weil es Wachtelbrüstchen oder Rinderfilets gab. Und wenn ich fragen würde: Welche Ursache ist die wahre? Wer Sie kennt, weiß: Ihren Hund haben Sie gern, Ihren Sohn haben Sie gern, Wachtelbrüstchen haben Sie gern, und Rinderfilet haben Sie auch gern. Also müssen wir, um die Frage zu klären, die konkreten Daten nehmen, etwa Reste von Rosmarin in Ihrem Mund oder Reste vom Gemüse zwischen den Zähnen. Wir gehen das an mit … einer Annahme a priori, sagen wir: Es war der Hund, oder: Es war der Sohn, oder: Es war die Wachtel, oder: Es war das Rind. Eine entsprechende Gleichung, das Verfahren von Bayes, sagt uns: Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer gegebenen Bedingung eine bestimmte Ursache war, die Wachtel von mir aus, ist gleich der Annahme, dass diese Bedingung im Fall der Wachtel gegeben ist, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der Wachtel an sich, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit der betreffenden Bedingung, sagen wir: Anwesenheit von Schalotten, Rosmarin und so weiter, wobei Rosmarin ja in beiden Mahlzeiten vorkommt. Also das kann man dann bei allen möglichen Hypothesen durchrechnen, was im Fall der Mahlzeit wie der Drohung jeweils zwei sind. Aber Sie, Herr Cevahir, können sowohl mit der Gleichung wie mit der abstrakten Beschreibung der Abbildung und ihres Schnitts nichts anfangen. Und weil jede und jeder unter euch Menschen solche Verständnisschwächen hat – Sie verstehen die Gleichung und das Pfeilbild nicht, die Mathematikerin würde vielleicht umgekehrt die Erläuterung in Prosa nicht verstehen –, ebendeshalb brauche ich nicht nur einzelne Menschen, sondern eine Gruppe. Und weil es bestimmte Vorgänge in der Notlage gibt, aus der Sie jemandem helfen sollen, deren Details sich sehr genau als Geschmackswerte beschreiben lassen, oder besser, Vorgänge, die man mit großer Genauigkeit auf Geschmacksnuancen abbilden kann … deshalb müssen Sie mitkommen, als Fachmann für Geschmack. Entschuldigung, falsch: Sie müssen nicht. Aber es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mitkämen.«
Auf seinem langen Weg zum Reichtum hat Aykut gelernt, dass man in schwierigen Verhandlungen nie verraten darf, ob man überfordert ist. Man gibt in solchen Fällen die Kompliziertheit, mit der man beschossen wird, dem Gegenüber zurück, indem man den Wust an einer Stelle aufspießt, die eine möglichst einfache Frage zulässt. Aykut hält sich daran: »Was ist das für eine Notlage, bei der ich helfen soll?«
Die Antwort ist eigenartig: »Stellen Sie sich vor, Sie könnten von Ihrem ganzen Körper nur noch Ihre rechte Hand spüren. Stellen Sie sich vor, das Einzige, was Sie sicher wüssten, wäre, dass eine andere Hand diese Hand fest umklammert hält.«
Er sagt: »Fahren Sie fort.«
Sie erklärt es ihm. Sie lässt nichts aus, erwähnt sogar das Ungeheuer Hundertsechsundneunzigtausendachthundertdreiundachtzig, obwohl sie weiß, dass er das sofort wieder vergessen wird.
Als die Erläuterung am Ende ist, fragt Aykut Cevahir: »Helfen, was hieße das?«
Sendungen
Eine dichte Reihe blauer Stechfichten spendet der Bushaltestelle Schatten.
Es ist kühl hier. Vor dem Glaskasten steht ein vierzehnjähriges Mädchen. Die junge Frau, die sich in wenigen Stunden als Teiresias vorstellen wird, besucht dieselbe Schule wie dieses Mädchen.
Die beiden Schülerinnen kennen einander nur oberflächlich. Die Wartende an der Haltestelle heißt Filipa. Im Gegensatz zu Teiresias hütet sie keine Geheimnisse. Filipa raucht. Sie zündet sich eine Marlboro nach der andern an, als müsste sie etwas beweisen. Sie trägt enge weiße Jeans und einen grobgestrickten grauen Pullover mit Glitzerklunkern. Filipas schulterlange Haare sind mit Schaum zurechtgemacht wie frisch geduscht. Über die Jeans hat sie einen Strickrock in Khaki gezogen. Dezente perlweiße Ohrstecker, ein Sternchen in der rechten Nasenflügelwand, etwas Rouge von By Terry. In halbhohen Schuhen von G-Star Raw steht sie bequem und hört Massimiliano Pagliara auf dem iPod. Sie weiß nicht, dass das Massimiliano Pagliara ist. Die Musik hat ihr Werner, der Exfreund ihrer Mutter, auf die kleine Maschine geladen. Noch mehr im Gerät stammt von ihm: Naxxos, Benoit & Sergio, Rune & Kaiza. Warmes. Dunkles.
Nichts fehlt. Nein, das ist gelogen. Ihr fehlt die Großmutter gerade sehr.
Eine bessere Freundin als die Oma hat Filipa nie gehabt.
Die alte Frau lebt nah beim Hauptbahnhof. Filipa findet, das sei zu weit weg, nicht allein räumlich: Das Alten- und Pflegeheim, in dem die Oma wohnt, ist kein Ort, zu dem es Filipa zieht, nicht einmal heute, da sie die Oma braucht, weil sie vor Liebeskummer kaum noch weiß, wer sie ist. Filipa findet, das Heim sei ein Gefängnis.
Optisch scheint das falsch: Man hat den Bau, einen schmal hohen Kasten, in gelbe Plättchen eingeschlagen, die wie Märchenburgmauerwerk aussehen.
Drinnen leben aber Abgeschriebene, und die leuchtende blaue Sonne aus Neon, die vorn überm Eingang hängt, lacht nicht aus Spaß, sondern weil sie verrückt ist.
Das Heim steht an einer der meistbefahrenen Straßen der Stadt, rechts gestützt von einem Möbelladen, links von Geschäften für Babybedarf, Computerkrempel, Golfzubehör.
Die Golfleute beschweren sich häufig über die Menschen aus dem Heim.
Die Alten stören das Sportbewusstsein.
Zwei breite Spuren einer vielbefahrenen Straße entfernt drücken sich Kneipen und Geschäfte zwischen Geschäfte und Kneipen. Zwei davon, ein Krachclub und ein Öko-Fahrradschuppen, halten sich seit Jahren. Der Rest wechselt im Zweimonatstakt.
Filipas Großmutter geht fast nie auf die andere Straßenseite.
Sie heißt Marianne.
Im Augenblick hält Marianne sich die Ohren zu. Sie sitzt beim Frühstück.
Wenn sie gerade nicht löffelt, schneidet oder kaut, legt sie die Hände vor die Gehörgänge. Das soll sagen: Ich sondere mich ab, denn eure Gespräche und euer Rundfunk widern mich an. Derzeit wohnt sie allein. Die andere Frau in ihrem Zweierzimmer ist letzte Woche gestorben.
Die Tote mochte das Dudelradio.
Manchmal sah sie auf dem Zimmer sogar fern, zu Mariannes großem Ärger.
Nie läuft im Gemeinschaftsraum Sprechradio, immer nur leichte Welle.
Wenigstens im Zimmer bleibt der Apparat ausgeschaltet, seit die andere Frau tot ist. Manchmal setzt Marianne sich zum Apparat und stellt sich Sprechsendungen vor, oft lustige, manchmal schreckliche. Grundsätzlich lehnt sie Musik freilich nicht ab.
Sie hat ihr Berufsleben damit verbracht, Kindern das Klavierspielen beizubringen. Ihr wirklicher Eifer galt allerdings anderen, vergeblichen Dingen.
In den Siebzigern und frühen Achtzigern war Marianne die Gruppenälteste einer winzigen maoistischen Sekte am Ort, der sie sich als Mittdreißigerin angeschlossen hatte. Alle anderen im Verein waren damals Anfang bis Mitte zwanzig. Bei denen verschaffte sie sich Respekt mit der Lüge, sie sei nur deshalb nicht Lehrerin für Musik an Gymnasien geworden, weil der Staat Menschen mit ihrer Gesinnung verfolge.
Zwar verfolgte der Staat Menschen mit derlei Gesinnungen damals tatsächlich.
Aber in stillen Stunden wusste Marianne: Sie hatte keine Lust aufs Lehramt. Zur Konzertpianistin hätte sie es ohnehin nicht gebracht, das war am Konservatorium rasch klargeworden. Eine Lehramtsausbildung wäre ihr als Eingeständnis künstlerischen Versagens erschienen. So erzählte sie ihrem nachsichtigen Vater, einem Zahnarzt, viel von Unabhängigkeit und Selbsterforschung, im Vokabular der Zeit.
Dem gütigen Mann leuchtete das ein. Er griff ihr finanziell unter die Arme, bis sich das Nachhilfegeben, das sie ihm zunächst als »Überbrückungslösung« dargestellt hatte, allmählich rentierte. Als Marianne dann auf verschlungenen Umwegen, über Liebesgeschichten und Demonstrationserfahrungen, in die linksradikale Szene geraten war, lernte sie einen Mann kennen, Lehrer für Sport und Musik an einem örtlichen Gymnasium, der sogar einen DKP-Aufkleber (»Freiheit für Angela Davis«) am knallroten Mofa spazieren fuhr, scheinbar ohne Angst um seinen Posten.
Die Beziehung zu diesem Mann zerbrach 1979, als Mariannes Bekanntschaften sich auf neue, nach Überzeugungsgrenzen sortierte Wohngemeinschaften verteilten und sie mitsamt ihrem Piano bei Maos Leuten landete.
Die lockten mit gefährlichen Abenteuern.
Gefährlich? Nun ja: »Heftig.«
Marianne hat das Wort bei Filipa aufgeschnappt und hält es für gegenwartsnah. Wenn sie der Enkelin ihre alten Geschichten von Wasserwerfern, Hausdurchsuchungen und Berufsverboten erzählt, findet Filipa das »echt heftig«. Noch heftiger allerdings findet sie die Geschichten von Mao und Stalin, mit denen Marianne manchmal moralische Stellungnahmen illustriert. In Wirklichkeit gebraucht Filipa Wörter wie »heftig« in Gesprächen mit Marianne nicht, weil man als junger Mensch heute so redet, sondern weil sie damit auf eine selbsterfundene Sorte Ironie hinauswill: Sie versucht, zu reden, wie alte Leute reden, wenn sie sich mit jungen Leuten in einer Sprache unterhalten, die diese alten Leute für die Sprache junger Leute halten. Filipa könnte auch »krass« sagen oder, wenn sie ein bisschen mehr über Mariannes Lieblingslebensabschnitt wüsste, vielleicht »stark«.
Manchmal schaut Marianne Scholz in den Spiegel und urteilt hart: Früher war mein Gesicht eine Mischung aus weiblichen und wölfischen Zügen. Jetzt ist das Weibliche weg.
Schäferhündin: schmale Nase, treue Augen. Die markanteren Kanten sind zerlaufen, die feineren brüchig geworden. Marianne verheimlicht vor sich, dass sie in Wahrheit keine Schäferhündin, sondern eine sehr schöne alte Frau ist. Sie hat mehr Liebe erfahren als die meisten und weiß, es liegt daran, dass in ihren besten Jahren zwar mehr verboten war als heute, dafür aber nicht so vieles vermiest wurde.
In den Siebzigern lebte sie eine Zeitlang bei Gesinnungsverwandten in England. Die meisten dieser strikt marxistisch-leninistisch orientierten Musikschaffenden hatten eine musikalische Hochschulausbildung hinter sich und waren vor ihrer Politisierung der Klangavantgarde nahegestanden. Mit ihrem Können, das sie nun als bürgerlich dekadent verwarfen, wollten sie aktiv brechen. So versuchten sie sich an der Produktion von etwas, das sie »people’s liberation music« nannten; das war eine seltsame Volksbefreiungsmusik, in der Solidarität mit dem geknechteten Irland, dem antiimperialistischen Kampf der Dritten Welt, den von Neonazis gejagten Zugewanderten in Großbritannien und der Arbeiterklasse, vom Hafen bis in die Bergwerke, zum Ausdruck kommen sollte. Man wollte Menschen erreichen und mitreißen.
Natürlich hatte das keinen Erfolg.
Die im Moment ihrer Konzeption bereits hoffnungslos veralteten Liedchen zerfielen zu nichts in den Sturmwinden von Rock und Pop. Großartige, lebensverändernde sechs Monate waren das trotzdem, die Marianne in jener englischen Landkommune verbrachte.
Dort begegnete sie auch dem Vater von Filipas Mutter.
Als sie sich wenig später von ihm trennte und nach Deutschland zurückkehrte, war das Kind noch nicht geboren. Es kam erst weitere sechs Monate später zur Welt. Dem Vater teilte Marianne nichts mit. Sie ließ den Kontakt ganz einschlafen, als jener sich schließlich gegen den Kommunismus und für eine solide Orchesterlaufbahn als Cellist entschied, im Einklang mit den Wünschen seiner Eltern, zweier Landadliger, die von der Existenz ihres Enkelkindes ebenso wenig erfuhren wie dessen Vater.
Marianne sieht ein, dass man sie wegen der Gleichgewichtsstörungen und der schadhaften Knochen, der Fehlernährung, die sie sich in langen Jahren der Einsamkeit angewöhnt hat, außerdem wegen Eisenmangels, Herzbeschwerden, Arthrose und hundert anderer Lästigkeiten nicht mehr in ihrer Wohnung hat leben lassen können.
Sie sagt oft: »Ich bin hier wegen der Zipperlein.«
Herz, Leber, Muskeln, das alles funktioniert bei ihr nicht mehr wie früher. Andere Ausfälle sind weniger ärgerlich. Das Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel darf ruhig schadhaft sein. Den täglichen Kleinkram will sie gar nicht wissen.
Anderthalb Stunden nach dem labbrigen Haferbrei und den mehligen Apfelschnitzen nähert Marianne sich dem Bahnhof, ihrem Vormittagsausflugsziel, ohne zu wissen, was in der Zwischenzeit geschehen ist.
Hat sie sich bei einer Pflegekraft verabschiedet? Vergessendürfen macht gute Laune.
Der Morgen ist frisch. Marianne schleicht sanft und langsam durch den sich lichtenden Nebel. Sie kann durchaus noch ordentlich gehen. Aber sie hat sich angewöhnt, an Orten, wo viele Menschen eilig durcheinanderlaufen, gemächlicher als notwendig voranzukommen, damit »die Bekloppten«, wie sie die Menschheit nennt, sie nicht anrempeln oder umwerfen. Geduldig legt sie die letzten Meter zum Bahnhof im Schatten des Intercity-Hotels zurück.
Hotel? Märchenturm: Marianne könnte nicht sagen, ob das Bauwerk ein Dach hat, weil sie selbst vom Heim aus, wenn sie dort aus dem Fenster sähe, ihren Kopf bis zum Genickbruch in den Nacken legen müsste, um so hoch hinaufschauen zu können.
Nicht unzufrieden wackelt sie an der Bushaltestelle vorbei, wo heute zum Glück nicht der wahnsinnige Straßenschlagzeuger auf seine selbstgebastelte Schießbude eindrischt.
Die meisten Leute im halbleeren Bahnbau stehen in drei Schlangen vor der Bäckereitheke. Der Weg zum Zeitungs- und Zeitschriftenladen ist frei.
Marianne gibt einen Teil dessen, was sie aus Würdegründen nicht »Taschengeld« nennen will, für vergängliche Lektüre aus. Das geschieht nach der wohlerprobten Regel »Halbe-Halbe: Was fürs Hirn und was zum Lachen«.
Im Heim gibt es nur die Regionalzeitung, die Marianne nicht liest.
Fürs Hirn wünscht sie sich heute aus alter Anhänglichkeit zu allem Britischen das Times Literary Supplement. Das ist aber nicht da. So kauft Marianne die New York Review of Books, sehr teuer, so dass sie zum Lachen nicht den Spiegel kaufen kann, sondern nur ein Klatschblatt über Schlagerstars und gekrönte Inzucht für 90 Cent. Das Budget ist genau berechnet: Rund hundert Euro für Notfälle müssen immer im Geldbeutel bleiben.
Mit ihren Drucksachen zockelt Marianne zum Stehcafé, wo sie sich einen Kamillentee und einen Einback kauft, weil alles andere ihr Sodbrennen verursacht. Das Lesen im Stehen hilft derzeit ihrem Kreuz. Morgen kann das anders sein; das Rückgrat hat täglich Launen.
Aus der New York Review of Books erfährt Marianne in einer halben Stunde Lesezeit, dass die Kulturwelt nicht mehr an Genies glaubt, dass Malewitschs Messerschleifer nach wie vor eine hübsche Artikelillustration abgibt, egal, wovon der Text handelt, dass die Säulen des Despotismus im arabischen Raum etwas mit Religion zu tun haben und dass die Philosophin Martha Nussbaum putzige Verbindungen zwischen Gerechtigkeit und Liebe erkannt hat.
Am Ende der Lektüre geht Marianne zu etwas über, das sie »meine Augenübungen« nennt.
Sie blättert zu den Seiten, auf denen das Druckbild mit den winzigsten Zeichen im Blatt steht. Das sind hier Kleinanzeigen, bei anderen Publikationen Briefe, Kolumnen oder das Impressum. Als Marianne gefunden hat, was sie sucht, beugt sie sich vor und versucht, das Kleinstgedruckte zu entziffern, ohne Lesebrille.
Der linksliberale akademische Mittelstand der Vereinigten Staaten von Amerika sucht in Mariannes Alter offenbar vor allem nach Liebe:
TIME BRINGS LOSS but also new appreciation of close companionship. Retired Manhattan female academic is interested in hearing from man seeking future of shared happiness and mutual respect. Particular passions: European art, classical music, social history, among others. NYR Box 65402
ACTIVE, attractive woman, late 60s, whose taste ranges from Broadway musicals to opera and ballet and who loves birds and animals. Manages a music foundation. Is seeking a man, same age range, for friendship and fun. Committed to care for a disabled husband. NYR Box 65401
LOS ANGELES MAN, 70, is ready to share life. Passions: running, nonfiction reading, holding hands. NYR Box 65300
Die letzte Anzeige, in der ein älterer Mann das Händchenhalten ausdrücklich zu seinen »Leidenschaften« rechnet, erinnert Marianne an eine Geschichte ihrer Enkelin. Filipa erzählt ihr ab und zu von einem zwei Jahre älteren Jungen, der mit einer anderen Mitschülerin »zusammen« sei. Die beiden hätten »schon Sex gehabt«. Filipa aber liebe diesen Jungen und verbringe auch immer wieder Nachmittage oder Abende mit ihm. Seine Eltern seien »reich und nie zu Hause«, weswegen er mit Filipa häufig »vor dem Flatscreen« sitze. »Da sind wir neulich so gesessen, und ich hab meine Hand im Teppich, krussele da mit meinen Fingern rum. Da kommt seine Hand dazu auf einmal und hält meine fest. Da habe ich die Luft angehalten, solange es ging, aber nichts gesagt. Dann hab ich nur ganz vorsichtig weitergeatmet. Er hat auch nichts gesagt. Dann ist er aufs Klo. Als er zurückgekommen ist, habe ich meine Hand geöffnet, dass er das sehen konnte, so als Einladung. Er hat draufgeguckt und gesagt: ›Wenn du das aber blöd oder unbequem findest, kannst du mich sofort loslassen, und ich denke nicht gleich, du magst mich nicht.‹ Das fand ich toll. So direkt und gleichzeitig indirekt. Ich meine, er hat ja nichts getan, wo Hanna ihm einen Vorwurf draus machen kann. Kein Fremdgehen, weißt du? Das war, als ob das mit dem Händchenhalten nur unseres ist. Ein beschütztes Ding, bis der Film rum war.«
Ob sechzehn, vierzehn, sechzig oder siebzig Jahre alt: Es gibt, denkt Marianne, nicht nur aufbrausende, sondern auch zarte Leidenschaften. Sie wendet sich dem Klatschblatt zu. Von dummen, niedlichen Personen ist die Rede: Eine Moderatorin von RTL ärgert sich über eine Liebesrivalin, eine Hollywood-Schauspielerin steht zu ihrer Leiblichkeit (»jedes Speckröllchen ehrlich verdient«), die Ehefrau eines Volksmusiksängers befindet sich im »Yoga-Rausch«.
Marianne kennt die meisten der Figuren aus regelmäßigen Kontrollen.
Sie ist zufrieden, hat ihr Hirn beschäftigt, ihre Augen trainiert, über Prominentensorgen gegrinst und an ihre Enkelin gedacht. Sie faltet das Papier zusammen, schmeißt den trivialen Teil weg und kriecht mit dem Rest unterm Arm zurück.
Auf dem Busparkplatz wird jetzt doch noch Straßenmusik gespielt. Es ist aber nicht der leidige Trommler, sondern ein junges Mädchen mit Gitarre. Oben bricht Licht durch die Wolken, Seidenfadensonnenstrahlen spinnen das Mädchen ein. Der Gesang hat einen britischen Akzent, der Marianne an ihre Zeit in der musikalischen Kommune erinnert:
Old Tiresias
No-one half so breezy as,
Half so free and easy as
Old Tiresias.
In der Anstalt gibt es Mittagessen.
Man trägt im Zimmer auf, nicht im Speisesaal, einen Maultaschen-Salat mit Möhren und Thymian, dazu Wasser ohne Kohlensäure. Als der Servierpfleger die unterbelegte Zweierstube verlässt, schaltet Marianne das imaginäre Sprechradio im Kopf ein. Sie isst in Ruhe und hört dabei den ausgedachten Moderator sagen:
In unserer beliebten und natürlich auch sehr guten Reihe »Betriebsprobleme und wie man sie bewältigt – Tipps für Beschäftigte und ihre Beschäftiger«, hören wir heute: Zufriedenheit im Betrieb. Die Zufriedenheit ist im Betrieb sehr wichtig, denn wenn alle unzufrieden sind, läuft nichts mehr. Das Einzige, was da noch läuft, ist: Es läuft jemand davon. Jetzt weiß aber auch jeder, dass es nicht nur Zufriedenheit gibt im Alltag, sondern eben auch das Genörgel. Das Genörgel findet statt, sobald einer sagt: So nicht. Das ist vor allen Dingen im Senioren- und Pflegeheim die Schwester Angelika. Was sie nicht merkt: Dadurch, dass sie immer nur nörgelt, wird’s auch nicht angenehmer. Irgendwann nörgeln die anderen dann auch alle, und zwar bevorzugt über Schwester Angelika. Und dieser Zustand, da gibt’s nur eins: Da muss man erst mal drüber reden, das heißt, da werden Gruppen gebildet und Konferenzen angesetzt, zehn, zwölf, hundert und dreitausend pro Tag, und da wird gesessen, und alle reden und reden, und sie reden dann darüber, dass sie noch mehr reden wollen, bis in die Nacht, und dann werden sie auf einmal in diesen kleinen Gruppen in den Hof gebracht und dort einfach abgeknallt. Okay.
Der fiktive Moderator, dessen gefällige Stimme an die des jungen Thomas Gottschalk erinnert, atmet pfeifend. Jetzt scheint er nachzudenken; vielleicht, mutmaßt Marianne, hat er gar kein Skript.
Sie schaltet ihr imaginäres Radio ab.
Das Mittagessen war akzeptabel. Marianne wünscht sich ein Nickerchen danach. Bevor ihre Augenlider tief genug sinken können, klingelt das Telefon mit den großen Tasten.
Die meisten hiesigen Ein- und Zweipersonenzellen sind mit so einem Gerät ausgestattet. Viele der Bewohnerinnen und Bewohner besitzen überdies ein Handy oder Smartphone. Als Mariannes Tochter ihr neulich zeigte, was das ist und wie es funktioniert, lachte die alte Frau: »Ha! Verstehe, für Bekloppte. Taschenrechner zum Reden, nein, danke.«
Das Riesentastentelefon im Zimmer benutzt Marianne selten. Will sie telefonieren, schleicht sie lieber zum Bahnhof und nutzt den allerletzten Münzfernsprecher der Stadt.
Dass die Telefonkarten, die ihr langjähriger Lebensgefährte, der vor neun Jahren verstorbene Winfried, so eifrig gesammelt hat, inzwischen ganz aus der Mode gekommen sind, findet sie sehr traurig. Solche Verluste begegnen ihr jetzt häufig.
Marianne nimmt den Hörer ab.
Filipa meldet sich: »Hallo! Du, ich hab die Schule geschwänzt.«
»Wir haben früher ›gestemmt‹ gesagt.«
»Wie, ›gestemmt‹? Wenn man was schafft, sagt man ›gestemmt‹, aber doch nicht, wenn man was gar nicht erst macht! Wie habt ihr das gesagt, ›ich hab die Schule gestemmt?‹«
»Nein, ohne Objekt. Einfach: ›Ich hab gestemmt.‹ Das hieß: Ich war nicht da, und zwar ohne guten Grund.«
»Ah. Also, dann hab ich heut gestemmt.«
»Und warum hast du gestemmt?«
»Wegen Tobi.«
»Das ist der mit den reichen Eltern?«
»Ja. Der hat das ganze Wochenende auf keine SMS geantwortet. Wahrscheinlich war er mit Hanna unterwegs. Als nix kam … da hab ich immer schlimmere SMSe geschickt, und dann ist mir eingefallen, was mache ich denn jetzt, wenn er die alle ihr gezeigt hat, und sie lachen drüber? Da hab ich mich so wahnsinnig geschämt. Da wollte ich sterben. Echt, ich habe gestern Nacht fast überhaupt nicht geschlafen und immer gedacht, ich geh zur Brücke und spring vor den ICE. Und dann bin ich heute Morgen aufgestanden und trotzdem los. Aber an der Bushaltestelle hab ich dann wieder gedacht, wenn ich heute einfach nicht hingehe, ohne Erklärung, und erst mittags im Sekretariat anrufe, und dann Mami anrufe, dass ich krank bin, und die dann … Na, da macht er sich wenigstens Sorgen. Dann muss er sich melden. Erst bin ich die ganze Zeit hier an der Bushaltestelle rumgestanden, nur mal zwischendurch rüber in die Bäckerei, dass ich nicht erfriere, das waren so Ideen, die ich ununterbrochen hatte, Erfrieren, Verhungern, Verdursten. Zwischendurch dachte ich immer, hier falle ich jetzt einfach um und bin tot.«
»Das hat aber nicht geklappt.«
»Hat’s nicht, nein. Und jetzt will ich … nur noch … nicht nach Hause. Kann ich zu dir kommen, und wir gehen spazieren oder so? Weil … das Ganze … das tut so weh, dass ich das Gefühl habe, allein davon, von der Warterei und weil ich mich so schäme, sterbe ich gleich von ganz alleine.«
»Na, komm. Hör mal …«
Marianne redet Filipa einige Minuten lang gut zu. Als das nicht fruchtet, will sie wissen, ob die Enkelin sich immer noch an der Bushaltestelle befindet.
Nein, sagt Filipa, sie sei beim Telefonieren bis zum Gewerbepark weiterspaziert. Marianne fragt, wie viel Bargeld Filipa bei sich habe. Als Filipa in verschiedenen Taschen etwa dreißig Euro findet, schlägt Marianne vor, man könne sich beim japanischen Garten treffen, in der Nähe des Gewerbeparks sei ein Taxistand. Falls Filipa von dort aus käme, träfe Marianne mit dem Taxi ungefähr zur selben Zeit bei den Japanern ein.
Filipa stimmt zu.
Ihr Taxifahrer stammt nicht aus Deutschland.
Er scheint verwirrt, erzählt brüllend von Kindern, die er hat oder haben will.
Filipa fragt sich während der Route, die er ausprobiert, ob er sie nach Warschau fahren wird, unter Geschrei. Filipa hat nicht direkt Angst vor ihm. Sie ist eher verblüfft. Nach zwei Versuchen, das Gebrüll zu kommentieren, versteht sie, dass der Mann gar nicht mit ihr redet, sondern Geister beschwört. Die letzten fünf Minuten der Fahrt verbringt Filipa mit Musik in den Ohren.
Die beiden Taxis treffen tatsächlich fast gleichzeitig vor dem schwarzen Tor zum Park ein. Als Filipa bezahlt, aussteigt und die Musikmaschine abschaltet, hat Marianne gerade damit begonnen, das Fahrzeug zu verlassen.
Der Fahrer und Filipa helfen ihr.
Marianne bedankt sich mürrisch. Filipa wechselt einen Blick mit dem Fahrer: Sie ist nicht böse, sie ärgert sich nur gern. Im Gehen lockert sich die Wut der alten Frau.
Bald hat sie Freude an der künstlichen Landschaft, den Azaleen, dem großen Ahorn mit dem malerisch gefärbten Laub, den Silhouetten der Kiefern, an Teichbambus und Steinplattenwegen. Felsen, Holzgatter, Moos. Kunst als Natur.
Aufmerksam hört sie zu, was Filipa zu erzählen hat.
»Ich kann’s gar nicht beschreiben. Mir ist schwindlig und übel gleichzeitig. Es fühlt sich an, als ob ich das selber gesehen hätte, wie er und seine Trulla da über mich lachen, über meine SMS. Ich mein, ich weiß ja, dass ich mir das nur ausdenke, aber … ich schau dauernd aufs Telefon, ob er sich jetzt gemeldet hat oder nicht, auf die Uhrzeit. Dann denke ich, jetzt ist große Pause, jetzt muss er sich melden. Aber er tut’s nicht. Dann denke ich, vielleicht kann er gerade nicht, vielleicht ist er umzingelt von seinen Kumpels und alles. Dauernd hör ich Musik, die ich dann aber gar nicht richtig mitkriege, weil immer der Gedanke kommt: Ich muss mich irgendwie ablenken, ich muss die Zeit irgendwie rumkriegen, bis er sich meldet. Normalerweise ist es doch so: Wenn man Musik hört, dann geht die Zeit ja schneller rum. Da hörst du mal zwei Stunden was und denkst, es war doch erst kurz vor zehn, wieso ist es jetzt schon zwölf? Aber es funktioniert eben nicht, es ist auf einmal umgekehrt: Ich hör was, und dann schau ich auf die Uhr, und es ist immer noch erst fünf Minuten später.«
Marianne denkt über gedehnte und gestauchte Zeit nach: Kennt die Heimleitung das Geheimnis, wie man die Ereignisgeschwindigkeit mit Musik manipuliert? Läuft vielleicht deshalb in den Gemeinschaftsräumen dauernd diese leichte Welle, damit die Alten nicht merken, wie das Leben durch die Sanduhr rinnt?
Filipa sagt: »Das Schlimmste sind diese … komischen … Schmerzen. Im Herz oder … im Kopf … es tut nicht körperlich weh, aber es ist wie … ich hab mir doch mal so schlimm die Hand verbrannt.«
»Ich erinnere mich«, sagt Marianne, »vor zwei Jahren, richtig?«
»Vor vier Jahren. Ich war zehn, das war beim Grillen mit Werner, mit Mamis Freund, wo ich umgefallen bin und dann mit der Hand auf den … da ist Haut kleben geblieben auf der heißen Platte, das war wie Käsefäden bei der Pizza, wie ich die Hand da weggezogen habe. Und danach … irgendwann, nicht gleich, aber so nach einer halben Stunde, fing das so irrsinnig mit den Schmerzen an, und ich dachte dauernd: Ich will jetzt sterben, damit das aufhört, und gleichzeitig war es eben so, dass ich dachte, ich sterbe schon davon. Und genau dieses Doppelte ist das jetzt auch.«
»Und deshalb bist du heute nicht in die Schule?«, sagt Marianne.
Filipa rümpft die Nase: »Bfff. Na ja. Es klingt total … Aber ich dachte, wenn ich weg bin, dann merkt er es mal richtig, und dann macht er sich Sorgen und …«, sie lacht, das erste Mal seit Tagen, »… und rettet mich.«
Sie schüttelt den Kopf und hilft Marianne auf eine Steintrittfläche.
Die Greisin bleibt stehen und betrachtet den Teich: große Seerosenblätter, Schatten der Fische im Wasser. Dann sagt sie, ohne Filipa anzusehen: »Das klappt nie. Wenn man weggeht, damit sie hinterherkommen. Das klappt nie. Ich hab das auch gemacht, mit deinem Opa.«
Der Opa ist für Filipa ein mythisches Wesen.
Sie weiß abstrakt, dass er aus biologischen Gründen existiert haben muss, aber »der Musiker in England« ist kein einprägsamer Name.
Filipa will beim Thema bleiben: »Na gut, nur … wenn man denkt: Ganz egal bin ich ihm nicht, das wissen wir doch, also müsste es doch was bewirken, wenn sich die ganze Sache für mich so extrem anfühlt, wenn ich davon fast sterbe – das müsste doch bei jemand, der mich zumindest nicht den letzten Dreck findet, irgendwas auslösen, dieses … dieses fast Sterben.«
Marianne sieht die Enkelin an und sagt: »Ich will dir was erzählen. Was das wert ist, wenn man sich darin suhlt, in der Vorstellung vom Sterben.«
»Kommt jetzt wieder so eine Geschichte vom Mao oder vom Stalin?«, fragt Filipa.
Es ist nicht spöttisch gemeint.
»Vom Stalin«, bestätigt die Großmutter.
Marianne möchte sich setzen. Die Enkelin führt sie zu einer der Bänke am Teichufer und hilft ihr, bis sie es bequem hat.
Die alte Frau beginnt: »Weißt du, was Albanien ist? Sozialistische Staaten? Enver Hoxha?«
Von alledem hat Marianne oft geredet. Filipa ist ehrlich: »Nicht genau.«
Marianne winkt ab: »Egal. Dann stell dir das vor wie im Märchen. Mit Kaisern und Königen. Du weißt, was der Unterschied zwischen einem Kaiser und einem König ist?«
»Ein Kaiser ist ein Oberkönig.«
Der Wind sucht Halt im Gras.
Marianne sagt: »Ungefähr richtig. Hitler, ein böser Kaiser, hat viele Könige im Osten überfallen. Stalin, ein guter Kaiser, hat ihn aufgehalten, zurückgetrieben und besiegt. So. Jetzt haben wir neue Könige im Osten, die dem Kaiser Stalin treu sind. Und der treueste von denen, das ist der König Enver Hoxha von Albanien. Der hat nun aber das Problem, dass einige westliche Könige, zum Beispiel der von Griechenland und der von England, ein Stück von seinem Albanien haben wollten, das noch ziemlich kaputt ist vom Weltkrieg. Und da geht also der König von Albanien, Enver Hoxha, eines Tages zum Kaiser Stalin, es ist … 1949, glaube ich … und erzählt ihm Folgendes: Als die Truppen von Hitler fast schon besiegt und aus dem Land Albanien geworfen waren, wollten die Engländer mit dem Hinweis, sie seien ja auch Feinde von Hitler und Verbündete der Albaner, mit den Albanern zusammen eine deutsche Garnison in einer Hafenstadt im Süden von Albanien ausheben, das heißt, sie wollten zusammen die Nazis, Hitlers Leute, verjagen. Sie sagten den Albanern: Wir machen das zusammen, und dann gehen wir wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Aber dann, obwohl die Nazis vertrieben sind, bleiben die Engländer da. Daraufhin sagen die Leute des Königs Enver Hoxha: Wenn ihr nicht sofort abhaut, schmeißen wir euch ins Meer. Da sagen die Engländer: Na gut, wir hauen ab, aber wir wollen Stützpunkte bei euch in den Häfen, weil wir euch geholfen haben. Und Stalin, dem Enver Hoxha das erzählt, sagt: Hmmm. Und Enver Hoxha fragt: Was machen wir jetzt? Sie wollen Stützpunkte in den Häfen! Und Stalin sagt: Nein, eure Häfen dürft ihr nicht hergeben. Auf eure Häfen müsst ihr gut aufpassen. Und Enver Hoxha sagt: O ja, wir sind die tapferen Albaner, wir sind zweihundertprozentige Kommunisten, wir werden die Häfen nicht preisgeben! Lieber, als dass wir sie preisgeben, werden wir sterben! Da sagt Stalin: Du hast mir nicht zugehört. Ihr sollt nicht sterben. Ihr sollt aufpassen.«
Fünf Minuten lang schweigen beide, die alte und die junge Frau.
Dann bittet Marianne mit leisen Geräuschen darum, dass Filipa ihr beim Aufstehen hilft. Als sie auf dem Kiesweg vorsichtig zum anderen Eingang des Parks gehen, sagt Filipa schließlich: »Ich hab’s kapiert. Was du mir sagen wolltest. Du wolltest sagen: Der Enwa Dingsda …«
»Enver Hoxha.«
»Der Enwa Hodscha ist wie ich mit seinem Gemache, von wegen: Sterben! Sterben! Wir sind bereit, zu sterben! Und der Stalin sagt ihm: Reg dich ab, das beeindruckt die andern kein Stück. Schau lieber zu, dass du … dass du …«
»Dich mit etwas beschäftigst, was gerade anliegt.«
»Aber wenn gerade nichts anliegt?«, fragt Filipa. »Ich meine, ich bin kein König und keine Königin. Ich muss keinen Hafen bewachen. Ich kann höchstens Musik hören. Und da schau ich halt dauernd auf die Uhr.«
»Dann mach was anderes als auf die Uhr schauen. Hör was anderes als Musik.«
»Was denn?«
Marianne lügt fröhlich: »Ich höre immer Sprechradio. Über Bücher, über Politik oder Kunst, oder Interviews. Heute Abend zum Beispiel …«
»Ach, das ist mir zu … ich weiß nicht, dann lieber Fernsehen oder DVD oder im Netz …«
Marianne wird energisch: »Nein, das muss Radio sein, wo du die Leute nicht siehst. Denn dann musst du sie dir vorstellen, das bringt dich auf andere Gedanken, weil … das ist viel … viel anstrengender als Musik. Und das Wort ›anstrengend‹, das meine ich als Lob.«
Enkelin und Großmutter haben den Taxistand am Blumenladen erreicht.
Filipa bleibt skeptisch, sie vermutet, dass die Vorstellung, »anstrengend« sei ein Lob, viel mit diesem Stalin zu tun hat, der ihr nicht geheuer ist.
Sie steigen gemeinsam in ein Taxi und fahren zum Heim, wo Filipa ihrer Großmutter wieder beim Aussteigen hilft und schließlich fünfzig Euro von ihr annimmt, wenn auch unter leichter Gegenwehr.
»Nimm, ich brauch es doch wirklich nicht!«, sagt Marianne. »Aber ruf mich heute Abend an, um halb zehn, da ist mein Radio vorbei. Dann kannst du gute Nacht sagen.«
»Gern!«
Filipa fährt weg.
Das Essen schmeckt Marianne schlechter als am Mittag. Schweigend verdrückt sie Schwarzbrot aus der Frischhaltefolie, Schinken wie Gummi, spült dann mit Hagebuttentee aus einem schlecht geputzten, schlierigen Glas nach.
Auf ihrem Zimmer liest sie noch zwei Stunden in der New York Times Book Review, dann schaltet sie das Fiktivradio ein:
In unserem Sendevergnügen »Gedichte heute« habe ich mich diesmal eingeladen, so dass ich selbst heute mein Gast bin. Ich heiße Erwin Matimmel und bin der wichtigste Dichter meiner Meinung nach. Das ist eine Meinung, die, wie man es in der Kunst häufig hat, ihre Gültigkeit beweist durch ein Kabinettstückchen als Beispiel. Das Kabinettstückchen ist mein neuestes Gedicht. Es heißt »Wie Popmusik die gute alte Zeit besiegte«. Es beginnt jetzt.
Wie Popmusik die gute alte Zeit besiegte
Gedicht
Von Erwin Matimmel
Yeah yeah und der Rock ’n’ Roll, ja das ist die Haselnuss
Am Brunnen vor den Schäfchen, Oh oh Morgenstund
Wie bist du doch beim Wandern die schönste Einigkeit und Freiheit!
Wahrlich, Azurro, so heißt mein Katzenwecker, der
Diesen Umstand auch nicht mag, den ganzen Tag,
Was ich euch sag, nur aber es …
Das Telefon mit den zu großen Tasten klingelt.
Filipa geht es nicht besser.
Sie sagt: »Ich hab’s mit der Musikidee probiert. Bringt nichts. Musik ist für mich erledigt.«
Marianne hat einen neuen Einfall: »Es sei denn, du machst sie selber.«
»Wie meinst du das?«
»Hast du dir eigentlich je überlegt, dass ich dir, bevor du wegen deinem Tobi da wirklich noch stirbst, auch einfach beibringen könnte, wie man Klavier spielt?«
»Nö. Nein, aber … wieso eigentlich nicht?«
Marianne malt das Programm aus, die Übungen, den Spaß.
Sie lachen, plaudern und phantasieren.
Als das Gespräch beendet ist, überlegt Marianne, ob sie das wirkliche Radio einschalten soll. Musik: Wieso eigentlich nicht? Bevor sie dem Impuls nachgeben kann, klopft es an der Tür.
Die Medikamentenausgabe hat schon nach dem Essen stattgefunden, mit Besuch rechnet Marianne nicht. So klingt ihre Stimme etwas ängstlich, als sie fragt: »Ja, bitte?«
Die Tür öffnet sich. Ein Mädchen, nicht älter als Filipa, tritt ein.
Marianne schaut die Fremde unsicher an.
Teiresias sagt: »Guten Abend. Sie kennen mich nicht, und ich kenne Sie nicht. Aber die Sonne kennt uns beide und braucht uns. Darf ich reinkommen?«
Konfrontation
Bernhard tritt barfuß und vorsichtig von einem glatten schwarzen Stein auf den anderen. In drei Schritten hat er den Bach überquert.
Die Moosinsel, deren grüne Härchen seine Sohlen am andern Ufer kitzeln, ist fast so kühl wie das Wasser, das seine Füße besprenkelt hat. Silbrig weiße Unterseiten von Lindenblättern leuchten ihn an, Flaumeichen und Rotbuchen stehen Spalier. Tiefer im Mischwald wachen Eiben, kein Tierlaut spricht. Bernhard lauscht: Bachglucksen, Herzklopfen, Schläfenblut. Er geht bergauf. Sanfter Wind streift seine groben Hosen, bewegt das Leinenhemd. Schnell findet er das Grundstück mit der Wartehütte im Teegarten.
Sträucher rascheln. Bernhard weiß, dass es hier keine Tiere gibt. Er denkt ungern ans Ungeheuer Einhundertsechsundneunzigtausendachthundertdreiundachtzig. Das Strauchzittern bricht ab, als fürchte es sich mit ihm. Der Besucher nähert sich dem Haupthaus, geht an der Laterne vor dem kleinen Brunnen vorbei. Schilf und Binsen stehen starr. Bernhard ist dankbar für die irdische Anmutung: Tiefendekor, das sich die Gastgeberin hat einfallen lassen, für ihn und die anderen Gäste. Es ist schön hier.
Er erreicht die Schwelle, hebt die Vorhangtür aus Bambusstreben vorsichtig beiseite.
Vo sitzt in mildem Licht. Sie wirkt nicht älter als Mitte zwanzig. Bernhard weiß, dass er an diesem Ort ähnlich jung aussieht. Vo zeichnet Blüten mit dem Kohlestift. Ihr Haar ist im Nacken zusammengebunden, ihr schlanker Hals liegt frei. Sie scheint zierlich, aber Bernhard weiß, wie gefährlich sie ist.
Er geht um sie herum, hockt sich ihr gegenüber im Schneidersitz auf den Boden. Draußen, erkennt er im Fenster, legt sich ein Schal aus Wolken um die schwarzen Bergspitzen.
Vo