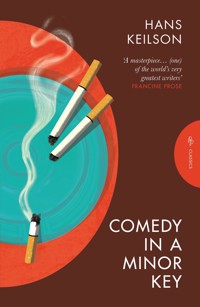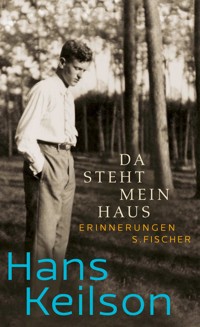
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Mit der Veränderung der Persönlichkeit ändert sich auch die Qualität der Erinnerung.« Diesen Satz zitiert Hans Keilson gleich zu Beginn seiner rückblickenden Erzählung. Es sind Spiegelungen und Splitter, leise und zweifelnde Betrachtungen, die in diesen ebenso bewegenden wie heiteren Erinnerungen aufscheinen. Die Jugend in Brandenburg, das Studium und das rauschende Leben in Berlin, das Exil in Holland – das sind die äußeren Stationen dieses Lebens. Wirtschaftskrise, Antisemitismus, Krieg, aber auch Freundschaft, Musik und Hoffnung bilden den Rahmen dazu. Entstanden in den neunziger Jahren, findet Hans Keilson in diesem Buch einen literarischen Ton, der seinem grandiosen und weltweit übersetzten Werk eine weitere Facette hinzufügt. An Stelle eines Nachworts findet sich am Schluss des Bandes ein ausführliches Gespräch über »hundert Jahre« Lebens- und Schaffenszeit. Gleichzeitig erscheinen ausgewählte Essays von Hans Keilson unter dem Titel ›Kein Plädoyer für eine Luftschaukel‹ und die Neuausgabe des frühen Romans ›Das Leben geht weiter‹. Lieferbar sind außerdem die Novelle ›Komödie in Moll‹ und der Roman ›Der Tod des Widersachers‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Hans Keilson
Da steht mein Haus
Erinnerungen
Herausgegeben von Heinrich Detering
Fischer e-books
Mit einem Gespräch zwischen Hans Keilson und dem Herausgeber
Da steht mein Haus
Erinnerungen
Geblüht im Sommerwinde,
gebleicht auf grüner Au,
liegt weiß es jetzt im Spinde
als Stolz der deutschen Frau.
1
Wer als Jude und Verfolgter auf der Flucht mitten in Europa gelebt und überlebt hat, dem bietet sich im Rückblick als Hintergrund seines Daseins nur eine einzige, ungebrochene Kontinuität an: die des Kalenders mit seinen eintönig wiederkehrenden Zahlen der Wochen und Monate, Wochen- und Sonn- und Festtagen, mit roter Farbe gedruckt und gültig in aller Welt.
Am 12. Dezember 1909 wurde ich in Freienwalde an der Oder geboren, als das dritte Kind meiner jüdischen Eltern. Das erste, ein Junge, starb kurz nach der Geburt, wahrscheinlich durch einen Kunstfehler des Arztes. Die Schlingen der Nabelschnur engten den Hals des Neugeborenen ein und erstickten das Kind. Im Januar 1907 kam meine Schwester Hilde zur Welt.
Mit der Veränderung der Persönlichkeit ändert sich auch die Qualität der Erinnerung. Dieser Satz – ich fand ihn in dem Lehrbuch Psychiatrie der Verfolgten meiner deutschen Kollegen von Baeyer, Häfner und Kisker – sollte am Anfang jedweden Erinnerungsberichtes stehen, aber gewiss am Anfang eines, wie ich ihn zu schreiben gedenke.
Es sind nicht nur die Erlebnisse und Schrecknisse der Kinderstube – es ist das Zeitalter, das mein Leben geprägt hat. Man muss erkennen, was man überwinden und beschreiben will. Der Umstand meiner Geburt als Jude im wilhelminischen Deutschland, rund fünf Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in einem kleinen, im Oderbruch gelegenen Kreisstädtchen der Mark Brandenburg, einst des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Streusandbüchse – mein Leben als Kind und Adoleszent unheilvoll verwoben in die Zeitläufte jener und auch der folgenden Jahre, der Inflation, der Fememorde und der Fridericus-Rex-Filme, für die einen »herrliche Zeiten« und Jahre des Aufbruchs, für andere, wenigere wie für mich und meine Angehörigen und Freunde letzthin Katastrophen – alles dies scheint mir erwähnenswert.
Mein Leben und meine Erinnerungen sind verätzt von den Schwaden der Zerstörung. Auch diese Aufzeichnungen, selbst dort, wo es sich um freundlichere, beglückende Erlebnisse handelt, deren man sich tröstlich erinnert, sind durchtränkt von bitteren Erfahrungen, unersetzlichen Verlusten und Abschieden, freiwilligen und ungewollten, zwei Weltkriegen. Ich habe als Kind Ausbruch und Ende des Ersten Weltkrieges und 1918, mit dessen Verlust, Zusammenbruch und Untergang des Kaiserreiches erlebt, die politischen und wirtschaftlichen Nachkriegswirren der Weimarer Republik, denen nicht nur die rein materielle Existenz meines Vaters erlag. Ich habe als Adoleszent die Zeit des emporkommenden und die Macht ergreifenden Nationalsozialismus, den Anbeginn der staatlich organisierten Judenverfolgung in Deutschland und das Ende des Rechtsstaates erlebt und schließlich auch die Vernichtung der jüdischen Gemeinschaft in den Niederlanden, wohin ich 1936 flüchtete.
Nicht die zeitliche Folge allein wird die Ereignisse zu einem Bild fügen, vielmehr die innerliche Verknüpfung der Gedanken und Empfindungen. Aber der Kern ist die unverbrüchliche Verbindung, die es zu verstehen gilt, von persönlichem Schicksal und den Einflüssen des Zeitgeschehens, von Gewalt und oft misslungenem Widerstand, ist das Wiederaufrufen von Bildern, ist ihr unverzagtes, unaufhaltsames Gegenüberstellen, wie es nur in demjenigen entsteht, der sich ohne Scheu ganz seinen Einfällen überlässt, um auf diese Weise zu der Wahrheit seines Lebens zu gelangen, das er erzählen will. Es werden eher Andeutungen, Anspielungen sein; Versuche, neben der äußeren auch die innere Lage des Ortes zu bestimmen, an dem ich mich gerade befand.
Erinnern heißt auch gedenken. Es wäre mir unmöglich, über meine Eltern, meine Kindheit, Freunde und auch Feinde und vor allem über die Zeit, da ich in Freienwalde zur Schule ging, meine ersten Schreibversuche unternahm, in Berlin lebte und studierte, unbefangen zu berichten, ohne der Umstände meiner Vertreibung davor und danach und auch meines Überlebens im Versteck zu gedenken. Alles hätte auch anders ablaufen können.
Zu diesen Umständen gehören auch die Jahre in den Niederlanden, vor, während und nach der feindlichen Besetzung, die Wiederaufnahme des ärztlichen Studiums in Amsterdam und der literarischen Bemühungen, meine Arbeit mit den jüdischen Kindern, die durch die Shoa zu Waisen geworden waren und in deren Betreuung ich mein eigenes Verwaistsein durchlebte. Dazu gehört aber vor allem auch das Leben mit meiner ersten, von Hause aus nichtjüdischen Frau, deren Impuls und Tatkraft ich das gemeinsame Ausweichen in das damals sicher erscheinende Holland verdanke, eine Illusion, wie sich alsbald erwies, aber doch ein Rettungsanker, stark und solide genug, um sich nach allem, dem Überwinden von Bedrohungen, Ängsten, aktuellen Gefahren, dank der mit unserem Kind gemeinsam erlebten Befreiung, in der Fremde endlich zu Hause zu fühlen.
Auch diese Aufzeichnungen schreibe ich in den Niederlanden, wo ich nach der Verfolgung für immer blieb.
2
Freienwalde war eine kleine, bescheidene Provinz- und Kreisstadt im Oderbruch, weithin sichtbar am Rande des unermesslichen Flachlandes, lang ausgestreckt zu Füßen einer Hügelkette. Es lag an einem verkümmerten Seitenarm der Oder, der als Kanal unweit des Bahndamms am östlichen Teil der Siedlungen seinen trägen Lauf nahm und am südlichen Ende versickerte. An beiden Ufern standen Fabriken und verschmutzten mit ihren Abfällen das an sich schon trübe Wasser. Vor unzähligen Jahren, in sagenhaften Zeiten, schleppten gewaltige Eisschollen Schutt, Geröll, Erdmassen mit sich und lagerten sie hier ab, indem sie wie eine Zange die Ebene einzwängten. Heute wellen sich sanfte Hügel, bestanden von düsteren Tannen, schlanken Birken, herben Buchen, aus dem Boden kommen heilkräftige Wasser. Die Erde brachte sich selbst zum Geschenk.
Wo die Hügel allmählich in das Flachland abfielen, waren rundherum Tonziegeleien entstanden, vereinzelt traf man sie auch in der Ebene an, inmitten der Felder und Weideplätze, in der Nähe eines halbversandeten, eingetrockneten Teiches. Landwirtschaft und Industrie bestanden hier dicht nebeneinander, die Fabriken waren ein gewaltiger Konkurrent, sie zogen viele Menschen an, der Bauer musste sie ernähren. In diesem Landstrich gab es keinen großen Wohlstand, der Boden trug Kartoffeln, Roggen, Gerste und Rüben, unveränderlich seit vielen Jahren, gerade genug, um das tägliche Leben zu fristen. Der Arbeiter in der Fabrik hatte es da schon besser, er tat für die vorgeschriebene Zeit seine Arbeit, war nicht abhängig von Wind und Wetter, vielmehr von der Gunst seines Herrn und der Lage auf dem Arbeitsmarkt – aber das kam erst später hinzu, als es immer mehr bergab ging.
Öfter sah ich vier bis fünf Männer in gestreifter Kleidung, als hätten sie Pyjamas an, einen großen Karren mit Holzscheiten durch die Straßen schieben. Das waren, wie meine Eltern mir sagten, Männer, die dort im Gefängnis eine Strafe absaßen. Ich fand, es war schon eine Strafe, dass sich die Männer in dieser Kleidung auf der Straße präsentieren mussten. Ein Gedanke, der einige Verwirrung in mir auslöste.
Ungefähr zehn Kilometer gen Osten, am Fuße einer Hügelkette, bahnte sich der mächtige, breite Oderstrom seinen Weg durch den Talkessel. Über das Wasser kam ein Gewitter herüber. Die Wolken standen drohend am Himmel, zu unheimlicher Schwärze geballt. Der Regen fiel ohne Unterlass. Nach vier Tagen strahlte der Himmel blau. Das Wasser strömte durch die Rinnsteine der Stadt, putzte die verschmutzten Straßen sauber und unsere nackten Füße, die wir am Rande der Bürgersteige in die reißenden Wässer hielten. Zu Zeiten der Schneeschmelze stieg das Wasser in der Oder, überflutete die Deiche und das Brachland und kam bis an die Tore der Stadt. Das Vieh, Kühe, Pferde und Schafe, war wieder in den Ställen, die Weidelande standen blank. Auch das Wasser hatte viele Gesichter.
Der Nähe des Flusses verdankte das Städtchen die Zufügung »an der Oder«. Und erst in den zwanziger Jahren erhielt es, seiner Moorbäder und heilenden Quellen wegen, den Titel »Bad«, eine Auszeichnung, wie die Bürger meinten, so dass ein jeder, auch ich, nicht ohne einen gewissen Stolz den Namen von jetzt an in voller Glorie aussprach: »Bad Freienwalde an der Oder.« Außerdem verbürgte die neue Titulatur mit der gesetzlichen Einführung der Kurtaxe eine gerüttelte Erhöhung der Preise für die Gäste des Kurbetriebes.
Da war der Kurpark, bestellt mit wetterfesten Stühlen und Tischen unter dem nur notdürftig schützenden Laubdach alter Kastanien. An der einen Seite des Parks die überdeckte Terrasse des Hotels, zu der eine breite steinerne Treppe hinaufführte. Oben stand, in seinem Stresemann, der Direktor oder Inhaber des Hotelbetriebes – ganz schlau wurde man nie, wem das alles nun eigentlich gehörte –, überschaute mit sympathisch-kritischem Blick das Gehen und Treiben von Gästen und Kellnern, das spannende Zusammenspiel von Wunsch und Erfüllung, Durst und Bier, süßer Gier und Kuchen, und verschwand wieder.
Ein anderes harmonisches Zusammenspiel vollzog sich weiter oben in dem offenen Rundbau der Kurkapelle. Da saßen oder standen die Geiger, Cellisten und Kontrabassisten, die Holz- und Blechbläser, Trommler und Paukisten. Es war die Stadtpfeife, die da musizierte, und sie musizierten wahrlich nicht schlecht. An Wochentagen nur in einer kleineren Besetzung, aber an Sonn- oder Festtagen saßen sie gedrängt, Pult an Pult, und spielten ihr Programm, das in einem Holzkästchen vorne am Geländer aufgehängt war. Dahinter stand, sichtbar erhöht, der Dirigent, der Leiter der Stadtpfeife, Herr Beug, ein selbstbewusster, schmächtiger Mann, ein Musikant in vielen Gassen, auf Hochzeiten, Begräbnissen, Turner- und Tanzfesten in der Stadt oder in den Dörfern rundherum. Er marschierte am Kopf seiner Kapelle, in Uniform, versteht sich, durch die Straßen der Stadt, und wir Kinder begleiteten ihn im Gleichschritt oder lauschten mit Bewunderung den gefälligen Weisen im Kurpark. Er erfüllte ein Bedürfnis, und er erfüllte es, wie man sagte, gut. Vor allem die bei ihm in der Stadtpfeife ausgebildeten Bläser, Trompeter, Posaunisten und was man die Humpabläser nennt, hatten, wenn sie die Stadtpfeife verließen, in den angesehenen Kapellen des Landes ein gutes Auskommen.
Unmittelbar an den Rundbau der Kurkapelle schlossen sich die überdeckten, mit Blumen verzierten Wandelgänge an, die Kurhallen. Hier befand sich ein unermüdlich Wasser spendender Brunnen, als sprudele er aus einer unerschöpflichen Wasserader sein heilbringendes Nass. Fortan sah man jedes Jahr eine wachsende Zahl von älteren Damen und Herren, gewichtig und mit Ernst, bei den ermunternden Klängen der städtischen Kurkapelle, aus Gläsern vermittels gläserner Röhrchen das genesende Wasser schlürfen und aller Welt kundtun, dass man zu einer von den Kassen anerkannten Kur weile, von der man sich Heilung versprach. Auch ich habe einmal aus heimlicher Neugier das Wasser getrunken. Es schmeckte abscheulich, und ich ließ es sein. Im Anschluss an die Wandelgänge lagen im hinteren Teil des Kurparks, umsäumt von Blumenbeeten, die medizinischen Gebäude für die ärztliche Betreuung, die Moorbäder und Untersuchungsräume mit den für damalige Zeiten modernen orthopädischen Apparaten.
Das Brunnental, umgeben von einer bewaldeten Hügelkette, in der Mitte das Kurhotel und auf den höher liegenden Seitenrändern schmale Gästehäuser, zu denen leicht ersteigbare Pfade hinaufführten – denn jede Strapaze musste den jeweiligen Patienten, den in ihren motorischen Funktionen behinderten Kurgästen, ja erspart bleiben –, das Brunnental war das sonntägliche Ziel der Bürger des Ortes und vieler Besucher aus der Umgebung und selbst aus Berlin. Sie kamen in imposanten Autos, die sie, unter der Obhut eines livrierten Wächters, auf den hierfür angewiesenen Parkplätzen am Eingang des Kurgartens stehenließen, und wir Kinder liefen dort herum und bestaunten die Gefährte und versuchten, uns die Namen der Firmenmarken einzuprägen, als gelte es Zeittafeln für den Geschichtsunterricht zu lernen.
Auch viele jüdische Gäste kamen mit ihren Autos nach Freienwalde, hauptsächlich aus Berlin. Einmal hörte ich meine Mutter den Vater fragen, was wohl der Herr Direktor oder Inhaber des Betriebes von diesen Gästen halte. Es war deutlich, dass sie selbst Schwierigkeiten hatte mit ihren Glaubensgenossen, die begütert waren und das ohne Umstände zur Schau trugen. Sie wusste, dass die Zahl der jüdischen Habenichtse, die man nicht sah und auch nicht sehen wollte, viel größer war. Mein Vater, Max, saß mit uns an einem Tisch im Park, rauchte seine Zigarre, vor sich ein Glas Bier. Er zuckte seine Achseln und hob sacht seine Hände, als wolle er sagen: »Was fragst du mich? Was soll er denken? Irgendwas wird er sich schon denken.« Dann nahm er einen Zug aus seiner Zigarre, blies den Rauch in den beschatteten Himmel, nippte an seinem Bier und sagte: »Lasst uns gehen. Ich werde zahlen.« Er rief den Kellner, wir gingen.
3
Die Synagoge in Freienwalde war ein kleines, weiß getünchtes und unscheinbares Gebäude, äußerlich nicht als Tempel zu erkennen. Sie lag in der Fischerstraße, die von der Bahnhofstraße in einem Bogen über holpriges Kopfsteinpflaster, umsäumt von niedrigen Wohnhäusern, zur Königstraße führte. Von der Königstraße führte die »Judentreppe« zur Fischerstraße, entlang am Synagogengarten, hinunter zum Eingang.