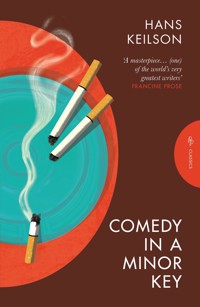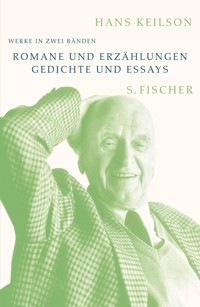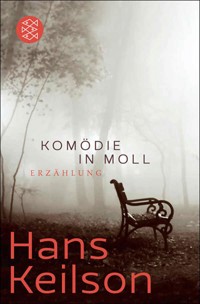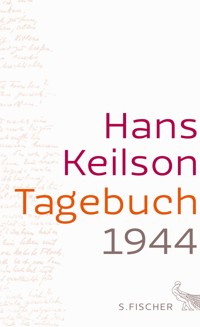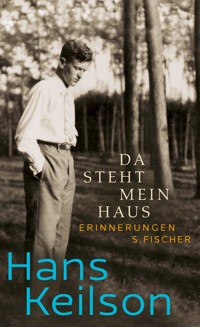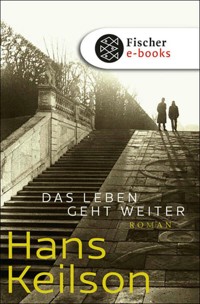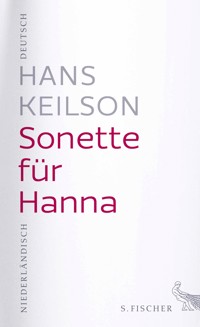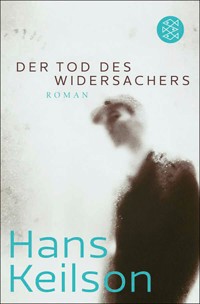
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum dieses aufregenden und subtil menschlichen Romans stehen ein junger Jude auf der Suche nach seinem Lebensweg und der politische Emporkömmling B., dessen Propaganda nach und nach ein bedrohliches, beklemmendes und zutiefst antisemitisches Klima erzeugt. Die symbiotische, ja schicksalshafte Verbindung von Täter und Opfer wird durch klare Beobachtung analysiert und durch das literarische Können des Autors zu einer allgemein menschlichen Parabel erhoben. 1942 begann Hans Keilson im holländischen Versteck mit der Niederschrift des Romans, der erst 1959 in Deutschland erscheinen konnte. Die amerikanische Neuausgabe 2010, zusammen mit der Novelle ›Komödie in Moll‹, rief weltweit begeisterte Reaktionen hervor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hans Keilson
Der Tod des Widersachers
Roman
Fischer e-books
Der Tod des Widersachers
Die hier veröffentlichten Aufzeichnungen wurden mir einige Zeit nach dem Krieg in Amsterdam von einem holländischen Advokaten übergeben. Er selbst hatte sie, wie er mir mitteilte, ungefähr zweieinhalb Jahre nach Kriegsausbruch von einem seiner Klienten erhalten, einem Mann Anfang Dreißig, der ihn zuweilen in harmlosen geschäftlichen Dingen um Rat gefragt hatte, wie es die tägliche Praxis eines Advokaten mit sich bringt. Zwischen ihnen beiden hatte nie ein besonders vertraulicher Ton geherrscht, der als Erklärung für die Tatsache hätte dienen können, daß jener ihm, seinem Rechtsbeistand, ein Bündel beschriebener Papiere überreichte, bevor er selbst für einige Zeit von der Bildfläche verschwand, um sich in Sicherheit zu begeben, nicht ohne vorher erklärt zu haben, daß diese Papiere den gegenwärtigen Besitzer nicht in Gefahr brächten und überall aufbewahrt werden könnten. Der Advokat hatte es jedoch für besser gehalten, sie mit eigenen Dingen und denen anderer Klienten unter seinem Hause einzugraben, wo sie den Krieg überstanden. Während jedoch die meisten vergrabenen Schriftstücke von ihren Besitzern wieder abgeholt werden konnten, blieben diese Aufzeichnungen in seinem Schreibpult liegen.
»Hier«, sagte er und überreichte mir das Bündel. Es war fleckig, zerknittert, die Schrift war zum Teil ausgelaufen, als hätte es längere Zeit im Wasser gelegen.
»Sie sind ja deutsch abgefaßt«, sagte ich überrascht.
»Lesen Sie«, erwiderte er kurz.
»Sie stammen also nicht von einem Holländer«, sagte ich.
»Nein. Lesen Sie und sagen Sie mir, was Sie davon halten.«
Ich begann nach dem Verfasser zu fragen, aber er wich jeder Antwort aus. Ich wußte, daß er vorzüglich Deutsch sprach, und erwog, ob er nicht selbst der Urheber sei. Ich stellte vorsichtige Fragen. Er lachte und sagte nur: »Lesen Sie, wenn Sie wollen.«
»Und was dann?« fragte ich weiter.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt Ihnen etwas ein.«
»Ist es keine Mystifikation?«
»Nein, nein«, erwiderte er hastig, »prüfen Sie selbst. Diese Papiere enthalten Aufzeichnungen, die ohne Zweifel als ein Versuch ihres Verfassers gedeutet werden müssen, über sehr persönliche Probleme seines Schicksals mit sich ins reine zu kommen. Aber lesen Sie erst, später können wir uns darüber unterhalten. Er war ein Verfolgter.«
»Das waren wir alle.«
»Sie bringen sie mir zurück?«
Er schloß die Schublade, aus der er sie herausgezogen hatte. Ich sah ihn an, wollte noch einige Fragen stellen. Doch er war ungeduldig. Ich unterließ es.
»Hat es Eile?« fragte ich nur.
»Nein«, erwiderte er. »Sie können mich hier in meiner Kanzlei treffen.«
Wir verabschiedeten uns.
Einige Tage später rief er mich an und erkundigte sich nach der Adresse eines gemeinsamen Bekannten, der plötzlich wieder aufgetaucht war. Ich gab sie ihm.
»Und?« fragte er.
»Ich hatte noch keine Zeit«, antwortete ich.
»Es hat keine Eile. Wir sehen uns?«
»Ich bringe sie Ihnen zurück!« sagte ich.
»Gut«, erwiderte er und lachte.
In den folgenden Tagen las ich sie.
»Ich bringe Ihnen Ihre Aufzeichnungen zurück.«
Der Advokat saß in seinem Büro hinter seinem vollbepackten Schreibtisch, ein Wahn von Zigarrendampf hing in der Luft.
Er kam mir entgegen und sagte: »Meine Aufzeichnungen? Denken Sie wirklich …? Es sind nicht die meinen.« Er lachte.
»Sie sind echt«, fuhr er fort.
Ich übergab ihm das Bündel.
»Eine Zigarre?«
»Danke.«
Wir setzten uns.
»Und?« begann er wiederum, »sagen Sie endlich etwas«, begann er mich auf eigentümliche Art zu einer Äußerung zu reizen, »sprechen Sie!«
»Was wollen Sie hören?«
»Nichts Bestimmtes, haben sie Ihnen gefallen? Nun, äußern Sie sich schon.«
Ich lachte. »Sie werden keine literarische Kritik von mir erwarten«, sagte ich. »Ästhetische Urteile sind die größten Mystifikationen, zu denen man sich verleiten lassen kann. Außerdem steht ja sehr deutlich in den Blättern, daß sie nicht als literarisches Produkt beabsichtigt waren. Es wäre unfair, dem nicht Rechnung zu tragen.«
»Eine diplomatische Antwort«, entgegnete er. »Ich empfing sie von dem Verfasser mit der Versicherung, daß sie kein Wort enthielten, das mich in Gefahr brächte, wenn ich sie aufbewahrte.«
»Haben Sie es ihm geglaubt?«
»Im Anfang ja, aber damals hatte ich sie noch nicht gelesen. Später warf ich einen Blick hinein.«
»Und dann?«
»Habe ich sie begraben. Sie sehen es dem Papier an, daß es feucht geworden ist. Wir leben in einem Wasserland.«
»Wie kann man so naiv sein zu glauben«, sagte ich. »Auch wenn er sich alle Mühe gegeben hat, in seinen Aufzeichnungen die Spuren zu verwischen, aus denen man genauere Schlüsse ziehen könnte, finde ich es ziemlich deutlich, wer der Schreiber war und woher er kam.«
»Ich auch«, antwortete er lachend.
»Er selbst anscheinend nicht. Ihn interessierte wohl nur die Camouflage.«
»Er schrieb es unter Druck im verborgenen, vergessen Sie das nicht«, sagte er heftig, »darum die ungenauen Angaben des Ortes und der Zeit. Aber halten Sie das für so wichtig?«
Ich sah ihn an.
Er war ein großer, breitschultriger Mann. Während des Hungerwinters war er um Pfunde abgemagert und hatte noch nicht sein früheres Aussehen wiedererlangt, das dem Bild entsprach, das man sich von ihm machte, ein gutgenährter, etwas schwerer holländischer Typ mit dem ausgeprägten Kopf eines Intellektuellen.
Ich wußte, daß er während des Krieges hinter den Kulissen eine hervorragende Rolle gespielt hatte und mit den Besatzungsbehörden auf eine ungemein schlaue und beflissene Weise umgegangen war, die ihnen mehr schadete als manches Sprengstoffattentat. Auch jetzt noch schien er imstande, mit diesen Aufzeichnungen mich zum Narren zu halten. Anscheinend erriet er meinen Zweifel. Es machte ihm Vergnügen, mich vorläufig im Ungewissen zu lassen.
»Eine merkwürdige Geschichte ist es auf jeden Fall«, sagte ich, »ein Elch, der um den Wolf trauert, der ihn zu fressen bestimmt ist. Eine menschlich fragwürdige Haltung, wenn ich sie auch begreife.«
»Sie vergessen«, erwiderte er feurig, »daß Tausende sich so haben jagen lassen, bis in den Tod. Ich habe es mitangesehen, wie sie den Süden unserer Stadt leergefegt haben.« Er schwieg, blickte dem Rauch seiner Zigarre nach. Mich hatte er so gut wie vergessen.
»Die Trams«, sagte er vor sich hin, »die Trams fuhren später unablässig in der Nacht, niemand schlief, und dann das Pfeifen und Kreischen der Wagen in den Geleisen, wenn sie in der Kurve lagen. Entsetzlich.«
Schweigen.
»Warum hat er seine Aufzeichnungen nach dem Kriege nicht zurückgeholt?« sagte ich. Der Advokat zuckte die Achseln. Er rauchte.
»Ich begreife es nicht«, fuhr ich fort.
»Viele haben ihre Sachen nicht mehr abgeholt.«
»Das ist etwas anderes.«
»Sie denken, daß er noch lebt?«
»Er hat es selbst geschrieben, er hat den Tod seines Widersachers geschildert.«
Er überlegte kurze Zeit, richtete seinen Blick auf mich und biß sich auf die Unterlippe.
»Er ist tot«, sagte er.
»Tot?«
»Ja, gefallen.«
»Aber er hat doch geschrieben?«
»Phantasie«, entgegnete er kurz.
Ich schwieg.
»Wann ist er gefallen?« fragte ich.
»Vor dem Ende.«
»Vor dem Ende?«
»Ja.«
Ich dachte darüber nach, daß er gefallen war, und schwieg.
»Er ist tot«, sagte er, »ich kann es Ihnen getrost erzählen. Er war einer unserer Helden. Kein Holländer von Geburt, er kam als Flüchtling ins Land. Später, kurz vor dem Krieg, ließ er seine Eltern nachkommen. Ich war ihm damals mit einem Gesuch an unsere Regierung behilflich. Sie lebten in einem Holzhaus, irgendwo auf dem Lande. Er leitete eine Fälscherzentrale, sie fälschte wichtige Stücke, Pässe, Dokumente. Außerdem stellte er Mikrofilme her. Nur wenige wußten es.«
»Und Sie?«
»Ich auch nicht.«
»Wie ist er denn gefallen?«
»Sehr simpel, sehr unheldisch, durch eine Liebesaffäre, er hatte ein Mädchen, das anscheinend das eine und das andere wußte.«
»Sie hat ihn verraten?«
»Es ist nicht bewiesen«, sagte er ruhig. »Wahrscheinlich hat sie mit einer Freundin darüber gesprochen. Ich glaube, sie liebte ihn. Die Freundin hatte anrüchige Beziehungen, ohne daß man direkt sagen kann, daß sie ihn verraten hat.«
»Eine komplizierte Sache«, erwiderte ich.
»Er war unvorsichtig«, sagte er, »das ist, wie mir scheint, die Lösung der Frage, unvorsichtig, wenn es um Frauen ging.«
»Um Frauen? Unvorsichtig, wenn es um die Liebe ging«, unterbrach ich ihn. Die Schärfe, die plötzlich in meine Stimme gefallen war, reute mich im gleichen Augenblick, als ich sein verwundertes Gesicht sah. Dennoch hatte ich nicht den Eindruck, daß er sich angefallen fühlte.
»Wenn es um die Liebe ging«, wiederholte er nachdenklich und nickte mir leicht zu, als verscheuche mein Zwischenwurf auch den letzten leisen Zweifel an seinem Ende.
Dann fuhr er fort: »Eines Tages erschien er am Nachmittag gegen vier Uhr zum Tee bei ihr.«
»Bewegte er sich frei?«
»Er hatte einen ausgezeichneten Paß.«
»Echt?«
»Gefälscht natürlich! Auf derselben Etage wohnte die Freundin des Chefs der gegnerischen Sicherheitsstelle. Anscheinend war man ihm auf der Spur. Die Freundin seiner Geliebten muß sich verplappert haben gegenüber der Freundin des Chefs. Er klingelte. Als die Tür geöffnet wurde, sah er oben an der Treppe eine Uniform. Er lief weg. Der andere folgte ihm, auf der Straße schoß er ihn nieder.«
»Eine Riesendummheit, er lief also in die Falle.«
»Die Geschichte ist noch nicht aus. Hören Sie. Er trug stets einen Revolver bei sich. Er war getroffen. Als er fiel, hatte er schon seinen Revolver gezogen und schoß im Fallen. Der andere starb kurz nach ihm.«
»Er hat also doch geschossen«, sagte ich.
»Ja«, erwiderte er. »Sie dachten, daß er log, was er schrieb? Natürlich hat er geschossen und gut getroffen, sie lagen beide auf dem Bürgersteig. Wir hatten einen guten Mann verloren und einen gefährlichen Feind. Zur Erinnerung haben wir an der Stelle, wo er fiel, eine Plakette anbringen lassen. Sie trägt nur seinen Namen und das Datum.«
(1942/1959)
I
Seit Tagen und Wochen denke ich an nichts anderes mehr als an den Tod. Jeden Morgen stehe ich, obwohl ich sonst lange und gerne schlafe, in der Frühe auf nach einer traumlosen Nacht. Ich fühle meine Kräfte stark und bereit in mir wie seit langem nicht mehr. Ich grüße den Tag, der mir den Gedanken an den Tod aufs neue bringt. Mit jedem Atemstoß dringt er tiefer bis in die verborgenste Stelle meines Körpers und erfüllt ihn ganz. Es ist der Tod, der mir die Feder führt, der Tod! Gott allein weiß, welches Erlebnis mir die Gedanken an ihn wie Eierchen in mein Gehirn gelegt hat, wo sie ungemerkt brüteten und reiften, bis sie eines Tages ausschlüpften und sich meinem Bewußtsein vorstellten. Aha, dachte ich, als er zum erstenmal in mir auftauchte, da ist er also, und begrüßte ihn, wie man einen guten alten Bekannten begrüßt, der einen Zug später kam, als man ihn erwartete. In Wahrheit hatte ich gar nicht so sehr auf ihn gewartet, er kam mir immer noch zu früh und überraschend. Ich wünschte ihn mir auch nicht herbei. Früher, wenn ich andere Menschen so über ihre Todesgedanken reden hörte – und über nichts lieben es die Menschen mehr sich auszulassen als über das, was sie ihr Letztes nennen –, blitzte es in mir auf: Und du, was ist mit dir und mit dem Tod, sag, wie hältst du es mit ihm? Dabei rauchte ich seelenruhig meine Zigarette und trank meinen süßen Tee, lauschte den Erzählungen der anderen und fühlte mich wohl. Nichts fiel mir weiter dazu ein. Auf jeden Fall war ich, was man einen interessierten Neutralen nennt. Der Tod – willkommen, dachte ich, oder zum Teufel –, bei Gott, ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Noch bin ich gesund, pfui, pfui, pfui, fühle mich bei meiner Jugend noch wohl und hoffe nicht, daß ich schon irgendwie ausersehen bin.
Dies alles ist verändert, seit ich an den Tod denke. Und weiter tue ich nichts als sitzen, sitzen und an ihn denken. So erfüllt bin ich, daß, schlüge man mir das Haupt vom Rumpf, mein Magen oder mein rechtes Kniegelenk die Tätigkeit des Denkens an ihn übernehmen und, ich wette, glücklich zu Ende führen würde. So voll bin ich vom Tod, so gesättigt.
Erzählen, wie er in meinen Kopf, in mich hineinkam? Ich entsinne mich nicht und will die Fäden lieber unentwirrt dort lassen, wo sie geknüpft wurden. Es ist das gleiche, wollte man die Frage des Arztes nach dem ersten Auftreten von Schmerzen am Arm nach bestem Wissen und Gewissen beantworten: An einem Dienstag, ich erinnere mich genau, ich ging über den Pferdemarkt und traf einen Bekannten. Er erzählte mir, daß er von Zeit zu Zeit ein zartes Stechen im Arm, oben in der Nähe des Gelenkes, verspüre. Vielleicht Rheumatismus, sage ich. Wer weiß auch, was das sein mag. Wie ich dann weiterlaufe, verspüre auch ich von Zeit zu Zeit so ein feines, leises Ziehen den Arm hinauf in die Schulter, da war es wieder, so zart, vielleicht daß eine Mutter so den ersten Stoß eines Kindes in ihrem Leib vernimmt. Aber nein, das weiß doch niemand, und wer es mir erzählte, wäre ein Narr, oder der andere ein Tor, wenn er es glaubte.
Ich kann nicht sagen, wie es war, als der Tod in mich fuhr, aber wohl, wie es war, als ich ihn verspürte. Wie wenn grimmige Schmerzen nachts den erlösenden Schlaf verstören, erging es mir. Nur daß es kein Schmerz war. Etwas ganz anderes, viel mehr Beseligendes, als ein Schmerz es sein kann, erfüllte mich. Ich verging fast.
Hier muß ich einfügen, welcher Art der Gedanke an den Tod war, der mich überfiel. Nicht der Gedanke an meinen Tod, den ich einst, bald oder in weiter Zukunft, sterben würde, ergriff mich. Beim ewigen Himmel der Nacht, ein so törichter Gedanke liegt mir fern, und ich hoffe nicht, daß ich mich je mit ihm zu beschweren brauche. Der Gedanke an den eigenen Tod – mich läßt der Gedanke kalt, unbewegt, vorerst kann er mich nicht erschüttern. Ich glaube nicht, daß ein ernsthafter Mensch sich je mit dem Gedanken an seinen Tod aufhalten wird. Dies ist nicht meine Sache, wird er sagen, mein Tod ist nicht meine Sache, und an ihn denken hieße sein Leben, das groß sein kann, wenn man es groß ersehnt, verkleinern, hieße die Grenzen angeben, denen es sich freiwillig fügen sollte. Ein Mensch wie ich – und ich bin nicht der einzige, zum Trost weiß ich das – lebt und arbeitet und beginnt sein tägliches Unternehmen in dem Gedanken, daß es so ewig und ununterbrochen weitergehen wird, im Namen des Himmels und aller Gerechten, bis ans Ende aller Zeiten.
Der Gedanke an den Tod meines Feindes war es, der mich wie in kalter Nacht durchfuhr und erschauern ließ. Der Tod meines Feindes
– ich denke ihn mit aller Seligkeit, die ein Gedanke haben kann für den, dem ein Gedanke etwas Lebendiges ist. Der Tod meines Feindes
– ich denke und erlebe ihn mit der Schwere und Erhabenheit, die ein Gedanke an einen Feind haben kann, der einem wert ist. Der Tod meines Feindes – zu jeder Stunde des Tages sind ihm ein Teil meiner Gedanken geweiht. Es sind die stolzesten Augenblicke über Tag, abgesehen von den Abenden und Nächten, wo kein anderer Gedanke als dieser mich beherrscht. Der Tod meines Feindes – gesegnet sei der Gedanke an den Tod meines Feindes. Man soll sich seinem Tod langsam entgegensehnen, wie die Braut dem Bräutigam, so sagen die Menschen, die ein eigenartiges Behagen darin schöpfen, die Sache des Todes und die der Liebe miteinander zu verbinden. Langsam soll man sich an ihn gewöhnen, um sich seiner wert und würdig zu erweisen. Nur wer dies erlernt hat, darf Anspruch erheben, sein Leben voll gestaltet zu haben. Aber ich sah viele, die sich an ihren eigenen Tod langsam und mit Schmerzen gewöhnt hatten, jedoch der Tod ihres Freundes warf sie um.
Wenige Menschen sah ich, die dem Tod ihres Feindes gewachsen waren. Seit mich dieser Gedanke ergriffen hat, hat sich mein Leben zu einem Ziel emporgeschwungen. Nie habe ich nach diesem Ziel gesucht noch gedacht, daß es mir je bereitet sein könnte. Ach, wie schmählich habe ich gelebt, bis ich erfuhr, welches Ziel auf Erden einem Menschen überhaupt bereitet sein kann. Was bedeuten sie alle, die anderen Ziele, die sich die Menschen selbst stecken, wähnend, Glückseligkeit, Liebe, Haß könnten sie hinwegtäuschen über den schalen Rest, der mit einem entseelten Körper zurückbleibt. Keine noch so hochherzige Lüge vermag den Brand zu löschen, den der Tod entfacht in den wahrhaft festlichen Gemütern zur Stunde des Erkennens. Ein Rauschen in den Lüften wie beim Fällen eines alten, starken Baumes, ein Pfeil, geschossen in das glitzernde Azur der Winterszeit – mein Gemüt ist festlich gestimmt, mein Feind betritt das weiße Land seines Todes.
Ich will, daß er, der zu seinen Lebzeiten wußte, daß er mein Feind war wie ich der seine, in seiner Sterbestunde eingedenk ist, daß mein Gedanke an seinen Tod unserer Feindschaft würdig ist. Ich trete auch jetzt keinen Zoll von ihr ab. Sie bleibt unser unvergängliches Eigentum noch in seiner letzten Erdenstunde. Ich bin es ihr, die unser Leben erfüllte, auch im Tode noch schuldig.
Ein langer Weg war es, bis mein Feind an sein Ende kam. Er führte von Sieg zu Sieg, zu Triumphen, die Bahn eines Unsterblichen. Er lief auch durch Niederungen, durch Sümpfe und Moraste, in denen es brütet und keimt von verborgenen Lüsten, mit Modergeruch voll Krankheit und Heimtücke – das Leben eines Sterblichen, so wie das meine. Heute hat er seinen größten Triumph erlitten: Er betritt das weiße Land seines Todes. Aber ein noch längerer Weg war es, bis ich, frei von allen kleinlichen Anlässen, deren sich Haß und Rache nur zu gerne bedienen, ihm auf seinem letzten Weg begegnete. Auch jetzt noch lebt ein Funke von Haß und Rache in meinen Gedanken, eine Spur von Gehässigkeit furcht sie. Ich wollte, ich könnte auch diese letzte Spur aus meinen Gedanken ausrotten, die wollüstigen Verzweigungen und Wurzeln von Schadenfreude und Wut: Ich bin es, der sitzt und wartet, und jener schreitet in seinen Tod, hört ihr es, jener schreitet in seinen Tod! Man kann sich nicht die Falten aus dem Gesicht herausschneiden, wie man die faulen Stellen aus einem Apfel herausschneidet, man muß sie tragen im Gesicht und wissen, daß man sie trägt, man sieht sie wie in einem Spiegel alle Tage, wenn man sich wäscht, man kann sie nicht herausschneiden, sie gehören in das Gesicht. Aber trotz allem, es ist ein festliches Warten, voll Freude und Trauer und Erinnerung und Abschied und Nimmerwiedersehn.
Ich wünschte ihm den Tod nicht, wie man jemandem etwas Schlechtes zudenkt oder mit Todeswünschen sich seine Widersacher vom Halse zu schaffen trachtet.
Was irren doch die Menschen, die glauben, der Tod sei eine Art Bestrafung. Auch ich, dies muß ich gestehen, war lange Zeit diesem Irrtum verfallen. So sehr haßte ich, so stark verlangte ich, mich zu rächen. Zu rächen nicht nur mich allein, mein eigenes Unglück, damals, als ich es noch groß und als ausschließliches Eigentum fühlte, das er über mich brachte, zu rächen auch die anderen von meinem Volke, die ebenso litten wie ich. Zum Glück erkannte ich noch beizeiten die Unsinnigkeit dieses Gedankens. Daß ich sie erkannte, auch dies verdanke ich meinem Feinde.
Mein Feind – ich werde ihn B. nennen – trat in mein Leben, ich erinnere mich, es sind seitdem rund zwanzig Jahre vergangen. Damals wußte ich nur undeutlich, was es bedeutet, Feind zu sein, und noch weniger, was es bedeutet, einen Feind zu haben. Man muß zu seinem Feind heranreifen wie zum besten Freund.
Oft hörte ich den Vater mit der Mutter darüber sprechen, zumeist im geheimnisvoll flüsternden Ton der Erwachsenen, damit von uns Kindern keines es höre. Es lag eine neue Art Vertraulichkeit in ihren Worten. Sie sprachen, um etwas zu verbergen. Aber die Kinder lernen, hellhörig durch sie, die Geheimnisse und Ängste der Älteren und wachsen an ihnen empor. Mein Vater sagte:
»Wenn B. je an die Macht kommt, dann gnade uns Gott! Dann werden wir noch etwas erleben.«
Meine Mutter erwiderte ruhiger: »Wer weiß, vielleicht kommt es auch anders. Ein so großer Herr ist er doch noch nicht.«
Ich trage das Bild noch in den Augen, wie sie damals zusammensaßen und miteinander sprachen.
Der Vater sitzt in der Küche auf einem niedrigen Stuhl, ein kleiner gedrungener Mann, etwas beleibt, und stützt seinen Ellenbogen auf den Rand des Schrankes, der die ganze Wand füllt. Seinen rundlichen Kopf hält er nach der Seite geneigt, die gespreizten Finger tragen die Last. Er hat gesprochen, aber sein seitlich gesenkter Kopf täuscht vor, als neigte er ein anderes Ohr vor, um eine Botschaft zu vernehmen. Er lauscht. Jedoch, es muß eine betrübliche Botschaft sein, die er vernommen hat. Sein Gesicht hat im Sprechen und Lauschen den Ausdruck von Betrübnis, Drangsal, wie wenn tief innen ein schwarzer Schleier in das Gesicht gefallen wäre, der es verhängt und zugleich als Hintergrund dient für alles, und darüberhin und davor ist das andere ausgespannt, das Äußere, Muskel, Haut, Haar, gleitet Bewegung, zuweilen noch ein Lächeln, aber immer, wenn man dieses Gesicht betrachtet, weiß man, dahinter liegt auf dem Grund, von dem aus es sich aufbaut, liegt, ganz von innen kommend, Drangsal, Betrübnis.
Seine Frau, die Mutter, ihm gegenüber an den Tisch gelehnt, neigt sich leicht vorwärts, hinein in den schmalen leeren Raum, den ein Gang zwischen ihnen läßt und den eine Fliege mit ihrem schweifenden Gesumme erfüllt, und sieht hinab auf ihn, der so klein dasitzt auf seinem Stuhl, kleiner als ein Kind, denn er ist ein Erwachsener. So hat sie sich unzählige Male hinabgebeugt zu allem, was kleiner und schwächer ist, und ohne daß sie es merkt, fällt ihr Körper von selbst hinein in dieses Sich-Zuneigen, obwohl er noch aufrecht und jung erscheint. Sie weiß, daß er nicht hört, was ihre Worte hinübertragen, daß nichts diesen Vorhang durchbricht, was von außen auf ihn prallt, aber daß das Sich-Neigen in den leeren Raum ihn erreicht. Er, der mit seiner Arbeit die Zeit in viele kleine Teile auseinanderbricht und die Bewegung gerinnen läßt in eine atemlose Pause zu Stillstand und Brache und dennoch in dieser Erstarrung noch etwas von dem, was sich bewegt, wiedereinzufangen sucht, Bewegung in Stillstand beleben will, fühlt die Bewegung auf sich zu und deutet aus ihr und entnimmt, was andere den Worten entnehmen.
Er war heraufgekommen aus seiner Dunkelkammer, in der die Platten in großen gläsernen Schalen gespült werden, bis das Bild auf ihnen entsteht, und war spornstreichs in die Küche gegangen, die er leer fand. Er setzte sich auf den niedrigsten Schemel, seine Frau hörte ihn heraufkommen und dort hineingehen. Sie ging zu ihm.
Die Küche ist der kahlste Fleck des ganzen Hauses, vollgestellt mit grüngestrichenen Möbeln, blank geschrubbt und glatt. Über dem Handtuchhalter hängt eine blaugestickte weiße Gardine, und um den Sims des Gestelles zieht sich ein Band weißer Spitzen. Alles ist kalt und wie abgeleckt. In der Mitte hängt ein weißer Lampendeckel an einer braunen Schnur tief herab. Hinter dem Rücken des Mannes verdeckt ein langer gelbverblichener Vorhang zwei hölzerne Bretter, vollgepackt mit Schuhen, und darunter liegen auf dem Fußboden in einer Ecke alte Zeitungen.
In diesem Augenblick betritt das Kind, das Stimmen durch die geschlossene Tür hörte, den Raum. Es sind Stimmen, die noch etwas ausdrücken, was hinter den Worten liegt, und das Kind, neugierig, wird davon in die Küche hineingezogen.
Die Küche ist für ein Kind ein Platz des Genusses und der süßen Geheimnisse, angenehmer Überraschungen, in die es am liebsten seine Finger hineinsteckt, um sie ablecken zu können, aber nicht der Platz für ernste Gespräche.
Vom Anfang ihres Gespräches weiß ich nichts, es sind nicht die Worte allein, an die ich mich erinnere, da in ihnen, für mein Bewußtsein zum erstenmal, der Name ausgesprochen wurde, den ich nicht mehr vergessen sollte. Aber Worte sind oft ganz unwichtig. Auch wenn man sie vergessen hat, man erinnert sich des ganzen Bildes, zweier Menschen, die sich in einer abgeleckten, kahlen Küche befinden, der eine sitzend und sein Haupt in die gespreizte Hand gestützt, der andere stehend, und zwischen ihnen ein schmaler, leerer Raum, in den sich ein Frauenkörper hineinhängt. Und auch des beiden Gemeinsamen erinnert man sich, das unaufhaltsam auf die beiden eindringt, der eine schon völlig erwartend und sich ihm entgegenlehnend, als flüchte er zu ihm hin, um in ihm Beschirmung zu finden, und der andere sich dagegen aufbäumend, noch aufständig, bereit, es mit ihm aufzunehmen: die unaufhaltsame Bedrängnis. Sie liegt in dem ganzen Bild, wie es sich geschlossen darbietet, aber auch in jedem Ausschnitt, in der Falte des verblichenen Vorhanges, vor dem der Vater sitzt, in der Fliege, die um die Lampe kreist und den leeren Raum zwischen den beiden mit ihrem summenden Fluge ausmißt. Sie liegt auch in dem blanken, geschrubbten Holzfußboden und in den geschlossenen Schranktüren und in dem Schalterknopf am Eingang der Tür. Die unaufhaltsame Bedrängnis liegt in allem, und wessen man sich auch einzeln erinnert, dieses oder jenes, eines zieht das andere mit herauf und verdichtet sich zu dem Ganzen, das tief innen geblieben ist in der Erinnerung und immer noch bleibt. Es ist nicht Angst, es ist etwas viel Stärkeres und Gefaßteres, als Angst ist, wenn sie in dir aufbricht. Du kannst nämlich fühlen, wie es langsam sich dir naht und auf die Schultern drückt. Du kannst dagegenstoßen, in es hineinbeißen und dich dagegenstemmen. Es ist so wirklich wie der Schalterknopf und die Fliege und die alten Zeitungen in der Ecke hinter dem Vorhang.
Alles das war der Eindruck weniger Sekunden, als ich eintrat. Das Gespräch zwischen ihnen lief noch einige Sätze weiter. Mein Vater sah mich dabei prüfend an, als dächte er über mich ernsthaft nach. Das Dunkle in seinen Augen verschwand. Die Mutter lehnte sich zurück und lachte mir zu.
»Soweit ist es noch lange nicht«, sagte sie. »Und wer weiß.«
Er holte einen Auslöser aus der Tasche und begann mit ihm zu spielen.
»Heute habe ich einen Hund und eine Katze fotografiert«, sagte er.
»Ja«, rief ich erfreut. »Haben sie sich vertragen?«
»Nein«, erwiderte er belustigt.
»Wie hast du sie dann aufgenommen?« fragte ich.
»Ich werde es dir erzählen. Eine Frau kommt in mein Atelier. An der Hand führt sie an der Leine eine schöne, große Dogge, am anderen Arm hängt ein Henkelkörbchen mit einer Chinchillakatze. ›Das sind Bützi und Hützi‹, sagt sie. ›Ich bringe sie Ihnen zu einer Aufnahme. Es sind die bravsten Tiere der Welt, schon ein Jahr leben sie zusammen. Es sind unsere Kinder, nur daß sie sich besser als Geschwister vertragen. Mein Mann wünscht zu seinem Geburtstag eine Fotografie von beiden, wie sie friedlich nebeneinanderliegen. Ich will sie ihm schenken, verstehen Sie, zur Erinnerung.‹«
»Zu welcher Erinnerung?« unterbrach ich ihn.
»Nun, daß Hunde und Katzen friedlich in diesem Hause leben.«
»Du mit deinen Geschichten«, sagte die Mutter lachend und erhob drohend ihren Finger.
»Es ist aber eine wahre Geschichte«, verteidigte er sich.
»Wahr oder nicht«, fuhr sie belustigt fort.
»Aber sie haben sich ja gar nicht vertragen«, warf ich auf einmal dazwischen, »zu Beginn hast du es wenigstens gesagt, also …«
»Ihr habt mich nicht ausreden lassen.« Und dann fuhr er fort: »Die Frau holt das Kätzchen aus dem Körbchen und setzt es auf die Erde. Der Hund setzt sich auf seine Hinterpfoten, steht wieder auf und trottet gutmütig durch das Atelier. Das Kätzchen schleicht sich unter den Tisch und beginnt sich zu lecken. Inzwischen unterhandle ich mit der Frau, wir besprechen die Größe und die Zahl der Abzüge. Sie bestellt sich eine solche Anzahl, als wollte sie ihrer ganzen Familie und allen ihren Freunden einen Abzug zur Erinnerung schenken. Wir einigen uns über den Preis. Im stillen überlege ich das Arrangement. Es soll ein einfaches Foto sein. ›Vielleicht einen kleinen Tisch mit Blumen dahinter?‹ frage ich. ›Ach ja‹, antwortet sie, und kurz darauf, ›ach nein, lieber nicht, es soll nur ein Foto von beiden sein, und Blumen würden nur stören.‹ Ich schiebe einen niedrigen Sessel herbei, werfe ein gelbliches Tuch darüber, die Frau lockt das Kätzchen unter dem Tisch hervor, hebt es auf den Sessel, es beginnt zu schnurren, der Hund kommt herbeigetrottet und läßt sich auf Zuspruch wieder auf seine Hinterpfoten nieder. Ich rücke meine Lampen zurecht, schalte die Deckenbeleuchtung ein, bringe zwei kleine Scheinwerfer in Stellung, um die Gruppe ins richtige Licht zu setzen. Die Frau steht bei den Tieren und spricht ihnen gut zu. Inzwischen ist das Kätzchen herabgesprungen, der Hund sitzt fest auf seinem Platz und sieht interessiert zu. ›Bützi, komm‹, ruft die Frau. Bützi schleicht heran und wird wieder auf den Sessel gehoben, bleibt einen Augenblick ruhig sitzen, reckt sein Hälschen, schaut nach oben, so daß es den Anschein hat, als ob es seine Schnurrhaare unter der Nase und auf der Oberlippe balanciere, es blinzelt, schaut unruhig nach rechts und links und springt wieder hinab. Im gleichen Augenblick ruft die Frau: ›Ach, ich habe vergessen, ihr das Halsbändchen umzutun‹, und kramt in ihrer Tasche. ›Wenn ich es nur nicht vergessen habe‹, murmelt sie. ›Nein, da ist es, komm, Bützi, komm, ich muß dir dein Halsbändchen umtun, du mußt doch schön sein, wenn du fotografiert wirst.‹ Das Kätzchen sitzt wieder unter dem Tisch und kommt mit seinem gespannt-zögernden Gang gravitätisch hervorgeschlichen. Die Frau beugt sich hinunter und macht das Halsband fest. Dann hebt sie das Kätzchen wieder auf den Sessel, und im gleichen Augenblick, als ihre Hände den Tierleib entlassen, trifft das Kätzchen Anstalten, wieder hinabzuspringen. ›Aber Bützi‹, ruft die Frau ein wenig verärgert, und während sie mit ihren Händen das Tier leicht auf den Sessel drückt, dreht sie sich um und fragt mich, ob es noch lange dauert, sichtlich nervös und unsicher geworden über den Erfolg der in Aussicht genommenen Vorstellung. ›Ich bin soweit‹, sage ich. ›Nur dieses Kabel noch, so.‹ – ›Das viele Licht macht sie nervös‹, ruft die Frau.«
Er unterbrach seine Erzählung und sah mich spöttisch an. »Auch Mütter müssen immer das Betragen ihrer Kinder, die sie zuvor als einen Ausbund von Tugenden dargestellt haben, beschönigen, wenn diese sich vor allem Volke vergaloppieren – ist es nicht so?«
Sein rundliches Haupt hielt er zur Seite geneigt, seine etwas zugekniffenen Augen blinzelten im Kreise herum. Er schwieg, als erwarte er Beifall. Er liebte es, sich von Zeit zu Zeit in solchen allgemeinen Betrachtungen zu gefallen, unter der Maske einer objektiv gültigen Feststellung, während jedem von uns seine Anspielung deutlich war. Aber die Mutter hatte im Laufe der Jahre gelernt, dergleichen über sich ergehen zu lassen. Sie schwieg ebenfalls, als stehe sie ganz im Bann seiner Geschichte und warte auf die Fortsetzung.
»Also«, fuhr er fort und nahm seine alte Haltung wieder ein, »während die Frau ihr Kätzchen in Schutz nimmt, sehe ich ihr rot angelaufenes Gesicht und sehe weiter, daß auch sie selbst sich ausstaffiert hat, als käme sie mit auf das Bild. ›Wollen Sie nicht das Kätzchen auf den Schoß nehmen?‹ frage ich. Sie zögert mit der Antwort und sagt nur: ›Meinen Sie, und was kostet das?‹ – ›Natürlich‹, sage ich, ›dann hat Ihr Mann alles, was er liebt, auf einem Bild, und es kostet Sie keinen Pfennig mehr.‹ Sie zögert noch einmal, tritt langsam von dem Sessel zurück, denkt nach, sieht auf die Tiere, sieht zu mir herüber und schweigt. Inzwischen sitzt Bützi noch immer auf dem Sessel, ich prüfe die erste Einstellung. ›Ach nein‹, sagt sie, ›nur die Tiere, so wie es in Wirklichkeit ist.‹ Da beginnt die Dogge – die ganze Zeit hat sie ruhig und breit gesessen und zugeschaut, wie das Kätzchen sich schlecht aufgeführt hat –, jetzt reißt sie ihr Maul weit auf und gähnt, erhebt sich, dreht sich etlichemal im Kreise und setzt sich wieder hin, aber diesmal mit dem Rücken zum Apparat. Bützi schaut verwundert. ›Hützi‹, ruft die Frau von der Seite, wo sie ihren resignierten Posten bezogen hat, und läuft erbost zu den Tieren, packt den Hund am Halsband und dreht ihn mit einem Ruck dem Objektiv zu. Ihre Nervosität ist so groß, daß die Tiere von ihr ergriffen werden. Wieder ist Bützi unter den Tisch gesprungen, und Hützi hat sich in den Falten eines Vorhanges verwickelt. Ist Bützi auf einen abgedankten Scheinwerfer gesprungen, steht Hützi vor dem großen Fenster, schaut hinaus, während ihre Herrin vergebens lockend und drohend die Gunst der Tiere wiederzuerlangen sucht. Es ist ein Schleichen und Trotten, ein Springen und Laufen durch das Atelier, ein lautlos-feierlicher Protest der Tiere dagegen, ihren widernatürlichen häuslichen Frieden zur Schau zu stellen. Und dazwischen die aufgeregte ratlose Frau, schwitzend von Gekränktheit, Enttäuschung und den tausendkerzigen Lampen, stets mit Ausrufen die Stille durchbrechend, wie: ›Ach, Hützi‹, ›Komm, Bützi‹, ›Ach nein‹, ›Komm auf deinen Platz‹, ›Komm zu deinem Frauchen‹, und dann die Beteuerung, daß sie zu Hause so friedlich miteinander lebten. ›Sicher sind es die Lampen, die sie beunruhigen, sie sind es eben nicht gewöhnt, und nun muß ich für meinen Mann doch ein anderes Geschenk ausdenken!‹«
»Wenn du dem Kätzchen Milch gegeben hättest«, sagte ich, »dann hättest du sie doch fotografieren können, aber so … wie schade!«
»Ich habe sie aber dennoch fotografiert«, sagte der Vater vielsagend.
»Ja?« rief ich jubelnd, »erzähle, wie du das gemacht hast.«
»Komm mit«, sagte er. »Ich werde dir zeigen, was ich getan habe.«
»Du kannst es mir später auch zeigen«, sagte die Mutter und verschwand.
Wir gingen durch das Atelier, in dem noch der Sessel und die Geräte standen. Das Licht war ausgeschaltet.
Wie das künstliche Licht ein anderes Licht ist als das des Tages, so ist das Dunkel der Dunkelkammer ein anderes als das Dunkel der Nacht. Soeben bist du noch durch ein helles Zimmer gegangen, in das von allen Seiten Licht hereinflutet, und jetzt stehst du in einer Dunkelkammer, aber draußen ist es Tag. Wie ist es dunkel hier, sagst du zu dir selbst, vielleicht auch, um dir ein wenig Mut zu machen im Dunkeln. Wer weiß, welche Gedanken in einem solchen abgeschlossenen Raum, der dunkel ist, in dir heraufkommen, während dich das Bewußtsein nicht verläßt, daß draußen Helle, Licht, Tag ist. Aber wenn du am Abend von einem erleuchteten Zimmer in ein anderes hinüberwechselst, in dem Dunkelheit herrscht, dann ist es wiederum etwas ganz anderes, und du bist ein anderer am Abend. Aber jetzt kannst du jeden Augenblick zurückkehren aus dem Schwarzen in das andere, das Helle, wenn du nur willst. Aber nein, du hast es freiwillig auf dich genommen und bleibst. Draußen ist es Tag. Du bist eingetreten, und deine Augen sind geblendet von so viel Dunkelheit. Es spielt tief in den Pigmentkernen deiner Augen, es schmerzt, nur einen Augenblick, daß du die Lider zukneifst und wartest, bis zwischen den Zapfen und Stäbchen innen eine andere Verabredung getroffen ist. Beides ist in dir, das Dunkle und das Helle, tief in der Netzhaut sind sie dir zu eigen, und du kannst sie wählen aus demselben Brunnen, je nachdem wo du dich befindest, im Hellen oder im Dunkeln. Wenn du sie wieder in der Dunkelkammer aufschlägst, sehen deine Augen in einer Ecke des Raumes ein glühendes Pünktchen, es ist rot. Du hast es anfangs nicht gesehen in soviel Dunkelheit, aber jetzt siehst du es. Ausgespannt mitten in dem Schwarzen hängt es und gibt nur einen matten, kleinen Schein. Es ist kein Licht, das leuchtet, es macht die Dunkelheit nur tiefer, sichtbarer, und du greifst sie mit dem Dunkel in deinen Augen und trägst sie herum in deinem Körper und deinen Händen, wie sie dich mit sich trägt und dich mahnt, daß das Schöpferwort jeden Augenblick ausgesprochen werden kann. Stille und Dunkelheit und der Schlag des Herzens.
»Komm her«, sagt der Vater, und ich sehe in der milden Finsternis, wie er aus einer großen Schale mit Flüssigkeit eine dunkle Platte herausfischt, von der die Tropfen in die Schale zurückfallen, und sie gegen das rote Lämpchen hält. Ich sehe auch seine Gestalt mit leichtem Schnitt aus der Dunkelheit herausgelöst, so daß ich seine Bewegungen beim Spülen erkennen kann. Ich höre nach langem Schweigen seine Stimme, sie erscheint mir tiefer und voller. Erwartungsvolle Angst steigt in mir auf, jedesmal wenn ich hier allein mit ihm bin, auf eine andere Weise allein bin, als wenn ich in einem taghellen Zimmer mit ihm zusammensitze. Denn in der Dunkelheit wird die Tat gezeugt eines jeglichen, man kann sie ins Helle und wieder ins Dunkle tragen, im Dunkel wird sie gezeugt.
»Das ist ein Hund«, sage ich mit gedämpfter Stimme.
»Das ist Hützi«, sagt er.
»Und hier?« Er zeigt mir eine neue Platte.
»Bützi!« rufe ich. »Du hast sie also doch aufgenommen!«
»Aber jedes für sich allein.«
»Sie haben sich nicht vertragen«, sage ich. »Und jetzt?«
»Ich bringe beide auf eine Platte und mache davon einen Abzug. Und auf dem Bild sitzen Hützi und Bützi friedlich zusammen, wie sie zu Hause sitzen. Dies ist das Geburtstagsgeschenk.«
Die beiden Fotoplatten liegen wieder in der großen, gläsernen Schale. Ich sehe ihn an, mir scheint, als sei es heller im Dunkel geworden. Ich erkenne die Züge seines fleischigen Gesichtes, auf dem etwas Triumphierendes liegt. Es ist kein Schatten mehr, es ist wieder eine Gestalt geworden.
Und ich sage: »Eigentlich ist es gar nicht wahr, denn sie haben hier doch nicht zusammengesessen.« Zugleich fühle ich eine Bewunderung für ihn in mir aufsteigen, obwohl meine Worte anscheinend nur Kritik enthalten.
»Was macht das?« sagt er erstaunt. »Das nennt man eine Trickaufnahme.«
»Aber es ist nicht wahr«, wiederhole ich hartnäckig. »Du machst es und findest es sehr spaßig, aber eigentlich ist es gemogelt!«
»Ach was!« Er ist ungehalten. »Das ist eben der Trick. Das verstehst du noch nicht.« Es ist wieder dunkler geworden in der Kammer. Er hat das rote Lämpchen ausgeschaltet.
»Komm!«
Ich fühle mich an den Schultern gepackt, und tappend werde ich durch das Dunkel geschoben, schwarz verhangene Wände entlang, durch gewundene Gänge, in die von außen Lichtstäubchen fallen. Dann wird ein schwarzer Vorhang zur Seite geschoben, die Ringe gleiten hell auf der eisernen Stange, und wir stehen preisgegeben dem vollen, hellen Licht des Tages.
Ich fühle, daß ich etwas gutzumachen habe, und frage dumpf: »Darf ich dabeisein, wenn du es machst?«
Er schaut mich nicht an, sieht durch das große Fenster des Ateliers hinaus auf den Vorgarten und sagt verbissen: »Nein!«
›Dann gnade uns Gott.‹ Die Worte meines Vaters liefen mir noch lange nach. ›Dann gnade uns Gott …‹ Wer war dieser Mann, daß er die Gnade Gottes für uns nötig machte, von der mein Vater nur bebend sprach?
Eines Tages stellte ich den Vater und fragte ihn ohne Umschweife. Gelassen nahm er dieses Mal meine Frage hin.
»B. ist unser Feind«, sagte er und sah mich nachdenklich an.
»Unser Feind«, sagte ich ungläubig.
»Was erzählst du wieder für Geschichten!« rief meine Mutter aus dem Nebenzimmer. Ihre Stimme zitterte.
»Er hat mich gefragt, und ich gebe ihm eine Antwort«, rief er zurück.
»Vergiß nicht, er ist noch ein Kind!«
»Er wird es aber begreifen«, sagte er. »Ist es etwa nicht wahr?«
Sie schwieg.
»Unser Feind?« wiederholte ich ungläubig.
»Ja, der deine und der meine und vieler anderer Feind auch!« Er lachte laut, ich dachte, daß er über mich lachte. Seine Mundwinkel hingen herab. Geringschätzig sah er mich an.
»Jetzt ist es genug!« ertönte wieder die Stimme aus dem Nebenzimmer.
»Warum?«
»Du brauchst ihm nicht auf jede Frage zu antworten! Gehe hinunter auf die Straße spielen, Kind«, fügte sie hinzu.
Ich sah ihn unentwegt an.
»Auch der meine?« fragte ich. »Ich kenne ihn ja nicht, kennt er mich denn?«
»Gewiß, der deine auch. Wir werden ihn kennenlernen, fürchte ich.«
»Warum aber?« fragte ich weiter. »Was haben wir denn getan?«
»Wir sind …«, erwiderte mein Vater.
Stille.
Meine Mutter trat ins Zimmer.
Was diese Antwort mit meiner Frage zu schaffen hatte, ist mir im Grunde damals nie klargeworden, so tiefsinnige und wohlerwogene Erklärungen ich auch später noch zu hören bekam. Alles schien mir eher ein Wahn zu sein.
Wie es dann mit der Gnade Gottes bestellt sei, fragte ich meinen Vater nie. Denn aus seinen Worten verspürte ich seinen Ingrimm und die ganze Bitterkeit, mit der er eine große Gefahr zu verkleinern trachtete. Vergebens. Soweit hatte ich ihn schon damals begriffen, daß B. als Feind mächtig war und noch mächtiger werden konnte, so daß einzig Gott mit seiner Gnade ihm widerstehen konnte. Doch eines begriff ich nicht. Genausowenig wie ich wußte, wer er war, von dem mein Vater als unserem Feind sprach, ebensowenig wußte ich, wer Gott war, von dessen Gnade mein Vater sprach. Ich kannte sie beide nicht. Aber sie beide waren da.
»Aber noch ist es nicht soweit«, fügte mein Vater milder lächelnd hinzu, um mich zu beschwichtigen, da er meine Stummheit richtig deutete. Mir schien es jedoch, als wenn er mit seinen Worten mehr sich selbst besänftigen wollte.
Dies geschah, als ich zehn Jahre alt war, und von diesem Zeitpunkt an stand hinter meiner Jugend ein doppelter Schatten, den die Worte meines Vaters heraufbeschworen hatten. Bis zu welchen Maßen er aufsteigen sollte, konnte ich damals noch nicht ahnen. Ich empfand nur das Fremde, das, ohne daß ich es mit Worten genauer hätte umschreiben können, auf einmal in mein Leben getreten war. Meine kindliche Unbefangenheit war angetastet. Ein leichter Riß, der mit den Jahren zu einer Wunde klaffte, die tief ins Fleisch drang, ohne sich zu schließen.
II
Ich habe meine Aufzeichnungen noch einmal durchgelesen und bin erschrocken. Ich möchte nicht in den Verdacht geraten, hier zu sitzen und mich zu bemühen, einen Roman zu schreiben. Ich habe viele Berufe gehabt und viel Lehrgeld zahlen müssen, aber nie den eines Schreibers.
Ich bin auch Sportlehrer. Meine Hände sind mehr geeignet, einen Ball oder eine Kugel zu halten als einen Federhalter. Abgesehen von meiner Unerfahrenheit, meine Gedanken und Gefühle in allgemein faßlichen Sätzen zum Ausdruck zu bringen, verbindet sich meine Beobachtung mit zuwenig Geduld, warten zu können, bis das Bild gerundet entsteht. Das Detail, das schnell zu bewältigen ist, reizt mich, die kurze Strecke der Sprinter ist meine Bahn.
Wenn ich mich jedoch einmal überwand und mich in Geduld faßte, merkte ich bald, daß mich meine Beine auch über längere Strecken trugen. Nie ließ mich mein Atem im Stich, vom Regelmaß des Herzschlags zu schweigen. Aber ich gab auf aus Langeweile. Meiner Ausdauer mangelt es an Phantasie. Zudem hasse ich die Prozedur. Mein Vater war Fotograf. Ein Roman oder eine Erzählung besteht ebenso wie der Film aus einzelnen aus der Zeiteinheit gebrochenen fotografischen Aufnahmen, die zusammengefügt den Eindruck einer sich unablässig durch die Zeit bewegenden Handlung erwecken sollen und in der Tat auch erwecken. Man wird begreifen, wenn ich erkläre, daß ich genug habe von Tricks aller Art. Gewichtige Fachleute, die sich Psychologen nennen, behaupten, wie ich gelesen habe, daß unser menschlicher Geist diese Taschenspielerkünste benötige und ohne sie weder die Wirklichkeit erfassen noch sich mit ihr in ein richtiges Verhältnis setzen könne. Sei dem, wie ihm wolle. Die einzige Bewegung, die auf Erden ungebrochen verläuft und mich interessiert, ist die Bewegung eines beseelten Körpers. Alles andere ist denaturierte Wirklichkeit. Begriffe sind ihr Prunksarg. Ich tue nichts anderes, als daß ich niederschreibe, was mir einfällt und was mich bewegt.
In einigen Wochen werde ich einen Entschluß fassen müssen, dessen Tragweite mir vorläufig noch ungewiß ist, da ich alles von ihm zu erwarten habe. Falls er in eine bestimmte Richtung fällt, werde ich diese Aufzeichnungen irgendeinem aus meinem weiten Bekanntenkreis übergeben und sie mir nach diesem Ereignis wieder zurückholen. Ich werde sie ergänzen mit meinen Erfahrungen in der dazwischenliegenden Zeit oder sie vernichten. Ich weiß sicher, daß ich alles überstehen werde, daß ich, vielleicht mit einigen Schrammen, wieder auftauche. Und falls ich nicht zurückkomme – auch mit dieser Möglichkeit muß ich rechnen –, kann der jeweilige Besitzer sie in den Ofen werfen, wenn er es nicht zuvor getan haben sollte. Auf jeden Fall werde ich der Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit des künftigen Bewahrers Rechnung tragen, daß ich Namen und direkte Anspielungen vermeiden werde und alles so allgemein wie möglich halte. Falls man diese Blätter bei ihm findet, darf ihm keine Gefahr erwachsen. Zum Glück gibt es Feinde genug auf dieser Welt unter jedem Himmelsstrich. Ein jeder kann jeden damit meinen, wenn er nur tüchtig schimpfen kann, und ich bin mir bewußt, eine abgeschmackte Wahrheit zu verkünden, wenn ich niederschreibe, daß es niemals auf Erden aufhören wird, Feinde zu geben. Sie rekrutieren sich aus den einstigen Freunden.
Mir schmeichelt die Einflüsterung, daß der künftige Besitzer meine Niederschrift nicht vernichten wird. Er wird sie selbst erst lesen, sie diesem und jenem zeigen, schließlich wird sich ein anderer mit meinen Federn schmücken und die Ohrfeigen empfangen, die mir zugedacht sind. Mein Eingeständnis zu Beginn, keinen Roman schreiben zu wollen, wird man einfach als einen üblen, gar nicht so originellen Trick disqualifizieren. Mir kann es gleich sein. Ich schreibe, weil die Bewegung, mit der die Feder über das Papier läuft, eine Spannung in mir löst und zugleich eine andere erweckt, die mir Vergnügen bereitet. Nicht die Langeweile treibt mich. Die Umstände machen es ratsam, im Zimmer zu bleiben und sich nicht oft auf der Straße blicken zu lassen. Ich schreibe, weil mir das Betreten der Sportplätze und der Zugang zu der Badeanstalt verboten ist. Das Schreiben ist eine Art Zimmergymnastik en minature.
Zudem bin ich besessen von einem Gedanken, den öffentlich zu bekennen ich mich weislich hüten werde. Meine eigenen Leute würden mich umbringen. Mir selbst erscheint er nicht so außergewöhnlich. Das Besessensein liegt in der Luft, hie Freund – hie Feind. Es wird mich zu gegebener Stunde nicht hindern können, meine Pflicht zu tun. Kein Mensch ist sattelfest. Ich bilde mir nicht ein, schlechter zu reiten als die anderen. Ob ich so gut schießen kann wie sie, ist eine andere Frage.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: