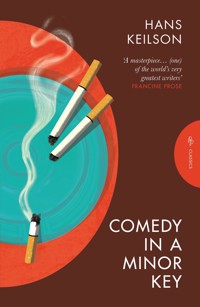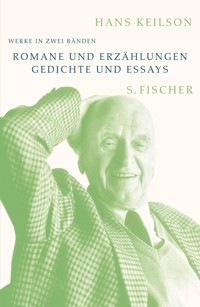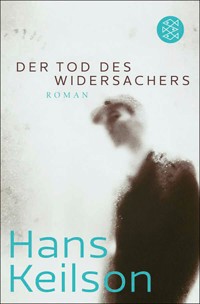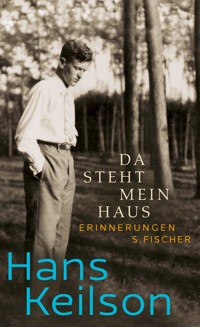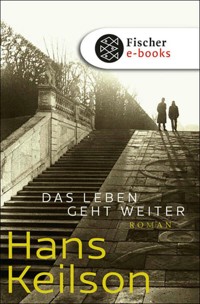6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wim und Marie haben sich im besetzten Holland dem Widerstand gegen die Nazis angeschlossen und verstecken in ihrem Haus den Juden Nico. Trotz angespannter Situation gibt es Momente der Innigkeit und das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Bis Nico sich eine dumme Erkältung zuzieht, stetig schwächer wird und schließlich stirbt. Wie wird man nun die Leiche eines rechtlosen Juden los, ohne sich selbst und den Widerstand zu gefährden? ›Komödie in Moll‹ erschien 1947 im renommierten Exil-Verlag Querido in Amsterdam und ab 1988 in verschiedenen Ausgaben des S. Fischer Verlags. Die amerikanische Übersetzung wurde 2010 weltweit gefeiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hans Keilson
Komödie in Moll
Erzählung
Fischer e-books
Komödie in Moll
Für Leo en Suus in Delft
I
»Da sind sie wieder«, sagte der Doktor plötzlich und richtete sich auf. Unversehens wie seine Worte hatte sich das Geräusch der nahenden Flugzeugmotoren in die Stille des Sterbezimmers geschlichen. Er legte den Kopf in den Nacken, kniff die Augen halb zu und lauschte.
Als wenn versteckt irgendwo in dem Hause ein kleiner Dynamo zu laufen begonnen hätte, der schnell auf Touren kam, so verstärkte sich der Summerton der anfliegenden Nachtgeschwader. Er hätte auch – so schien es zu Beginn – aus dem Keller kommen können, oder aus dem Nachbarhaus … Aber es waren die Nachtbomber, unzweifelhaft, die sich da ankündigten. In großer Flugbreite kamen sie von England her über den Strand, der nur wenige Kilometer von hier die Nordsee auffing, warfen ihre Lichtfackeln aus, die den nachkommenden den Anflugsweg über Holland anweisen mußten, und verschwanden über der östlichen Grenze in der Nacht. Wenige Stunden später konnte man sie an einer anderen Stelle mehr nördlich oder südlich im Lande zurückkommen hören. Ihr Geräusch entfernte sich in Richtung des Meeres.
Auch der Mann und die Frau, die unschlüssig um das Bett herumstanden, wie Menschen stehen, die Angst und Trauer zugleich bewegen, hoben ein wenig den Blick und lauschten.
»So früh schon«, flüsterte der Doktor vor sich hin.
Wim sah ihn verwirrt von der Seite an, als sei er im Zweifel, auf was sich diese Bemerkung bezog.
Die ersten Schüsse der Nacht, knallend, dumpf, sie kontrastierten eigentümlich zu dem feinen, fast musikalischen Geräusch der Flugzeuge. Die Glasfenster und Türen klirrten und rammelten, das ganze, zu leicht gebaute Haus antwortete mit einem feinen, kurzstößigen Zittern auf die Explosionen. Der Beginn war immer erregend, wie oft man ihn auch schon miterlebt hatte.
Er war gegen Ende März, die Tage wurden wieder länger. Als der Doktor gegen sieben Uhr erschien, war es draußen noch hell.
Trotzdem hatte Marie, wie sie es seit Monaten tat, das Zimmer auf der ersten Etage, in dem »er« wohnte, verdunkelt. Es war ein ziemlich kompliziertes System von Schnüren und Haken. Sie tat es lieber selbst, da sie fürchtete, man könne ihn von der Straße aus sehen – eine etwas übertriebene Sorge, denn sie hatten kein vis-á-vis.
Ihr Haus stand am Westrand der Stadt in einer Straße von gleichförmigen Neubauten – Suite unten, drei Zimmer mit Bad oben und Dachkammer mit Boden – gegenüber einem Park, hinter dem sich, unterbrochen von Kanälen und Dämmen, das unermeßliche Westland mit seinen Treibhäusern und den durch den Krieg entvölkerten Weideplätzen bis an den Horizont ausbreitete. Dahinter dampfte das Meer. Eine silberne Naht hielt dort wie ein glitzernder Reif Erde, Himmel und Wasser zusammen.
Diese allabendliche Verdunkelungszeremonie gehörte zu einer Reihe von vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen, die am gleichen Tag mit dem Fremden ihren Einzug in das Haus gehalten hatten. Als dann die Krankheit dazukam, hatte sie mit nur noch größerer Sorgfalt diese Handlung vollzogen in dem unbestimmten Gefühl, daß der Kranke eine noch größere Gefahr für sie bedeute als der Gesunde.
Seit ungefähr zwei Wochen lag er zu Bett. Das Fieber verlieh seinem Gesicht Farbe und Rundung, nachdem ein Aufenthalt von rund einem Jahr tagein, tagaus in dieser Kammer die letzten Spuren von Leben ausgemergelt hatte. In den letzten Tagen sprach er fast kein Wort mehr. Es ging zu Ende.
Wenn Marie am Abend in seinem Zimmer das Licht einschaltete, drehte er in alter Gewohnheit noch das Gesicht der Wand zu. Im Wechsel vom schummrigen Tageslicht zu dem matt-trüben der elektrischen Birne erschien es fahl, pergamenten. Aber der geschwächte Körper blieb dumpf und bewegungslos unter den wollenen Decken. Die Lampe in halber Höhe in der Mitte des Zimmers verbreitete mehr Schatten als Licht.
Sie hatten, seit er bei ihnen Unterschlupf gefunden hatte, eine kleinere Kerzenstärke eingeschraubt, um zu sparen. Und um den milchig weißen Schirm noch ein bläuliches Tuch gehängt, um ausstrahlendes Licht zu dämpfen.
Wim und Marie waren nicht ängstlich von Natur. Als sie den Entschluß faßten, jemanden bei sich zu verstecken, hatten sie das Risiko, das sie damit auf sich nahmen, ziemlich deutlich vor Augen – bis zu einem gewissen Maße, soweit man ein Risiko a priori einschätzen kann. Denn es fällt unter die Kategorie »Überraschung«, und diese ist eben nicht im voraus zu berechnen.
Wenn es ihm einmal in den Sinn kam, über Tag eigenmächtig das Fenster zu öffnen und seinen Kopf herauszustecken? Oder mitten in der Nacht das Licht anzudrehen, nachdem er vorher eigenhändig die Verdunkelung entfernt hatte? Nicht aus Mutwillen oder um ihnen einen Streich zu spielen … Jedoch bei einem Menschen in seiner Lage konnte man nie wissen, ob er nicht in der nächsten Minute eine Dummheit begehen würde. Schließlich ist es auch kein Pappenstiel, zwölf Monate oder oft noch länger, freiwillig, immer mit einer gewissen Gefahr vor Augen allein in einem Zimmer zu sitzen oder herumzuschleichen – in Filzschuhen natürlich.
Denn um alles in der Welt: die Putzfrau, die zweimal in der Woche einen halben Tag kam, oder die Nachbarn durften nicht wissen, daß sich hier ständig jemand auf der ersten Etage aufhielt, obgleich man ihnen »Gott sei Dank« völlig vertrauen konnte. In dieser Straße waren alle Menschen »gut«. Und wer weiß, ob bei ihnen nicht auch jemand in Filzschuhen durch eine Kammer schlich, der lieber nicht über Tag seine Nase vor die Tür steckte. Enfin, man sprach über derlei Dinge besser nicht. Es wurde soviel geklatscht …
»Kein Mensch darf es wissen, hörst du … nur unter dieser Bedingung«, – hatte Marie damals gesagt.
»Natürlich –« erwiderte Wim geruhsam »kein Mensch, das versteht sich doch von selbst. Aber du mußt es dir gut überlegen, es bringt eine Menge …«
»Ich habe es mir bereits überlegt«, entgegnete Marie. Er konnte wissen, daß sie nichts unüberlegt tat … »Kein Mensch, auch Coba nicht.«
»Auch Coba nicht, einverstanden«, bekräftigte Wim.
Coba war seine Schwester. Sie wohnte in der Nähe, in einem Vorort der Residenz, eine halbe Stunde Fahrt mit der Straßenbahn. Die beiden Frauen standen ausgezeichnet miteinander. Coba kam so oft zu ihnen, daß es auf die Dauer unmöglich war, es vor ihr geheimzuhalten. Und dann, warum vor Coba? … Aber Wim hatte »einverstanden« gesagt. Die Zeit würde es lehren. Und schließlich liegt in jeder Angelegenheit eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit.
»Und Erik?« fuhr Marie fort.
»Erik?« fragte Wim entgeistert, noch einmal: »Erik?« Kein Zweifel, sie hatte Angst. Die unsinnigsten Namen fielen ihr ein. »Ja, wie kommst du darauf? Solange wir verheiratet sind, ist er … einen Augenblick …« Er dachte nach. »… Ich glaube, einmal ist er bei uns gewesen. Von ihm haben wir doch nichts zu erwarten … Viel eher, wenn Mutter kommt, was dann?«
Marie erschrak. »An die Möglichkeit habe ich noch nicht gedacht …« Sie strich sich mit beiden Händen über den Kopf und steckte ihre Haare neu auf, obwohl an ihnen nichts zu stecken war … »Ja … überhaupt wenn wir Gäste bekommen … Wie wird Mutter es aufnehmen?«
»Du willst es ihr also sagen?«
»Wenn sie bei uns logiert, Wim – natürlich werde ich es ihr sagen.«
»Ich finde es gar nicht so natürlich«, hatte Wim gesagt und seine Krawatte zurechtgezupft …
Die erste Welle der Flugzeuge flog jetzt über die Häuserreihe.
Sie verharrten alle drei in der gleichen etwas geduckten Haltung, – ganz frei fühlte man sich nie –, den Kopf leicht zur Seite geneigt; bei den Schüssen, die jetzt in kurzen Abständen hintereinander dröhnten, zitterten ihre Nackenmuskeln in der Anspannung des Lauschens und der Gefahr, die über ihren Häuptern dahinrollte und das ganze Haus wie in einer unsicheren Erwartung beben ließ. Mächtig schlugen die Motoren. Die künstlichen Gebilde aus Gestäng und gewelltem Blech, aufgerufen zu einem starr geflügelten, kurzfristigen Leben, erfüllten Land und Himmel mit dem Takt ihrer eisernen Pulse.
Hier in der Kammer starb ein Mensch.
»Da sind sie wieder …« Das waren auch immer seine Worte gewesen. Mitunter wenn sie noch beim Abendessen zusammen in dem Hinterzimmer saßen – das einzige Mal am Tage, daß er, wie verabredet, nach unten kam – hatte er mitten im Bissen seinen Kopf jäh in den Nacken geworfen, so daß seine großen, behaarten Nasenlöcher unter dem stark gekrümmten Nasenrücken sichtbar wurden, und mit vollen Backen, während seine Hände das Eßbesteck senkrecht auf den Tisch pflanzten, diese vier Worte gesprochen: »Da sind sie wieder!« Als wenn er darauf gewartet hätte.
Wenn sie später kamen und er befand sich allein in seinem Zimmer, zuweilen sogar in seinem Bett, richtete er sich auf und sprach diese Formel in die stumme Kammer hinein.
Von ihnen dreien war er immer der erste, der sie hörte.
Wim ließ sich nicht stören. »Sooo«, antwortete er, mehr fragend als zustimmend. Aber auch nicht direkt ungläubig oder abweisend. Vielmehr auf jene taktvoll-uninteressierte Weise, mit der man eine Sache unentschieden läßt, die an sich möglich ist, wenn auch nicht gerade zu diesem Zeitpunkt. Auf keinen Fall unterbrach er deswegen seine Mahlzeit.
»Doch«, sagte Marie und zögerte, bis sie den nächsten Bissen von der gezückten Gabel nahm – »doch, Nico hat recht … hörst du?« … und sie spießte das Messer in die Luft.
»So früh heute«, fuhr Nico fort und sah auf die Uhr an der gegenüberliegenden Wand. »Zehn nach sieben.« Seine Augen glänzten, weil seine Ohren ihn nicht im Stich gelassen hatten. Das Summen verstärkte sich. Auch Wim vernahm es.
Die ersten Schüsse der Nacht, knallend, dumpf, sie kontrastierten eigentümlich zu dem feinen, fast musikalischen Geräusch der Flugzeuge. Die Glasfenster und Türen klirrten und rammelten, das ganze, zu leicht gebaute Haus antwortete mit einem kurzstößigen Zittern auf die Explosionen. Der Beginn war immer erregend, wie oft man ihn auch schon miterlebt hatte.
»Sie wollen wieder früh zu Hause sein, gib mir bitte die Kartoffeln, Marie«, sagte Wim. Er war mit dieser trockenen Erklärung zufrieden und meinte, die nicht besonders interessante Angelegenheit aus der Welt geschafft zu haben. »Eßt! Es wird kalt!«
»Nein, Wim, nein«, entgegnete Nico ein wenig gereizt, als ob es für ihn eine Existenzfrage war, und er ließ den Kopf mit den gefüllten Backen nach vorn sinken, »nein, das hat seine Gründe … sie werden einen langen Anflug haben, verstehst du? Vielleicht Berlin oder – ja, sicher Berlin, wir liegen hier direkt auf dem Luftweg nach Berlin.« Er sprach mit einer Überzeugung, als trüge er einen aktiven Anteil an der Ausarbeitung der Pläne für diese Bombennacht.
»Und wie ist es dir heute ergangen, Nico?« – fuhr Wim dann meistens fort und drehte kurzerhand von Berlin ab.
Und Nico antwortete im gleichen, gutmütigen Ton: »Danke, Wim, ich bin zufrieden, die Pension ist gut, und ich habe ein wenig Sprachen getrieben, Englisch und Französisch«, – je nachdem was er den Tag über getan hatte.
»Und wieviel Schachpartien hast du gewonnen?«
Denn er spielte Schach, nicht besonders gut, aber mit ungebrochenem Eifer.
Wenn Nico einen guten Tag hatte, antwortete er auf die versteckt schelmische Frage mit einer ebensolchen Antwort, etwa: »Keine, Wim, keine, mein Partner war heute zu stark …«
Er spielte immer mit sich selbst. Stunden und Stunden saß er an dem kleinen, viereckigen Tisch in seiner Kammer, das Brett mit den Figuren vor sich. Der gegenüberliegende Platz war frei … e2-e4, e7-e5, p1-p3 usw. Oft saß er lange, den Kopf in die Hand gestützt und dachte tief nach. Über ein Schachproblem? Über – –?
Am folgenden Tag konnte er es dann fast nicht abwarten, bis Marie am Nachmittag um fünf Uhr mit der Zeitung oben bei ihm erschien.
Versteckt hinter der Gardine hatte er die Zeitungsfrau beobachtet, wie sie hastig den kleinen Vorgarten durchschritt. Oft lief er gleichzeitig schnell aus seinem Zimmer – auf Hausschuhen natürlich, wie man es zu Beginn verabredet hatte –, so daß er noch oben, auf das Geländer gestützt, hörte, wie die Zeitung raschelnd durch den Briefschlitz gesteckt wurde und dann mit einem nachdrücklichen Ruck auf den Steinboden fiel. Die Sekunden, die dann folgten, waren oft die an Spannung reichsten seines ganzen verborgenen Lebens. Ob sie das wohl begriffen – seine Gastleute?
Er stand oben auf dem letzten Treppenabsatz und wartete, bis Marie kurz darauf aus ihrem Zimmer zum Vorschein kam, wo sie um diese Zeit mit einer Näharbeit beschäftigt saß, und die Zeitung aufhob. Sie entfaltete das Blatt, las die Überschriften – Lügen! nichts als Lügen! aber was sollte man machen, eine Zeitung mußte man schon halten wegen der Lebensmittel – wendete es, las die Familiennachrichten, Todesfälle, Verlobungen, Geburten – natürlich, auch in Kriegszeit wurde weiter geliebt und es kamen Kinder zur Welt – und schritt im Lesen die Treppe hinauf.
»Nico«, rief sie mit halblauter Stimme, daß es selbst ein Lauscher unmöglich hören konnte, nur er, von dem sie wußte, daß er oben stand und wartete – »Nico, du hast wieder einmal recht gehabt, in der Tat – –« Sie machte ihm gern die kleine Freude.
Oft geschah es aber auch, daß sie es vergaß und Wim die Zeitung als erster in die Hände bekam, wenn er aus dem Büro nach Hause kehrte. Oder daß Marie um diese Zeit in der Stadt Einkäufe machte.
Dann saß Nico oben auf der Treppe und führte mit sich selbst einen schweren Kampf, ob er es nicht versuchte und vorsichtig, vorsichtig … er konnte auch seine Hausschuhe noch ausziehen … auf Strümpfen nach unten schlich; einen kleinen Unterschied machte es schon; oder auf dem Treppengeländer, wie er es als Junge getan hatte, – er wußte genau, auf welchen Stufen das Holz nachgab und knarrte, die dritte und fünfte auf der ersten von oben gerechnet, und die erste und vierte auf der zweiten Treppenhälfte.
Aber schließlich wagte er es doch nicht. Wenn er auch überzeugt war, daß niemand, niemand auf der Welt ihn hören konnte … Es war gegen die Verabredung, er unterließ es. Es überstieg fast seine Kräfte. Niemand wußte, welch ein Kampf in ihm tobte.
Schnell rief er sich dann etwas anderes ins Bewußtsein, Marter, Greuel, die ihn sicher erwartet hätten, aber denen er entkommen war zu anderen neuen Foltern hier. »Überall warten Marter und Greuel«, sagte er vor sich hin. »Überall.«
Nach einer Weile stand er auf und schlich in seine Kammer zurück. »Na, na«, sagte der Doktor, als die Schläge der Abwehr hart in der Nähe dröhnten, »das sind aber ein paar schwere Brocken.«
Über dem Häuserblock zogen in unablässiger Reihe die Nachtbomber. Es war, als ob sie durch alle Räume des Hauses zugleich flogen.
Er blickte abwechselnd auf die Frau und den Mann, verspürte ihre verhaltene Angst vor dem leise und laut einherkommenden Tod und sah nach dem Schattenspiel der Pendellampe auf der gelblichen Zimmerdecke.
Dann bog er sich wieder über das Bett und betastete den Körper, der langsam erkaltete.
Wim hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt und starrte auf den Fußboden. »Wir müssen ihn beerdigen«, dachte er, »natürlich, einen Toten muß man begraben. Aber wie –?«
»So eine Nacht im Bombenkeller, während das Haus über dir zusammenfällt …« Der Doktor führte seinen Satz nicht zu Ende. Tot ist tot, und sterben kann man überall. Auch leben …?
Marie legte ihre Hand zaghaft auf den geschwungenen Rand des hohen Bettgestells am Fußende. Es war ihr, als ob sie den Toten selbst berühre. Sie sah ihn an. Unrasiert und sehr ausgeprägt lag er da, mit geschlossenen Augen. Sein Haupthaar, das wirr und ungekämmt in die knochige, nicht hohe Stirn fiel, war schwarz, der Backenbart, der ihm in der Krankheit üppig gewachsen war, schimmerte rötlich. Der entspannte, halb geöffnete Mund mit dem etwas hängenden Kinn gab dem leidenden Gesicht eine mehr ovale Form. Wie alt er aussah! Alles dies zusammen und die Erinnerung an den Nico, dem sie in ihrem Haus Unterschlupf gewährt hatten, verdichtete sich in Marie zu einem bestimmten Gedankengang. Seltsam, daß es ihr bei Lebzeiten nie in dem Maße aufgefallen war. Sie mußte an die Bibel denken, obwohl sie durchaus nicht kirchlich gesinnt war, an das Alte Testament, von dessen Volk er ein Sohn war. Hiob hätte so aussehen können, dachte sie.
II
»Wie hieß er eigentlich? –« fragte der Doktor.
Noch vereinzelte Schüsse in der Ferne … Es war wie zu Beginn, ein Summerton aus dem Nachbarhaus, oder aus dem Keller …
Wim zuckte die Achseln. Auch jetzt noch gab er den Namen nicht preis. Es blieb ein Geheimnis. »Wir nannten ihn Nico.«
»Nico, Nicodemus? – war das nicht der einzige unter den Schriftgelehrten, der damals …«
»Ja, ja«, sagte Wim. »Unserer war Reisender in Parfumerien.«
Der Doktor verzog seinen Mund.
»Reisender in Parfumerien? Ja, so ein bißchen Wohlgeruch nach dem Kriege hätten wir alle ein wenig nötig. Ist noch nicht das schlechteste. Armer Nico!« Es klang bitter, fast wie ein Vorwurf, daß er sie im Stiche ließ.
Wim preßte die Lippen aufeinander und stieß die Luft hörbar mit einem kurzen Ruck seines Kehlkopfes durch die Nase. »Hm.« Etwas verlegen starrten sie auf das Bett.