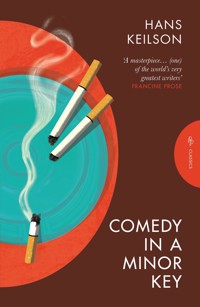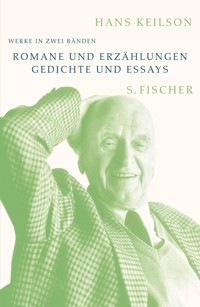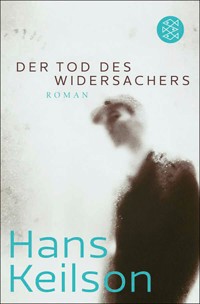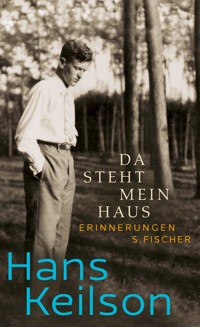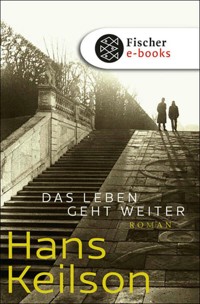
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans Keilson erzählt die Geschichte einer Jugend vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise der zwanziger Jahre. Aufbruch und Niedergang verschränken sich auf poetische Weise und beschreiben, aus der Perspektive eines jungen Mannes in der Provinz, die Atmosphäre der Weimarer Republik. ›Das Leben geht weiter‹ erschien 1933 und war Hans Keilsons erster Roman. Gleichzeitig erscheinen von Hans Keilson der Erinnerungsband ›Da steht mein Haus‹ und der Essayband ›Kein Plädoyer für eine Luftschaukel‹. Lieferbar sind außerdem die Novelle ›Komödie in Moll‹ und der Roman ›Der Tod des Widersachers‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Hans Keilson
Das Leben geht weiter
Roman
Fischer e-books
Das Leben geht weiter
Eine Jugend in der Zwischenkriegszeit
Der Hauswirt kam in den Laden, er war dick und hatte das Benehmen einer Frau.
»Ich will gern mal mit Ihnen reden, Herr Seldersen«, sagte er und machte sich wichtig.
Der Vater sitzt hinter der Kasse, vorn an dem großen Schaufenster, und liest. Das ist so seine Beschäftigung, wenn er keinen Kunden zu bedienen hat und allein ist. In den letzten Monaten hat er viel Zeit zum Lesen, dann liest er die Zeitung mitunter dreimal am Tag. Als er Schritte hörte, sprang er eiligst auf und sagte: »Bitte sehr«, da erkannte er seinen Wirt, und auf sein diensteifriges Gesicht trat eine behagliche Gelassenheit. Er lachte.
»Lassen Sie sich nicht stören, Herr Seldersen, ich bin es nur. Meine Frau sagte mir, ich soll nachsehen, ob Sie alleine sind, und da komme ich nun herüber. Eigentlich hat es noch Zeit, aber ich will doch einmal mit Ihnen reden.« Er drückt sich umständlich aus und umgibt alles mit einem Schleier.
Der Vater kommt hinter der Kasse hervor und stellt sich vorne neben den hohen Linoleumballen. Er ist durch die unklaren Worte ein wenig gereizt. Wer weiß, denkt er, was da wieder im Gang ist.
»Es handelt sich nur darum, Herr Seldersen«, beginnt der Wirt auf einmal merkwürdig kurz und nüchtern, »der Eckladen nebenan wird frei. In einem halben Jahr läuft der Kontrakt mit dem Konfitürengeschäft ab.«
Er will ihn nicht mehr erneuern, obgleich er viele Jahre hindurch stets eine angemessene Miete erhalten und einen ansehnlichen Gewinn aus dem Laden gezogen hat.
Aber sein eigener Laden, in dem Papier, Schreibwaren, Zeitungen zum Verkauf ausliegen – volle zwölf Jahre sitzt er in ihm –, ist ihm jetzt zu klein geworden, er will sich vergrößern, er fühlt den Drang. Gut.
Was ich hinten auf dem Speicher noch alles liegen habe, prahlt er, ein ganzes Warenhaus kann ich damit bestellen. Bilder, Bücher, Schreibwaren, Andenken. Außerdem, der Zeitungsverlag, den er hier am Orte vertritt, will ihm eine große Filiale ausbauen, draußen am Haus breite grüne Schilder mit den Namen aller bei ihm verlegten Zeitungen und Zeitschriften, ein großer Schaukasten als Aushang für die neuesten Nachrichten, alles wird großzügig und weltstädtisch aufgezogen. Zu diesem Zweck nun will er den Laden des Herrn Seldersen nehmen, der neben seinem Geschäft liegt. Die Wand zwischen beiden wird niedergerissen, und aus zwei kleinen Räumen entsteht ein großes Geschäftslokal. Herr Seldersen zieht dafür in demselben Haus eine Tür weiter in den Eckladen, sonst bleibt alles beim alten. Das ist sein Plan, was Herr Seldersen wohl dazu sagt. Ist das nicht großartig? Bedenken Sie, ein Eckladen, wie viele sich schon um diese Ecke bemüht haben! An der Hauptverkehrsstraße am Markt, eine bessere Lage gibt es nicht.
Pause.
Herr Seldersen hat die ganze Zeit dagestanden, als halte ihm jemand eine Ansprache, und zugehört, aber schon zu Anfang wußte er alles. Jetzt war die Reihe an ihn gekommen, sich zu äußern, und er sagte:
»Ja, da muß ich erst mit meiner Frau sprechen.«
Weiter nichts, kein Widerspruch, kein Auflehnen, er muß erst einmal mit seiner Frau darüber sprechen.
Der Wirt hatte es sich nicht so leicht vorgestellt. »Gewiß, sprechen Sie ruhig mit Ihrer Frau, es eilt ja nicht, in einem halben Jahr erst. Natürlich lasse ich Ihnen alles herrichten, die Wände neu kalken, den Fußboden ausbessern, alles, was zu machen ist. Darüber werden wir schon einig, vorerst sollen Sie sich nur mit dem Gedanken vertraut machen.«
Der Vater schweigt, angelehnt an den Ladentisch stützt er rückwärts seine Hände auf die Tischplatte und schweigt. Da kommt Frau Seldersen in den Laden und sieht die beiden Männer. Der Wirt oder seine Frau kommen öfter einmal herüber, sie besuchen sich gegenseitig, sie stehen gut miteinander. Als das letzte Kind bei dem Wirt ankam, vor zwei Jahren, und der Arzt mit der Hebamme allein es nicht mehr schaffte, wurde Herr Seldersen gerufen. Was man von ihm haben wollte, führte er aus, er reparierte Uhren, besohlte Schuhe, legte Klingelleitungen, bohnerte Fußböden, nahm Gardinen ab und brachte sie wieder an – er verstand alles. Und auch hier krempelte er sich ohne Zögern die Ärmel hoch, tat sich eine große Schürze um, und nach zehn Minuten war ein strammer Junge geboren. Das vergaß man ihm nie.
»Es ist gut, daß Sie kommen, Frau Seldersen«, sagte der Wirt, »ich spreche eben mit Ihrem Mann.«
»Was gibt es denn?« fragte die Mutter ängstlich. Der Wirt begann von neuem zu erzählen. Frau Seldersen hört zu, und ein großer Schreck überfällt sie. Doch zuerst zeigt sie sich noch beherrscht, bald wird sie unruhig, abwechselnd geht ihr Blick von dem Wirt auf den Vater, der wie abwesend dasteht, als sollte keiner seine Gedanken erraten, und wieder zurück auf den Wirt. Schon nach wenigen Sätzen hat sie verstanden, um was es hier geht. Der Vater ist in dieser Lage wie ein Kind, hilflos, ungeschickt, wäre sie nicht im richtigen Augenblick dazugekommen, er hätte alles schweigend hingenommen, nichts erwidert und nur im geheimen seine Gedanken gehabt.
»Das ist für uns immerhin eine gewaltige Zumutung«, beginnt sie, »wenn man schon mehr als zwanzig Jahre in diesem Laden hier steht. Und jetzt wollen Sie uns hinauswerfen.«
»Hinauswerfen, wo Sie bloß hindenken, keine Rede von Hinauswerfen. Nebenan in den Eckladen sollen Sie ziehen, ist das nicht außerordentlich?«
Die Mutter ganz aufgeregt, es kommt ihr alles so unerwartet: »Ja, aber warum denn diese Veränderung, überhaupt jetzt, wo kein Mensch weiß, welchem Ende man zusteuert.« Die paar Jahre, die sie noch arbeiten werden, es werden keine fünfundzwanzig mehr sein, bei Gott nicht, sie hatten es sich anders gedacht, aber nur keine Veränderung.
»Warum wehren Sie sich so«, fragte der Wirt auf einmal in scharfem Tone, »ob Sie hier oder nebenan in Ihrem Laden stehen, wer zu Ihnen will, geht auch die drei Schritte weiter bis zur Ecke. Genau drei Schritte, in dem gleichen Haus, geradezu lächerlich …«
Die Mutter schüttelt den Kopf, die letzten Vorstellungen prallen an ihr ab, als habe sie sie nicht gehört.
»…wo Sie selbst sagen, daß sie nicht mehr allzulange hier bleiben und sich bald zur Ruhe setzen.«
»Ja, zur Ruhe setzen«, wiederholt sie bitter.
»Gleichviel«, fährt der Wirt fort, »ich muß auch sehen, wo ich bleibe. Meine Kinder sind noch klein, aber Ihr Sohn kommt in drei Jahren aus der Schule, und Ihre Tochter ist schon in Berlin.« Aber er, wie steht es mit ihm?
»Dafür besitzen Sie doch das Haus«, wirft die Mutter ein. Er lacht, das Haus, gewiß, da habe sie recht, das Haus gehört ihm. Pause.
Ob sie seine grauen Haare sähe, die gehörten ihm auch. Haha, das Haus gehöre ihm, was er für Sorgen hat, wenn sie das wüßte, würde sie nicht so leicht hinsprechen, nein, nein, nichts als Sorgen bringt ihm das Haus. Da regnet es auf dem Boden durch, der Dachdecker muß kommen, da ist das Wasserrohr geplatzt, der Installateur wird gerufen, da muß der Müll abgefahren werden, und dann die Steuern, die auf dem Haus lasten … er greift sich an den Kopf. Nein, neulich erst hat er zu seiner Frau gesagt, Mama, hat er gesagt, das Haus macht mir nur Kopfschmerzen, noch nicht eine freudige Minute habe ich an ihm gehabt. Er hatte es von seiner Mutter geerbt, er wollte es nicht annehmen, bis zuletzt hat er sich dagegen gesträubt, aber was sollte er schließlich anderes tun? (Die Hypotheken sind in der Inflation ausgezahlt worden, die Aufwertung noch nicht fällig.) Er stöhnt schwer.
»Aber der Eckladen ist ja viel kleiner«, fängt nach einer Weile Herr Seldersen wieder an.
Zu klein, das gewiß nicht, und wenn er alles nahe beisammen hat, so kann ihm das doch nur recht sein. Aber hell ist er, wesentlich heller, sie werden viel an Licht sparen.
»Und das Schaufenster um die Ecke geht uns auch verloren«, wirft Frau Seldersen ein, »wer geht um die Ecke und sieht sich das Fenster an? Und beide Fenster sind auch viel kleiner. Muß es denn so bald sein«, fragt sie schließlich.
»In einem halben Jahr erst«, erklärte der Wirt, »ich sagte es schon am Anfang.« Er verspürte keine Lust mehr, sich länger in ein Gespräch einzulassen, aus dem am Ende vielleicht noch ein Streit entstand. Was nutzte ihre Widerrede, wenn er wollte …
Pause.
Die Mutter unterbricht das Schweigen, sie versucht einen unbefangenen Ton anzuschlagen: »Wir werden es uns überlegen, und Sie werden es sich auch einmal überlegen«, sagte sie so ruhig wie möglich, »Sie verlieren doch die Miete für ein Geschäft, so etwas muß genau durchdacht sein.«
»Die paar Jahre, die wir noch hier sein werden«, fügte Herr Seldersen treuherzig hinzu, »lassen Sie uns noch in dem alten Geschäft. Ich bin jetzt vierundzwanzig Jahre hier, wir bleiben ja nicht mehr lange, man hofft doch, daß es bald ein Ende haben wird. Reden Sie noch mal mit Ihrer Frau.«
»Das habe ich ihr schon alles gesagt«, antwortete der Wirt. Aber er versprach, die Angelegenheit noch einmal genau mit ihr zu bereden. Dann geht er.
Die Eltern bleiben zurück. Der Vater steht noch immer rücklings an den Tisch gestützt, die Mutter geht unruhig auf und ab. »Das gibt nichts Gutes«, sagt sie, »nur nicht daran rühren, ich setze keinen Schritt in den neuen Laden. Nein, nein …«
Der Vater schweigt. Er dachte nach, wie lange er schon Tag für Tag hier unten steht, die vier Kriegsjahre ausgenommen. Die Mutter hat so ihre eigenen Gedanken, er verlacht ihren Aberglauben, aber im Grunde ist er auch nicht frei davon. Er stöhnt. Gewiß, es war nicht ein einfacher Wechsel von Tür zu Tür, wie es der Wirt vorhin so leicht dargestellt hatte. Schließlich sprach die Zeit ein gewichtiges Wort mit, ihre Spur konnte nicht so schnell ausgelöscht werden. Herr Seldersen erinnerte sich genau, als er vor langen, langen Jahren hier in die Stadt kam, als Reisender, stand am Marktplatz ein kleines zweistöckiges Haus, vor dem gerade Leitern und Gerüste aufgefahren wurden. Als er nach einiger Zeit den Ort wieder einmal besuchte, schritt der Hausbau seiner Vollendung entgegen. Eigentlich war es nur ein Umbau gewesen, jedoch nicht wiederzuerkennen: aus einem kleinen baufälligen Haus entstand ein hochaufragendes Eckhaus, weithin sichtbar, unten waren vier Läden mit insgesamt acht großen Schaufenstern ausgebrochen. Hier sah Herr Seldersen die Erfüllung seiner Wünsche: als selbständiger Kaufmann im eigenen Geschäft nur sich selbst verantwortlich. Drei Jahre reiste er schon umher, ohne festen Sitz, ein Angestellter nur wie viele andere. Er stand für sich allein, verdiente gutes Geld. Er war tüchtig, man begegnete ihm mit Achtung und Wohlwollen, doch er, dieses unsteten Lebens überdrüssig, gedachte jetzt für sich selbst etwas zu erobern. Dreihundert Taler hatte er gespart … Kurz entschlossen ging er hier zu dem Hauswirt und traf einen kleinen geduckten Handwerker, der sich beim Bau übernommen hatte und nun tief in den Schulden steckte. Der sah ihn groß an. »Einen Laden habe ich noch frei«, sagte er, »in der Hauptstraße neben der Ecke, Sie können ihn haben, Sie gefallen mir.« So wurden sie einig. Nach einem halben Jahr eröffnete Herr Seldersen sein Geschäft. Über der Ladentür hing das Schild mit seinem Namen, in zwei Schaufenstern lag die Ware geschmackvoll ausgebreitet, im Laden selbst stand Herr Seldersen und verkaufte unermüdlich, was ein Mensch an notwendiger Kleidung nur brauchte, vom Schnürsenkel bis zum Anzug, alles gab es bei ihm zu kaufen.
Die Zeit ging, der Wirt starb, aber der Vater stand immer an der gleichen Stelle im Geschäft, undenkbar, daß es je anders sein sollte. Die Verhältnisse hatten sich gewaltig verändert, er hätte davon erzählen können.
Jeden Ersten trug er pünktlich seine Miete jetzt zum Sohn, nun erschien der heute auf dem Plan und brachte seinen Vorschlag an.
»Wir wollen abwarten«, sagte der Vater nach einer Weile zur Mutter. Abwarten, sie nickte zustimmend, ja, das bleibt die einzige Hoffnung.
Sie erwiderte nichts mehr, sie wußte, sosehr sie sich auch wehren, es wird ihnen wohl nichts anderes übrigbleiben.
Albrecht, der Sohn, kam aus der Schule, und sie gingen zu dritt zum Essen hinauf in die Wohnung. Das Lehrmädchen blieb allein unten, über Mittag war immer eine tote Zeit.
Die Teller vom Vater kamen sauber in die Küche zurück, er saß bei Tisch stumm, mit ernstem Gesicht, als ob sich etwas Schreckliches zugetragen hätte. Die Mutter bat ihn immer wieder, nur einen Löffel Suppe, einen Bissen Fleisch zu essen – vergeblich, er rührte nichts an.
»Es schmeckt dir wohl nicht?« fragte sie.
»Ich mag nicht«, antwortete der Vater. Sein Gesicht blieb starr wie zuvor.
»Du änderst doch nichts, wenn du nicht ißt«, sagte sie schließlich und fügte sich darein.
Der Vater schwieg. Albrecht, dem Sohn, der mit am Tisch saß, erschien dies alles rätselhaft. Was konnte der Vater nicht ändern? Albrecht kam ahnungslos aus der Schule nach Haus und wurde nun Zeuge dieser Unterhaltung, die seine Gedanken noch einige Zeit später beschäftigte. Genau verfolgte er die einzelnen Worte, beobachtete dabei verstohlen das Verhalten der Eltern, im geheimen versuchte er sich mit Deutungen und Erklärungen, aber er kam nicht ordentlich zu Rande damit. Er war jetzt sechzehn Jahre, ein mittelgroßer schmaler Bursche, der Jüngste in der Klasse, ein wenig verträumt und von einer zarten, fast mädchenhaften Empfindsamkeit. Schon jetzt zeigte er manche Anlagen, doch konnte man noch nicht erkennen, in welcher Richtung ihn später das Leben führte.
»Nimm wenigstens ein bißchen Obst«, fing die Mutter wieder an. Sie reichte dem Vater die Schüssel.
Ihm wurde das ewige Bitten zuviel, ach, quäl mich doch nicht, du siehst doch, daß ich mich schon genug quäle (aber das sagte er schon nicht mehr, man sah ihm nur an, daß er es bei sich dachte). Er ging sofort wieder hinunter in sein Geschäft, heute verzichtete er auf den kurzen Mittagsschlaf. Doch unten auf einem Stuhl überkam ihn die Müdigkeit so stark, daß er sichtbar in sich zusammenfiel, den Kopf auf die harte Lehne legte und in dieser komisch unbequemen Lage einnickte.
Die Mutter und Albrecht blieben oben zurück. Sie konnte sich nicht länger mehr beherrschen, zu viele Gedanken gingen ihr durch den Kopf, sie versank in leidvolle Erinnerung.
Zaghaft bat Albrecht, sie möge ihm doch sagen, was hier vorgegangen sei, während er in der Schule saß. Zuerst glaubte Frau Seldersen, mit bequemen Ausreden ausweichen zu können, aber da der Junge nicht nachließ, erzählte sie ihm von der Unterredung mit dem Hauswirt. Aufmerksam hörte Albrecht zu. Am Schluß sagte er freimütig, auch er könne nichts dabei finden, wenn sie drei Schritte weiter in den Eckladen ziehen, dann muß der Wirt ihnen eben mit der Miete entgegenkommen, da sie sagt, die neuen Räume liegen weit ungünstiger. Die Mutter lächelt etwas über seinen Eifer. »Nein«, erwidert sie, »das ist es ja nicht allein, es geht dabei mehr um anderes, aber das verstehst du ja nicht.« Nun wollte Albrecht erst recht von der Mutter wissen, was er nicht verstünde, und sie versuchte ihm nun zu erklären, was es für sie bedeutet, aus einem Raum zu gehen, in dem sie die Hälfte ihres Lebens verbracht und so manches erfahren habe … »Vierundzwanzig Jahre, älter als du bist, verstehst du das nicht?« Albrecht stützte seinen Kopf in die Hände und sagte nachdenklich: »Doch, ich glaube, ich verstehe es, aber wenn es nicht anders geht…«
Da erwiderte Frau Seldersen, lange nicht mehr so ruhig wie vorhin, daß man sich gegen jede Veränderung wehren müsse, solange es möglich sei. Überhaupt jetzt, wo sie doch alles verloren haben, will man sie auch noch dazu zwingen.
Albrecht begriff nicht den Zusammenhang, der versteckt in ihren Worten lag. Er sah ihr offen ins Gesicht; wie sie das von dem Allesverlorenhaben sagte, klang ihre Stimme hart, männlich, als wenn sie das gar nicht beträfe. Im übrigen verstand er nicht, was es bedeutet, etwas zu besitzen und dann abgeben zu müssen, er besaß nichts und wußte nicht viel. Er hatte es nur die Mutter zu vielen Gelegenheiten sagen hören, gleichsam als Entschuldigung, wie jemand um Nachsicht bittet, weil er schlechte Augen hat. Aber ihm selbst mangelte dabei jede Vorstellung.
»Vielleicht läßt der Wirt noch mit sich reden«, meinte er zum Schluß großmütig, um die Mutter ein wenig aufzumuntern. Sie schüttelte den Kopf: »Nein, das glaube ich nicht, wir müssen uns darauf gefaßt machen.« Dann ging sie. Albrecht blieb allein in der Stube, er wiederholte für sich ihre letzten Worte und dachte nach, er fand ihre Art, die Dinge zu behandeln, übertrieben und das Gefühl zu sehr betont. Mit etwas Großzügigkeit und Kraft glaubte er viel Unangenehmes umgehen, zumindest aber abschwächen zu können. Er maß der Sache weniger Gewicht bei.
Im Sommer endlich wurde der Bau von Herrn Dalke fertig, zwei Stockwerke und eine riesige Front von hohen Fenstern, über anderthalb Jahre hatte es gedauert, und es schien, als sollte er nie ein Ende nehmen. Bei den Ausschachtungen war man auf Grundwasser gestoßen, Wochen hindurch tat man nichts weiter als Wasser herauspumpen, wenn man am Abend damit fertig war, fand man am Morgen wieder einen großen See vor. Dann kamen die Gewitter, der Boden wurde aufgeweicht, lehmig, alles schien in Feuchtigkeit zu verfaulen, die Leute schüttelten den Kopf, daß dieser Bau nicht vorankam, er verunstaltete das Stadtbild, ständig fuhren Wagen vor, luden Lasten von Steinen, Brettern und Leitern ab, brachten Müll und den Abfall weg, auf der Straße lag Schutt und Erde herum – aber im Grunde waren sie doch froh, eine Menge Arbeiter hatten lange Zeit ihre Beschäftigung, verdienten Geld. Der Bau zog sich in die Länge, aber Herr Dalke konnte es aushalten, wenn er jetzt auch öfters mit einem sorgenvollen Gesicht umherlief und erklärte, wie sehr er sich übernommen habe, wenn er dies zu Anfang gewußt hätte …
Aber nun war es fertig, ein prachtvolles Gebäude, der ganzen Stadt gereichte es zum Ansehen; wenn man hineinkam, glaubte man in einen großen luftigen Saal zu gelangen, in dem nur Frohsinn herrschte, und wenn man die vielen Sachen ansah, die da zum Verkauf auslagen, so konnten einem nur lustige Gedanken kommen. Eine Treppe führte hinauf zum ersten Stock, da war das Reich der Kinder und der Frauen, alles, was man für die Wirtschaft brauchte, und feine Moden. Nun stand Herr Dalke unbestritten an erster Stelle, Herr Wiesel verhehlte nicht seinen Kummer, obwohl er gleich an zweiter Stelle folgte, er durfte sich eigentlich über nichts beklagen – er war eben nur ein wenig ängstlich.
»Wir werden es verspüren«, sagte er zu Herrn Seldersen, »was meinen Sie, wie es uns schadet, oder haben Sie für die nächste Zeit auch so einen Bau vor?«
Der Vater dachte daran, daß er nun bald in den neuen Laden ziehen müsse, wo alles kleiner und gedrückter war, aber gelassen erwiderte er, bisher sei man immer gut ausgekommen, warum sollte dies in Zukunft anders sein? »Und dann hat Herr Dalke doch die gewaltigen Unkosten«, erklärte er weiter, »auch hierin übertrifft er uns alle, er muß am Tage viel mehr einnehmen als ich zum Beispiel, wenn er auf seine Kosten kommen will, das ist ja klar.«
Herr Dalke kam herüber und lud Herrn Seldersen ein, seinen neuen Bau zu besichtigen, sie standen gut miteinander, auch wenn sie Konkurrenten waren; oftmals am Tag besuchten sie sich in ihren Geschäften, sonntags machten sie gemeinsam Ausflüge mit ihren Familien. Herr Seldersen nahm die Einladung an, und eines Abends nach Geschäftsschluß führte ihn der andere stolz durch die erleuchteten Räume, das hatte er geschaffen. Herr Seldersen lobte, er wurde nicht müde, immer wieder seine Bewunderung laut auszusprechen, er schüttelte Herrn Dalke die Hand, dankte ihm für seine Freundschaft und ging neidlos nach Hause.
Im Herbst zogen Seldersens in den neuen Laden, drei Schritte weiter an die Ecke, es war ihnen nichts anderes übriggeblieben. Der Wirt hielt sein Versprechen, er ließ alles neu herrichten, die Wände kalken, den Fußboden ausbessern, es war alles viel kleiner und gedrängter, es roch nach Farbe. Die Eltern wußten, daß sie hier nie heimisch würden, aber sie verloren kein Wort mehr darüber. Frau Seldersen hatte ihre Drohung wahr gemacht, in der ersten Zeit betrat sie nicht den neuen Raum, doch dann ließ es sich nicht länger vermeiden. Alle Bekannten besuchten sie, auch Herr Wiesel kam herüber. Er sah sich genau alles an und besprach mit Herrn Seldersen die Vorzüge und Nachteile; ihm ging es gut, er besaß ein großes Geschäft in der Eisenstraße, er kannte keine Sorgen. Frau Seldersen erklärte, daß nur die Neugier ihn trieb, zu sehen, ob die Regale voll Ware ständen, aber der Vater verwies ihr den Argwohn. »Bis jetzt sind wir alle noch satt geworden«, sagte er, »und Herr Wiesel meint es aufrichtig.«
In der ersten Zeit sah auch der Wirt öfters herein. »Nun haben Sie sich ja bald eingelebt, ich sagte es Ihnen gleich, es ist alles nicht so schwer.« Es klang wie ein Trost.
Herr Seldersen blieb ihm die Antwort schuldig, er machte eine Handbewegung, die sich der andere nach Belieben deuten konnte. Dann erzählte der Wirt, daß zum Frühjahr die Straße aufgerissen und neu gepflastert würde. Man beriet schon eifrigst in der Stadtverwaltung. »Das gibt Arbeit«, setzte er hinzu, »die Leute haben dann Geld und können wieder einkaufen.«
»Im Frühjahr«, entgegnete der Vater, »wer weiß, was bis dahin sich noch alles ereignet, jetzt stehen wir erst vor dem Winter. Im übrigen, woher will die Stadt das Geld nehmen? Eine Anleihe, neue Steuern, wer weiß woher?« Doch vorerst beriet man nur, das wollte nichts besagen.
Dieser Winter war der erste, in dem die Not und der ganze Jammer offenbar wurde, es gab Arbeitslose, in mancher Familie Vater und Sohn zugleich, die Leute kamen und erzählten, sie klagten viel, sie waren alle so mutlos, nirgends zeigten sich Ansätze zu einer neuen Hoffnung.
Seldersens standen in dem neuen Geschäft wie zuvor in dem alten, sorgten sich für den kommenden Tag und trugen kein weiteres Begehren. Die Zeit hatte so manche Veränderung gebracht, man nahm sie hin ohne jeglichen Widerspruch, ja beinahe mit einer gläubigen Gefaßtheit, als habe eine Gottheit dabei ihre Hand im Spiel. Auch dies hier war nur ein Glied in einer unabsehbaren Kette, es sollte nicht einmal das letzte sein.
Der Kaufmann Seldersen hatte sein Lebtag nichts mit denen im Sinn gehabt, denen der Kopf vor weittragenden Ideen zu platzen scheint, die keine Grenzen kennen. Was er benötigte, lag fein säuberlich um ihn herum, jederzeit erreichbar, seine Art verlor sich nur an das Alltägliche, er blieb nüchtern und überlegen, nicht ohne Spur von Zurückhaltung und Nachsicht, ein ganzer Mann – hinter ihm stand seine ganze Zeit. Er war jetzt über fünfzig Jahre alt und sein Leben bisher nur eine große Arbeit gewesen. Wenn er zurückblickte, da stand alles sicher und fest begründet, wie die Abrechnungen in den Büchern, es lief ein gerader Weg, und am Ende stand das Alter, die Ruhe, die Erholung von der Arbeit. Er hatte den Krieg gesund im Feld überstanden, wenn die Jahre auch doppelt zählten, von einem großen Glück schien er gesegnet, seine Kraft war ungebrochen. Vier Jahre leitete seine Frau das Geschäft, nebenbei zog sie zwei Kinder groß. Sosehr sie sich auch mühte, bei seiner Rückkehr fand Herr Seldersen nur noch Trümmer vor, die Regale standen leer, die Kunden blieben aus, alles in allem ein betrübender Anblick. Der Vater unterdrückte alle unliebsamen Erinnerungen und zwecklosen Grübeleien, sein Kredit war unerschüttert, er packte tüchtig mit an, überall hieß es eben wieder aufbauen. Es ging aufwärts in der ersten Zeit, ja, es ließ sich alles gut an. Die Stadt wuchs, nach allen Seiten dehnte sie sich aus, es entstanden prächtige Anlagen, die Fabriken steigerten ihren Umsatz, es gab Arbeit für jedermann, Wohlstand und Zufriedenheit, auch Herr Seldersen hatte teil. Er hatte seine Grundsätze und Anschauungen, nach denen er sich im Leben richtete. Schon damals hätte er sich entschlossener und rücksichtsloser zeigen sollen, vieles stünde heute anders.
In der Inflation verlor er sein ganzes Geld, von diesem Fall kam er nur schlecht wieder auf die Beine. Früher beschäftigte er drei Verkäuferinnen, wenn es not tat, half die Mutter mit aus. Heute teilte er seine Arbeit mit einem Lehrmädchen, aber er hatte sein Auskommen und war zufrieden. Gut, die Zeiten waren schwer und ließen noch Ernsteres ahnen, es hieß eben sich als Mann zeigen, mochte die Last, die auf den Schultern lag, noch so schwer sein – aber das Alter machte keinen Umweg.
In der Nacht zum ersten Osterfeiertag brannte die Fabrik draußen in den Alaungruben bis auf die Grundmauem ab. Es war ein prächtiges Feuer, der Himmel in weitem Umkreis blutig gefärbt, so daß die Wehren weither von den Dörfern des Oderbruches und herab von den Höhen des märkischen Hügellandes mit ihren altmodischen Spritzen angerückt kamen im Glauben, da brenne die halbe Stadt – und es war nur eine Fabrik.
Die Stadt lag weithin sichtbar am Rande des unermeßlichen Flachlandes, lang ausgestreckt zu Füßen einer Hügelkette. Vor unzähligen Jahren, in sagenhaften Zeiten, schleppten gewaltige Eisschollen Schutt, Geröll, Erdmassen mit sich und lagerten sie hier ab, indem sie wie eine Zange die Ebene einzwängten. Heute wellten sich sanfte Hügel, bestanden von düsteren Tannen, schlanken Birken, herben Buchen, aus dem Boden kamen heilkräftige Wasser, und die Erde brachte sich selbst zum Geschenk.
Wo die Hügel allmählich in das Flachland abfielen, waren rundherum Tonziegeleien entstanden, vereinzelt traf man sie auch in der Ebene an, inmitten der Felder und Weideplätze, in der Nähe eines halbversandeten, eingetrockneten Teiches. Landwirtschaft und Industrie bestanden hier dicht nebeneinander, die Fabriken waren ein gewaltiger Konkurrent, sie zogen viele Menschen an, der Bauer mußte sie ernähren. In diesem Landstrich gab es keinen großen Wohlstand, der Boden trug Kartoffeln, Roggen, Gerste und Rüben, unveränderlich seit vielen Jahren, gerade genug, um das tägliche Leben zu fristen.
Der Arbeiter in der Fabrik hatte es schon besser, er tat die vorgeschriebene Zeit seine Arbeit, war nicht abhängig von Wind und Wetter, vielmehr von der Gunst seines Herrn und der Lage auf dem Arbeitsmarkt – aber das kam erst später hinzu, als es immer mehr bergab ging.
Die Nacht war kalt und günstig für ein Feuer. Als das Signal ertönte und die ersten Feuerwehrleute noch schlaftrunken in ihren schweren Stiefeln durch die Straßen stolperten, war das Feuer durch einen Lagerschuppen, der bis obenhin mit fertiggebrannten Ziegeln vollgepackt stand, zum zweiten Verschlag durchgebrochen. Und der Himmel darüber wurde glühend wie eine Esse.
In der Stadt war es vorderhand mit der Nachtruhe vorbei. Seit der letzten Brandperiode vor zwei Jahren, als innerhalb mehrerer Wochen Tag für Tag abwechselnd eine Scheune, eine Strohmiete, ein Stall ausbrannte, hatte man ein so gewaltiges Feuer nicht mehr erlebt. Nun brachen die Flammen ein in die schläfrige Geborgenheit. Die Nacht, die brennende Fabrik, der gespenstisch erhellte Wald dahinter, der Widerschein am Himmel – all das erweckte in den schlaftrunkenen Menschen ängstliche Gedanken, die sich auf das Zukünftige richteten und hier ein erstes dunkles Zeichen zu sehen glaubten. Wer nicht herauslief zur Brandstätte, stieg auf den Dachboden und sah von dort ein großes Flammenmeer, eingebettet in tiefe dunkle Wälder, die ein roter Schein umgaukelte, als ob der Wald selbst brenne.
Der Kaufmann Seldersen stand in dieser Nacht nur kurze Zeit am Fenster, das schrille Signal zu Anfang, der immer mehr aufschwellende Lärm auf der Straße hatten ihn aus dem Bett geholt. Er lehnte sich hinaus, sah die Vorbereitungen der Feuerwehr auf dem kleinen Platz hinter dem Rathaus und hörte die aufgeregten Rufe der Vorbeieilenden.
»In den Alaungruben brennt es«, sagte er zu seiner Frau. Sie lag im Bett zwischen Schlafen und Wachen, unaufhörlich schwammen ihr die Bilder durcheinander.
»Es ist kalt, schließ das Fenster«, bat sie mit halber Stimme.
Der Vater legte sich wieder hin und vertraute der Wärme seines Bettes. Aber der Schlaf stellte sich nicht ein, die ganze Nacht lag er wach, die Erregung von draußen fieberte im Zimmer nach. Gedanken mancherlei Art quälten ihn. Nichts geschah, was in der Auswirkung für sich allein stand, alles war untereinander auf irgendeine Weise schicksalhaft verbunden, und keinem blieb es am Ende versagt, mitzutragen an der großen Verantwortung.
In den Alaungruben brannte das Feuer. Die Arbeiter aus den Gruben sind zum größten Teil seine Kunden. Jeden Donnerstag, wenn es Lohn gibt, kommen sie in die Stadt, mitunter noch am gleichen Tag oder erst am nächsten, und kaufen ein. Wenn sie dieses Mal kommen, werden sie viel zu erzählen haben, aber wie es mit dem Geld und dem Kaufen fortan steht…?
In dieser Nacht verloren an zweihundert Arbeiter auf lange Zeit ihre Arbeit. Der Besitzer nahm die Versicherungssumme und zog fort. Es hieß, der Brand sei ihm nicht ungelegen gekommen, in absehbarer Zeit habe er seinen Betrieb doch einschränken müssen, er warf nicht mehr genug ab. Das niedergebrannte Werk wurde von einer Gesellschaft gekauft, zwei Jahre blieb es brachliegen.
Das Feuer war längst wieder vergessen, der schweflige Qualm, der noch lange Zeit danach in der Luft hing, abgezogen, die Fabrik stand da, ausgebrannt, ein trauriges Bild der Verlassenheit, die Kinder spielten darin, wenn die Arbeiter daran vorbeigingen, wandten sie ihren Blick ab.
Da erschien eines Nachmittags plötzlich ein kleiner, noch junger Herr bei dem Kaufmann Seldersen unten im Laden, er trat recht entschieden auf, verlangte kurzerhand den Vater zu sprechen und zeigte auch sonst keine Befangenheit. Sein Äußeres wies manche Merkwürdigkeit auf, er trug einen besonders hohen Kragen, der dem Kopf gleichsam als Sockel diente, beim Sprechen verzog er in regelmäßigen Zwischenräumen sein Gesicht, wobei dann unzählige kleine Falten versteckt aus der glatten Haut hervortraten, es sah aus, als wenn er grinse.
Herr Seldersen schien ihn erwartet zu haben, er nahm seine Geschäftsbücher, flüsterte seiner Frau ins Ohr und ging mit dem Fremden hinauf in die Wohnung. Er hatte an den Büchern schwer zu tragen, aber der andere half ihm nicht. Die Mutter blieb allein unten zurück, sie setzte sich an die Kasse und faltete die Hände im Schoß. Sie hatte Mühe, ihre Erregung zu meistern. So fand sie Albrecht, als er in den Laden trat.
»Wo ist Vater?« fragte er.
»Oben«, antwortete die Mutter, sie kritzelte andauernd verschlungene Kreise auf ein Stück Papier. Nach einer Weile: »Geh einmal hinauf, ein Herr vom Finanzamt ist da, paß auf, was sie miteinander reden.«
Albrecht erstaunt: »Ein Herr vom Finanzamt? Was will er bei uns, und so überraschend?«
»Nein, er hatte sich heute morgen schon angemeldet, der Vater sagte es mir auch erst vorhin, ich wußte es nicht, er will Einsicht in die Bücher nehmen.«
»In die Bücher, verdammt«, entfuhr es Albrecht. Er besaß keine große Erfahrung in geschäftlichen Dingen, die Eltern hielten alles, was damit zusammenhing, von ihm fern. Wenn er sich zur Hauptgeschäftszeit unten aufhielt, schickten sie ihn in der Regel hinauf, zum Verkauf eignete er sich nicht, er stand nur herum, jedem im Wege, schon besser, er blieb oben.
Der Vater war als Geschäftsmann verpflichtet, ordnungsgemäß die Bücher zu führen, zu jeder Zeit konnte man schriftliche Unterlagen von ihm verlangen. Allabendlich, wenn er die Tageskasse überzählt hatte, besorgte er die Eintragungen, am Ende eines jeden Monats und dann wieder viertel- und ganzjährig folgte die große Abrechnung. Daraus ergaben sich die Abgaben an den Staat. Das Buchführen war eine Kunst, man konnte, wenn man es verstand, viel Eigenes dazutun, zurechtstutzen, färben. Ob sein Vater es auch tat, wußte Albrecht nicht genau, im Augenblick kamen ihm sogar Zweifel.
»Hoffentlich sind sie in Ordnung«, sagte er ängstlich.
»Natürlich«, antwortete die Mutter, sie war ihrer Sache anscheinend ganz sicher, »aber angenehm ist es nicht.« Albrecht ging hinauf in die Wohnung und legte sich im Nebenzimmer auf die Lauer.
Der Fremde, der Herr vom Finanzamt, nimmt ein großes Buch, und bevor er es aufschlägt, sagt er allgemein ein paar einleitende Worte.
»Sie wissen, daß wir mit Ihrer Erklärung nicht einverstanden sind, Herr Seldersen. Wir sind der Meinung, daß Sie versuchen, der Steuer eine beträchtliche Summe zu hinterziehen. Im Vergleich zu den vorigen Jahren erscheint es uns besonders auffällig. Allgemein versucht man jetzt, uns, den Staat, zu behumpsen« – wirklich, behumpsen, er gebrauchte es auch später noch ein paarmal, betrügen schien ihm zu scharf zu sein, denn er hatte ja keine direkten Beweise. »Es ist nur zu menschlich«, fährt er fort, »unsere Beamten sind jetzt täglich unterwegs, es kommt da so mancherlei ans Licht.«
Der Vater liegt mit dem ganzen Oberkörper quer über dem Tisch, damit er beim Hin- und Herreichen schneller zur Hand ist, ruhig hört er sich an, wessen man ihn da beschuldigt. Im Vergleich zum vorigen Jahr, was sollte er darauf antworten, hier die Bücher werden schon Auskunft geben. Hinter der Tür lauscht Albrecht gespannt. Bevor der andere aber anfing, hörte er den Vater fragen:
»Wie lange sind Sie schon hier auf dem Amt?«
»Seit einem dreiviertel Jahr.«
»Soso.«
Warum er frage, forschte der Beamte.
»Ach nur, Ihre anderen Kollegen kenne ich schon seit vielen Jahren, aber Sie habe ich eigentlich noch nie gesehen.« Pause.
Eine harmlose Frage, ja beinahe sinnlos und ohne Zusammenhang, aber Herr Seldersen verfolgte schon seine Absicht. So durchtrieben war er. Erkundige dich bei ihnen nach mir, wollte er damit sagen, frage sie, mit wem du es hier zu tun hast, mit einem Bilanzfälscher oder mit einem ehrlichen Kaufmann.
Der Beamte war nicht dumm, er verstand, nach welchem Ziel diese Frage schoß, aber er war erst kurze Zeit hier. Dieser alte Mann, wie er zitterte!
»Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, Herr Seldersen«, sagte er, »ich bin als Beamter verpflichtet, zu verhüten, daß man den Staat behumpst, und wenn ich jetzt bei Ihnen bin, so besagt das noch nichts gegen Ihre Lauterkeit. Schließlich müssen wir uns doch überzeugen, daß Ihre Angaben auf festem Boden stehen. Ich weiß genau, es ist jetzt eine schwere Zeit für Sie, für die Geschäfte, für uns alle. Hoffen wir, daß es bald besser wird.«
Der Vater nickte mit dem Kopfe.
Ja, es war schon schwer, lange durfte es nicht mehr so weitergehen, was sollte er noch große Worte machen. Er hatte gearbeitet und verdient, sein Geld verloren und weitergearbeitet, obwohl er die Fünfzig überschritten hatte und ihn oft das Verlangen nach Ruhe und Entspannung ankam. Hier in diesen Büchern stand alles haargenau, unfehlbar richtig. Die Erinnerungen gewannen die Oberhand in ihm, er nahm ein Buch zur Hand: »Da sind die Abschlüsse aus den Jahren vor dem Krieg, sehen Sie, das sind noch Zahlen, was? Die werden wir nicht wieder erreichen, nie, aber das will man auch gar nicht. Nur ein bißchen besser soll es werden, man will die Gewißheit haben, daß es langsam wieder bergaufgeht.«
Der Beamte fing an in dem Buch hin und her zu blättern, überprüfte einen Abschluß, verglich die Übertragungen, verfolgte die einzelnen Konten, überall machte er Stichproben. Zwischendurch stellte er einige Fragen an den Vater:
»Sie haben zwei Kinder, Herr Seldersen?«
»Ja, ein Mädel und einen Jungen.«
»Und Ihre Tochter ist in Berlin?«
Der Vater nickte: »Sie hat dort eine Stellung angenommen, nebenbei bildet sie sich noch weiter.«
»So. Wieviel geben Sie ihr monatlich?«
»Gar nichts, gar nichts, sie verdient sich alles selbst.«
»Davon lebt sie und bezahlt noch ihre Ausbildung, das ist doch nicht gut möglich«, forschte der Beamte.
Der Vater bewies es ihm, die Ausbildung kostete nicht viel, sie erhält Ermäßigungen und Vergünstigungen, »ihre Kleidung kann ich ja sehr billig besorgen«.
»Und Sie geben ihr gar nichts?«
Der Vater wand sich hin und her. »Nennen Sie das unterstützen, wenn ich ihr fünf Mark in die Tasche stecke oder ein Paket sende?«
»Wo buchen Sie den Betrag?«
»Das sind kleine Ausgaben, so nebenbei, die trage ich nie besonders ein«, antwortete der Vater, er wurde etwas befangen, seine Stimme verlor mehr und mehr an Sicherheit, für Albrecht ein bekanntes Zeichen. Er lauschte weiter, gespannt.
»Und die Geigenstunde von Ihrem Sohn?«
Der Vater stutzte, mit der Zeit kam ihm dieses Verhör geradezu unheimlich vor, was wußte der Fremde nicht noch alles von ihm? Sicherlich hatte er die Geige in der Ecke am Klavier gesehen. Aber ein Verhör, ein richtiges Verhör.
»Das steht hier«, gab er schnell zur Antwort und nahm ein kleines Buch zur Hand, das für derartige Ausgaben angelegt war.
Noch mehr wollte der Fremde wissen, zum Beispiel, warum Herr Seldersen kein Haus besitzt, wo er doch schon so lange hier ansässig ist und sicherlich Gelegenheit zu einem Kauf gehabt hat.
»Gott sei Dank, auch die Sorgen jetzt noch«, meinte der Vater.
Sorgen? Im Gegenteil, er hätte sein Geld doch dann gut angelegt und nicht alles verloren.
»Das habe ich eben verabsäumt«, gab Herr Seldersen zu, als gestehe er eine Sünde, »konnte man denn alles im voraus wissen und danach sein Handeln einrichten?«
Der Beamte schlug Seite für Seite um, und es dauerte eine lange Zeit. Albrecht wurde es allmählich zu langweilig im Nebenzimmer, er ging hinunter und erstattete der Mutter genauen Bericht, bisher ist alles gut abgelaufen, der Vater ein wenig aufgeregt, aber er macht klare Angaben, der Beamte kann ihm nichts nachweisen. Sie gab sich zufrieden.
Unterdessen arbeitete der Beamte weiter, rechnete, verglich, auf einmal entdeckte er zwei kleine Fehler, er lachte.
Diese Fehler hier waren nicht wesentlich, sie änderten auch nichts an dem Endergebnis, aber einem geübten Auge fielen sie sofort auf.
Dem Vater schoß das Blut zu Kopf, er neigte sich tief auf die Seiten: »Da habe ich angefangen, mir die Bücher alleine in Ordnung zu halten«, sagte er verschämt, »ich wollte die Ausgaben für einen Buchhalter sparen. Zu Anfang unterliefen mir dann gewiß ein paar Fehler.«
»Sie haben die großen Jahresabschlüsse auch alleine ausgeführt?« fragte der Beamte ungläubig.
»Jawohl, zusammen mit meiner Frau. Zuerst machte es große Schwierigkeiten, später fand ich mich damit zurecht.«
»Alle Achtung, wirklich, sehr anerkennenswert.« Er prüfte weiter.
Und dann auf einmal wurden die Summen immer kleiner, die Tageseinnahmen gingen immer mehr zurück, man sah es aus den Eintragungen.
Eine ganze Geschichte konnte man aus diesen Zahlen ablesen. Es gab kein besseres Beispiel. Herr Seldersen stand dabei und starrte auf die beschriebenen Seiten. Seine Erregung hatte sich allmählich gelegt, und eine beherrschte Ruhe lag über ihn gebreitet. »Glauben Sie mir, es ist schon so, wie ich sage«, bat er leichthin.
Der Beamte schwieg. Saß er abends, wenn Herr Seldersen das Geld zählte und die Summen eintrug, neben ihm? Er verglich die Schulden. Nach und nach verließ ihn seine anfängliche Steifheit und das Mißtrauen, ja er taute auf und wurde gesprächig.
»Soll Ihr Sohn später studieren?« fragte er Herrn Seldersen.
Der vergaß zuerst eine Antwort, die Frage hatte noch Zeit, wie konnte man sich jetzt schon entscheiden. Nach einer Weile:
»Es wird ihm wohl nichts anderes übrigbleiben, man muß abwarten.«
Schon jetzt verspürte er ein leises Unbehagen, wenn er an die Zeit dachte, in der sich sein Sohn und er mit ihm zu entscheiden hatten.
Anfangs wollte er auch gerne studieren, erzählte der Beamte, der Krieg kam ihm dazwischen, nachher mußte er zusehen, möglichst schnell Geld zu verdienen. Oft tat es ihm heute noch leid, Pflanzenkunde interessiert ihn brennend.
»So, Sie waren also auch schon draußen«, lenkte der Vater ab.
»Natürlich, ich bin sogar verwundet, ein Querschläger am Arm, es ging noch einmal gut aus.«
Herr Seldersen bot ihm eine Zigarre an.
Schließlich mußte der Beamte sich die Bücher mitnehmen, aus dem kurzen Einblick hier gewann er kein genaues Bild. Soweit er jetzt die Sache übersah, schienen die Angaben auf Wahrheit zu beruhen; von einigen kleineren Fehlern abgesehen, ließen sich keine Unregelmäßigkeiten entdecken. In ein paar Tagen erhält Herr Seldersen dann einen abschließenden Bescheid.
Als der Vater wieder im Laden erschien, lachte er.
»Ist alles in Ordnung?« fragte die Mutter ängstlich, die ganze Zeit verließ sie nicht die Sorge.
»Was soll denn nicht in Ordnung sein? Natürlich, alles hat seine Richtigkeit.«
Nach ein paar Tagen brachte der Beamte die Bücher eigenhändig zurück, er zeigte sich dieses Mal überaus freundlich und zuvorkommend.
»Hier bringe ich Ihnen die Bücher«, sagte er, »sie sind in Ordnung, es war nicht anders zu erwarten.«
Herr Seldersen hatte seine Genugtuung. Noch eine ganze Weile standen sie beisammen und unterhielten sich über die Aussichten. Er hieß übrigens Röllger.
»Das Geld ist knapp und teuer«, erklärte Herr Röllger. Herr Seldersen nickte zustimmend.
»Woher das nur kommt?« wunderte er sich.
Röllger: »Wir haben doch verloren, und deshalb sind wir in der verzwickten Lage.«
»Aber die anderen«, wirft Herr Seldersen ein, »die sich doch den ganzen Gewinn einstecken – geht es denen wirklich so gut?«
Röllger lachte höhnisch: »Von gutgehen keine Rede, aber sie können es vorläufig noch aushalten, denn sie haben ja große Reserven. Und dann die Verschuldung und Lastenverteilung, all das zusammen läßt keine Erleichterung aufkommen. Lieber gehen sie alle zusammen langsam zugrunde, als daß sie dem helfen, bei dem die größte Not herrscht.«
Herr Seldersen nahm sich ein Herz und erklärte freimütig, daß ihm diese gesamten Verwicklungen ziemlich unklar seien, er sieht nicht hindurch, wo es eigentlich im argen liegt, hinzu kommt, daß er auch gar nicht viel Eifer anwendet, um sich mehr um diese Angelegenheiten zu kümmern. Er hat mit sich genug zu tun – auch später wendet er diesen Satz noch oft an: mit sich selbst genug zu tun –, und das genügt ihm vollauf. Außerdem geht er ja deshalb zur Wahl und gibt seine Stimme ab, damit andere, die mehr Zeit haben, sich damit beschäftigen, gleichsam in seinem Auftrag entscheiden. Aber er fürchtet beinahe, daß auch die anderen sich nicht mehr zurechtfinden. In der Tat, es ist köstlich, sie lachen beide. Und dann die großen Zusammenkünfte und Konferenzen, jeden Augenblick eine andere, es wird da gut gegessen und vortrefflich geredet, das muß man sagen, juristische Berater sind natürlich immer zur Hand und finden die gesetzlichen Unterlagen und Begründungen, aber wie weit das mit Recht überhaupt noch etwas zu tun hat, weiß kein Mensch. Zehn Jahre dauert nun schon der Friede, aber er ist schlimmer als der Krieg selbst. Nun kann es endlich bald einmal besser werden.
»Sehr wahr«, sagte Röllger, »sehr wahr.« Zum Abschied gab er dem Vater die Hand, sie verstanden sich beide.
Einen Monat später, im Hochsommer, feierte Herr Seldersen sein fünfundzwanzigjähriges Geschäftsjubiläum. Fünfundzwanzig Jahre! Schon am Morgen schickte der Wirt sein Töchterchen mit einem großen Blumenkorb herüber, an dessen Henkel eine Fünfundzwanzig aus Margueriten gewunden hing. Viel herzlichen Glückwunsch! Der Wirt und seine Frau kamen später selbst und brachten ihre Glückwünsche. Sie fühlten sich geehrt, daß Herr Seldersen fünfundzwanzig Jahre in ihrem Hause sein Geschäft betrieb. Von dem Ruhm und den Ehrungen, mit denen man ihn jetzt überhäufte, fiel auch ein gut Teil auf sie ab. Fünfundzwanzig Jahre konnte man mit ihnen auskommen … und noch weitere fünfundzwanzig, sagten sie und schüttelten Herrn Seldersen kräftig die Hand. Sie dachten sich wohl beide nichts dabei und meinten es nicht so wörtlich, aber Herr Seldersen dachte bei sich im stillen so manches, offen gestanden, er besaß keinen besonderen Ehrgeiz mehr. Alle stellten sich ein und gratulierten, am Nachmittag stand es in der Zeitung, ein kurzer Rückblick … ein treuer Mitbürger der Stadt … angesehen, ein Stück Geschichte – herzlichen Glückwunsch und weiterhin alles Gute.
Unter den Kunden gab es einige, die die ganzen Jahre hindurch treu zu ihm gehalten und, was sie brauchten, nur bei ihm gekauft hatten. Die Eltern waren bereits Kunden gewesen, die Kinder damals noch klein, Seldersens erlebten mit, wie sie aufwuchsen, zur Schule gingen, eingesegnet wurden, sich verheirateten, nun kamen sie selbst, der Vater war vielleicht schon gestorben, sie brachten die Mutter mit. Die saß im Laden auf dem Stuhl, wackelte mit dem Kopf und erinnerte sich der vergangenen Zeiten.
Herr Seldersen ging umher und nahm alles hin, stumm, in einem beglückten Schweigen. Es war ihm nicht recht, auf einmal in den Mittelpunkt gerückt zu sein, wenn auch nur für einen Augenblick, er fühlte sich in seiner Zurückgezogenheit sicherer, umfriedeter, was hatte er schon für ein Verdienst sich erworben. Aber er konnte seine Rührung nicht verbergen, Dank, viel herzlichen Dank auch! Morgen ist auch ein Tag. Aber es ging ihn doch an, so ein Tag war schon ein Ereignis, man konnte auf ihn rechnen, sich auf ihn berufen, er entschädigte für vieles. Aber nicht zu verheimlichen, die Erinnerungen, die erwachten, waren nicht immer angenehm, ihnen wurde nicht immer ein freundliches Gedenken zuteil. Vor fünfundzwanzig Jahren, ja, da fing man erst an, mit Hoffnungen und Wünschen, man selbst war jung, kräftig. Und so sollte es werden, oh, was versprach man sich nicht alles. Und vor zwanzig Jahren … und vor fünfzehn Jahren, und dann … der Krieg vier Jahre, und dann … immer weiter, und dann …
Der Vater stand den ganzen Tag im Laden, zu Beginn des Nachmittags kam der kleine Kipfer, er war früher lange Zeit Zigarrenarbeiter gewesen, bis seine Lungen erkrankten. Er befand sich gerade auf dem Weg zum Rathaus, um eine Versammlung für die nächste Woche anzumelden; als er an der Ecke vorbeikam, stand Herr Seldersen an der Tür und hielt Ausschau. Auf dem Rückweg sprach der kleine Kipfer bei ihm vor. Von jeher, schon in seinen gesunden Jahren, befaßte er sich mit der Politik, vor allem die Fragen der wirtschaftlichen Neugestaltung hatten es ihm angetan, die Ökonomie, die Rationalisierung und wie die Worte alle hießen, die sich in seinem Munde sonderlich ausnahmen. Seit ihn seine Krankheit zur Untätigkeit verdammte, arbeitete er für eine radikale Partei, die ihn auch schon einmal verschickt hatte, er war belesen, witzig, ein großer, alter Soldatenmantel bedeckte seine kleine, schmale Gestalt. Er kam öfter zu dem Vater, und immer fanden sie Stoff genug zu einer Unterhaltung.
Zuerst brachte der kleine Kipfer noch nachträglich seine Glückwünsche an, sie kamen etwas verspätet, Herr Seldersen dankte, das lag nun schon lange zurück.
Der kleine Kipfer war viel beschäftigt, vor den Wahlen, sagte er, gibt es immer viel Lauferei. Er mußte organisieren, veranstalten, er empfing Anweisungen, gab sie weiter, alles lief bei ihm zusammen. »Man sieht Sie gar nicht in den Versammlungen«, begann der kleine Kipfer, »Sie sind doch ein verständiger Mann …«
Der Vater lachte. »Allerdings, ja, wenn die Politik mein Beruf wäre, aber so …«, er ist am Abend immer zu müde, entschuldigt er sich kurzerhand, im Augenblick lag ihm nichts an einem Gespräch.
»Ein Arbeiter, der acht Stunden Tonkarren schiebt, ist auch müde«, antwortete der andere, »wenn das jeder sagte, wo bliebe dann die Demokratie.« Er ließ nicht locker.
Herr Seldersen verzog mißmutig sein Gesicht: »Ich bin vier Jahre draußen gewesen«, erklärte er in einem Tone, der völlig seinen Widerwillen kundtat, »ich weiß Bescheid.« Am Abend will er wenigstens seine Ruhe haben. Den ganzen Tag steht er hier unten, was ihm die Leute alles erzählen, er hört genug – nein, er macht sich nichts daraus, in einem stickigen und überfüllten Raum zu sitzen, Reden anzuhören, Bravos und sonstige Zwischenrufe. Bis zu einem gewissen Grad erscheint ihm diese leidenschaftliche Anteilnahme lächerlich, verspielt, ja unmännlich. Glaubt der andere denn wirklich, daß es einen Einfluß auf das Geschehen im Augenblick oder in Zukunft hat, ihm geht das nicht ein. Außerdem ist er ja immer unterrichtet, er liest die Zeitung, natürlich, man muß doch wissen, was in der Welt vor sich geht. Aber jetzt überkommt ihn öfter dabei der Schlaf. So spricht Herr Seldersen, unlustig, spöttisch, und umgibt sich mit dem Schein einer behaglichen Sicherheit.
Bisher ist es ihm anscheinend noch sehr gutgegangen, entgegnet der streitsüchtige Parteifunktionär, denn wüßte er wirklich, was in der Welt vor sich geht, so dächte er entschieden anders über die Beschäftigung mit Politik, die nach seiner Meinung wohl nur für Beschäftigungslose da sei. So ist es ihm unter anderem vielleicht entgangen, oder seine Zeitung hat es ihm geflissentlich unterschlagen – denn das ist ein wesentlicher Grund für die allgemeine Unkenntnis –, daß zum Beispiel riesige Ernten an Weizen und Baumwolle vernichtet werden, während es hierzulande doch genug Menschen gibt, die noch nicht einmal das Nötigste zum Leben haben.
Herr Seldersen hatte davon gehört. Ja, er erinnerte sich, irgendwer erzählte es vor kurzer Zeit, er wollte es erst nicht recht glauben. Aber das muß doch einen Sinn haben?
»Ganz recht, einen Sinn, eben den, die Preise hochzuhalten.«
Dann habe er nur Nutzen davon, entschied sich Herr Seldersen, er sah die Dinge sehr einfach und fällte ein Urteil, ohne viel nachzudenken.
»Gut, dann muß aber der Verdienst aller anderen auch dem entsprechen. Denn was nutzt Ihnen der hohe Baumwollpreis, wenn Sie Ihre Ware nicht loswerden. Im Augenblick mag Ihnen die künstliche Hochhaltung der Preise günstig erscheinen, im Grunde ist das aber nicht nur ein Vorgang für sich alleine, losgelöst von allen anderen Vorgängen des täglichen Lebens, sondern ein einzelner in einer Gruppe von vielen, die in sich körperhaft zusammenhängen und Ihnen nicht alle einen Vorteil bringen können, Herr Seldersen.« Es ist in der Tat so verschlungen, daß alles ineinander übergeht. Heute kann er vielleicht noch von einem Nutzen reden, aber bald kann es so weit sein, vielleicht früher, als er erwartet, daß auch er eines Tages …
Hm, hm … der Vater versteht, doch vorläufig gibt er sich noch ruhig und unbefangen, als kenne er keine Sorgen, keine schlaflosen Nächte – aber unbehaglich ist ihm doch zumute. Er hat eine Ahnung, als wenn bei diesem Gespräch nicht sonderlich viel Rühmliches für ihn herausspringt, er wird keine große Ehre mit ihm einlegen. Kurzerhand abbrechen, es nicht zu Ende kommen lassen, das erscheint ihm im Augenblick einzig richtig. Aber für den kleinen schwindsüchtigen Radikalen wäre das ein herrlicher Beweis, daß der andere nicht mehr weiterkann. Herr Seldersen legt sich daher eine andere Erklärung zurecht.
»Bei mir ist es doch etwas anderes«, sagt er bedächtig. Wieso gerade bei ihm?
»Ein Geschäftsmann wie ich muß eine andere Taktik befolgen«, erklärt er gewichtig. »Ich bin ein Geschäftsmann, Kipfer, ich stehe sozusagen in der Öffentlichkeit, allen Augen sichtbar. Was ich tue, tue ich nicht nur für mich, gleichsam versteckt in meinen vier Wänden oder unter einer Decke. Sehen Sie, da kommt der Herr Inspektor vom Amt mit seiner Gemahlin, der Landwirt hier oben von der Höhe und der Arbeiter aus den Ziegeleien. Nun, ein jeder hat seine eigene politische Meinung, mit einem von den dreien stimme ich, was Politik angeht, sicherlich nicht überein, das ist auch nicht gut möglich. Soll ich es mit ihnen verderben und, wenn ich einen in einer Versammlung treffe, sagen: Guten Tag, Herr Inspektor, ich verkaufe Ihnen gerne jeden Tag, was Sie wollen, jederzeit haben Sie bei mir ein Konto, aber Ihre politische Meinung – sehen Sie sich Ihre Partei an, lauter Halunken, Bankrotteure, Hochstapler. Was er wohl da zur Antwort erhält? Meine politische Überzeugung, wird der andere sagen, geht Sie mit Verlaub einen Dreck an, und für mein Geld bekomme ich meine Ware auch bei Herrn Wiesel. Schon ist er ihn los. Oder wenn er in seinem Geschäft mit ihm ein Gespräch beginnt, wie soll er sich dazu stellen? Soll er vielleicht sagen, Sie haben recht, und dann kommt der nächste, und der hat auch wieder recht, und so fort. Da ist es schon besser, er sagt gar nichts, stellt sich unwissend.« Er faßt zusammen: »Nein, nein, all die sollen sich öffentlich herausstellen, die unabhängig sind oder vertragen können, wenn ihnen die Kundschaft davonläuft. Ich habe schon meine Meinung, gewiß, aber ich dränge sie keinem Menschen auf.«
Gewiß, das verlangt auch keiner von ihm, bestätigte der kleine Kipfer, aber wenn er es sich recht betrachtet, so scheint es ihm, als ist das nicht der einzige Grund. Herr Seldersen sagte vorhin etwas von unabhängig, wen in Gottes Namen bezeichnet er nun mit unabhängig, wer hängt denn heute nur von sich allein noch ab? Der Landarbeiter etwa, der Angestellte, der Ziegeleiarbeiter? Die sind doch alleweil auf dem Sprung, entlassen zu werden, wenn sie sich mit ihrer Überzeugung unliebsam bemerkbar machen.
»Warum sind sie auch so dumm?«
»Dumm?« Der kleine Kipfer schüttelt den Kopf, »dumm gewiß nicht.« Er hält es eher für mutig.
»Ja«, sagte der Vater und lachte spitzbübisch, als wollt’ er jetzt seinen größten Trumpf ausspielen, »dann sind da immer noch die Gewerkschaften …«
»Ja«, erwiderte der kleine Kipfer, und der Kopf wurde ihm heiß, »da haben wir noch die Gewerkschaften.« Er fühlte sich durchaus nicht geschlagen, im Gegenteil, jetzt holte er erst richtig aus, Herr Seldersen hatte ihm die Waffe selbst in die Hand gegeben.