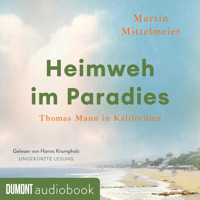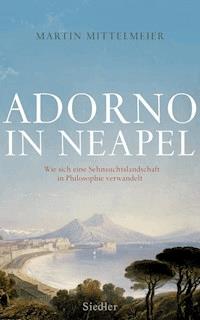9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nerven am Rande des Weltzusammenbruchs.
100 Jahre DADA
DADA: Waren das nicht schräge Verkleidungen, schrille Happenings, provokanter Nonsens, kurz: viel Lärm gegen das Nichts einer Kultur, die den Ersten Weltkrieg möglich gemacht hatten? Auch. Vor allem aber ist DADA eine Bewegung von Künstlern und Lebensstrategen, die lustvoll-kämpferisch auf eine unübersichtlich gewordene Welt reagierte. Martin Mittelmeier zeigt, wie überraschend aktuell diese Antworten sind und wie DADA noch immer die Kultur der Gegenwart beeinflusst.
Im Februar 1916 gründet mitten im Krieg im neutralen Zürich eine kleine Gruppe von Künstlern, Literaten und Theaterleuten das Cabaret Voltaire, in dem sich alsbald Unerhörtes abspielt. Hugo Ball zwängt sich in ein obeliskenartiges Kostüm und singt sinnlose Lautverse, Richard Huelsenbeck trommelt erfundene »Negerlieder« und Tristan Tzara dirigiert eine Kakophonie aus simultanem Gebrüll. DADA ist geboren und infiziert von Zürich aus die ganze Welt. Der Charakter von DADA ändert sich mit jedem Ort, denn die Dadaisten sind entschlossen, aus DADA kein neues Programm zu machen. Deswegen ist DADA, nach den Ready-mades von Duchamp, den Montagen von Grosz und Heartfield und den Skandalen im Paris von Breton rasch wieder vorbei. Aber es wirkt bis heute nach. Martin Mittelmeier flaniert und staunt mit uns durch das DADAUniversum, lässt uns teilhaben an der Vielzahl der DADA-Subversionen und zeigt, wie geschickt, verzweifelt und irrwitzig die Dadaisten auf die Probleme einer unmäßig komplex werdenden Welt reagierten, die der unsrigen zum Verwechseln ähnelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Martin Mittelmeier
DADA
EINE JAHRHUNDERT-GESCHICHTE
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Siedler Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Lektorat: Dr. Antje Korsmeier, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-16890-2V002
www.siedler-verlag.de
INHALT
AUF DER SUCHE NACH DADA
AUFTRETEN
Ich möchte Teil einer Eigenbewegung sein
Schönes neues Pathos
Simultanitätsdolmetscher
Musik liegt in der Kunst
Politik oder Kunst. Oder beides?
Viva Emmy
INTERMEZZO I: STELL DIR VOR, ES IST KRIEG
KUNST MACHEN
Vorbei, vorbei
Transparenzlinienpräzision
Zartes Pflänzchen Kunstgewerbe
Abgesondert
Volkskunst
Es geht wieder los
INTERMEZZO II: ENDSPIELE
ZUSAMMEN KLEBEN
Verschluckte Welt
Feinde ringsum
Befehl zur Freiheit
Welt sammeln
Brüchiger Prophet
Wurstigkeit
Tanz die Lotte Pritzel. Und dann den ollen Wilhelm. Und dann …
INTERMEZZO III: WORTFINDUNGSSTÖRUNGEN
SPRECHEN
Für den eigenen Gebrauch
Allein, allein
Sprachschmutz
Körpersprache
Lockerungsübungen
Also sprach Tzarathustra
Fatagagadada
Arp/Starb
Die drei Musketiere
Null. Nada
Phase zwei
Codes der Gesellschaft
Dada empört sich, regt sich und stirbt in Weimar
INTERMEZZO OHNE WAS HINTENDRAN
ANHANG
Anmerkungen
Bibliographie
Personenregister
BILDTEIL
Bildnachweis Bildteil
AUF DER SUCHE NACH DADA
Die Schweiz: ein Ruhepol, eine Oase, ein neutrales Land. Als ein deutscher Offizier mitten im Ersten Weltkrieg, im September 1916, die Grenze passiert, stellt er als Erstes die Uhr eine Stunde zurück, »in die Schweizer Friedenszeit«.1 In Rorschach, seiner ersten Schweizer Station nach dem Grenzübertritt, gönnt er sich ein anständiges Frühstück, weitaus üppiger, als er es sonst in diesen Zeiten bekommt, zum »ersten Mal seit langer Zeit wieder ein saftiges Beefsteak und reichlich Sahne zum Kaffee«.2 Anschließend geht es weiter nach Zürich. Dort bleibt er länger, als er muss, weil er sich nach dem leiblichen Genuss etwas zu Gemüte führen will, das in dieser Art im Ersten Weltkrieg ebenfalls nur in der Schweiz zu finden ist: ein Kabarett aus Künstlern unterschiedlichster Nationalität, von dem er Dinge gehört hat, die sein Interesse weckten.
Es ist kein gewöhnlicher Offizier, der da in Zürich eingetroffen ist, es ist Harry Graf Kessler, ein vermögender Kosmopolit, der, um bei Kriegsbeginn zu seinem Regiment zu stoßen, von London über Paris nach Potsdam reiste; der in ganz Europa nicht nur mit den wichtigsten Politikern, sondern auch mit den jungen, aufstrebenden, aufregenden Künstlern in beständigem Austausch steht. Von dem Zürcher Kabarett hat ihm der Münchener Lyriker Johannes R. Becher erzählt, den Kessler für den genialsten Dichter aus der Generation des Weltkriegs hält, aber auch für eine tragische Figur.3 Becher ist morphinsüchtig, er wirft seiner ehemaligen Freundin Emmy Hennings vor, ihn in die Abhängigkeit getrieben zu haben. Kessler hat in seinem Tagebuch Bechers Charakterisierung von Hennings festgehalten: »Sie lebt Indianergeschichten, denunziert sich selbst u. ihre Freunde der Polizei, nur der Sensation wegen. Hat mit sämtlichen Literaten geschlafen, zwei Litteraturbewegungen inszeniert, Neo Pathetiker u. noch eine, verkauft sich auf der Strasse für 50 Pfennig; Morphinistin u Dichterin. Hat jetzt in Zürich das Kabaret Voltaire. Schläft dort in einem Zimmer mit sämtlichen Artisten u Dichtern des Kabarets, 17 Mann, angeblich aus Armut. Sind acht Monate nicht aus den Kleidern gekommen.«4
Kessler ist Diplomat, er weiß mit solchen Äußerungen umzugehen. Zudem ist er frei von Voyeurismus, von all den angerissenen Dramen interessiert ihn die neue Literaturbewegung am meisten. Vielleicht hat er den Namen der zweiten Bewegung nicht genau verstanden. Oder er hat es nach dem etwas komplizierten Ausdruck »Neo Pathetiker« nicht für möglich gehalten, dass dieser Name so etwas Lapidares, Stammeliges wie »Dada« sein könnte.
Auf jeden Fall ist das Cabaret Voltaire in Zürich weitgehend unbekannt, in Kesslers Hotel hat man davon noch nicht gehört. Kessler lässt sich nicht entmutigen, der Kassierer eines Varietés äußert schließlich die Vermutung, dass es »so Etwas« einmal im »Zunfthaus zur Wage« gegeben habe, in einem der vielen traditionsreichen Zürcher Zunfthäuser auf der wohlhabenden, mondänen Seite der Limmat. Da logiere es aber schon seit acht Monaten nicht mehr, vielmehr sei es nun in die »Meierei« verzogen, in ein »kleines altmodisches Gasthaus am rechten Limmat Ufer«.5 Aber als Kessler dort ankommt, muss er erfahren, dass das Cabaret Voltaire auch hier nur für kurze Zeit stattgefunden habe, die Kellnerin übermittelt ihm die bittere Nachricht, dass es inzwischen »tot« sei.
Egal. Kessler genießt den Gang durch den altertümlichen Stadtteil und die engen Gässchen, genießt die anheimelnde Ansicht, die das Ensemble von Mond, See und Lichtern auf den umgebenden Bergen bietet, und geht in ein anderes Varieté. Ein darin gezeigter Film über die erfolgreiche Atlantiküberquerung des U-Boots »Deutschland« wurde laut Kesslers Notizen »stark beklatscht«.
Uns ergeht es heute, hundert Jahre später, auf der Suche nach dem Cabaret Voltaire und dem, was dort zum ersten Mal mit dem Namen »Dada« bedacht wurde, deutlich besser als Kessler. Es dürfte schwerfallen, ein Zürcher Hotel zu finden, in dem man nicht gewissenhaft Auskunft erhielte über den Beginn von Dada. Womöglich bekommt man einen Dada-Stadtplan, der verhindert, dass man, wie Kessler zunächst, das Zunfthaus zur Waag ansteuert, schließlich war der erste Ort der späteren Dadaisten die Meierei, bevor es nach vier Monaten auf die andere Seite der Limmat ging. Auch sind inzwischen die meisten der Missverständnisse, Erinnerungslücken, Übertreibungen und Fälschungen, die die Dadaisten in Umlauf brachten, identifiziert und aufgeklärt, so dass man Äußerungen wie die von Becher über Hennings als verzerrte Gerüchte goutieren darf. Dada ist penibel und leidenschaftlich erforscht, es hat einen prominenten Platz in der Ruhmeshalle der künstlerischen Avantgarde.
Dada gilt als der explosivste, konsequenteste, schrillste und vielfältigste Versuch, Kunst, Literatur und Sprache aus den Fängen bürgerlicher Ideologie zu befreien, sie der Musealisierung und Intellektualisierung zu entreißen und mit den Forderungen des täglichen Lebens zu konfrontieren. Eine unwahrscheinliche Verbindung von absolut unterschiedlich temperierten und talentierten Künstlern, Dilettanten und sonstigen Lebensstrategen trampelte während und nach dem Ersten Weltkrieg so lange auf den Restbeständen bürgerlicher Kultur und Lebensweise herum, bis diese ihre Überlebtheit eingestehen mussten und das Fitzelchen Irrsinn, das in ihnen versteckt war, herausgaben.
Das Cabaret Voltaire ist tot, behauptet die Kellnerin und damit hat sie vollkommen recht. Zur Zeit des Besuchs von Harry Graf Kessler im September 1916 ist die erste Phase von Dada vorbei. Hugo Ball, der damalige Freund von Hennings und Initiator des Cabarets, hat sich nach Ascona zurückgezogen, die Dadaisten werden auf die kleine Bühne der Meierei nicht wieder zurückkehren. Der Coup bei der Namensfindung »Dada« bestand darin, dass Dada von allen Bedeutungszuschreibungen frei gehalten werden sollte. Das paradoxe Programm war, kein Programm zu haben – was auch der dadaistisch Begabteste nicht lange durchhält. Auch deswegen ist Dada, kaum dass es begonnen hat, schnell wieder vorbei.
Das Cabaret Voltaire ist tot, da irrt sich die Kellnerin natürlich gewaltig. Die Protagonisten des Cabarets werden bald eine eigene Dada-Galerie eröffnen; die Dada-Zeitschrift ist noch nicht erschienen; legendär werdende Zürcher Auftritte stehen erst noch bevor. Zudem schwärmen die Dadaisten bald aus, tragen das Dada-Virus nach Genf, Berlin, Köln und Paris und stecken die ganze Welt damit an.
Noch heute ist »Dada« ein Wort, mit dem jeder etwas anfangen kann, es hat sich von seinen historischen Manifestationen längst emanzipiert und ist in die Alltagssprache eingesickert. Mit diesem Zweisilber kann man sich ganz hervorragend über lustigen Quatsch oder subversive Sprachkunst verständigen: von den weit ausgreifenden und emotional intensiven Anweisungen eines Fußballtrainers, der des Deutschen noch nicht ganz mächtig ist, bis hin zur Rap-Sprechakrobatik werden mitunter eine Vielzahl von Gegenwartsphänomenen unter dem Dach »Dada« versammelt. Und wann immer in europäischen Hauptstädten ein Club gegründet wird, der sich in die Tradition von kultureller Avantgarde, intellektueller Distinktion und libertinärem Kitzel stellen will – von den Salons der Aufklärer aus dem 18. Jahrhundert bis zum New Yorker Studio 54 –, darf das Cabaret Voltaire nicht fehlen.
Insofern ähnelt unsere Situation vielleicht doch der von Kessler. Dada schwirrt durch alle möglichen Träumereien von Befreiungsimpulsen und Subversion. Auf der Suche nach dem Erbe von Dada wird man von dem einen in die Hochzeit des Punk nach London geschickt, wo die von Dada erfundene nihilistische Geste zur Geltung kam – dann wieder wird man mitten in die Happenings der Achtundsechziger hineingeworfen, die die dadaistische Technik der provokanten Aktion ausnutzten.6 Der Philosoph Paul Feyerabend verwandelte die dadaistische Haltung gar in eine grundlegende, anarchistische Gedankenfigur: Einen Fortschritt des Denkens und der Erkenntnis könne es nur geben, wenn man bereit sei, sämtliche Vorannahmen und Erwartungen über den Haufen zu werfen.7 Ist das der unverlierbare Triumph von Dada, dass es so etwas wie eine Essenz von Widerstand zusammengebraut hat: hochexplosiv, schnell wieder vorbei, aber gerade deswegen universell anwendbar?
Jede sympathisierende Erzählung der Dada-Bewegung ist dem großen Reiz dieser Träumerei verpflichtet. Aber sie darf ihm nicht gänzlich erliegen. Denn die Gefahr ist groß, dass all das, was Dada für uns heute interessant macht, unter der Erwartungshaltung der Nachwelt begraben wird und nurmehr eine Art Subversionsfolklore übrigbleibt. Dada sei eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg und auf die Bankrotterklärung einer Kultur, die ihn möglich machte: So lautet ein völlig plausibler Dada-Erklärungsreflex. Doch je näher man den einzelnen Protagonisten und ihrer Geschichte kommt, desto vielschichtiger wird die Bewegung. Und desto spannender: Weil Dada so viele und so unterschiedliche Biografien, Interessen und Ausprägungen von Talent aushalten muss, ist das unter dieser Bezeichnung versammelte Ringen mit den Verheißungen, Zumutungen und Abgründen der damaligen Zeit so intensiv, so drängend, so enervierend. Einer Zeit, die noch dazu wesentliche Züge der unseren trägt.8
Eine Phase immensen wirtschaftlichen Wachstums führt zu einem Innovationsschub, der das Alltagsleben komplett umkrempelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sorgen Eisenbahn und Telegraphie für eine rasante Beschleunigung und Ausdifferenzierung der Lebenswelt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat die digitale Revolution sämtliche Abläufe des privaten und beruflichen Umgangs verändert. So wie sich mit den Bevölkerungsexplosionen der Großstädte ein neues Verhältnis von Nähe und Distanzierung ausbalancieren muss, erzwingen die sogenannten sozialen Medien eine Neudefinierung des Mit- und Gegeneinander. Nach dem Scheitern der sozialistischen Staatsprojekte hat sich in unserer Zeit das Gefühl des Posthistoire ausgebreitet: die Annahme, dass sich die großen Utopien und geschichtlichen Entwicklungslinien mehr oder weniger erledigt haben. Alles findet gleichzeitig statt, es gibt ein riesiges Durch-, weil Nebeneinander von Lebensentwürfen.
Eben diese Gleichzeitigkeit wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals zu einer Herausforderung für den mentalen Apparat des Normalmenschen. Der zeigt sich dieser Erfahrung nicht sofort gewachsen, die Welt ist derart komplex geworden, dass es dem Einzelnen schwerfällt, mit ihr mitzuhalten. Die Gefahr ist groß, dass der äußeren Unordnung eine innere antwortet: Das Denken werde »zerrissen in 1000 Einzelgedanken, Gedankenmoleküle und Atome, Einzelgedänkelchen, Einzelwesen«,9 schreibt beispielsweise der Schweizer Psychologe Fritz Brupbacher zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Einzelne verliert das Zutrauen, auf irgendeine Weise in die unordentlich und übermächtig gewordene Welt eingreifen zu können. Mehr noch, es wird immer fragwürdiger, ob er überhaupt noch das selbstbestimmte und selbstbewusste Individuum ist, das zu sein er einst stolz glaubte: »Alles was heute der Mensch über sich selber oder über die Welt erfährt, […] wirkt dahin, sein Persönlichkeitsgefühl zu schwächen. Seine Empfindungen, seine Triebe, seine Instinkte – so hört er – sind nicht sein individuelles Eigentum, sondern von seinen Vorfahren ererbt oder von seiner Umgebung bedingt; er ist ihr Durchgangspunkt, die flüchtige Zusammenfassung von Teilen, die im nächsten Augenblick sich zerstreuen und neue Verbindungen eingehen werden.«10 Das schreibt Kessler am Ende des 19. Jahrhunderts, vor der Macht-Analytik eines Michel Foucault und ehe es Algorithmen gab, die Wünsche zu erfüllen drohen, noch bevor man weiß, dass man sie hat.
Die Folge ist das Anschwellen von Ratlosigkeit, Überforderung, Erschöpfung. Der Vorläufer des Burn-out war die um die Jahrhundertwende grassierende Neurasthenie.11 Auch das beunruhigende Phänomen des Umschlagens von Unübersichtlichkeit in eine Gegenbewegung – dass junge Leute sich fanatisieren und in einen Krieg ziehen – kommt uns nicht unbekannt vor. Dies ist die Situation, in der sich im Februar 1916 einige junge Menschen auf einer kleinen Bühne im Zürcher Amüsierviertel in Kleider werfen, aus denen sie einige Zeit nicht mehr herauskommen werden. So ist das Wort von der Jahrhundertgeschichte im Untertitel dieses Buches nicht nur Mimikry an den Gegenstand: ein Bluff, eine maßlos überzogene Behauptung, provokanter Unsinn. Sondern es meint genau dies: dass die Dadaisten das Jahrhundertmatch »Wir gegen die Welt« angepfiffen haben, ein Match, das keineswegs vorbei zu sein scheint.
Die Geschichte von Dada wird umso mehr zu einer Geschichte, die uns noch heute etwas angeht, je genauer man sie einbettet in die Zeit des Jahrhundertbeginns. Deswegen werden die Dadas in diesem Buch von raumgreifenden Auftritten zahlreicher Personen flankiert, die nicht zum Inner Circle der Dadaisten gehören. Das ist auch deswegen unverzichtbar, weil sich die Dadaisten in ihrer Lust auf unmittelbaren Gegenwartsbezug ständig an Zeitgenossen abarbeiten, die inzwischen aus dem geistesgeschichtlichen Kanon herausgefallen sind. Erst wenn man beispielsweise Max Brod, Theodor Däubler, Kurt Hiller oder Salomo Friedlaender neu kennenlernt, werden aus vermeintlichen Unverständlichkeiten konkrete Polemiken und Anspielungen; erst dann konturieren sich die manchmal auch gänzlich undadaistisch aussehenden Strategien, mit denen es die Dadaisten mit den Ideen ihrer Zeit aufnehmen.
So steht zwar im ersten Teil dieses Buches der berühmte Auftritt Hugo Balls im kubistischen Kostüm beim Vortrag seiner Lautverse im Zentrum. Balls Bühne ist in diesem Moment aber nicht nur ein Zürcher Zunfthaus, sondern der Epochenbruch, der sich schon lange vor dem Ersten Weltkrieg ereignet. Der Begriff der Simultanität wird dabei vom modischen Schlagwort für diesen Bruch zur tatsächlich nützlichen Kategorie für die Beschreibung einer als Durcheinander empfundenen neuen Welt. Balls »Vorleben« bis zu seinem Auftritt ermöglicht uns eine Tour de Force durch die ästhetischen Avantgarden, durch die Boheme-Gruppierungen und literarischen Zirkel wie etwa die angeblich von Hennings gegründeten Neo-Pathetiker, die um eine adäquate Haltung zu dieser Simultanität ringen. Die gewichtigen Fragen nach dem Verhältnis von Politik und Kunst, nach dem Stand der Geschlechterverhältnisse, nach der Möglichkeit von Gemeinschaft – Hugo Ball stellt sie, indem er da steht in seinem kubistischem Kostüm, er stellt sie vehement und beharrlich, da hat er noch nicht einmal zu sprechen begonnen.
Die Dadas durchleben eine Übergangszeit. »Es bröckelt bereits«, schreibt einer von ihnen, »der neue Mensch dehnt sich«, aber wie wird er aussehen, der neue Mensch, wenn er denn endlich die alte Welt durchbrochen hat? Es gibt zum Jahrhundertbeginn ein unüberschaubares Angebot an alternativen Lebenskonzepten, die der rasanten Industrialisierung und wachsenden Unübersichtlichkeit neue Einfachheit, Mystik und Transzendenz entgegensetzen. Womöglich sind das aber nur die Geburtswehen für eine stillere Utopie, für ein lässiges Auf-Augenhöhe-Kommen mit einer Welt voller Möglichkeiten, für eine Entspannung der Geschlechterverhältnisse, für eine Coolness, die viele Europäer in der Neuen Welt und deren Hauptstadt New York vermuten.
Der Elsässer Künstler Hans Arp, ebenfalls einer der vermeintlich 17 Männer des Cabaret Voltaire, ist unser Begleiter durch die utopischen Landschaften zwischen den Lebensreformern in Ascona, den Bemühungen um ein zeitgemäßes, menschenfreundliches – also ideologiefeindliches – Design und der Suche nach der klaren, einfachen Linie, nach einer Kunst, die die Übertreibungen des modernen Persönlichkeits- und Künstlerkults revidiert. Dass die Dadaisten die Kunst für tot erklärt haben, ist ein Gerücht, das sie selbst durch die ständige Produktion von Kunstwerken, Ausstellungen und das Besprechen von Kunstwerken widerlegen. Sie propagieren nicht das Ende der Kunst, sondern den Beginn einer neuen, wie sie sich etwa in einem Relief von Hans Arp manifestiert, das in diesem Kapitel seinen Auftritt haben soll.
Wie aber kommt das Neue in die Welt, wie geht Veränderung vor sich? »Auf die Verbindung kommt es an«, sagt Hugo Ball, »und dass sie vorher ein bisschen unterbrochen wird.« Das Zerlegen des Bestehenden und das Neukombinieren der befreiten Elemente ist eine grundlegende Technik der Dadaisten, sie nimmt sich die Institutionen der Gesellschaft und deren symbolische Codes vor. Je nachdem, wie stark die Welt gerade wütet, kann man das »Unterbrechen« auch ihr selbst überlassen. Krieg, Revolution und deren Niederschlagung erzeugen genug Gesellschaftsabfall, den man als Dadaist dann nur noch einsammeln muss. Am deutlichsten zeigt sich diese Technik in den Collagen – Hannah Höchs »Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands« steht im Zentrum des Kapitels »Zusammen kleben« und ermöglicht uns einen Blick auf das Berlin der Nachkriegszeit und auf das Gerangel zwischen der dadaistisch inspirierten Gruppe um das Cabaret-Gründungsmitglied Richard Huelsenbeck (mit Raoul Hausmann und Johannes Baader) auf der einen Seite und der politisch kämpferischeren Gruppe um den Maler George Grosz auf der anderen.
Die größte und langfristigste Wirkung hatten die so kurzlebigen Dadas im »Unterbrechen« des symbolischen Codes, in der Irritation und Überdehnung konventioneller und ritueller Sprechweisen. Hugo Balls Lautverse sind nur die berühmtesten Unterbrechungen sinnhaften Sprechens, die Dadaisten vollziehen ein ganzes Register von sprachlichen Lockerungsübungen, von denen wir heute noch zehren. Im Kapitel »Sprechen« flankieren diese sprachlichen Dehnungsübungen die Erzählung von den Versuchen des jüngsten Gründungsmitglieds des Cabaret Voltaire, des Rumänen Samuel Rosenstock alias Tristan Tzara, den Geist von Dada nach Paris zu exportieren.
Wenn zum Dadaismus der produktive Umgang mit den Unmöglichkeiten des eigenen Vorhabens gehört, dann sind die folgenden Seiten als durchaus dadaistisch zu begreifen. Jedes Kapitel gehört einem der Gründungsmitglieder des Cabarets, gehört der Stadt, der er die frohe Kunde von Dada bringt, und der Kunstform, die er in der Hauptsache praktiziert – dieser Plan ist natürlich viel zu schematisch, als dass er so ein spontanes und schillerndes Phänomen wie die Dada-Bewegung auch nur annähernd in den Griff bekäme. Deswegen geht das auch andauernd schief, deswegen hat sich schon im zweiten Kapitel mit Ascona ein dezidiert undadaistischer Ort hineingedrängelt, deswegen schieben sich zwischen die Kapitel auch Intermezzi, in denen Anekdoten angehäuft werden, die zwar nicht unbedingt alle wahr sind, aber unbedingt wahrhaftig. Und wenn sich das Wort »Dada« von der Zürcher Gründermannschaft emanzipiert und Künstler auf der ganzen Welt inspiriert, dann verlässt es die engen Grenzen dieses Buches.
»Auf die Verbindung kommt es an«, sagt Hugo Ball, »und dass sie vorher ein bisschen unterbrochen wird.« Nun denn. Raus aus den Kleidern, in denen es sich die Rezeption einiger Dadaisten bequem, aber müffelig gemacht hat, und hinein in die Indianergeschichten!
AUFTRETEN
Hugo Ball im kubistischen Kostüm
© Hugo Ball: Hugo-Ball-Sammlung, Pirmasens
ICH MÖCHTE TEIL EINER EIGENBEWEGUNG SEIN
Die Schweiz ist neutral, es herrscht Friedenszeit, deswegen sind im Jahr 1916 Menschen aus aller Herren Länder in Zürich angekommen. Die mondäne Bahnhofstraße bekommt den Spitznamen Balkanstraße, Franzosen und Deutsche, die nicht weit entfernt einander gegenseitig umbringen, können sich in den Straßen Zürichs noch freundlich grüßen, Russen sind in der Stadt, wie jener Wladimir Iljitsch Lenin, der mit einem »unbeweglich steinernen Gesicht, eine unscheinbare Aktenmappe unterm Arm«,1 durch die Gassen läuft, aus Triest ist der Ire James Joyce nach Zürich gekommen. Aber auch Geschäftemacher sind angekommen, Kriegsgewinnler, Journalisten, Spione und solche, die behaupten, welche zu sein.
Zürich ist klein, und alles mag etwas langsamer als in den anderen europäischen Metropolen gehen, aber dennoch sind künstlerische Moderne, revolutionäre Umtriebigkeit und Morphinismus nicht nur Importe der Immigranten. Es gibt in Zürich Förderer der zeitgenössischen Kunst wie etwa den Lehrer, Schriftsteller, Buchhändler und Kunstliebhaber Han Coray, es gibt politische Zirkel wie die von dem Psychologen Fritz Brupbacher initiierten Treffen zur sozialistischen Arbeiterbildung im Restaurant »Zum Weißen Schwänli«, es gibt wichtige intellektuelle Umschlagplätze wie die Hacksche Buchhandlung, deren Inhaber an einer Überdosis stirbt.
Man darf also, wenn man an einem zentralen Ort wie dem Zunfthaus zur Waag eine irgendwie kulturelle Veranstaltung plant, auf ordentlichen Andrang und illustres Publikum hoffen. Noch dazu ist es eine besondere Veranstaltung: Zum ersten Mal treten die Autoren, Künstler, Sängerinnen und anderweitig Begabten, die sich als Cabaret Voltaire in der kleinen Meierei versammelt hatten, auf einer größeren, repräsentativeren Bühne auf. Und es ist der erste Abend, den sie mit jenem Wort betiteln, das irgendwann plötzlich aufgetaucht war, um dem, was dort vor sich ging, einen Namen zu geben: Nur knapp zwei Monate bevor Kessler vergeblich das Cabaret sucht, am 14. Juli 1916, findet der »I. Dada-Abend« statt.
Viele der Gäste haben schon von Dada gehört, einige waren bereits bei den Abenden des Cabaret Voltaire zugegen. Man ist gespannt, denn in letzter Zeit ging es in der Meierei deutlich munterer zu als bei den vielen vergleichbaren Zürcher Kabaretts. Die Programmankündigung verspricht in nüchterner Aneinanderreihung allerlei: »Musik. Tanz. Theorie. Manifeste. Verse. Bilder. Kostüme. Masken« sind zu erwarten. Der Abend hat etwas Programmatisches, die Vielzahl von Manifesten deutet darauf hin, dass die Mitwirkenden ein für alle Mal klarstellen wollen, was Dada soll, will und kann.
Irgendwann im Laufe des Abends erscheint Hugo Ball auf der Bühne, die meisten kennen den großen, hageren Mann mit dem schmalen Gesicht, der mit seiner Ernsthaftigkeit und seiner scheinbaren Unerschütterlichkeit die durchschnittliche Betriebstemperatur des Boheme-Milieus stets etwas senkt. Auf den ersten Blick ist so ein Auftritt nichts Weltbewegendes für Hugo Ball, eigentlich ist er ständig auf der Bühne. Er hat sich das vergangene Jahr weitgehend mit Tingeltangel-Programmen über Wasser gehalten, sein Glück oder sein Pech ist, dass er ganz leidlich das Piano bedienen kann. Für die Untermalung eines Kabarettabends reicht es allemal. Nun aber tritt er nicht als Begleiter, sondern als Hauptakteur auf die Bühne. Er war es, der mit Emmy Hennings den Gründungsaufruf für das Cabaret Voltaire initiiert hat, deswegen verfügt er über die volle Autorität des Erfinders, wenn er seinen Auftritt mit den Worten beginnt: »Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, daß bisher niemand etwas davon wußte und morgen ganz Zürich davon reden wird.« Seine Mitstreiter hätten sicher nichts dagegen, wenn er als Primus inter Pares das Programm bloß ankündigte, wenn er als Zirkusdirektor die Erwartungen an die Spektakel seiner Menagerie hochschraubte und die anderen dann mal machen ließe. Aber das ist nicht Hugo Balls Art. Wenn er schon eine solche Ansage macht, dann will er ihr auch beikommen, er möchte seinen Anteil tragen an dem, wovon morgen ganz Zürich reden soll.
Ein besonderer Auftritt also soll es werden. Hugo Ball hatte ausgiebig Gelegenheit, die Kunst des Auftretens einzuüben. Im Jahr 1910 beginnt er an der Schauspielschule des Deutschen Theaters Berlin eine Ausbildung als »Hilfskraft für Regie, Dramaturgie und Verwaltungsfragen«.2 Er darf als angehender Regisseur die Schauspielschüler anleiten, einmal sogar als Vorbereitung zu den Regielehrstunden des Direktors Max Reinhardt, wobei ihm die Schauspieler zunächst mit der dem Anfänger gebührenden Missgunst begegnen. Eine Mischung aus »Kindergarten und Tollhaus«3 sei diese Schule, schreibt Ball seiner Schwester Maria, aber bald beginnt er, das »excentrische Wesen des Schauspielers«4 immer besser zu verstehen. Denn als Regieschüler hat man auch Spielverpflichtung, muss man sich selbst auf der Bühne behaupten. Launigkeit, Dünkel, mangelndes Verantwortungsgefühl: alles verständliche, ja unumgängliche Kollateralschäden der Schauspielkunst. »In diesem Schlüsselbund finde ich den Dietrich auch fürs verschobenste Seelenkunstschloss noch«, schreibt Ball, und: »Ich beginne das Theater zu lieben.«5
Eine schwierige, wechselvolle Liebe, die ihren Höhepunkt erfährt, als Ball vom Intendanten Eugen Robert als Dramaturg an das Münchener Schauspielhaus gerufen wird, dem er in einer seiner ersten Amtshandlungen zu dem von Reinhardts Bühne inspirierten Namen »Kammerspiele« verhilft. Vor Balls Verpflichtung hat Robert das Theater zu einem Forum der modernen Dramatik gemacht. Die erste Spielzeit unter neuem Namen wird im Oktober 1912 mit einem Stück von Leonid Andrejew eröffnet, das idealtypisch »Das Leben des Menschen« nachzeichnet. Noch unter verzweifelt ärmlichen Umständen braust der Held dieses Stückes gegen die graue Figur auf, die als Allegorie für das Schicksal, den Satan oder das Leben stets irgendwo im Eck herumsteht und die Stationen des Helden stumm begleitet: »Kleinmütige Menschen beugen sich vor deiner rätselhaften Macht, dein steinernes Antlitz jagt ihnen Schrecken ein, in deinem Schweigen hören sie dräuende Nöte und grausigen Fall. Ich aber bin kühn und stark und fordere dich zum Kampfe heraus! Laß unsere Schwerter blitzen und unsere Schilde klingen, laß unsere Hiebe auf die Häupter niedersausen, daß die Erde davon erbebt!«6 Es ist das Aufbäumen vor dem sich endlich einstellenden Erfolg, die letzte Station, bevor die Zeit des Helden gekommen ist und er zum begehrten, gesuchten Mitglied der höheren Gesellschaft wird.
Könnte das nicht Hugo Balls eigene Situation als junger, rühriger Dramaturg an einer aufregenden zeitgenössischen Bühne gut treffen? Er macht sich für die moderne Ausrichtung des Theaters unentbehrlich, organisiert Foyerausstellungen mit der Berliner Sturm-Galerie von Herwarth Walden, der den neuesten künstlerischen Strömungen wie Expressionismus und Futurismus ein Forum gibt, gewinnt Dichter wie Gerhart Hauptmann für Autorenlesungen und Matineen. Und er hat angefangen, selbst zu schreiben. Die Tragikomödie »Die Nase des Michelangelo« ist bereits 1911 erschienen, und er hat schon ein neues Stück, die Komödie »Der Henker von Brescia«, begonnen.
Ball ist ehrgeizig, er möchte etwas erreichen, »ich habe solche Sehnsucht, ein grosser Künstler zu werden!«,7 schreibt er an seine Schwester. Natürlich würde er gerne den mütterlichen Sorgen, dass der Abbruch der Lehre in einer Lederhandlung und später auch noch der Promotion womöglich ungünstige Entscheidungen waren, die Grundlage entziehen. Doch das ist nicht der Hauptgrund. Ball beginnt zu einem Zeitpunkt seine wesentliche Lebens-»Station«, als eine ganze Generation danach drängt, an der Reihe zu sein. Die freien Verse, mit denen der amerikanische Dichter Walt Whitman im »Song of Myself« ebendieses Selbst befeiert (»I celebrate myself«), haben längst auch das lyrische Sprechen im alten Europa angesteckt. Max Stirner mit seinem radikalen Egoismus (»Mir geht nichts über Mich!«) wird um die Jahrhundertwende wiederentdeckt, der Kunstgewerbler Hermann Obrist webt eine Linie in einen Wandteppich, die man gerade noch als Pflanze identifizieren kann, die aber lieber als trotziger Namenszug »eines grossen Mannes, eines Eroberers, eines Geistes, der durch neue Urkunden, neue Gesetze gebietet«,8 gesehen wird. Und die Schockwellen, die Nietzsches Ermordung Gottes und des alten Menschen ausgelöst hat, werden noch geraume Zeit für vielfältige Strömungswirbel sorgen. Balls Auseinandersetzung mit Nietzsches Schriften ist intensiver als die der meisten seiner Zeitgenossen: Nietzsches Zeit in Basel war das Thema von Balls nicht zu Ende gebrachter Promotionsschrift, und so hat sich Ball philologisch redlich an Nietzsches Umwertung herangetastet: »Ein anderes Prinzip der Wertschätzung war aufgestellt: das der schöpferischen Köpfe anstelle der gehorchenden, beziehenden; das des Geschmacks anstelle der Pflicht; das der persönlichen Freiheit anstelle der persönlichen Abhängigkeit«.9
Ball hat das Theatermachen und das Auftreten gelernt, und er hat sich den Furor einer »ästhetischen Kultur im Gegensatz zu einer moralischen« theoretisch erarbeitet. Aber es geht nichts über die Praxis. In seinen Münchener Kammerspielen erlebt Ball eine Art des Auftretens, die er nicht für möglich gehalten hätte. Eugen Robert ist es gelungen, die Uraufführung von Frank Wedekinds »Franziska« an die Kammerspiele zu holen, ein Stück, über das Harry Graf Kessler noch 1925 bemerken wird, wie »merkwürdig modern u. nachrevolutionär« es wirke: »Es riecht förmlich nach 1919/1920.«10 Und weil Wedekind das Gefühl hat, dass die ausgebildeten Schauspieler seine Stücke verhunzen und ihn damit um den wohlverdienten Triumph bringen, spielt er die männlichen Hauptrollen am liebsten selbst. Hugo Ball staunt bei den Proben und den späteren Aufführungen zu »Franziska« nicht schlecht: Da ist einer, der denkt gar nicht daran, sich zu verwandeln, der stürmt auf die Bühne und nimmt sie vollends ein. Wenn Frank Wedekind, der nicht-schauspielernde Berserker, glüht und hackt und vibriert, dann kippen all die Einfühlungs- und Verwandlungsspezialisten, all die Virtuosen psychologischer Schauspielkunst einfach um. »Donnerwetter«, ruft Ball aus: »Prägnanz im Superlativ.«11
Wäre das nicht das passende Vorbild für Ball bei seinem Auftritt im Zunfthaus zur Waag? Nicht länger gezaudert, heraus mit allem, was man ist! Man will ja nicht gefallen oder entzücken, man will Kenntnis davon geben, dass jetzt unwiderruflich etwas Neues beginnt. So wie es Wedekind als Nicht-Schauspieler in seinen Stücken exekutiert. Weg mit dem Maja-Schleier der Gesellschaftskonventionen, freier Blick aufs dionysisch Eigentliche. Wer will denn noch Frau Schmidt dabei bewundern, wie gut sie sich in Frau Huber verwandeln kann? »Wir suchen im Theater keine Seelenwanderung mehr; wir suchen Personagen: Neue Körper. Neue Seelen. Wir kommen uns Schauspieler ansehen, wie Sokrates zur Herodote kommt: Neugierig. Nicht auf das Stück. Sondern auf den Kerl, sondern auf das Weib oder Weibchen«,12 schreibt Ball. Der Mensch lässt sich nicht mehr auf die Rollen reduzieren, die er zu spielen hat, Moral ist ein Unterwerfungsinstrument und Gott ist tot. Aber weil der Zweifel daran immer wieder aufzuflammen droht, ist es angebracht, Gottes Hinrichtung beständig zu inszenieren und die Werte immer wieder aufs Neue umzuwerten. Und so schießt Wedekind als Conférencier einer neuen Ära die Bühne frei von einem gemütlich gewordenen Naturalismus. Als Tierbändiger tritt er zum Prolog seines »Erdgeistes« auf die Manege gewordene Bühne und kündigt statt der abgehangenen Probleme des bürgerlichen Trauerspiels das »wahre Tier, das wilde, schöne Tier« an, die nackte, von allen Konventionen befreite Kreatur.
Aber schon 1914 ist das Hugo Ball nicht mehr genug. Wedekind: Das ist ein Theaterereignis, dass einem die Luft wegbleibt, es reinigt die Bühnenluft von allem Ach und Oh des psychologisch-realistischen Theaters. Allerdings ist er im Kampf gegen die alte Zeit selbst noch einer ihrer Protagonisten – Wedekinds Mission, sein Aufbegehren gegen die Moral macht ihn für Ball selbst zum Moralapostel. Graf Kessler wird angesichts einer Aufführung der »Büchse der Pandora« notieren, dass Wedekind nicht revolutionär sei, sondern »bloß rebellisch gegen Mächte, die er anerkennt, zum Beispiel sexuell«. Ein »Sklave, der an seinen Fesseln in höchst pikanter Weise rüttelt«, sei er: »mehr Sadist als Freiheitskämpfer.«13 Für Hugo Ball ist Wedekind ein Schlusspunkt, ein grandioses letztes Mal, unwiederholbar, wenn man nicht zum bloßen Epigonen einer Geste werden will. Also was nun, nach dem Spektakel Wedekind? Ball schreibt: »Wir stellen als Gegenideal, zwecks Überwindung, den Expressionismus auf, der gar kein Objekt mehr kennen will; der mit wahnsinniger Wollust die eigene Persönlichkeit wiederfindet und deren Diktatur ausruft in hintergründigster Selbstschöpfung.«14
Expressionismus: Das ist noch nicht der Epochenbegriff, wie wir ihn heute kennen und benutzen, Das Wort ist ein Spaß, ein Wortspiel, um sich möglichst deutlich vom Impressionismus abzugrenzen, ein Wort, das die Lust anzeigt, einen eigenen Ausdruck unbelastet von aller ästhetischen Tradition zu finden, ein Wort, das inhaltlich erst noch gefüllt werden muss.15
Wenn Hugo Ball im Juli 1916 auf der Bühne des Zunfthauses zur Waag eine Art Diktator der eigenen Persönlichkeit zur Darstellung bringen wollte, dann hat er das in extrem elaborierter Hintergründigkeit vollzogen, elaboriert bis zur Parodie. Er hat sich in ein Kostüm stecken lassen, das er drei Wochen zuvor auf der kleinen Bühne der Meierei schon einmal ausprobiert hatte und das er wie folgt beschreibt: »Mein Beine standen in einem Säulenrund aus blauglänzendem Karton, der mir schlank bis zur Hüfte reichte, so daß ich bis dahin wie ein Obelisk aussah. Darüber trug ich einen riesigen, aus Pappe geschnittenen Mantelkragen, der innen mit Scharlach und außen mit Gold beklebt, am Halse derart zusammengehalten war, daß ich ihn durch ein Heben und Senken der Ellbogen flügelartig bewegen konnte. Dazu einen zylinderartigen, hohen, weiß und blau gestreiften Schamanenhut.«16
In diesen Kartonröhren schafft er es noch nicht einmal eigenfüßig auf die Bühne, man muss ihn heraustragen. Das passt doch nun gar nicht zur diktatorischen Selbstschöpfung, das ist doch wie Vollkaracho mit Handbremse, ein Auftritt, der schon auf der ersten Schwelle zur Bühne aus dem Tritt gekommen ist. Ist Hugo Ball der typische Diktatoren-Anfängerfehler unterlaufen: sich eine viel zu schrille Fantasieuniform zu wählen, die dann die Diktatur über den eigenen Körper übernimmt?
Hugo Ball ist kein Diktator und auch kein Propagandist der eigenen Persönlichkeit. Selten wird über einen Menschen so einmütig und vorbehaltlos positiv berichtet, wird seine Zurückhaltung, sein empathisches Abwägen, seine Vorsicht aus Gerechtigkeitssinn gelobt und bewundert. Selbst die, denen Balls strenge Gutmütigkeit suspekt ist, zollen ihm allergrößten Respekt. Die große Geste, der Auftritt, das Ausrufen irgendeines Programms: nichts für Hugo Ball. Emmy Hennings berichtet, wie schwer es schon war, Ball dazu zu bringen, sie in Gaststätten auf der Gitarre zu begleiten. Schüchtern und voll Scham muss er sich die Aufregung zunächst in geschützten Hauseingängen vom Leib üben. Der Weg auf die Bühne ist für Ball ein immens schwieriger. Alles an seinem Auftritt zeigt diese Schwierigkeit: Weniger selbstverständlich, selbstgewiss und vital ist kaum je einer aufgetreten. Ist möglicherweise genau das die Botschaft, ist das Hugo Balls Manifest? Dass all die diktatorischen Kraftprotze stolperanfällig sind, weil sie nicht so genau wissen, wohin mit der ganzen Kraft? »Da bin ich«, ruft der Stirner’sche Egoist. Na gut. Und nun? Hugo Ball ist in seinem Kostüm die Ikone einer Generation, die zwischen Aufbruchslust und Richtungslosigkeit feststeckt. Selbstbefeierung, dionysische Ekstase oder Wille zur Macht sind ja nun auch keine alltäglichen Aufgaben. Die Talente sind außerdem nicht durchweg gleichmäßig verteilt, manchmal öffnet sich ein weiter Raum zwischen der Lust an der Persönlichkeitsdiktatur und den zur Verfügung stehenden Mitteln, sie zum Ausdruck zu bringen.
Mit dem Apothekersohn und Medizinstudenten Richard Huelsenbeck begegnet Hugo Ball in den frühen 1910er Jahren in München jemand, der diesen Raum virtuos durchmisst. Huelsenbeck möchte Dichter sein, aber es hapert bei der Suche nach einem würdigen Gegenstand. Was Ball als Befreiung fasst, dass das »Gegenideal« des neu zu findenden Expressionismus keinen Gegenstand haben soll, wird für Huelsenbeck zum Problem. »Ehrgeiz soll die Peitsche meiner Entwicklung sein. Ich will hinauf«,17 schreibt er in sein Tagebuch, aber dieser Ehrgeiz läuft mangels Objekt heiß. Huelsenbeck hat das Glück, über den Tellerrand seines Milieus schauen zu können und sich dabei keine allzu dramatischen Kämpfe mit seinem Elternhaus liefern zu müssen. Auf einer solchen freigeräumten Anhöhe kann es allerdings passieren, dass einem die Gegenwart nur so um die Ohren fliegt: »Heute Socialist, morgen Egoist, heute Catolik morgen Anarchist. Herrje, das hurt, seufzt, brüllt und taucht in Meere meiner Meinungen, dass ich die Ohren verlieren könnte, aber die Ohren des feineren Gehörs, das Gefäss der Seele, die Poesie«,18 schreibt Huelsenbeck im Tagebuch. Auch wenn er weiß, dass die Poesie unter diesen Umständen anfällig ist für das Produzieren von bloßen Klischees und sprachlichen Versatzstücken, peitscht ihn sein Ehrgeiz trotzdem dazu, es zu probieren. Das Gedicht »Gebet«, mit dem er es zu einer ersten Veröffentlichung schafft, beginnt so: »Fülle meine Seele mit dem stillen Sehen/ leuchte über meinen Wegen,/ Du, Du gibst den Tränen/ Kraft und gibst den Schmerzen Segen.«19
Mit seinem kubistischen Kostüm hat Hugo Ball einen Standard an extravagant unpraktischer Bekleidung gesetzt, an dem sich zu messen die Dada-Bewegung nicht müde werden wird. Wenn Huelsenbeck Dada später nach Berlin weiterträgt und die Frage nach der Handlungsmächtigkeit und Autonomie des Einzelnen durch die unterdrückte Novemberrevolution politisch brisant wird, wird der Persönlichkeitsdiktatorenuniformkollektion ein weiteres Glanzstück hinzugefügt. Wieland Herzfelde bebildert, als er 1919 mit dem Maler George Grosz und seinem Bruder John Heartfield den politisch kämpferischen Malik-Verlag aufzubauen beginnt, den hintergründigen Befreiungsslogan »Jedermann sein eigner Fußball« mit aller tragikomischen Konsequenz.
Wieland Herzfelde, von seinem Bruder John Heartfield in seinen eigenen Fußball montiert, 1919
© John Heartfield: International Dada Archive, Special Collections, University of Iowa Libraries/The Heartfield Community of Heirs/VG Bild-Kunst, Bonn 2015
SCHÖNES NEUES PATHOS
Szenenwechsel. Eine Art Privatsalon. Müdigkeit. Es herrscht große Müdigkeit. Alle sind schon da, und eigentlich könnte man anfangen, aber ein Mitglied des Clubs fehlt noch. Muss das denn sein, immer diese Entscheidungen, warten oder nicht, gerade heute, am Gründungsjahrestag. Der Hausherr ist unsicher, außerdem ist er unendlich müde, aber schließlich ringt er sich durch, dann fange man eben an. Die Anwesenden sind froh, endlich können sie ihre Liegeplätze im Speisesaal einnehmen, die durch spanische Wände voneinander separiert sind, so dass man sich nicht der Störung eines zufälligen Blickkontaktes aussetzen muss. Es ist das Treffen der sogenannten Differenzierten, der dermaßen Differenzierten, dass ihre Zusammentreffen weit außerhalb des normalen sozialen Lebens stattfinden. Der Kern ihrer Satzung, wenn sie denn so etwas Profanes wie eine Satzung hätten: dass nichts, was sie tun, erwartbar, gewöhnlich, konventionell sein darf. Unendlich schwierig ist es, in dieser Liegerunde das Wort zu ergreifen, denn jedes Anheben, jedes Ergreifen ist sofort umstellt von Floskeln, möglicherweise sogar von Pathos, vom Ruch des schon mal Dagewesenen. Als es dann aber doch ein paar von ihnen geschafft haben, mit verbalen Verrenkungen, die die Verrenkungen des letzten Jahres natürlich noch einmal überbieten mussten, Wortbeiträge in die Buchten der anderen Betten hinein zu verteilen, kommt endlich der verspätete Gast. Walder, der Hausherr, ist froh und hocherfreut, denn es ist ein besonderer Gast, bei ihm darf man sich sicher sein, dass er sich wieder etwas ganz besonders Schrilles hat einfallen lassen, dass er die Subtilität der »Differenzierten-Loge« um eine bedeutende Drehung weiterschrauben kann.
Und jawohl, er enttäuscht auch dieses Mal nicht, er hat sich in ein köstliches Kostüm geworfen, köstlich, weil nicht etwa elegant, sondern die längst gewöhnlich gewordene Eleganz durch krasse Unvorteilhaftigkeit überbietend. So entzückend ungeschickt ist sein kubistisches Obelisken-Kostüm, dass er darin nicht einmal laufen kann, das ist ja wohl der Gipfel. Der Hausherr ist begeistert, als die Diener den Nachzügler hereintragen und er mit einem unverständlichen Gestammel beginnt.
Dies hat sich in der Wirklichkeit nie zugetragen, es ist der Beginn von Max Brods erstem Roman Schloß Nornepygge. In unserer Schilderung hat sich Hugo Ball in eine Szenerie auf die Spitze getriebener décadence hineingemogelt, in die er mit seinem Kostüm erstaunlich gut passen würde. Die Figur, die in der Romanwirklichkeit den Differenzierten-Club so sehr in Begeisterung zu setzen vermag, heißt Guachen. Die Aktionen, die er mit großem Aufwand für ein sogenanntes satanisches Varieté in Szene setzt, würden umstandslos als dadaistische Performances durchgehen. Einen Pianisten sperrt er ein, so dass dieser auf keinen Fall üben kann, und wenn er zum Vorspielen endlich am Klavier sitzen darf, entwendet Guachen ihm die dringend benötigte Brille, so dass das dargebotene Stück zum mühsamen Desaster wird. Das Ballett, für das er die magersten, knochigsten und ungelenkigsten jungen Frauen aussucht, darf nur in den späten Nachtstunden proben, auf dass die gemeinsamen Tanzfiguren niemals geschmeidig werden und Verletzungen zur Nachtordnung gehören.
Für eine Gruppe junger Studenten, die im Berlin der 1900er Jahre eine alternative, nicht-schlagende Verbindung organisieren, ist Max Brod, den man heutzutage meist nurmehr als Kafka-Vertrauten und Retter von dessen Manuskripten kennt, ein literarischer Shooting-Star, und seinen Roman Schloß Nornepygge lesen sie als bezwingende Analyse ihrer Gegenwart. Kurt Hiller, der maßgebliche Betreiber für die Gründung des »Neuen Clubs«, wie die Studenten ihre Vereinigung bald nennen, beschreibt die Lektüre des Romans als einen »Donner, eine Raserei, eine Betäubung«, sie war ihm »stärkstes, wesentlichstes, heiliges Erlebnis«.20
Brods Roman ist der Roman der Stunde, er gibt dem Suchen der Studenten nach einem Platz in ihrer Gegenwart eine ausdrucksstarke Bebilderung. Wie Andrejews Stück »Das Leben des Menschen« ist der Roman eine Art Stationendrama, aber statt der allegorischen, abstrakten Expressivität des Theaterstücks fährt Brod die ganze Welt in ihrer gegenwärtigen Ausprägung auf. Der Club der Differenzierten ist nur die erste Station, in die Brod seinen Helden Walder schickt – das erste Angebot, wie der Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu begegnen wäre. Es ist, trotz aller Überzeichnung, nicht das unplausibelste. Denn wie soll es einem gelingen, sich inmitten des Hurens, Seufzens, Brüllens, das ja nicht nur Huelsenbeck auf die Ohren schlägt, Gehör zu verschaffen? Die deutschen Großstädte sind in den Jahrzehnten um den Jahrhundertwechsel dermaßen gewachsen und randvoll mit Persönlichkeiten, da wartet keiner auf Hugo Ball, Huelsenbeck oder Hiller. Man muss ungewöhnliche Wege finden, um sich bemerkbar zu machen. Also »greift man zu qualitativer Besonderung, um so, durch Erregung der Unterschiedsempfindlichkeit, das Bewußtsein des sozialen Kreises irgendwie für sich zu gewinnen: was dann schließlich zu den tendenziösesten Wunderlichkeiten verführt, zu den spezifisch großstädtischen Extravaganzen des Apartseins, der Kaprice, des Pretiösentums, deren Sinn gar nicht mehr in den Inhalten solchen Benehmens, sondern nur in seiner Form des Andersseins, des Sich-Heraushebens und dadurch Bemerklichwerdens liegt«,21 wie ein zeitgenössischer Philosoph bemerkt. Guachen ist die böse zu Ende gedachte Karikatur einer solchen Überlebensstrategie.
Nach dem Differenzierten-Club probiert der Romanheld Walder die bürgerliche Ehe aus, Dolce Vita, Askese, am Ende gibt es die veritable Option auf Volksführerschaft. Walder geht auf den Dachboden und hängt sich auf. Aber zuvor nutzt er die Gelegenheit, in ausgreifenden Monologen den jungen Studenten aus dem Herzen, oder besser gesagt, aus dem Hirn zu sprechen: »Ich weiß, was ich bin. Ein Kind unserer Tage, Zeitgenosse der Eisenbahnen und großen Kolonialreiche, krank von den einströmenden Schätzen des Weltverkehrs, krank von allzuviel Empfängnis, von allzuvielen Möglichkeiten, unabgeschlossen, ein Opfer des geistigen Freihandels, durchfurcht von allen Dampferlinien und Telegraphendräten der Welt. Ich weiß, was ich bin. Der moderne Mensch.«22 Faust und Hamlet waren wenigstens noch Heroen. Gut, Hamlet war auch schon angekränkelt von seiner Unschlüssigkeit, aber der neue moderne Typus – Walder – weiß noch nicht mal, »ob ich unschlüssig oder des wahren Weges wohl bewußt sein soll. Ich wehe mit dem Winde dahin, ich bin durchsichtig, ich bin überhaupt nichts mehr als ein warmer Luftzug, eine fragende Betonung, ein stummes h…«23
Walder leidet an dem Modernisierungsschub zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um die Jahrhundertwende erfährt Deutschland eine Art erstes Wirtschaftswunder, die Gesamtproduktion von Industrie und Handwerk verdoppelt sich, die Volkswirtschaft insgesamt wächst um 75 Prozent, Kapitalgesellschaften, chemische Industrie und Elektroindustrie machen das Land zu einem der führenden Industriestaaten.24 Walder nennt ein paar der Phänomene, mit denen diese Entwicklung in den alltäglichen Erfahrungsbereich des einzelnen Menschen eindringt. Warum aber führt diese Erfahrung zu so viel Leid? Was ist es, das den »modernen Menschen« in den Suizid treibt? Was hindert daran, das Mehr an Freiheit, das die neue Vielzahl an Möglichkeiten doch bringen könnte, lustvoll auszunutzen und produktiv zu machen?
Am 8. November 1909 hält Kurt Hiller im »Neuen Club« eine programmatische Rede, in der er den Gästen (und später, 1910, den Lesern der Zeitschrift Der Sturm) die kulturkritische Diagnose präsentiert, die hinter dem Krankheitsbild des Nichtzurandekommens mit den allzu vielen Möglichkeiten steckt. Sie ist aus der Philosophie des Geldes