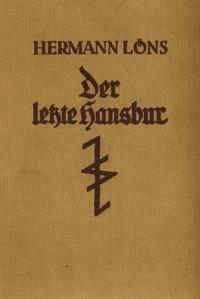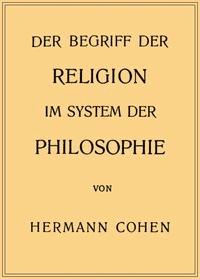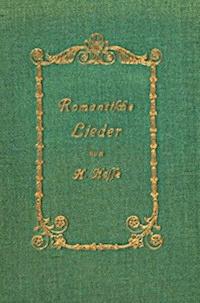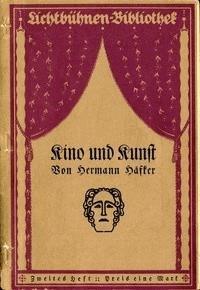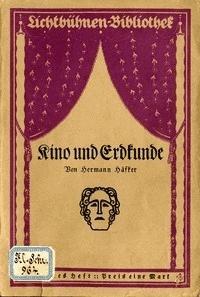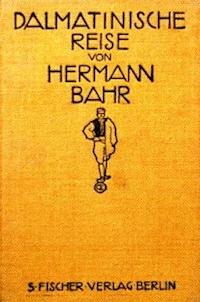
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Ähnliche
DALMATINISCHE REISE
VONHERMANN BAHR
S·FISCHER·VERLAG·BERLIN·1909
DRITTE AUFLAGE
Umschlag und Einband von Professor Emil Orlik.
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. Copyright 1909 by S. Fischer, Verlag, Berlin.
Die Abbildungen verdankt der Verfasser der Güte des Ingenieurs Meitner in Salona, sowie der Kunstanstalt Stengel in Dresden, die geplanten eigenen Aufnahmen sind von der Ragusäischen Polizeibehörde verhindert worden.
DALMATINISCHE REISE
1.
Jetzt kommt es wieder! Immer um diese Zeit. Wenn der Februar sich in den kahlen Ästen dehnt.
Oft um Weihnachten schon geschieht es mir, daß ich, auf dem Semmering vom Doppelreiter zum Wolfsbergkogel rodelnd, plötzlich das Meer sehe, das blaue Meer. Nur einen Moment lang. Der Wind schneit mich an, die Nadeln zergehen, mich wässert in den Augen; und indem ich sie schließen muß, begibt es sich, daß ich das blaue Meer sehe. Die Lider, fest vor dem stechenden Schnee zugepreßt, lassen mich das blaue Meer sehen. Nur einen Moment lang. Schon bin ich wieder wach und erblicke den Eselstein, drüben vor mir, im wogenden Grau. Das blaue Meer haben mir bloß meine Lider vorgeträumt. Nur einen Moment lang. Aber diesen war es in mir da. Und mitten im neblichten Dampf und stachligen Schnee weiß ich jetzt plötzlich wieder, daß irgendwo das blaue Meer ist. Und während ich dann, von der Station den weich verschneiten Berg hinauf, schnaufend meine Rodel schleppe, sagt alles in mir: Blau, blau, blau! Das ist mir wie ein magisches Wort, das alle Sehnsucht stillen kann. Und abends dann, im winterlichen Behagen frottierter Füße in frischen Strümpfen, wenn im Kamin die großen Scheite krachen und ihre roten Zungen zeigen, verfolgt es mich. Immer mit denselben beiden Bildern: ich sehe mich in Mattuglie aus dem Zug steigen und vor mir liegt in der Sonne das blaue Meer da, bis zur Insel Cherso hin; oder ich bin über San Giacomo, auf der weißen Straße nach Trebinje, und unten ist das blaue Meer und drüben das immergrüne Lakroma und dann wieder das blaue Meer und überall das blaue Meer, jauchzend in der Sonne. Immer diese zwei Bilder sind dann bei mir, zum Greifen leibhaft vor mir da. Bis ein großes Scheit prasselnd einbricht und mich aufschreckt: das Gesicht zerrinnt, zum Fenster sehen die stillen alten Fichten herein, in ihren weißen Mänteln.
Und in der hellen Winterslust wird es wieder vergessen. Wochenlang. Aber wenn dann im Februar plötzlich manchmal nachts ein warmer Wind über den Acker fliegt, daß man aus dem Schlaf ans Fenster fährt, als hätte drunten im Garten das Glück gerufen, das Glück selbst mit seiner wilden Stimme, wie mit Peitschenknall, wenn das bange Stöhnen in den nackten Ästen ist, wenn die Wolken, wie tolles Vieh, in Angst und Entsetzen durcheinander rennen, dann kann ich nicht mehr, dann weiß ich sonst gar nichts mehr, dann bin ich überall bis an den Rand von Gier voll, Gier nach dem Meer, nach unserem blauen Meer in der Sonne.
Immer um diese Zeit. Wenn man am Zittern der kahlen Äste merkt, daß schon das Blut in ihnen schlägt.
Und dann steht wieder jene Zeit in mir auf, jene dunkle Zeit vor fünf Jahren. Da war ich am Tode, die Kraft entsank meinem Herzen. Der Arzt schickte mich nach einer Anstalt am Bodensee. Ganz einsam saß ich dort, in Erwartung. Schnee. Sturm. Nebel. Und kein Atem. Und die Furcht. Damals habe ich das Wort Trübsinnig verstehen lernen. Und Schleimsuppe. Und kein Mensch. Vita minima, innen und außen. Und kein Schlaf. Da saß ich und sah dem Nebel zu. Mein Kopf sah zu, mein Kopf lebte noch; sonst war ich abgestorben. Einmal las ich damals, Konrad Ferdinand Meyer habe von seiner Mutter gesagt, sie sei »heiteren Geistes, traurigen Herzens« gewesen. Dies traf mich so, daß es mir geblieben ist. Es war wie von mir gesagt. Traurig hatte ich das Herz, den heiteren Geist focht es nicht an. Ich las den ganzen Tag. Um abends kein Wort davon zu wissen. Ich konnte zuletzt nicht mehr durch das Zimmer gehen. Da sagte der Geist zu mir: Das blaue Meer! Und der Geist gebot mir zu fliehen. Ich gehorchte. Ich fürchtete den Tod gar nicht mehr. Nur voll Angst war ich, das blaue Meer nicht mehr zu sehen. Das blaue Meer noch einmal zu sehen war alles, was ich wußte. Das hatte ich noch zu tun. Dann war's gut. Dann meinetwegen –.
So floh ich. Ich erinnere mich noch an den merkwürdigen Abend im Inselhotel in Konstanz. An diesem Tag war der Frühling angekommen. Der See glänzte, weiß flog sein Schaum auf. Das Inselhotel ist ein altes Kloster, Dominikaner haben hier gehaust. Ich war der einzige Gast. Da saß ich, ließ mir Rheinwein bringen und rauchte große Zigarren. Ich fand, daß alles, was es auf der Erde gibt, wunderschön ist; und als hätte ich das noch gar nicht gewußt, sondern eben jetzt erst entdeckt. Und ich dachte mir, daß kein Mensch sterben kann, so lange er noch mit seinen Augen sieht, wie schön die Welt ist; er darf nur die Augen nicht sinken lassen. Da hörte mein Herz auf, so traurig zu sein. Am anderen Morgen mußte ich früh heraus. Noch war die Nacht übrig, als ich zum Schiff ging. In Geheimnissen standen die Bäume des Stadtgartens, die Umrisse der alten Häuser. Nun hatte ich im Hafen zu warten. Der Horizont war wie ein großer schwarzer Ring. Gaslicht, elektrisches daneben, grünes und rotes an schwanken Schiffen und an der Bahn, durch weißen Nebel glühend. Die Uhr der Station und noch eine andere Uhr am Ufer wie zwei große böse Monde. Und der stille Morgenstern. Und plötzlich ein Blitz, erst violett, dann rot, die Sonne kommt, die Nebel fallen, es lacht der Tag. Da fuhr ich über den hellen See.
Nach vierundzwanzig Stunden war ich in Mattuglie. Da lag das blaue Meer vor mir, bis zur Insel Cherso hin. Zwei Wochen später bin ich nach Athen gefahren. Auf der Akropolis saß ich, vor dem kleinen Tempel der Nike, Schwärme von Veilchen schienen im Meer zu schwimmen. Da fragte ich mein Herz. Froh war es.
Und immer, seitdem, wenn es im Norden und Nebel verzagen will, zupft es mich und verlangt hinab, an das blaue Meer, zur Sonne. Immer um diese Zeit, wenn aus nackten braunen Schollen das Erwachen dampft.
Damals, vor fünf Jahren, ist mein ganzes Leben anders worden. Denn ich weiß jetzt, daß der Mensch durch den Geist und vom Willen aus eine viel größere Macht über Leiden hat, als wir glauben. Meine Wiederkehr zum Leben ist damals durch das Gemüt geschehen. Ich habe mich entschlossen, nicht zu sterben: anders kann ich es nicht sagen. Die Ärzte nannten es ein Wunder. Ich habe seitdem ein fast unverschämtes Vertrauen zur inneren Heilkraft. Es kommt in der Not nur darauf an, sie zu finden. Sie scheint sich dann zu verkriechen; fast hat man das Gefühl, als wäre sie faul; sie will nicht, sie hat Scheu, sich herzugeben. Und ich finde sie nur am Meer. Vielleicht ist das ein Aberglaube. Immer aber, wenn ich unfähig bin, meinen Willen zum Leben zu wecken, treibt es mich seitdem ans Meer. Da springt er auf und ist bereit.
Ein rechter Heliotrop bin ich. Zur Sonne muß ich mich wenden. So viel Sonne scheint, so viel Kraft wird mir. Das zieht mich jedes Jahr nun wieder ins Sonnenland, nach Dalmatien. Wie eine Wallfahrt ist es, um von Angst und Trübsal in Licht und Wärme zu genesen.
Nun ist aber Dalmatien nicht bloß ein Sonnenland, Märchenland, Zauberland, sondern nebenbei auch noch eine Provinz der österreichisch-ungarischen Monarchie. Es kommen fast keine Fremden hin, und die paar Fremden, die kommen, verstehen die Sprache nicht und verkehren mit den Leuten nicht. In anderen Provinzen glaubt Österreich zuweilen den Fremden ein bißchen Europa vorspielen zu müssen. Hier hat es das nicht nötig. Hier kann es sich noch unverdorben zeigen. Hier steht es nackt da, wie im Paradiese.
Und darum ist mir diese Fahrt, jedes Jahr, wenn ich dem Winter entfliehe, immer auch eine Wallfahrt zum alten Österreich. Die Bora bläst mir meine Kraft wieder auf und ich lerne wieder ein bißchen Österreichisch. Es kann beides nicht schaden.
2.
Auf dem Südbahnhof. Eine Wirrnis sportlich vermummter Jugend, die auf den Semmering fährt. Der Winter ist jetzt Mode worden. Oder wenigstens das Winterkleid. Vergleicht man Wiener mit Berlinern oder gar Engländern, die zum Rodeln gerüstet sind, so zeigt es sich, daß diese nur nach dem Zweckmäßigen, nach dem Sachlichen trachten und ihren Stolz darin haben, sachverständig auszusehen, während der Wiener ein Kostüm will, das malerisch wirken soll; mit allem, was er treibt, treibt er sein Spiel. Ist es gar noch ein jüdischer Wiener, so trägt er die Skier wie Orden, bis zu Tränen gerührt, zu den Sportfähigen zu gehören, als ob es eine der jüdischen Nation verliehene Auszeichnung wäre, eine Annäherung an den Baron; dafür will er gern die rauhe Hand des Winters leiden.
Im Kupee. Warum kauft sich der reisende Mensch acht Zeitungen? Er könnte für denselben Preis bei Reclam Goethes Briefwechsel mit Zelter haben. Warum liest er lieber achtmal dieselben Nachrichten? Es scheint ihm ein Lesen erwünscht, das bloß mit den Augen geschieht, das Hirn aber freiläßt, das also den Geist gleichsam bloß hinzuhalten, damit er Ruhe gibt, und die Gedanken von ihm abzuhalten hat. Vielleicht geschieht es aber auch nur deshalb, weil er die Zeitungen auf der Bahn kriegt, und den Zelter nicht. An den Zeitungen verdient der Händler, mit dem Zelter nicht. Warum findet sich niemand, der, um der Volksbildung willen, von der man so viel spricht, in den Stationen den Reclam und die gelben Kosmosbücheln auslegt? Weil es allen diesen Leuten immer nur darum zu tun ist, von den Dingen und über die Dinge zu sprechen, keinem aber, sie zu tun.
Da erscheint, hoch oben im Schnee, die Kirche von Maria-Schutz. In solcher Schönheit steht sie leuchtend dort, daß mir ist, als hätte ich sie so noch nie gesehen! Ich muß aber lachen, denn ich erinnere mich, daß mir noch jedesmal immer wieder ist, als hätte ich sie so noch nie gesehen. Seltsam: wir haben kein Gedächtnis für Eindrücke, wir bewahren sie nicht wirklich auf. Wir täuschen uns, wenn wir uns zu erinnern glauben. Wir erinnern uns nur, daß einmal ein Erlebnis da war. Es selbst aber verläßt uns. Kommt es wieder, so können wir es kaum erkennen. Immer ist es wieder wie zum erstenmal. Immer wieder, wenn im Fidelio im zweiten Akt die Hörner rufen und ihr Licht den schwarzen Kerker sprengt, wenn ich den Wilhelm Meister lese, wenn Kainz spricht, wenn der Mildenburg schmerzensreiche Stimme tönt, wenn ich einen Klimt sehe, wenn ich wieder vom Semmeringer blauen Haus in Fichten die Rax erblicke, wenn ich wieder über San Giacomo auf der weißen Straße mit den Agaven bin, ist mir immer wieder: Nein, ich hab's ja noch nie gewußt, jetzt ist es zum erstenmal, jetzt weiß ich es erst und kann's nie mehr vergessen! Und so glaubt man es jetzt erst zu haben und jetzt bei sich zu halten, für alle Zeit, und glaubt, daß es nun nie mehr vergehen kann, und doch vergeht es wieder und verlischt, und es ist nur ein grauer Schatten, der davon in der Seele kauern bleibt.
Triest. Ein prachtvolles Automobil bringt den Gast in ein elendes Hotel. Triest hat nämlich noch immer kein Hotel, das halbwegs den Gewohnheiten eines Europäers entsprechen könnte. Wien ja schließlich auch nicht. Die Wiener sind sehr bös, wenn man sagt, daß sie kein Hotel und kein Fuhrwerk haben. Sie finden es unpatriotisch, das zu sagen. Ich finde es unpatriotisch, keins zu haben. Ich fragte neulich einen: Also wo habt ihr denn ein Hotel wie das Adlon in Berlin, wo denn? Er antwortete mir, zornig: Aufgewachsen sind Sie im Adlon! Ich erwiderte: Nein, es handelt sich aber auch nicht um mich, sondern um die Fremden, die sind es nun einmal gewohnt, europäisch zu wohnen, und da sie das in Wien nicht können, reisen sie wieder ab. Er sagte: Sollen die Fremden zuerst kommen, dann wird man ja sehen. Ich sagte: Die Fremden wollen aber zuerst sehen, dann werden sie kommen. – Es ist immer derselbe Streit. Der Fremde soll es sich erst durch Fleiß und Ausdauer verdienen, dann wird man ihn belohnen. Wien ist darin der richtige Vorort von Istrien und Dalmatien. – Das sind so österreichische Sachen, die niemand erklären kann. Warum gibt es europäische Hotels in Karlsbad, in Franzensbad, in Marienbad, in Salzburg und überall in Tirol? Und warum gibt es keine in Wien, in Triest, in Pola, in Fiume und in Dalmatien? Man könnte doch einfach die Herren Pupp, Jung und Christomanos von Staatswegen in die anderen Provinzen importieren.
Merkwürdig ist Triest. Die schönste Landschaft. Schöner als Neapel. Aber gar keine Stadt. Man hat das Gefühl, hier überhaupt nirgends zu sein. Es kommt einem vor, als bewege man sich im Wesenlosen. Hier hat sich nämlich der Staat das Problem gestellt, einer Stadt ihren Charakter vorzuenthalten. Natürlich geht das nicht, es ist doch eine italienische Stadt. Aber sie darf nicht. Daher der Unwille, den man überall an ihr spürt. Es ist eine Stadt, die eine unwillige Existenz führt. Was sie ist, soll sie nicht sein, und gegen den Schein, zu dem man sie zwingt, wehrt sie sich. Nun stößt sich aber der Staat damit selbst vor den Kopf. Er braucht die Stadt. Er braucht sie stark und groß. Doch Kraft und Größe lassen sich nicht verordnen. Der Staat tut alles, um die Stadt zu verkrüppeln, und wundert sich dann, wenn sie nicht wächst. Auf jede Forderung der Stadt antwortet er: Werdet zuerst Patrioten, dann wird man etwas für euch tun! Während sich die Leute natürlich denken; Tut erst etwas, wofür es sich lohnt Patrioten zu sein! Es ist genau dieselbe Geschichte wie mit den Wiener Hotels und den Fremden.
Bei Zara.
Der Staat fragt die Triestiner in einem fort: Warum seid ihr nicht patriotisch? Und die Triestiner fragen in einem fort: Warum sollten wir patriotisch sein? Es weiß nämlich bei uns niemand, was ein Patriot ist. Ein Patriot ist, wer sich unter einer Regierung so wohl fühlt, daß er sie durchaus mit keiner anderen vertauschen möchte, aus Angst, dabei zu verlieren. Weshalb auch eigentlich tief in jedem Menschen der Wunsch ruht, ein Patriot sein zu können. Dies nicht zu bemerken ist das System der österreichischen Verwaltung. Es war schon immer so, auch als wir noch Oberitalien hatten. Es hat sich nicht geändert. Der Staat traut den Triestinern nicht, die Triestiner trauen dem Staat nicht. Daraus hat sich mit der Zeit das schöne Verhältnis ergeben, daß die beiden, der Staat und Triest, sozusagen nicht mehr miteinander verkehren. Macht aus dieser Stadt, was sie sein könnte, eine starke und reiche und große Stadt, stärker und reicher und größer als Venedig, und die nächste Generation wird sagen: Wir wären ja Narren, zu tauschen! Und warum soll sie nicht italienisch sein? Ihr könnt euch ja gar nichts besseres wünschen als eine italienische Stadt, die sich in Österreich wohl fühlt!
Nun sagt jeder Triestiner, wer es auch sei: Wir müssen die italienische Universität kriegen! Und jeder vernünftige Mensch in Österreich sagt: Die italienische Universität muß nach Triest! Alle sind einig. Darum geschieht es nicht. Denn wenn in Österreich alle einig sind, glaubt man, daß etwas dahinter stecken muß. Und wenn in Österreich jemand etwas will, glaubt man, daß er eigentlich etwas anderes will; oder doch aus anderen Gründen, als er sagt. Die Regierung kann sich nicht denken, daß es in Österreich anständige Menschen gibt.
Die Italiener wollen eine italienische Universität, um ihre Söhne auszubilden, und sie wollen sie in Triest, weil sie Triest nahe haben und weil ihre Söhne in fremden Städten unglücklich sind. Nein, sagt die Regierung: sie wollen sie, um Irredentisten zu züchten! Worauf zu antworten wäre: Irredentisten züchtet ihr, ihr, weil jeder österreichische Italiener ein Irredentist sein wird, so lange er sich in Österreich fremd fühlt, und weil jeder sich in Österreich fremd fühlen muß, so lange man ihm mißtraut! Die Heimat eines Menschen ist dort, wo er sich bei sich zu Hause fühlt. Sorgt dafür! Und ferner: Eine bessere Zucht von Irredentisten als in Wien gibt es gar nicht. In Wien fühlt sich der italienische Student fremd, er versteht die Sprache nicht, er ist von Feindschaft umgeben, niemand nimmt sich seiner an, Heimweh quält ihn, so sitzt er den ganzen Tag mit den anderen im Café beisammen, um nur doch seine Sprache zu hören, und wenn unter diesen nun ein einziger ist, den die Not oder die Sehnsucht zum Irredentisten macht, so sind es nach einem Monat alle; seelische Kontagion nennt man das. Und endlich: Ihr treibt jeden Italiener aus Österreich hinaus, dem ihr die Wahl stellt, ein Italiener oder ein Österreicher zu sein! Es muß ihm möglich werden, als Italiener ein Österreicher zu sein. Wie denn unser ganzes österreichisches Problem dies ist, daß es uns möglich werden muß, Österreicher deutscher oder slawischer oder italienischer Nation zu sein.
3.
Ich gehe zum Lloyd um mein Billet. Sie sind auf diesen Palast sehr stolz. Er ist 1883 von Ferstl erbaut, in jenem sinnlosen und grundlosen Ringstraßenstil, der wie eine tote Sprache klingt. Ich habe einen alten ungarischen Pfarrer gekannt, der eine Vorliebe hatte, lateinisch zu reden. Gullasch essen und lateinisch reden. Und genau so wirkt dieser Bau. Und dann bin ich immer traurig, beim Lloyd. Weiß selbst nicht warum. Seine Kapitäne sind so wunderbare Menschen. Sie fühlen sich als Italiener, stammen aber fast alle von Kroaten ab, und jene Beweglichkeit mischt sich seltsam mit dieser Wehmut. Ganz stille verhaltene Menschen sind es, von einer geduldigen Höflichkeit, unter der eine stumme Sehnsucht ruht. Ich habe sie sehr gern, aber sie machen mich so traurig. Warum? Ohne gesprächig zu sein, lassen sie sich doch gern einmal zum Erzählen verführen und haben dann die lustigsten Geschichten bereit. Wie oft, bei ruhiger See, wenn wir nach dem Essen abends im Dunkel mit glühenden Zigarren beisammen saßen, hab ich ihnen gehorcht! Und doch macht's mich immer traurig. Unter ihren Worten, während der Mund lacht, ist eine Traurigkeit. Und dann fährt einmal ein Schiff des Norddeutschen Lloyd oder der Hapag vorbei. Da verstummen sie. Sitzen still und schauen hin und rauchen. Höchstens, daß einer einmal sagt: Glauben Sie, wir könnten das nicht auch, was die können? Und dann kommt's langsam heraus: sie fühlen sich als die besten Seefahrer und begreifen nicht, warum ihnen die vorkommen, die nordischen! Und da stehen sie dann nachts auf der Brücke im Wind und denken daran. Wir können so viel als die! Wir sind nicht schlechter! Warum läßt unser Lloyd die anderen vor? Das liegt schwer auf ihnen.
Wir sitzen in der Direktion oben beisammen, geraten ins Reden, und ich sage ihnen das. Euere Leute sind unfroh, weil sie das Gefühl haben, der Lloyd könnte mehr sein. Warum ist er es nicht? Warum seid ihr so falsch bescheiden? Warum seid ihr weniger, als ihr könnt? Man ist sehr artig mit mir, aber nicht ohne jenen leisen Spott, den Fachmenschen für Laien haben. Ein Fachmensch ist, wer den Apparat im einzelnen kennt. Einen Laien nennt er jeden, der nicht nach dem Apparat, sondern nach der Leistung fragt. Der Fachmensch ist zufrieden, wenn der Apparat in Ordnung ist. Der Laie hätte stets Lust, auch einmal den Apparat zu wechseln. Man weist mir nach, daß der Apparat in Ordnung ist. Aber ich frage wieder: Warum seid ihr, nach der Meinung euerer eigenen Leute, nicht alles, was ihr sein könntet? Man antwortet mir: Weil es sich nicht rentiert! Und rechnet mir vor, daß wir uns mit den nordischen Gesellschaften nicht messen können, denn diese haben den amerikanischen Handel und das Geschäft mit den Auswanderern voraus. Und nun Zahlen, ganze starre Reihen drohend aufgereckter Zahlen. Zahlen beweisen! Ja, dem Kaufmann. Seid ihr Kaufleute? Ist die Schiffahrt eines Landes ein Geschäft? Gehört sie nicht vielmehr zu den moralischen Dingen? Rentieren sich Armee und Flotte? Rentieren sie sich kaufmännisch? Baut man eine Bahn nur, wenn bewiesen ist, daß sie sich rentieren muß? Versteht ihr nicht, daß die Schiffahrt eines Landes ein Ausdruck seiner Macht und seines Willens ist? Die Schiffahrt kann Geld einbringen. Aber auch moralische Dinge: Mut, Stolz, Lust kann sie bringen. Und Mut, Stolz, Lust kreisen dann im Lande, bis zuletzt auch aus ihnen wieder Geld wird. Freilich sagt der Lloyd mit Recht: Ich bin ein privates Unternehmen, ich kann nicht mein Geld hergeben, damit es irgendwo zuletzt zum Gelde eines anderen werde. Er hat recht, aber der Staat hat unrecht, der nicht einsieht, daß die Schiffahrt ein Brunnen öffentlicher Energie, des Selbstvertrauens und der Tatenlust sein kann. Den Schiffen eines Landes sieht man an, ob es ein kleinmütiges oder ein hochgesinntes Land ist.
Nun ist ja Derschatta Präsident des Lloyd geworden. Noch diesen Monat soll er antreten. Wird er helfen? Ist er der Mann, das Verzagen der Routine zu besiegen? Die Kapitäne des Lloyd sind die besten der Welt. Aber in der Direktion des Lloyd steckt etwas viel Assessorismus. Es kommt darauf an, den Lloyd nicht von der Kanzlei, sondern von den Schiffen aus zu leiten. Ein großer Kaufmann mit einem unbändigen österreichischen Hochmut gehörte her. Wie Bruck einer war (einer von den paar wirklich Großen in Österreich, der denn dafür auch dann von der Verleumdung erwürgt worden ist). Hat Derschatta dazu die Kraft? Er war einst eine österreichische Hoffnung. Ich kannte ihn, zwanzig Jahre ist es her, ich war damals Freiwilliger, abends ging ich aus der Kaserne gern ins Spatenbräu, da saß er mit Steinwender. Derschatta, der Steirer, Steinwender, der Kärntner, Sylvester in Salzburg, Beurle und der junge Löcker in Linz, die hatten damals das Vertrauen der Jugend. Von ihnen erwarteten wir die Kraft, das deutsche Bürgertum aufrecht und selbstvoll zu machen. Vor zwanzig Jahren war das. Sie haben alle viel erreicht, aber das deutsche Bürgertum nichts. Und merkwürdig ist nur, wie jeder von ihnen auf einmal aus dem Politischen abschwenkt, um sich eine Wirksamkeit im Sachlichen zu suchen, gleichsam eine Nische, um dort seine Tatkraft unterzustellen. Es kommt plötzlich die Leidenschaft über sie, etwas zu leisten, etwas zu tun. So treten sie aus dem Politischen aus, denn da scheint ihnen dies unmöglich. Merkwürdiges Land, wo die besten Politiker, um wirken zu können (wenn sie es nicht vorziehen, Eigenbrödler oder Sonderlinge zu werden, wie Steinwender), aus der Politik austreten müssen, vor Angst, sich zu vergeuden, vor Sehnsucht nach einer Wirklichkeit für ihre Kraft, und wo nur die ganz unfähigen Politiker sich behaupten können! Die Frage für den Lloyd ist nun, ob Derschatta bei ihm bloß einfach in Pension gehen will oder dort ein Gebiet für seine Kraft sucht. Er hat Kraft. Leider aber hat er auch Verstand, und zwar solchen von der bösen Art, die, mit dem Elend und der Schmach unserer Verwaltung bekannt, ungläubig, hoffnungslos und furchtsam macht. Seine ganze Generation hat Österreich aufgegeben. Sie verzichtet. Jeder will sich nur irgendwie noch zu einer Wirkung im kleinen retten. Im kleinen fortzuwerkeln; sonst wissen sie sich keinen Ausweg mehr. Der Lloyd aber hätte einen Phantasten nötig, der an das Unmögliche glaubt. Denn was bei uns unmöglich scheint, ist das Wirkliche. Und zu helfen ist uns überall nur durch Romantiker, die man auf die Wirklichkeit losläßt; das Romantische wird ihnen durch die Wirklichkeit dann schon ausgetrieben. Und wenn nun Derschatta, vielleicht, statt der verzichtenden Gescheitheit, vielleicht, die andere Gescheitheit wählt, eine nämlich, die sich, aus Einsicht ins Notwendige, zwingt, das Vermessene zu wagen, könnte der Lloyd wieder hoffen, vielleicht. Er müßte sich nur dann auch abgewöhnen, verbindlich zu sein. Denn der Lloyd braucht eine rauhe Hand mit einem starken Besen. Für feine Finger ist diese grobe Arbeit nichts.
Nachmittag mit einem der liebenswürdigen Herren vom Lloyd nach Opcina hinauf. Wie wir auf der Piazza della Caserma in die Elektrische steigen, fällt mir drin, unter armen Leuten sitzend, Marktweibern mit großen Körben und Dienstmädchen in fransigen Tüchern, ein hochgewachsener stämmiger Herr auf, der mich irgendwie von fern an den bulgarischen Fürsten erinnert, mit einer Dame, die einmal sehr schön gewesen sein muß. Ich höre, daß es der Statthalter ist, Prinz Hohenlohe, der vor einigen Jahren einmal ein paar Wochen Minister war, aber, als ihm zugemutet wurde, von seiner Meinung und vom Rechten abzustehen, lieber wieder ging. Seitdem heißt er der rote Prinz; eine Meinung zu haben gilt ja hier für anarchistisch. Seine Frau ist eine von den drei Schönborn-Mädeln, in die wir, vor zwanzig Jahren, als Studenten von weitem alle verliebt waren, in alle drei. Er, fünfundvierzig Jahre alt, unverbraucht, tätig und tüchtig, sitzt hier im Winkel und wünscht es sich nicht anders. Wenn in unsere Verwaltung einmal ein anständiger Mensch gerät, hat er nur den Wunsch, beiseite zu bleiben; keiner scheint der eigenen Anständigkeit zuzutrauen, daß sie die landesübliche Gemeinheit überwinden könnte. Er ist hier beliebt, den Leuten gefällt sein offenes, unverdrossenes Wesen. Auch die bösesten Italiener mögen ihn. Nur ist es freilich töricht, zu glauben, daß sie, weil sich einmal ein Statthalter verständig und natürlich beträgt, nun gleich versöhnt sein müßten. In Wien meint man immer, alles komme bloß vom bösen Willen der Untertanen her, den es nun durch Beredsamkeit, wohl auch allerhand Gefälligkeit, zu beschwichtigen gelte. Die Leute hier aber hätten den besten Willen, so bald es ihr Interesse wäre. Unsere Regierungen wissen noch immer nicht, daß es das Interesse ist, das die Menschen regiert. Wo's mir gut geht, oder wo ich mir einbilde, daß es mir gut gehe, da ist mein Vaterland, hurra! Wo's mir schlecht geht, an Leib oder Seele, wo mich hungert oder friert, wo ich nicht froh werden kann, da will ich fort, abbasso! Unsere Regierungen glauben es mit Orden zu machen, das ist zu idealistisch gedacht.
Cattaro
Oben, beim Obelisken, als wir den Wagen verlassen, tritt der Prinz auf mich zu, um mich zu begrüßen. Er ist sehr nett mit mir. Nur haben Aristokraten, wenn sie mit pöbelhaften Leuten nett sind, bei uns das, daß sie darüber selbst zu sehr gerührt sind; es treten ihnen über ihre Herablassung die Tränen in die Augen. Wer weiß übrigens, wie man selbst an ihrer Stelle wäre! Wir sind ja schließlich in einem Staat, wo heute noch der Fürst, der Graf ein höheres Wesen ist, nicht gesetzlich, aber wirklich, der Macht nach. Jedes Gespräch eines Adligen mit einem Bürger beruht eigentlich also auf einer Fiktion. Beide fingieren, daß die Rechtsungleichheit ausgelöscht sei. Beide wissen aber, daß sie das doch eben, um miteinander sprechen zu können, bloß fingieren. Und das macht beide verlegen. Der Fürst denkt: Ich bin doch sehr aufgeklärt, ich prügle diesen Bürger nicht, sondern spreche sogar mit ihm, wie mit einem Menschen! Und der Bürger denkt: Er könnte mich auch prügeln! Natürlich merkt man das dann der gegenseitigen Nettigkeit an. Ich glaube nicht, daß ein Lord und ein englischer Schneider, wenn sie miteinander sprechen, dies denken.