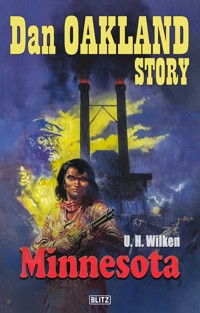Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Schwadron des Teufels Lieutenant Colonel Gilles Goldwater hasst alle Indianer. Seitdem seine Frau von Indianern getötet wurde, denkt er nur an Rache. Mit einer Schwadron Soldaten stößt er ins Indianerland vor und hinterlässt eine Spur des Grauens. Dan Oakland und Sky versuchen alles, um dieses sinnlose Töten zu verhindern. Doch die Saat der Gewalt breitet sich weiter aus. Sioux-Tomahawks töten lautlos Young Horse ist ein Krieger, der mit seinem Volk viel Leid erlebt hat. Er schwört allen Weißen Rache und überfällt mit den Sioux Städte und Eisenbahnen. Sky Oakland sitzt in einem der Züge. Er konnte seine Freundin Annie überzeugen, mit ihm zusammen in das Sioux-Land zu gehen, um dort zu leben. Doch dann stirbt Annie durch einen Pfeil der Sioux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare
4310 U. H. Wilken California-Trail
4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter
4312 U. H. Wilken Die Teuflischen
4313 U. H. Wilken In Todesgefahr
4314 U. H. Wilken Schwarzer Horizont
4315 U. H. Wilken Der Raubadler
4316 U. H. Wilken Trail aus Blut und Eisen
4317 U. H. Wilken Der Wolfskiller
4318 U. H. Wilken Nachtfalken
4319 U. H. Wilken Der Geheimbund
4320 U. H. Wilken Tödliche Tomahawks
4321 U. H. Wilken Minnesota
4322 U. H. Wilken Die Revolver-Lady
4323 U. H. Wilken Sterben am Washita
4324 U. H. Wilken Langmesser
4325 U. H. Wilken Der Bärentöter
4326 U. H. Wilken Manitoba
4327 U. H. Wilken Yellow River
4328 U. H. Wilken Land der Sioux
4329 U. H. Wilken Todesvögel
4330 U. H. Wilken Shinto
4331 U. H. Wilken Blutmond
4332 U. H. Wilken Der Skalphügel
4333 U. H. Wilken Todestrommeln
4334 U. H. Wilken Skalpjäger
4335 U. H. Wilken Fort Lincoln
4336 U. H. Wilken Sky
Tödliche Tomahawks
Dan Oakland Story
Buch Zwanzig
U. H. Wilken
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Redaktion: Alfred Wallon
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-95719-106-9
4320 vom 01.08.2024
Inhalt
Schwadron des Teufels
Sioux-Tomahawks töten lautlos
Über den Autor
Schwadron des Teufels
Der Colt entlud sich krachend.
Das Blei jaulte durch die Lichtbahn der Straße und stieß den Scout O’Hearly gegen die Bretterfassade eines Hauses.
Der Scout sank, ohne einen Laut von sich zu geben, in den kalten Staub und blieb mit ausgebreiteten Armen reglos liegen.
Das Echo des Schusses hallte noch zwischen den Häuserfronten, als der Heckenschütze schon davonhastete. Während das Echo in der tintig schwarzen Nacht verwehte, stürzten immer mehr raue Burschen aus dem Saloon der Grenzertown.
Hier an der Frontier Line galt allein das Gesetz des Stärkeren. Und stärker war, wer schneller schoss.
Männer sammelten sich bei der Leiche des Scouts.
Keiner von ihnen wusste, wer O’Hearly getötet hatte.
Doch er war ein Weißer gewesen. Und das bedeutete nach der Grenzer-Logik, dass sein Mörder wohl ein Indianer sein musste. Zu sein hatte. Wer sonst, schlussfolgerten die eher schlichten Gemüter, sollte ein Interesse am Tod dieses zeitlebens kreuzbraven Kavallerie-Scouts haben?
Und so verwandelte sich die zunächst eher hilflose Ansammlung vor dem toten Scout rasch in einen Lynchmob, der immer lauter nach einem Opfer verlangte, einem mit roter Hautfarbe, versteht sich.
Der junge Mann mit den schulterlangen schwarzen Haaren und dem schmalen braungebrannten Gesicht in der weichgegerbten Hirschledertracht schien den Männern ein idealer Kandidat für den Strick.
Als Sky Oakland die johlende, waffenstarrende Horde auf sich zustürmen sah, handelte er augenblicklich. Er hechtete auf das brüchige Stalldach und tauchte mit einem waghalsigen Satz in das Dunkel der der Straße abgewandten Seite.
„Fangt ihn!“, keifte irgendwer. „Schleppt den Bastard unter den Galgenbaum!“
Sky hatte in den Augen des Mobs einen Makel, der für sich allein die Lynchpartie rechtfertigte, er war ein Halbblut.
Die Horde tobte um den Pferdestall hinaus auf die Prärie, wo das hohe Gras im Nachtwind rauschte.
Sky huschte geduckt davon.
Er fürchtete sich nicht, dennoch sah er keinen Sinn darin, einem völlig enthemmten Lynchmob Paroli zu bieten.
Während er flüchtete, sah er plötzlich die Gestalt.
Ein Mann, der einen langen Fellmantel und einen Hut trug.
Ein Weißer.
Jetzt verschwand er hinter einer Bodenwelle. Sky zweifelte keinen Augenblick, dass er dem Mörder des Scouts begegnet war.
Als Sky über die Bodenwelle kam, konnte er nichts erkennen. Hinter ihm brüllte der Mob, vor ihm hämmerten die beschlagenen Hufe eines Pferdes davon.
Da schlug Sky einen Haken wie ein Hase.
Es gelang ihm, dem Mob zu entkommen.
Außer Atem erreichte er wieder den Stadtrand. Hier stieß er den Lockruf eines Kauzes aus.
Irgendwo in der Stadt antwortete ein Wolfsschrei.
Dan Oakland hatte gerade im Store Munition gekauft, für seine Winchester und Skys Volcanic Rifle.
Nun lief der bullig wirkende Trapper in der derben Wolfsfellkleidung mit der Geschmeidigkeit und Schnelligkeit eines Vollblutindianers zum Mietstall, sattelte die Pferde und brachte sie ins Freie.
Dann ritt Dan Oakland um die Stadt und traf auf seinen Sohn.
Sky sprang in den Sattel, und wenig später verschluckte die Nacht Vater und Sohn.
* * *
An einem nebligen Frühmorgen dieses blutigen Sommers trat der Farmer Kelly aus seiner Erdhütte. Er blickte forschend über die Prärie.
Kelly war ein Weißer, der mit einer Indianerin zusammenlebte.
Er war dabei, eine kleine Farm aufzubauen. Der Anfang war schon gemacht; mit einem rostenden alten Pflug hatte er das Grasland aufgebrochen. Zwei kleine Felder breiteten sich um die Hütte aus.
An diesem Morgen holte Kelly sein Pferd aus dem Anbau und sattelte es.
Seine Squaw kam heraus und stopfte Proviant in die Satteltasche. Schweigend und mit weichem Lächeln wartete sie auf seinen Aufbruch. Ihre Zuneigung war echt.
Kelly deutete über die Prärie auf die fernen blauen Berge, die noch im Dunst des Morgens schwammen.
„Wenn die Sonne untergeht, werde ich mit genügend Fleisch zum Braten zurückkehren“, sagte er.
„Ich werde alles vorbereiten, Kelly“, antwortete sie leise und strich über seinen Arm.
Ein Lächeln huschte über sein raues Gesicht. Er küsste sie auf die Stirn, stieg in den Sattel und ritt über die Prärie davon.
Noch lange war er weit draußen zu erkennen. Ein dunkler, sich bewegender Punkt in der Unendlichkeit der Prärie.
Seine Squaw machte sich an die Arbeit.
Sie hörte nicht den dumpfen Hufschlag mehrerer Pferde, der gegen den Wind näherkam.
In der mit Erdschollen bedeckten Hütte herrschte ewiges Halbdunkel. Ein gemeinsames Lager aus Fellen befand sich neben der erloschenen Feuerstelle.
Töpfe und Krüge standen auf dem Kamin aus Feldsteinen. Ein kleiner klobiger Tisch war Mittelpunkt der Behausung. An den Wänden hingen mächtige Geweihe und einige Felle.
Plötzlich hörte die Squaw den Hufschlag.
Sie stand völlig still in der Hütte und lauschte.
Pferde trappelten näher, Sattelleder knarrte, Radsporen klingelten.
Mehrere Reiter saßen vor der Erdhütte ab.
„He, ist da jemand?“
Die heisere Stimme ließ die Squaw zusammenzucken. Sie krampfte die Hände zusammen und starrte aus geweiteten Augen hinaus.
Soldaten standen vor dem Eingang.
Gras und Staub haftete an den Uniformen. Alkoholdunst wehte in die Hütte. Die Männer grinsten und traten näher.
„Da ist ja eine Indianerin!“
„Und jung dazu!“
„Könnte mir gefallen, sie mal auszuprobieren. Was meint ihr?“
„Well, nichts spricht dagegen.“
„Die Rothaut kann doch nicht allein sein! He, Jungs, seht euch mal um!“
Am fernen östlichen Horizont leuchtete der Himmel orangefarben. Ein neuer Tag hatte begonnen.
Zwei der Fremden standen noch immer vor der Tür der Erdhütte. Die Uniformen waren durchschwitzt und verschmutzt.
Immer hatte die Squaw von Kelly gehört, dass sie keine Angst vor den Blauröcken zu haben brauchte, doch nun fürchtete sie sich. Diese verwaschene blaue Uniform ließ zwar alle Männer gleich aussehen, doch sie verbarg die verschiedensten Charaktere, anständige ebenso wie hässliche.
Die anderen kamen zurück.
„Im Anbau hat ein Pferd gestanden. Der Mist ist noch frisch. Der Kerl muss erst vor kurzem weggeritten sein, vielleicht vor einer Stunde.“
„Dann ist die arme Indianerin ja mutterseelenallein!“
„Ja, und sie leidet bestimmt schreckliche Langeweile. Wir sollten sie ein wenig unterhalten, nicht?“
Langsam traten die Soldaten ein.
Im Inneren der Erdhütte war es nahezu dunkel.
„Macht mal Licht, Jungs!“
Ein Zündholz flammte auf. Dann flackerte ein Talglicht auf dem Tisch.
Wie erstarrt stand die Indianerin vor den Soldaten, aschgrau im Gesicht, von lähmender Angst gepeinigt.
„Na, Süße, wie willst du’s haben?“
„Geht!“, schrie die Squaw mit brüchiger Stimme. „Bitte.“
„Aber, aber, wer wird denn so spröde sein? Na komm schon, Squaw, stell dich nicht so an.“
Einer der Soldaten kam auf sie zu.
Die anderen betrachteten grinsend die Szene.
Der Soldat packte zu und riss der Squaw das Lederkleid von den Schultern.
Gellend schrie sie auf, krallte die Hände in seine Uniform.
Sie konnte ihn nicht abwehren.
Er zwang sie auf das Lager.
Die anderen feuerten den Kumpan an.
Draußen stampften die Pferde, wimmerte der Wind um die Hütte. Taufeucht öffneten sich die wilden Blumen auf der Prärie.
Irgendwann pochte Hufschlag davon.
* * *
Der heiße Wind bewegte die Hüttentür und trocknete die Erde auf den Feldern.
Der Tag ging zur Neige, als weit draußen auf der Prärie der einsame Reiter erschien.
Diesmal stand seine Squaw nicht vor der Hütte und erwartete ihn. Er rief, doch sie antwortete nicht.
Da ließ er die erlegte Antilope fallen und stürzte in die Hütte.
Seine Squaw hing tot an einem der Geweihe. Sie war völlig nackt.
Die erstarrte Hand umkrampfte den Fetzen aus einer blauen Uniform.
In Kelly lagen Verzweiflung und Rachegelüste im erbitterten Widerstreit.
Bei Sonnenuntergang bestattete er seine Squaw.
Als die Nacht hereinbrach, war aus dem arbeitsamen Farmer ein Mann geworden, den allein der Wunsch nach Vergeltung beseelte.
* * *
Von diesem Ereignis wussten Dan Oakland und Sky naturgemäß nichts, als sie jetzt die Lichter der Grenzertown weit hinter sich versickern sahen.
Lächelnd zeigte Dan in die Ferne.
„Dakota, mein Junge.“
Dort buckelten sich die schwarzen Berge des Indianerlandes, dort schlug das Herz von Dakota, Paha Sapa!
„Es scheint so nahe“, meinte Sky versonnen. „Dabei ist es noch so fern, bestimmt fünf Tagesritte von hier.“
„Das könnte hinkommen. Vielleicht sind es auch sechs.“ Dan ritt neben seinem Sohn und legte ihm die Hand auf die Schulter. „Jedenfalls ist es gut zu wissen, dass wir bald zuhause sind, Sky.“
„Ja, Vater. Ich freue mich riesig darauf.“
„Mir geht es auch so.“ Dan richtete sich in den Steigbügeln auf und spähte über das Land. „Wir müssten bald Fort Robinson erreichen.“
„Willst du ins Fort, Dad?“
„Nein, wenn du nicht willst?“
„Ich will nicht, Vater!“
Lächelnd trieb Dan das Pferd an und ritt schneller. Sie erreichten einen kleinen Fluss, der sich mitten durch die Prärie schlängelte. Während der Regenzeit mussten seine Wasser reißend sein, denn sie hatten ein tiefes Bett in Erde und Gestein gegraben. Die Ufer waren zerklüftet. Das Wasser schimmerte im Mondlicht.
Vater und Sohn saßen ab und ließen die Pferde saufen. Sie selbst schöpften mit den Händen das klare Wasser und tranken.
Plötzlich machte Sky seinen Vater auf eine Spur aufmerksam.
Beide betrachteten die Eindrücke unbeschlagener Hufe.
Hier waren mehrere Indianer auf Ponys vorbeigekommen.
„Sioux, Dad?“
„Schon möglich, aber ich denke eher an die Cheyenne, Sky.“
„Vielleicht sind einige Hundemänner der Cheyenne noch auf der Flucht, Dad. Die Armee hat sie doch versprengt. Und nun werden sie überall gehetzt und zusammengeschossen.“
„Du hast vielleicht recht, mein Junge. Sie sind jedenfalls dem Fluss gefolgt. Reiten wir hinterher.“
* * *
GILLES GOLDWATER.
So stand es am Gartentor, mit einem glühenden Eisen in das Eichenholz gebrannt. Das Schild hing am Tor zum kleinen hübschen Garten, in dem Blumen blühten und Gemüse angepflanzt war.
Das kleine Holzhaus war das Schmuckstück dieser Gegend. Es lag nahe am Weg nach Fort Robinson. Sein weißer Anstrich leuchtete tagsüber hell in der Sonne, und wer in Fort Robinson ein Fernglas hatte, konnte das Haus von Lieutenant Colonel Gilles Goldwater sehen.
Es war noch dunkel, als die Tür geöffnet wurde und ein großgewachsener Mann aus dem Haus trat. Sein Haar war bereits ergraut, obwohl er noch gar nicht so alt war.
Aus verkniffenen blauen Augen blickte Gilles Goldwater über den kleinen Hof.
Drüben im Stall richteten sich die drei Soldaten der Wache auf, standen stramm und warteten auf den Befehl.
„Sattelt mein Pferd.“
Goldwaters Stimme klang wie aufeinander reibendes Eisen; sie drang durch Mark und Bein.
Die drei Soldaten beeilten sich, seinem Befehl zu entsprechen.
Ein hartes Lächeln spielte um seinen Mund. Er hielt den linken Arm steif. In diesem Arm steckte noch immer Blei, ein Andenken aus dem Bürgerkrieg.
Gilles Goldwater galt bei seinen Untergebenen als ein schneidiger, oft überharter Offizier. Hinter vorgehaltener Hand murmelte so manch einer das Wort „Schleifer“. Die Ernennungsurkunde zum Kommandanten von Fort Robinson war von Custer eigenhändig mitunterzeichnet, die Beförderung zum Colonel hatte General Sheridan in Washington nachdrücklich befürwortet.
Goldwater erfreute sich der Gunst aller guten Adressen der Indianerfresser in der Army, ein Umstand, der sich bisher als ungemein karrierefördernd erwiesen hatte.
Seine konzentrierte Liebe und Fürsorge erfuhren Familie und Army zu annähernd gleichen Teilen, wobei freilich nur schwer auszumachen war, wer stärker darunter litt.
Auch an diesem Morgen versäumte der Lieutenant Colonel das gewohnte Ritual der Familienverabschiedung nicht. Er küsste zerstreut die Stirn seiner blonden Frau Eleanor, einer ehemaligen Lehrerin, und tätschelte nicht ohne Vaterstolz die Wange der hübschen Pat, die gerade siebzehn geworden war.
Der zwölfjährige Washington Earl hingegen wurde mit der Ermahnung bedacht, sowohl die Schularbeiten korrekter auszuführen, als auch einen Blick in die Armeevorschriften zu werfen.
Das „Ja, Daddy“ klang vergleichsweise mürrisch.
Während Goldwater in den Sattel stieg und das Pferd sogleich zum Galopp in Richtung Fort spornte, lächelte seine Frau den Kindern zu.
„Kommt ins Haus.“
Pat folgte der Mutter, während Washington Earl, der hoffnungsvolle Goldwater-Spross, die Soldaten der Wachmannschaft feixend betrachtete, ehe er im täuschend nachgeahmten Tonfall des Vaters anhob: „Ihr seid mir für das Wohlergehen der Familie verantwortlich. Ich brauche nicht zu betonen, welche Konsequenzen auch nur die geringste Pflichtvergessenheit nach sich zieht!“
Der Junge lachte schallend und lief nun ebenfalls ins Haus.
„Verdammter Bengel“, knurrte ein Soldat, „aber nett ist er!“
„Der Alte will ihn unbedingt nach West Point auf die Militärakademie schicken“, meinte ein anderer Soldat. „Der Junge soll wohl mal General werden.“
„Dann wird er uns scheuchen wie sein Alter“, versetzte der dritte Soldat grimmig. „Noch hat der Bursche nicht Blut geleckt, aber wenn er erst mal merkt, wie angenehm das ist, Befehle zu erteilen, dann wird er uns ganz schön den Hintern lüften, verlasst euch drauf.“
„Noch ist er ein Junge wie jeder andere. Kommt, es ist noch früh, machen wir für eine Weile Augenpflege.“
Sie gingen in den Stall zurück und streckten sich auf den Strohschütten aus. Eigens zum Schutz der Familie des Colonels waren sie abgeordnet worden. Sie hatten nicht viel mehr zu tun, als die Familie zu bewachen, und, natürlich, Garten und Gebäude in Ordnung zu halten.
In der Nähe war das tiefe eingeschnittene Flussbett, in dem gegenwärtig nur wenig Wasser war. Dort bildeten sich zu dieser frühen Stunde die Nebelschwaden, und von dort kam plötzlich ein berittener Indianer näher.
Die Soldaten hörten den Hufschlag des Ponys, fuhren hoch und packten die Gewehre.
Sie krochen zum geöffneten Stalltor und spähten hinaus.
Im Haus war das Licht gelöscht worden.
Frühlicht erhellte die Nebel, und gespenstisch löste sich der berittene Indianer aus den Schwaden. Er verhielt am Rand des Hofes.
Die Soldaten beobachteten, dass der Indianer sich mühsam im Sattel hielt. Sein Körper, feucht vom Nebel, schimmerte rötlich. Auch das Haar zeigte einen rötlichen Farbschimmer. Er trug keine Waffe, jedenfalls war davon nichts zu erkennen.
Langsam und mit angeschlagenen Gewehren verließen die drei Wachsoldaten den Stall.
Als der Indianer die Blauröcke erblickte, hob er die Hand und streckte zwei Finger aus, was soviel wie Gut Freund hieß. Dann machte er eine Handbewegung zum Mund hin.
„Der will was zu essen haben“, sagte einer der Soldaten.
„Soll er was kriegen! Blei! Das liegt schwer im Magen, davon hat er lange was.“
„Nicht so hastig, Jungs. Von welchem Stamm kann die Rothaut sein?“
„Schätze, das ist ein Cheyenne.“
„Ja, könnte hinkommen, aber er hat sich überall rot bemalt, seht ihr das?“
„Fragen wir ihn doch mal“
Sie überquerten den Hof.
Die Gewehre zielten unablässig auf den Indianer.
An seiner Schulter war eine klaffende Wunde zu erkennen.
„Wer bist du?“, fragte ein Soldat lauernd. „Von welchem Stamm?“
„Cheyenne“, antwortete der Indianer dumpf.
„Was willst du hier, he? Die Southern Cheyenne sind doch im Süden, die Northern Cheyenne im Nordwesten. Die Armee ist wohl hinter dir her, was?“
„Ich habe Hunger.“
„Und da kommst du einfach her und erwartest, dass wir dir was geben, wie?“
„Ja.“
Die Soldaten flüsterten miteinander, ohne den Blick von dem Indianer zu nehmen.
„Das ist ein Hundemann der Cheyenne“, raunte ein Soldat. „Das sind wilde Krieger. Sie tragen ein langes Lederband über der Schulter, das mit Stachelschweinborsten verziert ist. Der Kerl hier trägt so ein Büffellederband, seht ihr?“
„Dann lassen wir ihn nicht weg!“
Zusammengesunken saß der Cheyenne auf dem Pony und wartete. In seinen dunklen Augen war nichts zu erkennen. Er hatte den Blick auf einmal in die Ferne gerichtet, und die Soldaten wussten nicht, dass er an die ewigen Jagdgründe dachte.
„He, komm runter vom Gaul! Du bist unser Gefangener!“
Der Cheyenne starrte sie ausdruckslos an.
„Ich bin freiwillig gekommen, ich werde ebenso wieder gehen“, erklärte er. „Die Bleichgesichter wollen mir kein Essen geben?“
„Du hast es begriffen, Rothaut!“
„Dann werde ich gehen.“
Der Indianer zog sein Pony herum und ritt an.
Da schossen sie ihm in den Rücken.
Er stürzte vom durchgehenden Pferd, schlug hart auf und lag tot im Gras.
Von den Schüssen aufgeschreckt, stürzte Mrs. Eleanor Goldwater aus dem Haus. Sie hielt ein Gewehr. Sohn Washington Earl und Tochter Pat folgten.
„Was ist geschehen?“, rief die Frau des Lt. Colonels. „Wer hat geschossen?“
„Oh, Ma’am, ein Indianer wollte das Haus überfallen. Wir haben ihn noch rechtzeitig erwischt.“
„Bleibt beim Haus“, befahl die Frau ihren Kindern. Sie kam mit dem Gewehr näher. Mit flackernden Augen blickte sie auf den toten Cheyenne.
„Er hat ja gar keine Waffe!“
„Die liegt hier irgendwo im Gras, Ma’am. Bitte, beruhigen Sie sich, verlassen Sie sich ganz auf uns, wir machen das schon.“
„Ein Indianer“, flüsterte Mrs. Goldwater, „und so nahe beim Fort! Es gibt in Fort Robinson etliche von ihnen, die der Hunger dorthin getrieben hat. Vielleicht hatte auch dieser Indianer nur Hunger!“
„Nein, Ma’am, er wollte töten. Das ist kein gewöhnlicher Indianer, das ist ein Hundemann der Cheyennes! Die Hundemänner sind auserwählte Krieger, Ma’am, die gegen uns kämpfen. Es ist besser, wenn Sie wieder ins Haus gehen.“
Das waren seine letzten Worte.
Alles geschah in wenige Sekunden.
Im Morgendunst tauchten jäh mehrere Indianer auf Ponys auf und feuerten auf die Soldaten.
Im Bleihagel sank auch Mrs. Eleanor Goldwater zu Boden.
Gellend schrie Pat, die Tochter, auf und wollte in das Haus zurück.
Sie stieß gegen ihren Bruder, und beide verloren den Halt und fielen.
Hufe polterten heran. Geschmeidige Körper schnellten von den Ponys auf die Schwelle des Hauses und warfen sich auf Pat und ihren Bruder.
Pulverdampf wallte.
Schreie gellten und erstarben.
Heftig schlug die Tür des Hauses hin und her. Im Stall tobten die Pferde. Ponys liefen über den Hof. Hufe zerwühlten den Garten, stampften die Blumen nieder und zertraten das Gemüse.
Geschirr wurde im Haus zertrümmert, Gardinen heruntergerissen, Bettzeug zerfetzt.
Die Cheyenne wüteten.
Schließlich hasteten sie aus dem Haus und sprangen auf die Ponys. Den toten Stammesbruder nahmen sie mit.
Mit abgehackt klingenden Rufen des Triumphes verschwanden sie im Morgendunst.
Wenig später jagten Dan Oakland und sein Sohn heran und schwangen sich von den keuchenden Pferden.
Während Dan sich über die toten Soldaten und über die blonde Frau beugte, schnellte Sky in das Haus, sah das Ausmaß der Zerstörung. Aus den geborstenen Fenstern hingen zerfetzte Gardinen.
Mit schweren Schritten betrat Dan das Haus.
Als er die Schlaflager erblickte, weiteten sich seine grauen Augen einen Herzschlag lang.
„Wir müssen zum Fort, Sky.“
* * *
Lt. Colonel Gilles Goldwater ließ exerzieren. Im ständigen Hin und Her des Schwenkens marschierten die Soldaten nach den gebrüllten Kommandos der Ausbilder über den sonnenhellen Platz des Forts.
Jäh brach die Ausbildung ab.
Eisiges Schweigen herrschte.
Alle Soldaten, alle Trapper, alle Indianer und alle Marketendermädchen starrten auf Dan Oakland und seinen Sohn.
Sie ritten durch das geöffnete Tor, und oben auf den Wehrgängen und Wachtürmen standen die Posten mit angeschlagenen Gewehren.
Das plötzliche Schweigen schreckte Goldwater auf. Steif ging er um seinen Tisch und trat an das Fenster seines Dienstzimmers.
„Sir“, flüsterte die Ordonnanz, „die Frau Gemahlin ...“
Ein lautes Stöhnen drang über Gilles Goldwaters Lippen und ließ die Ordonnanz verstummen. Alle Wut, alles Entsetzen und Grauen durchlebte der Lieutenant Colonel in diesen Sekunden. Dann stürmte er hinaus. Unter dem Vordach blieb er steif auf dem Plankenweg stehen.
Seine Schultern erschlafften. Das Gesicht war fleckig. Die blauen Augen hatten allen Glanz verloren.
„Eleanor!“, stöhnte er.
Vor ihm zügelten Dan und Sky die Pferde.
Niemand im Fort rührte sich. Der Hauch des Todes wehte über die Palisaden.
Goldwater schwankte, hielt sich am Vordachpfosten fest und starrte ununterbrochen auf seine Frau, deren Leiche eines der Handpferde trug.
Der dickliche Major Ambrose Bourke und der junge Lieutenant Morse Dorsey kamen steif heran und stellten sich an Goldwaters Seite, um ihn notfalls stützen zu können.
Aber Gilles Goldwater schaffte es auch ohne ihre Hilfe, auf den Beinen zu bleiben. Er bewahrte sogar Haltung in dieser schrecklichen Stunde und bewegte sich nun langsam die beiden Holzstufen hinunter.
Zitternd strich er über das blonde Haar seiner Frau.
„Tragt sie in meine Unterkunft“, befahl er mit belegter Stimme.
Bourke und Dorsey ließen es sich nicht zweimal sagen.
Soldaten hoben ihre toten Kameraden von den Pferden und trugen sie davon.
Der glatzköpfige Sergeant Aldo Webb kam heran. Er zog den Stiernacken ein und starrte Dan Oakland und seinen Sohn düster an.
Gilles Goldwater blickte noch eine Weile ins Leere, dann fragte er: „Wo sind meine Kinder? Pat und Washington Earl?“
„Ihre Kinder waren nicht mehr im Haus, Colonel“, antwortete Dan ernst. „Als wir kamen, war alles schon vorbei.“
„Spuren?“
„Ja, aber sie werden im Flussbett kaum noch zu erkennen sein.“
„Rothäute?“
Dan zögerte, denn die Antwort fiel ihm nicht leicht.
„Ja, Colonel, wahrscheinlich Cheyenne. Mein Sohn und ich haben Spuren gefunden. Danach konnten wir ungefähr nachvollziehen, wie alles geschehen ist. Ein einzelner Cheyenne war herangeritten und ist von Ihren Soldaten erschossen worden. Darauf folgte der Angriff der Cheyenne. Ihre Frau war draußen bei den Soldaten.“
„Keine Spur von meinen Kindern?“
„Wir haben nichts gefunden. Ihre Kinder sind wahrscheinlich von den Cheyenne entführt worden.“
Goldwater schwieg.
Dieser Mann fraß den ganzen Schmerz in sich hinein. Er schrie und jammerte nicht. Die Folgen waren absehbar.
„Mein Junge und ich werden alles versuchen, Ihre Kinder zu befreien, Colonel. Wir sind lange genug im Indianerland, um zu wissen, wo wir suchen müssen.“
„Ich auch!“, unterbrach Gilles Goldwater mit brüchiger Stimme. „Wie heißen Sie, Trapper?“
„Daniel Oakland.“
„Also, Oakland, ich verzichte auf Ihre Hilfe! Ich habe Männer genug. Und ich werde meine Kinder selbst befreien und unter diesem roten Mordgesindel aufräumen!“
Hart wandte er sich ab und verschwand in der Kommandantur.
Dan blickte seinen Sohn nur an. Sie zogen die Pferde in den Schatten des Pferdestalls und ließen sie dort saufen.
Ambrose Bourke, der untersetzte Major, kam mit dem jungen schwarzhaarigen Lieutenant Morse Dorsey aus der Baracke und sprach mit dem stiernackigen Sergeant.
Daraufhin brüllte Sergeant Aldo Webb seine Befehle und scheuchte die Soldaten vom Platz.
„In einer halben Stunde steht hier alles marschbereit, verstanden? Los, los, bewegt euch!“
Staub wehte über den Platz. Im Stall stampften und wieherten die Pferde. Soldaten empfingen am Depot Munition. Der Koch gab Proviant aus. Der Quartermaster überprüfte die Portionen. Über den Gehsteig vor der Unterkunft hastete der Zahlmeister. Stallburschen sattelten die Pferde.
Allein saß Gilles Goldwater am Lager seiner toten Frau und hielt ihre Hände, und niemand hörte seine gemurmelten Worte von Hass und Vergeltung.
„Verdammter Mist!“, brüllte Sergeant Aldo Webb. „Wollt ihr euch wohl beeilen, ihr lahmen Krücken?“
Alles hastete durcheinander.
Dan Oakland verzog etwas das wettergebräunte Gesicht und nickte seinem Sohn zu.
Beide stiegen auf die Pferde.
Für Sky war es nicht gut, jetzt noch länger in Fort Robinson zu bleiben, denn allzu schnell konnte sich der Zorn der Soldaten gegen ihn richten, weil er ein halber Indianer war. Langsam ritten sie am Rand des Platzes entlang.
In diesem Moment kam Gilles Goldwater aus der Kommandantenbaracke, und Dan war mit seinem Sohn gerade neben dem Plankensteg.
„Wollen Sie mich nicht doch begleiten, Oakland?“, fragte Goldwater düster.
„Wir werden vorausreiten, Colonel.“
„So, voraus, und was versprechen Sie sich davon?“
„Wir können die Spuren sichern. Vielleicht bringen wir die Indianer dazu, die Gefangenen freizugeben.“
„Glauben Sie im Ernst, dass Sie das schaffen, Oakland?“
Dan wollte nicht verraten, dass er als Catch-the-Bear einen nahezu legendären Ruf unter den Indianern hatte. Jeder hier im Gebiet der Weißen und an der Grenze, der ein Freund der Indianer war, lebte in ständiger Gefahr, einfach über den Haufen geschossen zu werden.
„Wir wollen es versuchen, Colonel.“
„Ihr seid verrückt.“ Goldwater starrte über den Platz. „Major Bourke! Wo, zum Teufel, bleibt Scout O’Hearly?“
„Der ist zur Stadt geritten, Sir“, antwortete Bourke und kam schnell heran. „Er hatte dienstfrei und wollte sich wohl wieder einen zur Brust nehmen. Aber er müsste eigentlich heute Morgen zum Dienst zurückgekommen sein.“
„Dann hat er sich betrunken und alles vergessen, dieser verdammte Scout! Major, wir brauchen sofort einen anderen Scout!“
„Ich werde das sofort erledigen, Sir!“
Bourke lief weg, und Goldwater blickte Dan forschend an.
„Sie könnten doch gut als Scout einspringen, Oakland. Der Sold ist nicht schlecht, dazu freie Verpflegung und Munition.“
Dan lächelte ernst.
„Nein, Colonel, wir leben in der Wildnis. Wir eignen uns nicht als Befehlsempfänger, die je nach Bedarf von der Leine gelassen werden.“
„Ihre Antwort gefällt mir nicht, Oakland, aber ich kann Sie ja wohl nicht zwingen, als Scout in den Dienst der Armee einzutreten.“
„Wir werden auch so alles tun, Ihnen behilflich zu sein, Colonel.“
„Na, schön, dann sehen wir uns ja irgendwann wieder, nicht wahr?“ In Goldwaters blauen Augen war der alte harte Glanz zurückgekehrt. „Ich will die Hundesöhne fassen, Oakland! Um jeden Preis!“
Dan nickte bedächtig und wollte das Pferd wieder antreiben, als Major Ambrose Bourke mit einem langhaarigen Mann herankam. Dieser Mann war wie ein Wildtöter gekleidet. Er zog ein Pferd hinter sich her. Hinter dem Sattel lag eine zusammengerollte Decke, die weitere Kleidungsstücke und auch Felle umschloss.
„Ich habe einen neuen Scout, Sir“, meldete der Major eifrig. „Das hier ist Kelly. Er kennt das Land gut.“
Mit seinen langen schwarzen Haaren stand Kelly in der Sonne, braungebrannt und ernst. Die Lederkleidung war schon ziemlich schmierig.
„Saufen Sie auch so gern, Kelly?“, wollte Goldwater wissen.
„Ich habe lange nichts mehr getrunken“, antwortete Kelly.
„Well, dann sind Sie wohl der richtige Mann.“ Goldwater war mit dem neuen Scout einverstanden. „Major, was ist denn nun mit O’Hearly?“
Dan Oakland nickte seinem Sohn zu. Daraufhin ritt Sky langsam zum Tor hinaus.
„Ich glaube, Colonel, dass ich das weiß“, sagte Dan schleppend. „Wir sind ja aus der Stadt gekommen. Da ist ein Scout erschossen worden, und wenn ich richtig gehört habe, war sein Name O’Hearly.“
Gilles Goldwater atmete pfeifend ein, straffte sich und fragte nach dem Täter, doch Dan zuckte nur die Achseln. Daraufhin machte Goldwater eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er damit bekunden, dass ihm das Schicksal des Scouts O’Hearly so sehr nicht berührte.
Dan verließ Fort Robinson und schloss sich seinem Sohn an. Im leichten Trab ritten sie in die hitzeflimmernde Weite.
In Fort Robinson stand alles zum Abmarsch bereit.
Während die Soldaten aufgesessen warteten, kniete Gilles Goldwater am Lager seiner toten Frau und betete stumm.
Dann trat er ins Freie und musterte streng die Männer der Schwadron.
Männer husteten, Pferde stampften auf der Stelle.
Vorn saßen Major Ambrose Bourke, Lieutenant Morse Dorsey und der Scout Kelly auf ihren Pferden.
Abseits der Schwadron standen die Frauen und Mädchen.
Wie Bourke und Sergeant Aldo Webb waren auch viele andere Männer verheiratet, und mancher hatte seine Frau in das Fort holen dürfen.
Steif ging Lt. Colonel Goldwater zu seinem Pferd und stieg in den Sattel.
Seine Stimme klang heiser und markig, als er schrie: „Schwadron! Zu Viererreihen! Reitet an!“
Die Kavalleristen schwenkten herum, reihten sich ein, und die Schwadron ritt in Viererreihe an den winkenden Frauen und Mädchen vorbei. Wenig später war der letzte Soldat im Staub hinter dem Tor verschwunden.
* * *
Der Wind fauchte über das tiefe Flussbett.
Geduckt ritten Dan und Sky durch das steinige Bett.
Oben am zerklüfteten Uferrand bog sich das hohe Gras im Wind. Über ihnen war blauer Himmel, von vielen weißen Wolken übersät, die schnell dahintrieben.
Immer wieder hielten Dan und Sky an und betrachteten den Boden.
Die unbeschlagenen Hufe der Indianerponys hatten das Gestein nicht zerschrammen können, und auch im Sand zeigte sich kaum noch eine Spur.
Sky bemerkte den tiefen Ernst an seinem Vater.
„Machst du dir Sorgen um die beiden Kinder des Colonels, Vater?“
Dan lächelte bitter.
„Nein, um die Cheyenne, Sky! Was sie in ihrem wilden Zorn getan haben, kann ihnen allen zum Verhängnis werden! Wir müssen die Kinder befreien und so schnell wie möglich zum Colonel zurückbringen, sonst wird es ein Blutbad geben. Ja, Sky, ich befürchte das Schlimmste.“
„Du glaubst, dass der Colonel blutige Rache nimmt, Dad?“, rief Sky durch den orgelnden Wind.
„Ja, Sky!“
Sie ritten hart und erreichten schließlich eine felsige Uferböschung. Hier trieben sie die Pferde empor und gerieten in den heftigen Wind. Vor ihnen wogte das Gras wie die Wellen einer rauen See, und eine breite Fährte führte zum fernen Horizont.
Sie folgten dieser Spur.
Sie führte über die Prärie zu den dunklen Bergfalten hinüber.
Oft blickten Dan und sein Junge zurück, doch von der Schwadron war noch nichts zu erkennen.
Vielleicht hatten sie Glück und konnten ein Gemetzel verhindern.
Am Spätabend stießen sie zwischen die Berge, und auch hier fing sich fauchend der Wind und rüttelte an den Fichten und Laubbäumen.
Die Spur der Cheyenne war urplötzlich verschwunden; die Hundemänner hatten sie so sorgfältig getilgt, dass selbst Dan und sein Sohn, beides erfahrene Fährtenleser, in Schwierigkeiten kamen.
Dan verhielt.
„Wenn wir der Spur weiterhin folgen, Sky, dann hinterlassen wir der Schwadron einen deutlich erkennbaren Weg, und das will ich nicht länger. Wir machen einen Umweg.“
Sie bogen ab.
Etwa eine Stunde später kam die Schwadron im klirrenden Trab über die windige Prärie zwischen die Bergausläufer geritten.
„Los, Kelly!“, sagte Lieutenant Colonel Goldwater so scharf, als wäre der Scout sein Bluthund. „Suchen Sie, Mann!“
Und Kelly ritt voraus.
Sie konnten die Spur der Cheyenne noch viel weniger erkennen, folgten Dan und Sky und gerieten dabei in zerklüftetes und wildes Gelände, wo sich auf steinigem Boden schließlich auch die Spuren des Trappers und seines Halbblutsohnes verloren.
„Jetzt zeigen Sie mal, was Sie können, Kelly!“
Kelly drehte sich halb im Sattel, und die Haarmähne wirbelte ihm in das braungebrannte Gesicht.
„Ja, Sir!“
* * *
Im zerklüfteten Bergland entdeckten Dan und Sky das kleine Lager der Cheyenne-Krieger.
Es lag gut geschützt zwischen hohen Felsen, so dass es kaum auszumachen war. Im Schutz der bizarren Felsbrocken flackerten zwei Lagerfeuer und warfen ihren zuckenden Schein auf die starren Gesichter der Indianer, die die Farben des Krieges trugen.
Dumpfer Gesang kam über die Lippen der Cheyenne. Feierlich bahrten sie den toten Stammesbruder im Geäst eines windzerzausten Baumes auf, so wie es auch die Sioux mit ihren Toten machten.
Abseits in einer Felsenhöhle kauerten das Mädchen Pat und der zwölfjährige Washington Earl Goldwater.
Die beiden blonden Kinder des Lieutenant Colonels bangten um ihr Leben. Sie hatten beide die tote Mutter und die niedergemachten Wachsoldaten gesehen.
Noch hatten die Cheyenne keine Wache ausgestellt. Vielleicht wollten sie nach der Trauer und einem kargen Mahl weiterziehen.
Wolkenfetzen trieben vor dem bleichen Mond dahin. In Felsspalten fing sich wimmernd der Bergwind.
Kehlige Laute wehten von den Feuern, und oben in der Baumkrone ruhte die mit Fellen umwickelte Leiche des Hundemannes der Cheyenne. Die Enden der Felle schlugen hart gegen die Äste.
Plötzlich geschah etwas Seltsames.
Aus dem nächtlichen Hintergrund trat ein junger schlanker Halbblutindianer hervor. Ruhig kam er näher und machte das Zeichen der Freundschaft, und zwei der Krieger stießen Laute der Überraschung aus.
Sie hatten ihn wiedererkannt. Sky war Mitglied des Bundes der Hundemänner gewesen.
Und während die Krieger sich aufrichteten, ertönte der schaurige Ruf eines Wolfes durch Wind und Nacht.
Catch-the-Bear Dan Oakland war da!
Hochaufgerichtet und in Wolfsfelle gehüllt, stand er oberhalb des Indianerlagers vor dem bleichen Mond und den treibenden Wolken.
Vom Wind geschüttelt, das lange schwarze Haar zerzaust, so trat Sky in den Feuerschein und sagte: „Ich komme in Sorge zu euch, Brüder. Hört auf die Worte meines Vaters Catch-the-Bear.“
Die Hundemänner, die der Armee entkommen waren, standen erschöpft und zerschunden vor Sky Oakland. Und Sky sah in die ausgemergelten und knochigen Gesichter, auf denen die Kriegsfarbe abzubröckeln begann.
Alle Blicke lösten sich von Sky und richteten sich auf den herankommenden großen Mann mit dem sandfarbenen Haar und den rauchgrauen Augen.
Catch-the-Bear erreichte die Feuer und blieb neben seinem Sohn stehen.
„Der Mond ist hell in dieser Nacht, und viele Augen suchen im Land nach den tapferen Männern des großen Stammes der Cheyenne. Viele Säbel sind noch trocken, doch der Stahl schreit nach dem Blut der Söhne Manitus. Der Wind erzählt mir von zwei Gefangenen, die die tapferen Hundemänner fortbringen wollen, doch er hat mir nicht gesagt, wohin. Ich möchte mit euch reden, Hundemänner.“