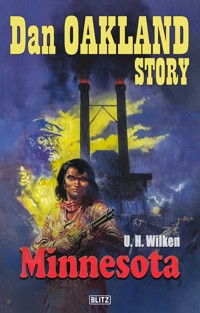Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Zurdo, der maskierte schwarze Reiter, dessen wahre Identität niemand kennt, sorgt in Kalifornien für Gerechtigkeit. Auf seinem Weg begegnen ihm Verbrecher und Mörder. Er wird in blutige Kämpfe verwickelt, findet aber auch Verbündete. Dieses Taschenbuch enthält folgende Romane: 1. Schwur der blutigen Rache 2. Der Tod wütet in Kalifornien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
U. H. Wilken
Blutige Rache
ZURDO – Der schwarze GeisterreiterBand 1
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-673-6
Schwur der blutigen Rache
Dröhnender Hufschlag durchbrach die Stille. Im gestreckten Galopp jagte ein Reiter über den Kamm des bizarren Höhenzuges. Wild flatterte der schwarzrote Umhang im Reitwind. Hell blitzte der Stahl des Degens im kalten Sternenlicht. Gleich einem unheimlichen Spuk verschwand der maskierte schwarze Reiter im Dunkel der Nacht.
Wie gelähmt standen die Menschen im Sacramento-Tal. Ein Ruf hallte über die noch unentdeckten und verborgenen Goldfelder Kaliforniens.
„Zurdo reitet wieder!‟
Kalifornien in den Tagen, da die aus dem Westen vordringenden landgierigen Amerikaner den Spaniern und Mexikanern das Land am Pazifik entreißen wollten. Die Zeit der erbarmungslosen Machtkämpfe der Gringos, der heimtückischen Intrigen der Franzosen und der berechnenden Schachzüge der Russen, eine Zeit des skrupellosen Terrors, des Totschlags und der Morde.
In dieser Nacht rollte eine Kupee-Kutsche mit federnden Achsen westwärts, Richtung Küste. Sie folgte dem Weg zur Hazienda de los Toros. Das flackernde Licht der Wagenlaterne fiel auf das Gespann und geisterte über die starren Gesichter der berittenen Musketiere hinweg. Schwere, großkalibrige Alston-Reiterpistolen steckten in den Halftern neben den Sätteln, ein Geschenk der Amerikaner.
Die Stille eines trügerischen Friedens lag über dem nächtlichen Kalifornien. Plötzlich trommelten die Hufe eines Pferdes hinter dunklen Oleanderbäumen entlang und verstummten. Im Schutz des Dickichts und der Felsen verhielt der maskierte Reiter. Funkelnde scharfe Augen beobachteten die nahende Kutsche. Verwegenes Lächeln lag um den Mund.
Zwei Männer, die Macht und Einfluss besitzen wollten, saßen nebeneinander im schwankenden Gefährt.
„Wann erreichen wir die Hazienda, Capitan Laurant?“
Der französische Offizier blickte den Amerikaner freundlich an.
„Oh, Monsieur Mason, nur ein klein wenig Geduld noch“, antwortete er im singenden Tonfall, „wir werden den Besitz dieses einfältigen spanischen Edelmannes morgen erreichen, mon ami. Er weiß natürlich nicht, dass Kalifornien bald uns gehören wird. Er ist dumm und kopflos wie ein geschlachtetes Huhn, das auszunehmen eine Kleinigkeit ist!“
„Halten sich unsere Leute bereit?“
„Aber ja, Monsieur Mason!“ Flüchtiges, heimtückisches Lächeln zuckte über Laurants Gesicht, und in den dunklen Augen flackerte es verschlagen auf. „Unsere Leute werden zuschlagen, wann und wo wir es auch immer wollen. Tacker Jackson ist ein guter Mann. Er hat die anderen unter Kontrolle.“
„Hoffentlich“, knurrte Cole Mason. „Ich muss mich auf jeden Mann verlassen können. Sie, Capitan, verstehen es gut, sich in der Politik zurechtzufinden, Sie haben Freunde im französischen Lager. Meine Stärke ist die Gewalt.“
Laurant lächelte geschmeichelt, löste den Blick vom rauen Gesicht des Amerikaners und blickte hinaus. Der Wind fauchte um die Kutsche und schüttelte die Sträucher und Bäume am Wegesrand. Fahles Licht zuckte über den Hügeln und zerriss den schwarzen Himmel über dem Sacramento Valley. Dumpf grollte es in der Ferne. Neben der Kutsche ritten die Musketiere einher. Die Hufe trappelten über den sandigen Weg.
„Sie können sich auf alles verlassen, Monsieur Mason. Dieses Kalifornien ist zu schön, als dass wir es den Spaniern und Mexikanern überlassen könnten.“
Plötzlich straffte der Kutscher die Zügel, und die Kutsche hielt an. Sofort öffneten Mason und Laurant die Türen und blickten nach vorn. Dichte Bäume bildeten einen Hohlweg. Fauchend schlug der Wind durch das Dickicht.
„Was ist los?“, schnauzte Mason. „Warum halten wir hier?“
„Wir haben Schreie gehört, Monsieur!“, rief der Kutscher. „Schreie nach Hilfe!“
In diesem Moment ertönte wieder ein schauriger Schrei aus der dunklen Tiefe der Bäume hervor. Der Wind zerfetzte den Schrei. Abgerissene Blätter wirbelten auf den Weg und tanzten an der Kutsche vorbei.
„Seht nach!“, rief Laurant den Musketieren zu. „Los, vorwärts!“
Die Männer trieben die Pferde an und folgten dem Weg. Die Kutsche stand still. Das Licht der Wagenlaterne flackerte unruhig. Dumpf schnaubten die Wagenpferde. Blätter wirbelten in die Kutsche hinein. Mason und Laurant schlugen die Türen zu und setzten sich wieder.
„Das Unwetter kommt näher, Monsieur Mason. Vielleicht erreichen wir noch vor dem Gewitter die Hazienda de los Toros.“
Cole Mason verzog das Gesicht. Er schlug den Kragen des Mantels hoch und wollte antworten, als draußen eine Stimme ertönte. Hufe schlugen hart und wild.
„Was, zum Teufel, ist jetzt wieder los?“, grollte Mason, ruckte hoch und öffnete die Wagentür.
Urplötzlich spürte er einen Druck am Hals. Seine grauen Augen weiteten sich. Er konnte kaum schlucken. Die Spitze eines Stoßdegens drückte unterhalb des Kehlkopfes in seinen Hals. Der Wind drückte die Wagentür vollends auf. Aus dem Dunkel der Nacht war ein Maskierter hervorgekommen.
Augen blitzten kalt und blickten Mason und Laurant scharf und drohend an. Das Pferd des Unheimlichen stand still. Der Maskierte hielt in der Linken den Degen. In der Rechten lag schwer und wuchtig eine Pistole.
Die beiden Männer wagten keine Bewegung. Cole Mason verharrte steif in der halbaufgerichteten Haltung. Laurants Augenlider flatterten wie im Fieber.
Der schwarze Umhang des Maskierten schlug hin und her. Die Innenseite war purpurrot. Eine Larvenmaske bedeckte die halbe Stirn, die Augenbrauen und noch etwas vom Nasenrücken. Das Gesicht war kaum zu erkennen.
Jungenhaftes, breites Lächeln ließ die Zähne blitzen. Der Oberlippenbart zog sich in die Breite. Die Stimme ließ keinen Zweifel aufkommen, sie klang fest und hart.
„Ich warne Sie, Señores. Greifen Sie nicht nach Kalifornien. Versuchen Sie nicht, das Presidio in die Gewalt zu bekommen. Ich werde alle Ihre Schritte bewachen und eingreifen, sollten Sie meinen guten Ratschlag nicht beherzigen. Sie, Señor Mason, wollen mit Ihren Pionieren aus dem Westen über das Land herfallen. Sie, Monsieur Laurant, wollen die Russen in das Land holen. Señores, ich werde Sie töten, wenn Sie im Land bleiben.“
Der Maskierte drückte zu, und Mason sank auf den Sitz zurück. Hart schlug die Tür gegen die Kutsche. Der Reiterumhang flatterte hoch, und die schwarze Kleidung eines spanischen Caballeros war zu sehen. Der Silberschmuck auf dem Bolerojäckchen reflektierte sekundenlang das Laternenlicht. In der Ferne brüllte das Unwetter.
Wie gelähmt saßen die beiden Männer in der Kutsche.
Nur langsam überwanden sie den Schreck über das jähe Auftauchen dieses unheimlichen schwarzen Reiters.
Der Stoßdegen bewegte sich nicht, als säße er in einem Schraubstock. Dunkel gähnte die große Mündung der Pistole. Mason und Laurant waren dem Tode näher als dem Leben.
„Vergessen Sie meine Warnung nicht, Señores!“, sagte der Maskierte ruhig. „Es wäre Ihr Tod. Und wer will schon von uns so früh sterben, Señores? Hasta la vista.“
Er riss den Degen zurück und schlug die Tür zu. Aufwiehernd drehte sich das Pferd. Der Franzose auf dem Kutschbock versuchte, nach der Waffe unter dem Rock zu greifen.
Der Reiter schien zaubern zu können. Im Nu war die Pistole verschwunden, und schon schlug er mit der Peitsche zu. Das geflochtene Leder legte sich schlangenhaft um den Oberkörper des Fahrers. Mit einem Ruck riss der Reiter den Fahrer vom Bock. Schon fauchte der Degen durch die Luft. Die scharfe Klinge des Toledo-Degens durchschnitt Zügel und Zaumzeug der Pferde. Klatschend traf die Peitsche die Wagenpferde und trieb sie vorwärts. Die Pferde rasten los und vom Weg herunter. Das vordere Rad der Kutsche zerschellte an einem Baumstamm. Mason und Laurant wurden in der Kutsche durcheinandergewirbelt und stürzten aus den Türen hervor.
Schon kamen die Musketiere zurückgeritten.
„Schießt ihn nieder!“, schrie Mason röchelnd. „Knallt den Hundesohn ab! Lasst ihn nicht entkommen!“
Der Unheimliche jagte bereits weg, als die Reiterpistolen aufbrüllten. Das Pferd zuckte heftig zusammen. Aufwiehernd durchbrach es das Dickicht und verschwand mit dem Reiter unter den Bäumen.
Im Galopp hetzten die Musketiere hinterher.
Schwankend kamen Mason und Laurant auf den Weg und stierten durch die Nacht.
„Woher weiß der verfluchte Kerl von unseren Plänen?“, keuchte Mason. „Haben Ihre Leute nicht dichtgehalten, Capitan?“
„Ich lege meine Hand für sie ins Feuer“, versicherte Laurant und atmete pfeifend.
„Von meinen Leuten kann es niemand gewesen sein“, krächzte Mason. „Meine Männer brennen darauf, in das Land einzufallen!“
Hinter den Bäumen krachten Schüsse.
Der Maskierte nahm Wege, die nur ein Einheimischer kennen konnte. Das angeschossene Pferd lahmte stark und wieherte unter Schmerzen. Mit einem geschmeidigen Sprung war der Maskierte vom Pferd, klopfte den Hals des Tieres, dann verschwand er zwischen den Bäumen. Der Umhang flatterte über die Sträucher hinweg. Geduckt lief er davon.
Auf keuchenden Pferden erreichten die Musketiere das zurückgelassene Tier. Sofort schwärmten sie aus und begannen zu suchen.
Immer wieder donnerte es über dem Sacramento-Tal. Ein Diagramm von Blitzen fuhr zuckend über den weiten Himmel. Pferde durchbrachen das Unterholz. Stimmen hallten durch die Nacht.
Der Unheimliche verbarg sich hinter den Bäumen.
Kaltblütig beobachtete er zwei Musketiere, die immer näherkamen. Jetzt trennten sie sich. Einer verschwand hinter den hohen Sträuchern. Der andere trieb das Pferd genau auf den Maskierten zu.
Er ritt ins Verderben.
Sein Pferd scheute plötzlich. Er sah einen flatternden Umhang, erkannte im Halbdunkel ein maskiertes Gesicht und riss die Pistole hoch, wollte abdrücken, da durchbohrte ihn der Stahl des Stoßdegens. Lautlos kippte er vom Pferd, schlug dumpf auf.
Der Maskierte packte den Zügel, riss den Degen voller Kraft heraus und setzte die Spitze auf die Stirn des Toten. Er machte eine kurze und harte Bewegung, und auf der Stirn blieb ein Z zurück …
Schon ritt der Maskierte davon.
Die Nacht schlug ihren schwarzen Mantel um ihn und schluckte ihn. Spurlos verschwand er im Dunkel.
Zurdo war wieder unterwegs.
*
„Señora!“, hallte es durch die große Vorhalle. „Señora, Gringos kommen! Sie müssen gleich hier sein!“
Oben auf der breiten Treppe erschien eine Frau. Ihr mütterliches Gesicht wurde ernst. Ihre Bewegungen verrieten Stolz und Anmut.
„Geh und erwarte sie!“, sagte sie. „Ich werde sie empfangen.“
„Ja, Herrin!“
Der Diener verschwand. Das Gewitter grollte. Grelles Licht zuckte durch die Fenster. Gardinen bewegten sich schleierartig vor den geöffneten Fenstern. Vom Regen erfrischte Luft wehte in das große Herrenhaus.
Teresa Monterrey ging in eins der vielen Zimmer hinein. Sie öffnete das Fenster und blickte über das weite Land. Regendunst hing über den Olivenhainen, über den Ziersträuchern, Oleanderbüschen und alten Bäumen. Weit draußen hatten sich die Stiere zusammengerottet. Fackeln flackerten auf dem großen Hof vor dem Casa Grande. Lichtschein fiel gelb und anheimelnd aus dem großen Pferdestall.
Langsam schälten sich die Umrisse der Reiter aus dem diesigen Dunst des Abends.
Die Haziendera stand reglos am Fenster im dunklen Zimmer und beobachtete die Reiter. Schmerzlich zuckte es um ihren Mund. Das graue Haar, wie von Silberfäden durchzogen, schimmerte im Licht der Blitze.
„Fremde“, flüsterte sie vor sich hin. „Sie bringen nur Unheil nach Kalifornien.“
Dumpf tönte das Gebrüll der Longhorn-Rinder von den Weiden herüber. Vaqueros ritten umher, saßen geschmeidig in den Holzsätteln und hielten das Vieh zusammen.
Niemand sah die Frau am Fenster. Niemand hörte ihre bitteren Worte.
Unten vor der Hazienda de los Toros hielten die Musketiere an. Aus dem kleinen Reiterrudel lösten sich Laurant und Cole Mason. Unter den Vordächern und im Schutz des mächtigen Eingangs verharrte die Dienerschaft der Hazienda. Berstender Donner ließ die Fensterscheiben klirren. Bis auf die Haut durchnässt, standen die Musketiere neben den Pferden.
Die Frau sah, wie der Verwalter die beiden Fremden empfing. Dann schritten sie über den Hof.
Erst jetzt verließ die Spanierin ihren Platz am Fenster. Sie läutete nach der Zofe und ließ lange auf sich warten.
Mason und Laurant waren in das große Herrenzimmer geführt worden. Im Kamin prasselte das Feuer. Wohlige Wärme füllte den Raum. Schmiedeeiserne Stäbe und Gitter verkleideten von draußen die Fenster. Blumen dufteten in einer Vase. Ein riesiger Bücherschrank füllte eine Zimmerwand aus. Spanische Gemälde hingen an den Wänden. Alles war kostbar, doch nichts war üppig. Ein gewisser strenger Stil war überall zu erkennen.
Als die Frau des Hazienderos das Zimmer betrat, erhoben sich Laurant und Mason, verbeugten sich und grüßten. Laurant machte eine Hofverbeugung und lächelte ausgesprochen freundlich.
„Unsere Herzen sind voller Dankbarkeit für die gütige Aufnahme in Ihrem Haus, Señora. Wir sind unterwegs zur Küste. Ein schlimmes Missgeschick hielt uns auf, sonst wären wir bereits heute morgen hier eingetroffen. Wir möchten Ihre Gastfreundschaft nicht allzu sehr beanspruchen, Señora. Leider gab es einen kleinen Zwischenfall, und unsere Kutsche ist nicht mehr zu benutzen.“
Cole Mason nickte steif dazu. Er konnte sich nicht wie ein Kavalier bewegen. Seine Knochen waren zu derb, seine Gesinnung zu rau, seine Herkunft zu einfach.
„So ist es, Señora“, sagte er nur.
Teresa Monterrey lächelte zurück, betont höflich und zurückhaltend.
„Fühlen Sie sich hier wie in Ihrem eigenen Haus, meine Herren. Die Mozos werden Ihnen trockene Kleidung bringen. Haben Sie ein wenig Geduld, Señores. Don Ricardo wird erst morgen hier eintreffen. Er holt seinen Sohn vom Hafen ab. Daher kann ich Ihnen leider keine Kutsche zur Verfügung stellen.“
Laurant verbeugte sich wieder.
„Es ist uns eine Ehre, Gast in Ihrem Hause zu sein, Señora. Wir vermögen unseren Dank nicht in Worte zu kleiden. Der Himmel möge Ihnen danken.“
Sie stellten sich vor und machten einen ruhigen Eindruck.
„Señores, wir sind hier nicht an dem Hofe des Königs“, sagte Donna Teresa freundlich. „Die Hazienda de los Toros ist Herberge für jeden, der Schutz vor dem Unwetter sucht. Wir haben hier große Plantagen und eine Stierzucht.“
„Ich habe davon gehört, Señora“, antwortete Laurant. „Niemand in Kalifornien liefert den Toreros bessere Stiere.“
„Ich darf mich jetzt zurückziehen, Señores. Ihre Leute werden im Gesindehaus untergebracht.“
„Gracias, Señora. Es wird uns eine Ehre sein, auch Don Ricardo kennenzulernen …“
*
Ein Segler lag auf der Reede vor Santa Rosa. In Booten wurden die Passagiere an Land gebracht.
Auf dem steinigen Uferweg vor den Hütten und Häusern stand eine Kutsche. Rassige Pferde bewegten sich unruhig und fiebernd vor dem leichten Wagen.
Der Rauch eines Zigarillos wehte den Booten entgegen. Die Einwohner standen an der Küste und beobachteten die nahenden Boote. Ein grauhaariger Edelmann verharrte neben der Kutsche.
Über den Küstenbergen tobte das Unwetter. Hier am Pazifik strahlte die Sonne, und das weite Meer funkelte und glitzerte wie Silber. Rufe tönten an Land. Draußen auf der Reede wurden die Segel der California eingeholt.
Wenig später legten die Boote an. Matrosen halfen den Passagieren an Land. Unter den Passagieren befand sich ein junger schlanker Mann. Die graue Reisekleidung verriet den langen Aufenthalt auf dem Segler. Er hatte verschiedene Schiffe benutzen müssen, um aus dem alten Spanien nach Kalifornien zu gelangen. Nur mit einem Koffer in der Hand drehte er sich suchend um und erblickte die Kutsche. Sein braungebranntes Gesicht erhellte sich. Er winkte und näherte sich der Kutsche.
Der grauhaarige Hidalgo umarmte seinen Sohn. Immer wieder klopfte er ihm auf die Schultern.
„Miguel, mein Junge! Willkommen in Kalifornien! Deine Mutter sehnt sich nach dir. Hast du die lange Reise gut überstanden?“
„O ja, Vater.“
„Keine Seekrankheit?“
„Nein. Unsere Pferde schaukelten mich noch schlimmer, Vater.“
Don Ricardo lächelte versonnen. Er war glücklich, seinen Sohn wieder bei sich zu haben.
„Es waren lange Jahre, mein Sohn. Wir können uns unterwegs über alles unterhalten, nicht wahr? Oder möchtest du erst einmal in Santa Rosa übernachten?“
Miguel Monterrey blickte um sich. Santa Rosa war ein kleines Nest und unbedeutend. Sein schwarzes Haar glänzte in der Sonne. Er sah nach den dunklen Wolken empor, die über das Küstengebiet hinwegtrieben.
„Ich möchte zur Hazienda, Vater. Ich sehne mich nach Ruhe und Geborgenheit.“
Wieder legte ein Boot an. Ein bärtiger großer Mann stieg aus dem Boot. Mit wuchtigen Schritten kam er näher und zog den Hut.
„Sehe ich richtig?“, sagte er und lachte dröhnend. „Sie haben Ihren Sohn wieder, Don Ricardo!“
„Das ist Kapitän Jefferson Cody, Vater“, stellte der Sohn den Kapitän des Seglers vor. „Señor Cody ist ein erfahrener Kapitän. Es war ein Vergnügen, Gast auf seinem Schiff zu sein.“
„Ihr Sohn hat mir viel über Sie erzählt, Señor Monterrey“, sagte der Amerikaner. „Wir haben uns oft unterhalten. Leider waren wir unterwegs nach hier gezwungen, den Anker zu werfen. Viele Trossen waren gekappt worden. Wir hatten einen längeren Aufenthalt. Man kann sich auf seine Mannschaft auch nicht mehr so gut verlassen.“
„Ja, ich hatte lange warten müssen“, erwiderte Ricardo Monterrey, „und ich hatte mir schon Sorgen gemacht.“
Während sich die beiden Männer unterhielten, schritt Miguel Monterrey nach vorn und begrüßte den zähen, sehnigen Indio, der neben den Pferden stand und sie festhielt. Immer wieder grollte der Donner des Unwetters herüber. Wolkenfetzen trieben über die Küste.
„Mein guter alter Chato! Wie geht es dir?“
Der Indio kniete vor dem jungen Mann nieder.
„Mein junger Herr“, flüsterte er, „es geht mir gut. Chato darf nicht klagen. Er ist sehr glücklich über die Ankunft seines Herrn.“
„Steh auf, Chato. Nimm meinen Koffer und verstau ihn auf der Kutsche. Nun komm schon, Hombre!“
Die dunklen Augen des Indios leuchteten. Scheu berührte er die Stiefel des jungen Spaniers. Hastig wischte er den Staub von den Stiefeln und rieb mit dem Ärmel seines Hemdes die eingetrockneten Regentropfen vom weichen Leder. Dann lief er um das Gespann und hob den Koffer auf.
Miguel Monterrey stand wieder auf kalifornischem Boden. Er atmete tief ein und sah nach den Bergen hinüber. Er hörte den Kapitän reden und die Menschen am Ufer lachen. Die amerikanischen Matrosen vertäuten die Boote. Herdrauch wehte von den Häusern herüber.
„Leben Sie wohl, Señor Monterrey!“, rief der Kapitän. „Gute Reise!“
Der junge Monterrey ging zurück und drückte die Hand des Seefahrers.
„Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, Herr Kapitän. Ich würde mich darüber freuen.“
„Ja, ich auch. Sie waren ein guter Gesprächspartner, Don Miguel.“
Die Kutsche rollte davon. Jefferson Cody starrte ihr nach und verzog das raue Gesicht. Er spie aus und knurrte dumpf vor sich hin: „Elender Lackaffe. Aufknüpfen sollte man diese arroganten Spanier. Die sind zu nichts nutze. Solche aufgeblasenen Jüngelchen sind mir ein Gräuel. Das ist kein richtiger Kerl.“
Mit wiegendem Gang entfernte er sich und stapfte in die Taverne.
Don Ricardo saß seinem Sohn gegenüber. Die Pferde trappelten nach Osten. Zerklüftete Felsen wuchteten am Weg empor. Kleine Gehöfte lugten hinter Bäumen hervor. Fauchend schlug der Wind gegen die geschlossene Kutsche.
„Ich hoffe, dass du vieles in Spanien gelernt hast, Miguel.“
„Oh, ich hatte nicht viel Langeweile, Vater. Spanien hat schöne Señoritas.“
„Du solltest nicht den Weibern nachlaufen, Sohn. Lernen solltest du, studieren und fechten.“
„Das war sehr langweilig, Vater. Es hat mich angeödet.“
„Zwei Jahre bist du in Spanien gewesen, und du hast nichts daraus gemacht? Antworte mir, Miguel!“
Der Sohn lachte gezwungen auf und legte die Hände an die Brust.
„Aber Vater. Natürlich habe ich gelernt, zwischendurch. Spanien ist doch so schön. Ich konnte nicht immer lernen.“
„Du hattest dich also auf diesen ewigen Empfängen herumgetrieben“, grollte Don Ricardo. „Du hattest den Frauen und Mädchen schöne Augen gemacht. Deine Antworten verraten es mir. Ich müsste mich schämen. Ich wollte einen Mann aus dir machen lassen. Aber du bist das geblieben, was du schon vor deiner Reise nach Spanien gewesen bist, ein Don Juan, ein Windhund, mehr nicht. Mein Gott, wenn ich daran denke, was für Söhne meine Nachbarn haben. Die Hidalgos können auf ihre Söhne wirklich stolz sein.“
Miguel senkte den Kopf. Sein Gesicht nahm einen weichen und niedergeschlagenen Ausdruck an.
„Was kann ich dafür, Vater? Ich bin nun einmal so. Niemand kann sich wirklich ändern.“
„Du hast zu viel von deiner Mutter. Aber du bist ein Mann, Junge. Schöne Worte nützen dir nichts in Kalifornien. Präsident Santa Anna hat in Mexico befohlen und verfügt, dass alle kalifornischen Missionen an die Rancheros abgegeben werden. Die Verwalter der Missionen sind neu hinzugezogene Mexikaner. Die Ländereien der Mönche werden jetzt von den Rancheros verwaltet. Jeden Tag stoßen immer mehr Amerikaner nach Kalifornien vor. Der Gouverneur Juan Bautista Alvarado hat einem Amerikaner große Ländereien am Sacramento überlassen, einem Gringo, der John August Sutter heißt und ein Schweizer ist. Bei diesem Gringo ist auch schon mehrmals der französische Diplomat Duflot de Mofras eingeladen worden. Merkst du, was die Gringos vorhaben? Sie wollen unser Land. Und dieser verdammte amerikanische Konsul in Monte Rey, dieser Larkin, schreibt schon öffentlich darüber, dass Kalifornien sich von Mexico trennen und sich den amerikanischen Staaten angliedern sollte. Amerika den Amerikanern, das schreibt er. Es wird Kämpfe geben, und du denkst an Weiber!“
„Vater, sei nicht zornig auf mich …“
„Ich soll ruhig sein? Großer Gott, was verlangst du von mir! Ich fühle mich der Republik Mexico nicht im Geringsten verpflichtet, mir geht es um Spanien und Kalifornien! Der Amerikaner John Bidwell ist mit vielen Fremden im Sacramento-Tal eingetroffen, und diese Gringos wollen alles mit Gewalt an sich reißen! Da kann ich nicht ruhig sein! Ich erwarte von meinem Sohn, dass er so denkt wie ich und auch so handelt!“
„O Vater, ich bin in Spanien gewesen, ich habe die Leute reden gehört. Was kannst du gegen die fremden Mächte tun? Auch du kannst nur reden! Ein Kampf ist doch sinnlos, er führt nur ins Elend, er lässt Blut fließen. Ich mag nicht daran denken.“
Gewittersturm fegte über das Land. Ferne Lichter versickerten im Dunkel der tief hinwegziehenden Wolken. Regen prasselte auf die Kutsche, Sturmböen drückten gegen das Gefährt.
Don Ricardo Monterrey versank ins Grübeln. Manchmal blickte er auf. Dann sah er, wie sein Sohn mit einem Medaillon spielte und es betrachtete.
„Was ist das?“
„Sie ist eine wundervolle Frau, Vater. Sie wurde im alten Kastilien geboren. Sie ist wie eine Göttin.“
„Du bist jetzt in Kalifornien. Vergiss Spanien. Es treibt sich viel Gesindel hier herum. Banditen sind den amerikanischen Pionieren gefolgt. Sie sind zur Landplage geworden. Du brauchst einen starken Arm und ein verwegenes Herz, sonst wirst du untergehen. Ich kann dich nicht ewig beschützen, Miguel.“
Der Sohn schien den ernsten Sinn der Worte nicht begriffen und gehört zu haben. Verträumt blickte er hinaus in das Unwetter, das fern über Sacramento tobte.
„Miguel!“
„Ja, Vater?“ Der Sohn blickte ihn erschrocken an.
„Wann wirst du so werden wie dein Jugendfreund Cesar Visconte? Er ist ein stattlicher junger Mann, mutig und entschlossen. Wenn er auch nicht reich ist, so ist er doch ein echter Caballero und Hildalgo, ein Kämpfer von Kalifornien.“
Miguel Monterrey schluckte und rückte den Degen zurecht. Unruhig strich er über den gepflegten Oberlippenbart hinweg.
„Lass mir bitte Zeit, mein Vater. Ich will dich nicht enttäuschen. Wie geht es Cesar? Ist er schon verheiratet?“
„Nein. Er arbeitet. Besuch ihn bald, damit du einen echten kalifornischen Spanier zu sehen bekommst.“
Grell fuhren die Blitze über den Himmel. Nass schlugen die Sträucher am Wegrand. Heftig schüttelten sich die Bäume. Flammen zuckten aus einem vom Blitz getroffenen Baum empor, erloschen im prasselnden Regen. Vorn auf dem Kutschbock saß zusammengekrümmt und fröstelnd der Indio Chato und lenkte die Pferde. Fern im Westen schlugen die aufgepeitschten Wogen des Pazifiks gegen die Küste.
*
Kerzen leuchteten auf dem festlich geschmückten Tisch. Lautlos glitt die Dienerschaft umher. Raunende Stimmen tönten durch das Herrenhaus der Hazienda de los Toros.
Im Herrenzimmer saßen an diesem Tag Cole Mason und Laurant. Ihre Kleidung war getrocknet, gesäubert und gebügelt worden. Sie tranken spanischen Wein und plauderten. Die Frau des Hazienderos erschien in der Tür.
„Meine Herren, Don Ricardo ist eingetroffen. Er wird Sie gleich empfangen.“
Sie verschwand wieder, und Mason starrte Laurant seltsam an.
„Wir brauchen seine Kutsche. Wir müssen schnellstens zur Küste. Das Schiff wird warten.“
„Eine schöne Gegend hier, nicht wahr?“, Laurant lächelte hintergründig. „Und alles nette, harmlose Leute. Wir könnten diese Hazienda gut als Unterschlupf gebrauchen, mon ami.“
„Die Idee ist nicht schlecht, Laurant …“
„Unsere Leute sind nicht weit von hier entfernt. Sie halten sich in der Nähe einer Weggabelung bereit. Die Ecke heißt El Rincon de los Toros, Winkel der Stiere. Sie grenzt an den Besitz dieses Don Ricardo.“
Mason knurrte dunkel, grinste zynisch und nickte.
„Nur Geduld, Capitan.“
In diesem Moment betrat Ricardo Monterrey das Herrenzimmer. Hinter ihm erschien sein Sohn. Die beiden Männer erhoben sich, stellten sich vor und grüßten freundlich.
„Bitte, setzen Sie sich“, sagte der Haziendero. „Das ist mein Sohn Miguel. Er ist gerade aus Spanien zurückgekommen mit der California! Das Unwetter hat uns etwas aufgehalten.“
„Hatten Sie eine angenehme Reise, Monsieur?“, erkundigte Laurant sich und blickte Miguel Monterrey freundlich lächelnd an.
„O ja, Señor. Kapitän Cody war ein sehr angenehmer Gesellschafter. Die Reise hat mir Spaß gemacht.“
„Ich kenne Cody“, sagte Mason. „Ein erfahrener Kapitän. Aber das Schiff hätte doch längst Santa Rosa erreichen müssen.“
„Es hatte einen unfreiwilligen Aufenthalt gegeben“, antwortete Ricardo Monterrey. „Aber sprechen wir nicht mehr darüber. Sie wollen also zur Küste, Señores?“
„Ja“, nickte Mason, „und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre Kutsche zur Verfügung stellen würden.“
Der Haziendero lächelte. Seine Beherrschung war groß. Er zeigte den Fremden nicht seine starke Abneigung und seinen Groll. Alle seine Gefühle verbargen sich hinter der Höflichkeit eines Edelmannes.
„Selbstverständlich, Señores. Darf ich vielleicht wissen, was Sie nach unserem schönen Kalifornien geführt hat? Geschäfte?“
„Ja.“ Cole Mason verzog das Gesicht. „Wir hätten Sie nicht aufgesucht, wenn nicht dieser Maskierte aufgetaucht wäre.“
Monterrey hob die Augenbrauen an. Seine Stimme klang etwas belegt.
„Ein Maskierter? Erzählen Sie, meine Herren!“
„Er war plötzlich da. Er bedrohte uns. Dann jagte er die Kutsche zwischen die Bäume. Später fanden wir einen unserer Musketiere wieder. Tot. Auf der Stirn war ein Zeichen eingeritzt, ein großes Z.“
Starr sah Ricardo Monterrey den Amerikaner an.
„Z“, flüsterte er, „Z wie Zurdo …“
„Was haben Sie gesagt?“
„Nichts, Señor Mason. Ein Z, sagten Sie? Was kann das bedeuten?“
„Das wissen wir nicht.“
Der junge Monterrey fasste sich unwillkürlich an den Hals.
„Das könnte Zur …“
„Du wirst müde von der langen Reise sein, Miguel“, unterbrach Monterrey seinen Sohn. „Geh, leg dich schlafen.“
Der Sohn nickte. Er war viel zu gut erzogen, um zu widersprechen. Und er verabschiedete sich und verließ das Herrenzimmer.
Mason konnte das abfällige Grinsen kaum verbergen und rieb sich das Gesicht.
„Ihr Sohn ist ein sehr artiger Junge, Señor Monterrey.“
„Ja, das ist schon selten geworden“, fügte Laurant hinzu. „Die jungen Leute sind oftmals wild und hemmungslos.“
Ricardo Monterrey seufzte leise, straffte die Schultern und antwortete nicht darauf. Ihm war aber dennoch anzumerken, dass er sich etwas schämte, einen so im Wesen schwächlichen Sohn zu haben.
Eine Stunde später verließen Mason und Laurant mit der Kutsche die Hazienda. Die berittenen Musketiere folgten der Kutsche und eskortierten sie.
Oben in seinem Jugendzimmer saß der junge Miguel auf dem Bett und ließ sich von seiner Mutter umarmen und streicheln.
„Vater sagt, dass ich zu Cesar Visconte reiten soll, Mutter. Aber ich würde lieber Señorita Severina einen Besuch machen. Wie geht es ihr, Mutter? Wohnt sie noch immer bei ihren Eltern?“
„Sie sind umgezogen, mein Junge. Sie wohnen in der Nähe von Cesar.“
„Lieben die beiden sich?“
„Das frag sie selber, mein Junge. Und nun schlafe. Ich bin sehr glücklich, dass du wieder bei uns bist, Miguel.“
*
Unablässig regnete es. Wasser verdampfte im Feuer unter den nassen Bäumen am Rincon de los Toros. Schnaubend standen Sattelpferde auf dem Lagerplatz. Schweigend hockten Männer am Feuer. Das Unwetter machte sie missmutig und gereizt.
Plötzlich durchbrach ein Mann das Unterholz und kam keuchend an das Feuer herangelaufen.
„He, nicht weit von hier ist ein Haus, Jungs! Tacker, wir könnten uns dort einnisten, anstatt hier im Regen herumzuhocken! Wer weiß, wie lange wir hier noch warten müssen.“
Sieben Männer starrten in das Feuer.
Sieben skrupellose Männer grinsten bösartig.
Nacheinander verließen sie den Flammenkreis des Feuers. Radsporen rasselten über den Lagerplatz. Dumpfe Stimmen verloren sich unter den Bäumen. Pferde stampften. Einer der Männer kam zurück und stieß mit dem derben Stiefel die Holzglut auseinander.
Langsam ritten sie aus dem Wald hervor und überquerten die Weggabelung. Der Hufschlag verstummte irgendwo abseits des Weges …
Gewitterleuchten erhellte das Land und ein fernes Haus.
Trübes Licht fiel durch das Fenster.
Am steinernen Kamin hockte ein junger Mann und blickte in die Flammen. Er hörte im Stall die Maultiere rumoren und im Korral die Rinder brüllen.
Hinter ihm am Tisch saß ein Halbblut. Die breiten Wangenknochen schimmerten im Lichtschein. Das dunkelhäutige Gesicht war ausdruckslos. Die schwarzen Augen funkelten.
Am Herd stand ein Chinese und kochte das Essen für den morgigen Tag. Bei jedem Blitz und Donnerschlag zuckte er zusammen. Stille Furcht prägte die Züge des gelben Gesichtes.
Das Vieh brüllte.
Das Halbblut erhob sich auf einmal.
„Ich werde das Vieh in den Schutz der Bergflanke treiben, Don Cesar“, sagte er mit dunkler Stimme.
Cesar Visconte sah auf und nickte.
„Bueno, tu das, Manuelito. Schaffst du es auch wirklich allein?“
„Si, Señor!“ Das Halbblut lächelte breit. „Ich bin kein Dummkopf. Nur Tontos schaffen es nicht allein.“
Er bewegte sich mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze zur Tür und glitt hinaus. Ein Regenschauer kam herein. Das Talglicht flackerte. Im Kamin fauchte das Feuer. Mit dumpfem Geräusch fiel die Tür zu.
Der Chinese zitterte. Wieder brüllte das Unwetter.
„Du brauchst dich nicht zu fürchten, Mosquito“, sagte Cesar Visconte lächelnd. „Bist du nicht ein Sohn des Himmels? Deine himmlischen Brüder machen so einen Höllenkrach.“
„Sie sehr böse sein“, flüsterte der Chinese. „Sie zornig. Ahnen von Mosquito sich streiten heftig miteinander.“
Cesar stand auf und trat an den Herd heran, sah in die Töpfe und legte die Hand auf die Schulter seines chinesischen Kochs.
„Morgen wird mir die Arbeit noch einmal so viel Spaß machen, Mosquito, denn ich werde wissen, dass es was Gutes zu essen geben wird.“
„Mosquito großer Koch sein, viele Künste beherrschen. Mosquito König der Köche sein. Herr immer zufrieden sein mit Mosquito.“
„Muy bien. Geh jetzt, du musst noch die Burros versorgen.“
„Mosquito schon eilen wie Wolken vor Sturm.“
Der Chinese eilte hinaus, und Cesar Visconte war allein im Haus. Monoton schlug der Regen auf das flache Dach des kleinen Ranchos.
Schimpfend überquerte der Chinese den Hof. Der Boden war aufgeweicht und zu Morast geworden. Das Stalltor schlug hin und her. Die Stalllaterne wackelte am Pfosten. Die Maultiere röhrten dumpf. Das Halbblut Manuelito kam aus dem Stall geritten und trieb das Pferd hart in das Unwetter hinein. Im Korral brüllten die Rinder. Das Holzschild an den Stangen, die das Tor zum Rancho darstellten, quietschte laut. Schemenhaft verschwand Manuelito im Dunst.
Nass bis auf die Haut, betrat der Chinese den Stall, nahm die Laterne und ging tiefer hinein. In den Boxen rumorten die Pferde und Maultiere. Wind pfiff durch die Fugen.
Cesar Visconte schien zu träumen.
Damals, als sein Freund Miguel dieses Land verlassen hatte, war auch so ein heftiges Unwetter über Kalifornien hinweggetobt. Er erinnerte sich, dass das Schiff nicht hatte auslaufen können, und er sann darüber nach, was alles in der Zwischenzeit geschehen war. Stilles Lächeln lag um seinen Mund.
Draußen brüllten die Rinder und trotteten aus dem Stangenkorral. Die Longhorns knallten die Hörner aneinander und wälzten sich wie eine knochige Flut in das Tal hinaus.
Im Stall sprach der Chinese vor sich hin, um sich selbst Mut zu machen.
Krachend traf ein Blitz die ferne Eiche und spaltete sie. Die Burros keilten aus. Erschrocken wich Mosquito zurück. Die Laterne entglitt seiner Hand und knallte gegen einen Pfosten. Flammen leckten über den Boden, und der Wind stieß hinein.
Wie von Sinnen, riss Mosquito die Pferdedecke von der Boxwand und warf sie auf die Flammen, erstickte das Feuer, trampelte auf der Decke herum und sah und hörte nichts anderes.
Zitternd und keuchend hielt er inne.
Regenfäden kamen in den Stall. Es war dunkel zwischen den Boxen. Fahles Gewitterleuchten fiel zuckend in den Stall, blendete den Chinesen. Er wagte sich nicht hinaus. Die Angst, von einem Blitz getroffen zu werden, ließ ihn erstarren.
Die letzten Longhorns verließen den Korral und rannten der kleinen Herde nach. Geschickt und zäh trieb Manuelito die Rinder durch das kleine Tal und zum Bergrücken hinüber. Oben auf der Kammhöhe bogen sich die Bäume. Windzerzaust schüttelten sie ihre Äste, und Laub wirbelte davon.
Im Rancho warf Cesar Visconte Holz nach, rührte dann in den Töpfen, kaute auf der langstieligen Pfeife herum und horchte immer wieder hinaus.
Schließlich griff er nach den Chaps, legte sie um die Beine und packte die Peitsche. Er wollte Manuelito nicht allein lassen. Es war eine schwere Arbeit, die Herde in den Schutz der Talwand zu bringen. Und Cesar Visconte hatte niemals die Arbeit gescheut.
Er stieß die Tür auf, und eine Sturmböe warf die Tür gegen die Hauswand. Regen prasselte in sein Gesicht. Er kniff die Augen zusammen und stierte über den Hof.
Die dunklen Berge der kalifornischen Sierra buckelten sich wie riesengroße hingestreckte Raubtiere in den Himmel. Von irgendwoher trieb hüpfend ein ausgerissener Comastrauch über den Hof. Wild schlug die Tür.
Er drehte sich um, packte sie und drückte sie mühsam zurück. Die Peitschenschnur war um sein Handgelenk geschlungen. Er hörte nicht die hastenden Schritte. Plötzlich spürte er einen harten Druck im Rücken. Eine dunkle Gestalt riss die Tür auf. Fremde stießen ihn in sein eigenes Haus hinein.
Im Stall warf Mosquito den Tieren das Futter vor. Auf einmal vernahm er im Toben des Unwetters rasselnde Sporenräder. Er ließ den Futtersack fallen und stierte hinaus. Drüben schwang die Tür hin und her. Licht geisterte über die Türschwelle. Eine dunkle Gestalt tauchte auf und riss die Tür zu.
„Señor Visconte!“, flüsterte Mosquito. „Du haben Besuch? Mosquito unruhig sein!“
Er zögerte, horchte, doch nichts war zu hören.
Drei Fremde standen vor Cesar Visconte. Männer, die vor nichts zurückschreckten.
Niemals war Cesar Visconte ein Feigling gewesen. Niemals war er Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen. Er konnte hitzköpfig handeln und fuchsteufelswild werden.
„Was wollen die Señores in meinem Haus?“, fragte er scharf. „Ich habe sie nicht gerufen!“
Tacker Jackson lachte gepresst. Sein Atem klang wie das Hecheln eines gejagten Hundes. Das verwüstete Gesicht war nass vom Regen und von Zynismus verzerrt.
„Hört euch diesen dreckigen Scheißkerl von einem Spanier an!“, sagte er krächzend. „Der will uns wohl rausschmeißen?“
„Ich habe Sie nicht eingeladen, Señores!“
„Aber wir uns!“, fauchte der Mann neben Tacker Jackson wütend. „Du hältst das verdammte Maul, Stinktier! Glaubst du, wir wollen ewig da draußen im Unwetter herumhocken? Hier bei dir ist es richtig gemütlich!“
Das Stalltor hämmerte gegen die Wand. Zitternd lief Mosquito aus dem Stall. Er beugte sich nach vorn, wurde von den Sturmböen erfaßt und quer über den Hof getrieben. Atemlos erreichte er das Haus, schob sich an der Wand entlang und erreichte das Fenster.