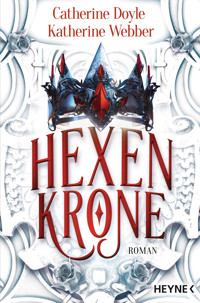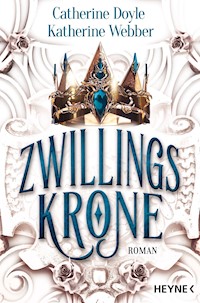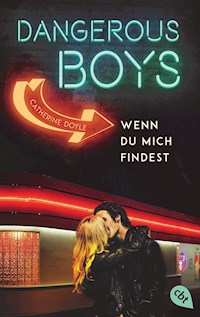6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Dangerous Boys-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wenn es um Rache geht, ist Liebe eine gefährliche Komplikation
Als eine mysteriöse Familie in die verlassene Villa in ihrer Nachbarschaft zieht, verändert sich Sophies Leben für immer. Unwiderstehlich von Badboy Nic angezogen, gerät Sophie immer tiefer in eine kriminelle Unterwelt. Nur langsam kommt sie hinter die dunklen Geheimnisse von Nics Familie – und die ihrer eigenen. Als sie schließlich die schreckliche Wahrheit erfährt, steht plötzlich alles auf dem Spiel: ihre Familie, ihre Liebe – ihr Leben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Ähnliche
© Catherine Doyle
DIE AUTORIN
Catherine Doyle wurde 1990 in Irland geboren. Ihre Inspiration für ihr Debüt »Dangerous Boys« holte sie sich von Shakespeares Romeo & Julia und der Mafia. »Dangerous Boys« spielt im heutigen Chicago, wo ihre Mutter aufwuchs.
Mehr über cbt/cbj auf Instagram unter @hey_reader
CATHERINE DOYLE
DANGEROUS
BOYS
WENN ICH DIR VERTRAUE
Aus dem Englischen
von Doris Attwood
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erstmals als cbt Taschenbuch Dezember 2019
© 2014 by Catherine Doyle
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Vendetta« bei Chicken House UK, London
© 2019 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Die deutsche Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Valentine Vendetta« im cbj Kinder- und Jugendbuchverlag.
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Doris Attwood
Umschlaggestaltung: Suse Kopp, Hamburg
Umschlagmotive © Gettyimages/Car Culture,
Shutterstock/Anna Berdnik
ml · Herstellung: LW
Satz: KompetenzCenter, MönchenGladbach
ISBN 978-3-641-25374-5V001
www.cbj-verlag.de
Für meinen Dad
Teil 1
»Von allen Formen der Vorsicht ist die Vorsicht in der Liebe vielleicht die verhängnisvollste für das wahre Glück.«
Bertrand Russell, Die Eroberung des Glücks
1
Der Honigtopf
Zuerst konnte ich es gar nicht sehen, weil es zwischen der Kasse und einem Stapel Notizblöcke stand. Gut möglich, dass es schon seit Stunden einfach dort wartete – oder sogar noch länger –, während ich im Gracewell’s Diner wieder einmal beinahe einging vor Langeweile. Wie so oft in diesem Sommer.
Wir waren an diesem Abend nur noch zu zweit, um den Laden abzuschließen. Ich hockte neben der Kasse und trommelte mit den Fingernägeln auf die Theke, während Millie, meine beste Freundin und kellnernde Leidensgenossin, durch das Diner schlitterte und in den Besenstiel sang, als wäre er ein Mikrofon. Alle anderen waren schon gegangen, während mein Onkel Jack – Manager der unteren Spitzenklasse – direkt mit einem Kater zu Hause geblieben war.
Die Tische standen in exakten Reihen, flankiert von weinroten Stühlen mit geraden Rückenlehnen und dem einen oder anderen Gummibaum. Die Tür war abgeschlossen, das Licht gedimmt und die Sitznischen an den Fenstern sauber.
Ich versuchte gerade, Millie nicht dabei zuzuhören, wie sie Adele massakrierte, als ich es bemerkte: das Honigglas. Ich hob es hoch und betrachtete es.
»Ich glaube, ich werde langsam besser«, rief Millie mitten in ihrem Song-Mord von der anderen Seite des Diners. Das Einzige, was sie wirklich richtig draufhatte, war der leichte britische Akzent, allerdings auch nur, weil sie selbst Britin war. »Ich treff jetzt sogar diese eine hohe Note!«
»Schon viel besser, Mil«, log ich, ohne aufzublicken.
Das Glas war klein und rundlich. Der Honig darin war von goldenen Kristallen durchzogen und floss träge hin und her, als ich das Glas vor- und wieder zurückkippte. Ein ausgefranstes quadratisches Stück Stoff war über den Deckel gespannt, und statt eines Etiketts schlang sich ein dünnes Samtband um die Mitte, das mit einer aufwendigen Schleife zusammengebunden war. Es war schwarz.
Selbst gemacht? Eigenartig. Ich kannte niemanden in Cedar Hill, der seinen eigenen Honig herstellte, und ich kannte hier fast jeden. So war unser Städtchen nun mal: ein kleiner Vorort von Chicago, in dem jeder alles über jeden weiß, in dem niemand vergibt und niemand vergisst. Ich konnte ein Lied davon singen. Nach dem, was mit meinem Dad passiert war, war ich zu einem Kind der Schande geworden, und Schande hat die Tendenz, an einem zu kleben wie ein großes rotes Warnzeichen auf der Stirn.
Millie schmetterte die letzte Note ihres Songs mit ohrenbetäubender Hingabe, hüpfte dann hinter die Theke und verstaute den Besen an seinem Platz. »Können wir gehen?«
»Wo kommt das her?« Ich balancierte das Honigglas auf meiner offenen Handfläche und hielt es ihr hin.
Sie zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Es war schon hier, als meine Schicht angefangen hat.«
Ich sah sie durch die goldene Flüssigkeit an, die ihr Gesicht verzerrte wie ein Prisma. »Ist doch eigenartig, oder?«
Millie verzog ihre Miene zu einem klassischen Das-Thema-dieser-Unterhaltung-interessiert-mich-nicht-die-Bohne-Ausdruck. »Der Honig? Nicht wirklich.«
»Er ist selbst gemacht«, sagte ich.
»Ja, das sehe ich.« Sie kniff die Augenbrauen zusammen und streckte eine Hand aus, um das Glas zu berühren. »Das Band ist irgendwie seltsam. Vielleicht hat es ein Gast statt Trinkgeld hiergelassen?«
»Welcher Gast gibt denn Honig statt Trinkgeld?«
Millie schnappte nach Luft und ihr Gesicht hellte sich auf. »Hast du heute …«, sie atmete dramatisch ein, »möglicherweise …«, sie atmete wieder aus, »einen …«
Ich lehnte mich erwartungsvoll nach vorne.
»… kleinen gelben Bären bedient …«
Ich konnte nicht fassen, dass ich darauf hereingefallen war.
»… der Winnie Puuh hieß?«
Ihr Lachen riss mich mit, das tat es immer. Es war genau dieses Lachen gewesen – als würde jemand eine Ente strangulieren –, das ich schon so gewinnend an ihr fand, als sie vor fünf Jahren nach Cedar Hill gezogen war. In der Schule ertappten wir uns ständig dabei, wie wir über dieselben Dinge lachten. Es waren diese Albernheiten, die uns zusammengebracht hatten – dämliche Grimassen schneiden oder ein unangebrachtes Kichern, wenn jemand stolperte und hinfiel. Lange, unsinnige Unterhaltungen und Diskussionen über lächerliche, hypothetische Situationen. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Freundschaft als Einzige das überleben würde, was meiner Familie vor achtzehn Monaten passiert ist. Aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr, weil Millie sowieso die beste Freundin war, die ich jemals haben konnte, und die einzige, die ich wirklich brauchte.
Wir konnten gar nicht mehr aufhören zu lachen, während wir den Laden absperrten, bis wir draußen in der milden Nachtluft standen. Das Diner befand sich an der Ecke Foster und Oak in einem bescheidenen, flachen Gebäude aus verblassten Ziegelsteinen. Es war vollkommen symmetrisch, und seine quadratische Form spiegelte sich auch in den ebenso quadratischen Fenstern, die die Fassade dominierten, und dem kleinen Parkplatz wider, der es von allen Seiten umschloss. Am überhängenden Dach des Diners war ein Schild angebracht, auf dem in geschwungenen Buchstaben »Gracewell’s« stand und das nur halb von den Straßenlaternen erleuchtet wurde, die das Grundstück säumten. Gleich auf der anderen Straßenseite erhob sich die alte Bibliothek in den Nachthimmel, halb versteckt hinter einer Reihe ordentlich geschnittener Bäume, die sich in Richtung Westen entlang des Gehwegs am Postamt vorbei fortsetzte.
Als wir den leeren Parkplatz überquerten, hielt ich noch immer den hübsch verzierten Honigtopf in der Hand. Es ist ja nicht so, als würde das irgendjemandem etwas ausmachen, redete ich mir selbst ein – mein Onkel Jack lag mit selbst verschuldeten Kopfschmerzen zu Hause, und es war niemand da, der offizielle Ansprüche hätte anmelden können. Ich hatte nur getan, was jeder andere erschöpfte und unterbezahlte Angestellte auch getan hätte: Ich hatte diese Gratisüberraschung, für die ich keine sofortige Verwendung hatte, an mich genommen und das Diner mit einem Gefühl des Triumphs verlassen.
»Also, ich hatte da so einen Gedanken.« Millie verlangsamte auf mein Tempo.
»Sei vorsichtig«, neckte ich sie.
»Vielleicht sollte ich den Honig nehmen.«
»Wer’s findet, darf’s behalten«, trällerte ich.
»Sophie, Sophie, Sophie.« Sie legte einen Arm um meine Schulter und zog mich zu sich heran. Wir waren beinahe gleich groß, aber Millie hatte genau an den richtigen Stellen die richtigen Kurven, während ich jungenhaft flach und dünn war und die gleichen Hamsterbacken hatte wie mein Vater, obwohl ich immerhin auch seine Grübchen geerbt hatte – ein Silberstreif am Horizont. Millie drückte ihre Wange an meiner platt, als wollte sie mich genau daran erinnern. Ich spürte, wie sie lächelte. »Meine allerbeste Freundin auf der ganzen Welt. Oh, wie öde mein Leben doch ohne dich wäre! Die Sterne würden nicht halb so hell leuchten, der Mond wäre nur ein Schatten seines früheren Selbst. Alle Blumen wären welk, und …«
»Auf keinen Fall!« Ich schlüpfte aus ihrer Umarmung. »Du kannst mir nicht mit Komplimenten meinen neuen Honigvorrat abluchsen. Ich bin immun gegen deinen Charme.«
Millie kniff die Augen ganz fest zusammen und stieß ein herzzerreißendes Wimmern aus. »Du bekommst doch schon das ganze verdammte Diner. Kann ich nicht wenigstens den Honig haben?«
Obwohl sie recht hatte, entsprach es nicht unbedingt meinem größten Lebensziel, das Diner zu erben, sobald ich achtzehn war. Mein Vater hatte das so festgelegt, bevor er gegangen war, und mein allzeit mürrischer Onkel Jack, der eine besonders überzeugende Ich-akzeptiere-kein-Nein-als-Antwort-Aura ausstrahlte, würde seine Anweisungen auch garantiert befolgen. Es spielte ohnehin keine Rolle. Millie und ich wussten beide, dass das Diner die Aufregung nicht wert war. Es war nichts weiter als eine einzige große Sackgasse, auf die mein Leben unaufhaltsam zusteuerte und die mir schreckliche Kopfschmerzen bereiten würde. Aber der Honigtopf mit der schwarzen Schleife? Der war hübsch – eine nette Überraschung, die die Monotonie dieses Tages durchbrochen hatte.
Millie schlurfte hinter mir her. »Sophie, hier spricht dein Gewissen«, flüsterte sie mir über meine Schulter zu. »Ich weiß, es ist schon eine Weile her, seit wir zum letzten Mal miteinander gesprochen haben, aber es ist an der Zeit, das Richtige zu tun. Millie ist so nett und hübsch. Möchtest du ihr den Honig denn nicht geben? Denk doch nur mal daran, wie glücklich sie das machen würde.«
»Ich wusste gar nicht, dass mein Gewissen einen britischen Akzent hat.«
»Ja, na ja, da solltest du nicht zu viel hineininterpretieren. Gib ihr einfach den Honig.«
Ich blieb am Ende des Parkplatzes stehen, wo wir uns trennen und in verschiedene Richtungen gehen würden. Bevor sich das Einkommen meiner Eltern halbiert hat, sind Millie und ich immer in dieselbe Richtung gegangen: in die Shrewsbury Avenue, in der es Haushälterinnen und Gärtner und gigantische Swimmingpools gibt und in der tatsächlich Kristallkronleuchter in ausladenden Dielen hängen. Nun war mein Nachhauseweg viel länger als früher.
»Millie mag Honig ja noch nicht mal«, zischte ich. »Und sie hat keinerlei Respekt vor Bienen. Letzte Woche hab ich gesehen, wie sie dreimal auf eine draufgetrampelt ist, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich tot ist.«
»Es ist nicht meine Schuld, dass dieses Land von widerwärtigen Insekten überrollt wird.«
»Was erwartest du denn? Es ist Mitte Juli!«
»Es ist eine Schande.«
»Und du hattest dieses Parfum aufgelegt, Flowerbomb.«
»Sie hat sich unangemessen verhalten.«
»Also hast du sie umgebracht.«
Millies Hand schoss nach vorne. »Gib mir einfach den verdammten Honig, Gracewell. Ich brauche ihn als Bestechungsmittel, damit sie meinen Hausarrest aufheben.«
Ich hob die Augenbrauen. Wir hatten gerade gemeinsam eine Acht-Stunden-Schicht hinter uns gebracht und sie hatte diese Sache mit keinem Wort erwähnt. »Hausarrest?«
»Total ungerecht. Ein einziges großes Missverständnis.«
»Ich bin ganz Ohr …«
»Alex hat mich Spangengesicht genannt.« Millie machte eine dramatische Pause. »Ist das zu glauben?«
Nun, sie trug tatsächlich eine Zahnspange. Und technisch gesehen befand sie sich in ihrem Gesicht. Aber das sagte ich ihr natürlich nicht. Stattdessen tat ich, was jede beste Freundin getan hätte: Ich setzte einen Ausdruck blanker Wut auf und tat, als könnte ich nicht fassen, was für ein ungehobelter Tyrann ihr nicht besonders reifer, aber definitiv sehr attraktiver Bruder war.
»Er ist so ein Arsch«, bot ich an.
»Er ist zweifelsfrei der schlimmste Mensch auf diesem Planeten. Wie auch immer, eins führte zum anderen, und sein iPhone ist aus dem Fenster gefallen … na ja, eigentlich ist es mir eher aus der Hand gefallen … die zu diesem Zeitpunkt zufällig aus seinem Zimmerfenster hing … Er ist total durchgedreht.«
»Hach, Geschwisterliebe …«
»Ja, du kannst von Glück sagen, dass du dein Zuhause nicht mit dem König aller Vollidioten teilen musst«, wütete sie weiter. »Welcher Neunzehnjährige verpetzt bitte seine kleine Schwester? Ich meine, wo bleibt denn da sein Ehrgefühl? Er ist eine absolute Schande für den Namen Parker. Und woher hätte ich auch wissen sollen, dass sein Telefon kaputtgeht?«
»Eigenartig.« Den Honig noch immer in der Hand, lehnte ich mich an die nächste Straßenlaterne und beobachtete, wie sich mein Schatten in ihrem Lichtkegel verformte. »Ich hätte schwören können, dass die neuen iPhones einen eingebauten Fallschirm haben.«
Millie fing an, in der Luft herumzufuchteln, als könne sie so das Problem vertreiben, weil es vor ihrer Nase schwebte. »Wenn ich meiner Mom als kleine Aufmerksamkeit dieses Glas mit Honig schenke, den sie für eines ihrer Backrezepte verwenden kann, dann wird sie mich als die liebevolle, fürsorgliche Tochter betrachten, die ich ja auch bin, und diesen unfairen Hausarrest wieder zurücknehmen, den sie ungerechtfertigterweise und nur wegen meines ignoranten Bruders verhängt hat, diesem Schwein.«
Ich richtete mich auf. »Das wird nie und nimmer funktionieren. Ich behalte den Honig.«
»Von mir aus«, sagte sie und warf gekonnt ihr glattes braunes Haar zurück. »Der ist wahrscheinlich sowieso vergiftet.«
Sie streckte mir die Zunge raus, rauschte in die Dunkelheit davon und ließ mich mit meiner hart erkämpften Beute allein zurück. Ich ließ das Glas in meine Tasche gleiten und sah zu, wie sich die schwarze Schleife von mir entfernte.
Ich überquerte die Straße, blieb dann jedoch stehen und versuchte, mich zu entscheiden, welche Richtung ich von hier aus einschlagen sollte. Nach sechs Schichten in Folge pochten meine Fußballen wie verrückt, und da Millie und ich so lange getrödelt hatten, war es bereits später, als es hätte sein sollen. Normalerweise zog ich den längeren Weg nach Hause vor – er war gut beleuchtet und frequentiert –, aber die Abkürzung war entschieden schneller. Sie umging das Stadtzentrum und schlängelte sich stattdessen den Hügel hinauf, bevor sie schließlich um das Spukhaus am Ende der Lockwood Avenue führte.
2
Der Junge mit den unheimlichen Augen
Der Vollmond stand hoch am Himmel, aber der Abend wirkte trotzdem dunkler als gewöhnlich. Nachdem mich fünfzehn Minuten lang nur das Geräusch meiner Schritte begleitet hatte, ragten vor mir nun die Türmchen des alten Priestly-Hauses in die Höhe. Sie schienen wie Wachtürme über ihre Nachbarhäuser zu blicken.
So schön sie auch sein mochte, die Villa hatte mich schon immer an ein Puppenhaus für Kinder erinnert und war ziemlich verfallen. Ihre weiß getünchte Holzfassade wölbte sich an mehreren Stellen seltsam nach innen, während die Ecken wie Messerklingen hervorstachen und sich durch den dichten Efeu bohrten, der das Gebäude überwucherte. Eine von Blättern bedeckte Steinmauer schlängelte sich rund um das Haus – es war das einzige in ganz Cedar Hill, das sich einer solchen Privatsphäre erfreute, auch wenn sich potenzielle Eindringlinge eher durch seine gotische Aura abschrecken ließen als durch diese Begrenzung.
Alle, die das Haus kannten, sprachen mit ebenso großer Furcht wie Faszination darüber und dachten sich oft ihre eigenen Geschichten dazu aus. Als ich sieben Jahre alt war, hat meine Mutter mir von einer wunderschönen Prinzessin erzählt, die all ihre Tage hoch oben in den Türmen des alten Hauses verbrachte, wo sie sich vor der arrangierten Hochzeit mit einem jämmerlichen, langweiligen Prinzen versteckte. Als ich zehn war, hatten die Kinder in der Umgebung beschlossen, es sei das Haus einer hinterlistigen alten Hexe, die die riesigen Zimmer mit Katzen und Fröschen, Kupferkesseln und Besen füllte und mitten in der Nacht in den Himmel hinausflog, um die Nachbarschaft nach umherstreunenden Kindern abzusuchen, die längst tief schlafend in ihren Betten hätten liegen sollen. Als ich Millie kennenlernte, hat sie mir von Vampiren erzählt, die direkt hinter den rissigen Fensterscheiben standen und mit glänzenden, dunkelroten Augen in die Nacht hinausblickten.
Dann, mit vierzehn, als ich an einem Schulprojekt über die Geschichte von Cedar Hill arbeitete, stieß ich auf die grausige Wahrheit über die Villa. Es gab dort weder Hexen noch Prinzessinnen oder Vampire – nur die Geschichte einer jungen Frau namens Violet Priestly, die im Zweiten Weltkrieg als Krankenschwester an der Front gearbeitet hatte und durch diese einschneidenden Erlebnisse nach Kriegsende ein völlig anderer Mensch geworden war. Traumatische Erinnerungen suchten sie heim wie böse Geister, bis ihre Halluzinationen schließlich so drastisch wurden, dass sie sich nicht länger ignorieren ließen. Kurz nachdem sie ihren Mann und ihren kleinen Sohn vergiftet hatte, erhängte sie sich in der Eingangshalle des alten Herrenhauses.
Natürlich fand es danach keinen Käufer mehr.
Nichts konnte die Finsternis vertreiben, die das Priestly-Anwesen umgab. Selbst in der Hitze der heißesten Sommertage, wenn Luftspiegelungen auf den Straßen flirrten, war die Villa von einer unleugbaren eisigen Kälte umhüllt. Und so überdauerte sie die Jahrzehnte wie ein Mahnmal aus einer anderen Zeit und von einem anderen Ort: resolut, leer und vollkommen uneinnehmbar.
Jedenfalls bis heute Nacht.
Während ich mich der Villa näherte, Wärme in meine mit einem Mal eiskalten Arme rubbelte und beinahe bereute, dass ich mich für diesen Nachhauseweg entschieden hatte, bemerkte ich erstaunt, dass sich das Haus vollkommen verändert hatte, seit ich das letzte Mal daran vorbeigegangen war. Endlich hatte es doch jemand getan – es wirklich getan. Die verlassene Priestly-Villa war ins einundzwanzigste Jahrhundert gezerrt und wieder zum Leben erweckt worden.
Ich blieb stehen.
Die Flügel des verrosteten Eisentors standen weit offen und drückten sich gegen die Hecken, die sich nun nicht mehr schlaff über die Gartenmauer ergossen. Die Trauerweiden waren so weit zurückgestutzt worden, dass sie beinahe unnatürlich gepflegt wirkten und Fenster im ersten Stock enthüllten, von denen ich gar nicht gewusst hatte, dass sie existierten. Auch der Efeu war zurückgeschnitten worden, wodurch die robusten Holzbretter darunter zu erkennen waren, während die frisch in Rot gestrichene Haustür von zwei tropfenförmigen Laternen flankiert und erleuchtet wurde.
Im Lichtschein der Laternen parkten außerdem zwei schwarze Geländewagen Seite an Seite auf dem frisch gestreuten Kies.
Mein Telefon vibrierte an meiner Hüfte – eine SMS von Millie, die mir mitteilte, dass sie sicher zu Hause angekommen war und mich gleichzeitig unbeabsichtigt daran erinnerte, dass ich das von mir noch nicht behaupten konnte. Zögernd setzte ich mich wieder in Bewegung, aber irgendetwas im Inneren des Hauses ließ mich erneut innehalten. Die Priestly-Villa, das erfrorene Herz von Cedar Hill, schlug wieder, und auch wenn es schon spät war – ich wollte verdammt sein, wenn ich nicht mehr darüber herausfand.
Dann spürte ich plötzlich etwas. Ich ließ den Blick an den Bäumen hinaufwandern und erkannte eine flackernde Gestalt in einem der oberen Fenster. Es war ein Junge. Ich konnte mir zwar nicht sicher sein, was sein Alter betraf, aber selbst auf diese Entfernung waren seine leuchtenden Augen nicht zu übersehen. Sie schienen viel zu groß für sein zartes Gesicht zu sein und wirkten, als würden sie mich aus einer anderen Welt anstarren. Dabei wurden sie so groß und rund, dass sie ganz unnatürlich aussahen. Er lehnte sich nach vorne und presste seine Handflächen gegen das Glas, so als wollte er die Scheibe aus dem Rahmen drücken. Winkte er mir zu? Oder wollte er mir sagen, dass ich verschwinden sollte?
Ich hob eine Hand, um zu ihm hinaufzuwinken, aber sie erstarrte auf halber Strecke, schweißbedeckt und zitterig. Dann, genauso schnell, wie er aufgetaucht war, verschwand der seltsame Junge wieder in der Dunkelheit hinter dem Fenster, bis das Haus mit seiner brandneuen Fassade wieder vollkommen still vor mir lag.
Stirnrunzelnd ließ ich den Blick von der leeren Fensterscheibe über die Einfahrt schweifen, als die Dunkelheit vor mir zum Leben erwachte. Ein schwaches Rascheln schwebte durch die Luft, und ich kniff die Augen zusammen, bis ich hinter einem der Geländewagen eine weitere Gestalt erkennen konnte. Er stand vornübergebeugt und schien im Inneren des Autos nach etwas zu suchen.
Ich versuchte, gegen den Drang anzukämpfen, noch weiter nachzuforschen, aber meine Handflächen kribbelten richtig an meinen Seiten, als meine Neugier die Oberhand gewann und mich förmlich in Richtung des Hauses schob. Ich machte einen vorsichtigen Schritt vom Gehweg herunter und schlüpfte durch das offene Tor. Das Rascheln verstummte. Eine Autotür knallte zu, und ich hörte, wie der lose Kies in der Dunkelheit knirschte. Als sich die Gestalt aufrichtete, tauchte der Kopf des Mannes hinter dem Fahrzeug auf. Er bewegte sich über den Kies, bis er zwischen dem Haus und dem Tor stand und beobachtete, wie ich ihn beobachtete.
Selbst unter den Laternen konnte ich nur seine Umrisse ausmachen: ein großer Schatten mit breiten Schultern und sicheren Bewegungen. Er hielt inne, senkte die Arme und ließ mit absichtlicher Langsamkeit einen Seesack in Richtung Boden sinken, bis er neben seinen Füßen liegen blieb. Dann machte er einen Schritt zur Seite und trat mit voller Kraft mit seinem Stiefel dagegen, und der Sack entwischte meinen neugierigen Blicken und landete hinter dem am nächsten stehenden Geländewagen. Aber was auch immer sich in dem Sack befand, ich hatte ihn bereits gesehen, und das wussten wir beide.
Der Mann neigte den Kopf zur Seite und kam näher, einen entschlossenen Schritt nach dem anderen. Die Distanz zwischen uns wurde immer geringer. Mit jedem seiner Schritte schlug mein Herz noch heftiger in meiner Brust. Meine Neugier löste sich in Luft auf, und die krasse Realität holte mich ein: Ich hatte das Gelände unbefugt betreten und war dabei erwischt worden, und jetzt kam diese schattenhafte Gestalt mit großen Schritten auf mich zu.
Ich drehte mich um und stolperte wieder auf die verlassene Straße hinaus. Als das Geräusch der schweren Schritte die Stille hinter mir zerriss, rannte ich los. Die Katze, die mit einem schrillen Miauen vor mich sprang, erwischte mich auf dem völlig falschen Fuß. Als ich gerade schlitternd zum Stehen kam und wie wild mit den Armen fuchtelte, knallte der Typ gegen meinen Rücken. Mitten im Schrei verstummte ich, weil mir der Aufprall den Atem aus den Lungen quetschte und ich durch die Luft flog. Ich ließ meine Tasche fallen und landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Gehweg, meine Hände und Knie schürften über den Asphalt. Schwindel überkam mich und mein Abendessen schwappte munter in meinem Magen hin und her.
Bevor ich begriff, was da eigentlich gerade passiert war, oder ich mir ausmalen konnte, wie genau ich wohl umgebracht werden würde, wurde ich aus meinen Schmerzen und vom Asphalt auf die Beine gerissen. Ich stand wieder genau an derselben Stelle wie vor wenigen Sekunden, so als hätte jemand auf ZURÜCKSPULEN gedrückt.
Nur dass diesmal etwas anders war: Diesmal spürte ich starke Hände um meine Taille. Sie hielten mich aufrecht, während ich vor- und zurückschwankte und versuchte, das Gleichgewicht wiederzufinden.
»Stai tranquillo, sei al sicuro.« Die Worte waren so fremd und unerwartet, dass ich dachte, ich hätte sie mir nur eingebildet.
Ich senkte den Blick auf die Hände, die mich umfassten, und im nächsten Augenblick sah ich mir selbst von oben zu, wie ich mich in die Arme eines völlig Fremden sinken ließ, auf einer verlassenen Straße, mitten in der Nacht und direkt vor dem berüchtigtsten Haus in ganz Cedar Hill.
Eines Fremden, der mich gerade dabei erwischt hatte, wie ich unbefugt auf sein Grundstück eingedrungen war, und der mich anschließend zu Boden geworfen hatte.
Ich hatte genügend Liebesfilme gesehen, um einen romantischen Moment zum Dahinschmelzen zu erkennen – aber ich kannte auch jede Menge Folgen CSI. Erschrocken stieß ich die fremden Hände von meinem Körper und machte einen Satz nach vorne. Ich beugte mich nach unten, schnappte mir meine Tasche vom Boden und erhaschte einen Blick auf die dicke Silberschnalle an seinem Lederstiefel, bevor ich mich wieder aufrichtete und die Tasche hastig über die Schulter warf. Ich schaute zu ihm hinauf und wünschte, ich hätte irgendetwas in meiner Tasche, das sich als Waffe verwenden ließ … nur für den Fall. Aber er stand vollkommen still da, während in der Dunkelheit Schatten über sein Gesicht tanzten. Er unternahm keinen weiteren Versuch, mich anzugreifen, und ich würde auch ganz sicher nicht hier stehen bleiben und abwarten, ob er sich nicht doch noch dazu entschloss.
»Komm mir nicht hinterher.« Meine Stimme klang kräftiger, als ich mich fühlte. Ich drehte mich um und rannte los.
Ich hörte, wie er mir nachrief, aber ich war schon zu weit weg.
Ich drehte mich nicht noch mal um, aber ich war mir sicher, dass ich die Augen des Schattens – seine Augen – im Nacken spüren konnte, während ich rannte. Das Geräusch seines Lachens verfolgte mich durch die Dunkelheit.
❊ ❊ ❊
Ich kam in Rekordzeit zu Hause an. In der Küche stellte ich zuerst den Honigtopf auf dem Fensterbrett ab, bevor ich nach oben trottete, ein wenig Salbe auf mein brennendes Knie schmierte und ins Bett kroch. Nachdem ich gefühlt mehrere Stunden lang mit aufgerissenen Augen an die Decke gestarrt und dem drängenden Trommeln in meiner Brust gelauscht hatte, fiel ich in einen unruhigen Schlaf voller Träume von Jungen in Fenstern, die sich schließlich in Albträume über schattenhafte Gestalten und Honigtöpfe mit schwarzen Schleifen verwandelten.
3
Das Klatschmaul
Es gab wirklich nicht viel, was mich so richtig nervte. Eine dieser seltenen Ärgernis-Quellen hatte es allerdings mal wieder geschafft, in mein Haus einzufallen und diesen sonnigen Morgen bereits zu ruinieren, bevor er richtig begonnen hatte.
»… und das ist kein gutes Omen, Celine. Ich habe einen sechsten Sinn für solche Dinge …«
Rita Baileys Stimme, schriller als eine Polizeisirene, drang trotz der Tatsache, dass sie sich eine Etage unter mir befand, mühelos bis in mein Zimmer. Ich blickte finster an die Decke hinauf. Ich wollte nichts über Lana Greens Affäre hören. Oder über Jenny Orins immer schlimmer werdende Schuppenflechte. Oder über den Läuseskandal der Tyler-Kinder. Die schiere Lautstärke des Organs dieser alten Dame ließ mir jedoch keine andere Wahl. Irgendwann musste ich schließlich sowieso da durch, und angesichts des deprimierenden Durcheinanders in meinem Zimmer, gepaart mit dem Wunsch, in Ruhe zu frühstücken, beschloss ich daher, mich ihr sofort zu stellen und den unangenehmsten Teil meines Tages hinter mich zu bringen.
Ich rollte aus dem Bett, krabbelte wühlend durch zerknitterte Jeans und auf links gedrehte T-Shirts und angelte schließlich einen halb vergrabenen BH heraus. Ich sprang auf die Füße und drehte mich um, ohne dabei etwas berühren zu dürfen – manchmal verwandelte ich das Ganze gern in ein Spiel –, schnappte mir eine Jeansshorts vom Boden und zog sie an, bevor ich mich für ein weißes Tanktop und mein Lieblingspaar Converse entschied. Nachdem ich etwas Feuchtigkeitscreme aufgetragen und mein Haar zu einem fransigen Zopf geflochten hatte, trottete ich nach unten und wappnete mich gegen das Unausweichliche, in das ich mich gleich stürzen würde. Noch dazu ohne Kaffee und völlig übermüdet.
Rita Bailey, eine alte, beleibte Dame mit kurzem weißen Haar und verhärmtem, eingefallenem Gesicht saß in einem schreiend pinkfarbenen Hosenanzug über den Küchentisch gebeugt und nippte an ihrem Kaffee. Neben ihr ertrug meine Mutter höflich ihre Gesellschaft und rang sich in den passenden Momenten zu einem angestrengten Lächeln oder roboterhaften Kopfnicken durch. Sie hatte sogar einen Teil des Tischs frei geräumt, der für gewöhnlich unter verstreuten Nähutensilien und Stapeln von Stoffproben begraben lag. Die waren nun auf nur einen halben Quadratmeter Fläche beschränkt, lehnten in bedenklicher Schieflage an der Wand und drohten, jeden Moment auf sie zu kippen.
Als wir noch in dem großzügigen Haus mit vier Zimmern in der Shrewsbury Avenue wohnten, konnte meine Mutter zwei komplette Zimmer für die Unmengen von Stoffen und anderen Materialien beanspruchen, die sie für das Schneidern ihrer Kleider benötigte, aber hier schienen ihre unfertigen Werke ständig von einem Zimmer ins nächste zu schwappen und uns in allen erdenklichen Farbtönen und Mustern durch das vollgepackte Haus zu folgen. Meterweise elfenbeinfarbene und Chantilly-Spitze ergossen sich über Sessel und kämpften unter Schaufensterpuppen in kurzen Sommerkleidchen und üppigen Abendkleidern um ihren Platz. Seit wir vor eineinhalb Jahren hierhergezogen waren, hatten die gelegentlichen Male, bei denen ich schreiend aufgewacht war, weil in der Ecke meines Zimmers plötzlich eine halb fertige Schaufenster-Braut stand oder ein Jeanskleid hing, das niemals das Licht der Welt erblicken sollte, durchaus ihre Spuren bei mir hinterlassen.
Es war nicht so, dass meine Mutter kein System gehabt hätte. Vielmehr durchschaute es niemand außer ihr. Sie war wahrscheinlich die organisierteste unorganisierte Schneiderin in ganz Chicago, und ich glaube, das gefiel ihr auch. Mrs. Bailey, die mit zusammengekniffenen Augen auf den schwankenden Stoffstapel auf der anderen Seite des Tischs blickte, gefiel es jedoch offensichtlich ganz und gar nicht.
Ich rauschte in die Küche und zog ihre Aufmerksamkeit auf mich, bevor sich ihr Lächeln so sehr anspannte, dass ihr Gesicht fast explodierte. »Guten Morgen, Mrs. Bailey.« Das war doch gar nicht so schwer.
Sie richtete ihren starren Blick auf mich. »Guten Morgen, Persephone.«
Ich zuckte zusammen. Es war schon eine ganze Weile her, seit ich meinen Namen in all seiner Scheußlichkeit gehört hatte, und, wenig überraschend, hatte sich nichts daran geändert – er war immer noch das Letzte. Die Art, wie die alte Dame ihn aussprach, schien ihn allerdings nur noch schlimmer zu machen. Sie dehnte die Vokale in die Länge, so als spreche sie mit einem fünfjährigen Kind: Pör-seff-on-iiiii.
»Ich ziehe Sophie vor«, erwiderte ich mit einer gewissen Verbitterung, die dieses Thema für gewöhnlich mit sich brachte.
»Aber Persephone ist doch viel schöner.«
»Na ja, so nennt mich aber niemand.«
Das war nicht mein Name und das wusste sie auch. Er war nur ein Symbol für die flüchtige Obsession meiner Mutter für griechische Mythologie, die unglücklicherweise mit dem Zeitpunkt meiner Geburt zusammengefallen war. Zum Glück hatte mein Vater schon in meinem ersten Lebensjahr vor diesem Zungenbrecher kapituliert. Es hatte nicht lange gedauert, bis ihm »Sophie« als angemessene Alternative eingefallen war – der Name, den er mir, wie ich vermutete, von Anfang an hatte geben wollen und für den ich ihm aus zwei Gründen bis in alle Ewigkeit dankbar sein würde: Zum einen, weil ich so nicht mit diesem Relikt von einem Namen durchs Leben gehen musste, das praktisch niemand richtig schreiben konnte. Und zum anderen, weil er mir stattdessen nicht den Spitznamen »Persy« verpasst hatte. Als meine Mutter ihre Niederlage eingestand, wurde ich endgültig zu »Sophie«. Schlicht, einfach und leicht auszusprechen.
»Woher wissen Sie überhaupt, dass ich eigentlich so heiße?«, fügte ich hinzu, als ich kurz darüber nachgedacht hatte. All die Male, in denen Mrs. Bailey mich nun schon absichtlich mit meinem falschen Namen angesprochen hatte, war ich nie auf den Gedanken gekommen, sie zu fragen, wie sie eines meiner bestgehüteten Geheimnisse entdeckt hatte. Andererseits war sie auch die Erste gewesen, die unser neues Haus gefunden hatte, nachdem wir umgezogen waren – und das obwohl wir alles darangesetzt hatten, es vor ihr zu verstecken, und obschon es beinahe eine Stunde Fußweg von der Shrewsbury Avenue entfernt lag. Vielleicht war sie ja doch hellsichtig.
»Ich hab ihn mal in einem Brief gesehen.«
»Wo?«
»Ich kann mich nicht mehr erinnern.« Sie klang, als fühle sie sich durch meine Frage beleidigt. »Vielleicht war er aus eurem Briefkasten gefallen.«
»Mmhmm.« Schnüfflerin, notierte ich im Geiste.
Neben mir fuhr meine Mutter mit einem Finger über den Rand ihrer Tasse. »Sophie«, rügte sie mich sanft, »warum sprechen wir nicht über was anderes?«
»Warum? Versuchst du immer noch, nicht offen zugeben zu müssen, dass du mir den scheußlichsten und peinlichsten Namen verpasst hast, der dir eingefallen ist?« Obwohl meine Stimme fröhlich klang, scherzte ich nur teilweise. Nicht dass meine Mutter das gestört hätte – sie fand meine Entrüstung über meinen Namen unerklärlicherweise höchst amüsant. Ich schätze, das war nun mal der Lauf der Dinge. Sie hatte mit diesem Scherz angefangen, und nun verfolgte er mich dank gewisser Leute wie Mrs. Bailey und Onkel Jack, der ihn wie eine Waffe einsetzte, wenn er sauer auf mich war, weil ich im Diner spontan ein Nickerchen machte.
»Ich finde, der Name Sophie ist genauso hübsch. Er passt zu dir«, lenkte meine Mutter ein und grinste in ihre Tasse, bis ich nur noch die Spitzen ihrer sanft geschwungenen Augenbrauen sehen konnte.
Ich spürte ein winziges, neidvolles Stechen, weil sie so symmetrisch waren. Alles an ihr war zart und feingliedrig, wie bei einer Elfe. Durch das Wunder der Genetik hatte sie zwar nur ihr sonnenblondes Haar und ihr herzförmiges Gesicht an mich weitergegeben, aber durch die wundersame Kunst der Mimikry hatte ich mir auch ihre Tendenz zu extremer Unordnung und ihre Unfähigkeit, etwas Anständiges zu kochen, angeeignet. Bis auf Weiteres hielt ich mich mit einem Urteil über meine geringe Körpergröße jedoch zurück, da ich nach wie vor hoffte, vor meinem siebzehnten Geburtstag, der mit großen Schritten näher rückte, wie durch ein Wunder doch noch acht Zentimeter zu wachsen.
Beim Wort »Sophie« stieß Mrs. Bailey einen lang gezogenen, rauen Laut der Missbilligung aus. Es klang, als würde sie ersticken – und für einen flüchtigen Moment hoffte ein kleiner, unmoralischer Teil von mir, dass sie es auch wirklich tat.
Als ich den Raum zur Küchentheke durchquerte, um mir eine Tasse Kaffee einzuschenken, fiel mein Blick auf das Honigglas auf dem Fensterbrett. Sonnenstrahlen zwinkerten mir durch das Glas zu, als wollten sie mir »guten Morgen!« wünschen. Es wäre eine Schande, ihn nicht zu probieren, entschied ich. Ich schnappte mir einen Löffel, hebelte den Deckel vom Glas, legte das ausgefranste Stück Stoff beiseite, mit dem er bedeckt war, und passte auf, dass ich das schwarze Samtband nicht beschädigte.
Hinter mir ging Mrs. Bailey ihrem Lieblingshobby nach – der Kunst des Nörgelns. »Aber Persephone ist viel eleganter. Jetzt mag der Name vielleicht nicht zu ihr passen, aber sie könnte doch versuchen, hineinzuwachsen.«
»Danke, aber ich glaube, ich bleibe lieber bei Sophie und lebe weiter in der modernen Welt.« Ich tauchte meinen Löffel in das Honigglas und drehte ihn herum.
»Du siehst heute Morgen so müde aus, Sophie«, informierte Mrs. Bailey meinen Hinterkopf und betonte meinen Namen dabei so gezwungen, als sei er furchtbar schwierig auszusprechen.
Ich ignorierte ihren Spott ebenso wie die zivilisiertere Alternative, den Honig auf Müsli oder eine Scheibe Toast zu träufeln, und steckte mir den Löffel stattdessen direkt in den Mund.
»Sie wird wieder hellwach und gesprächig sein, sobald sie ihre Koffeindosis intus hat«, erklärte meine Mutter hinter meinen Schultern.
Die Anspannung in ihrer normalerweise sehr ruhigen Stimme verriet mir, dass sich ihre Geduld allmählich dem Ende zuneigte. Selbst nach allem, was mein Vater getan hatte, war es meiner Mutter gelungen, ihre beinahe unmenschliche Freundlichkeit zu bewahren – was wiederum bedeutete, dass sie immer noch zu höflich war, um eine einsame, nervtötende Dame in den Sechzigern wegzuschicken, obwohl sich fast alles, was sie von sich gab, auf Missbilligungen und zweifelhafte Komplimente beschränkte.
»Bist du sicher, Celine? Sie kommt mir völlig erschöpft vor. Sie wirkt nur noch wie der Schatten eines normalen sechzehnjährigen Mädchens. Sie sollte raus in die Sonne und sich ein bisschen bräunen lassen. Sie war immer so ein hübsches kleines Ding.«
Im Ernst?, hätte ich am liebsten mit derselben Gehässigkeit erwidert, aber der Honig klebte mir die Zähne zusammen.
Meine Mutter stieß ein leises Seufzen aus – eine ihrer Spezialitäten. Es war so mehrdeutig, dass jeder alles daraus lesen konnte – »ich bin müde/glücklich/enttäuscht« –, aber in diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass es vor allem dieses Gesprächsthema beenden sollte.
Ich widerstand dem Drang, mir meinen Kaffee zu schnappen und zu fliehen. Stattdessen drehte ich mich um, setzte mich an den Küchentisch, zog die Stuhlbeine so geräuschvoll ich konnte über den Boden und weidete mich genüsslich an dem Ausdruck des Unbehagens in Mrs. Baileys Gesicht.
Okay, meine Liebe, dann wollen wir mal. »Ich hoffe, ich habe euch nicht bei irgendwas Wichtigem gestört.« Die mühevollen, mit Honig verklebten Worte verhüllten den Sarkasmus in meiner Stimme. Ich trank den ersten herrlichen Schluck von meinem Kaffee und spürte, wie der Dampf aufstieg und meine Nase wärmte.
»Na ja, um ehrlich zu sein, hast du das.«
Welche Überraschung. Ich schien es immer wieder zu schaffen, Mrs. Bailey bei der Verkündung ihrer skandalträchtigen Neuigkeiten zu stören.
»Ich habe deiner Mutter nur gerade erzählt, dass erst kürzlich eine Familie in das Priestly-Haus in der Lockwood Avenue eingezogen ist.«
Dass mich tatsächlich etwas interessierte, das Mrs. Bailey zu sagen hatte, erschreckte mich unsagbar. Aber ja – jetzt klebte ich förmlich an den Lippen des größten Klatschmauls in ganz Cedar Hill, so als würde sie jeden Moment die finale Wendung meiner Lieblingsserie verkünden. Ein ganzes Bataillon Fragen formierte sich in meinem Kopf. Woher kommen sie? Wie sind sie mit den Priestlys verwandt? Warum tragen Sie diesen irrsinnigen pinkfarbenen Hosenanzug?
»Na, ich bin mir sicher, es ist ganz gut, ein paar neue Gesichter in der Nachbarschaft zu haben«, warf meine Mutter ein, bevor ich überhaupt loslegen konnte.
Die alte Dame schüttelte so heftig den Kopf, dass es aussah, als hätte sie einen Anfall. Sie lehnte sich über den Tisch und sah uns eine nach der anderen eindringlich an, so als wollte sie sichergehen, dass sie unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit hatte, obwohl sie sehr gut wusste, dass dies bereits der Fall war. Sie senkte die Stimme. »Du weißt ja, dass ich eine hellseherische Gabe habe, Celine. Ich habe schon Dinge gesehen, als ich noch ein Kind war …«
Ich musste in meinen Kaffee pusten, um mein hämisches Grinsen zu verbergen.
»Vor ein paar Wochen bin ich an dem alten Priestly-Anwesen vorbeigekommen und hatte ein wirklich beunruhigendes Gefühl. Als ich dann die Renovierungsarbeiten und die Umzugswagen gesehen habe, ergab plötzlich alles einen Sinn. Das Haus ist wieder bewohnt, und ich weiß einfach, dass das nichts Gutes bedeutet.«
»Vielleicht sollten wir keine voreiligen Schlüsse ziehen«, entgegnete meine Mutter. An der Leichtigkeit in ihrer Stimme erkannte ich, dass ihre Aufmerksamkeit allmählich schwand. Sie zupfte an einem losen Faden ihrer Caprihose herum und runzelte die Stirn.
Ich spielte mit dem Gedanken, Mrs. Bailey ebenfalls zu sagen, sie solle sich ein bisschen entspannen, aber ihr Blick war bereits in Richtung unseres Gartens hinter dem Haus gewandert, so als blicke sie in eine andere, verborgene Dimension. Tatsächlich starrte sie jedoch nur auf die Topfpflanze, die auf unserem Fensterbrett stand. Sie kniff die Augen zusammen und seufzte, vermutlich, weil sie bemerkt hatte, dass die Pflanze tot war.
»Es kann nichts Gutes dabei herauskommen, wenn fünf junge Männer in der Nachbarschaft Unruhe stiften, denn genau das werden sie tun, Celine. Denk an meine Worte.«
Sie schüttelte erneut den Kopf, aber jede der kurz geschnittenen Strähnen ihres weißen Haars blieb völlig regungslos, so als seien sie erstarrt.
»Moment mal, haben Sie gerade gesagt fünf Männer?« Zwei von ihnen hatte ich bereits gesehen. Na ja, oder vielmehr einen von ihnen, irgendwie. Der zweite hatte mich umgeworfen. Bei der Erinnerung daran legte ich die Stirn in Falten. Auch nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen hatte, wusste ich nicht, was ich von der ganzen Sache halten sollte.
Mrs. Bailey war natürlich vollkommen empört über mein Interesse. Ihr Mund klappte immer wieder auf und zu, so als versuchte sie, exakt die richtigen Worte zu finden, um zu beschreiben, was für eine Schande ich war. »Fünf junge Männer, die nur Ärger machen werden«, seufzte sie schließlich und drückte in einer theatralischen Geste eine Hand auf ihre Brust, um die Dramatik noch zu unterstreichen. »Ich habe gesehen, wie sie eingezogen sind, und ich kann euch sagen, dass sie ganz und gar nicht nach ehrenwerten Leuten aussahen.«
Haben Sie das nicht auch über meinen Vater gesagt?, hätte ich am liebsten gefragt, hielt mich jedoch zurück. Es war die Sache nicht wert, sich deswegen zu streiten. Das war es nie. Und außerdem hatte ich längst alle Informationen, die ich brauchte: Es gab eine neue Familie mit lauter Jungs in der Nachbarschaft. Millie würde vor Begeisterung umkippen, wenn ich ihr das erzählte.
Gedankenverloren stand ich auf, um meine noch immer halb volle Tasse ins Spülbecken zu stellen. »Ich finde es ziemlich cool, dass wir jetzt neue Nachbarn haben.«
»Was ist daran denn cool?« Mrs. Bailey warf mir die Frage wie einen Dolch in den Rücken.
Ich drehte mich um. »Was ist daran nicht cool? Niemand kommt jemals freiwillig nach Cedar Hill. Diese Stadt ist so langweilig, dass man das Gefühl hat, wir würden alle jeden Moment zu Fossilien erstarren.« Vielleicht sind das einige von uns ja auch längst … Wieder biss ich mir auf die Zunge.
»Kein Grund, gleich so dramatisch zu werden«, gab sie zurück.
Ich blinzelte heftig, um nicht unfreiwillig mit den Augen zu rollen.
»Ich bin mir sicher, dass diese Jungs völlig in Ordnung sind«, warf meine Mutter ein, während sie in ihrem Nähkästchen wühlte. Ich konnte sehen, dass sie viel mehr daran interessiert war, eine Nadel zu finden, um den losen Faden in ihrer Hose wieder zu vernähen, der sie im Stich gelassen hatte.
Von der Anstrengung, ihr Lächeln aufrechterhalten zu müssen, begann Mrs. Baileys Gesicht allmählich zu zucken. »Nein, Celine, irgendwas stimmt da nicht. Dieses Haus stand so lange Zeit leer. Und wir kennen alle den Grund dafür.«
»Geister«, flüsterte ich dramatisch. Ich hätte am liebsten ein »Oooooo« hinzugefügt, kam jedoch zu dem Schluss, dass das doch etwas zu weit führen würde.
Mrs. Bailey erhob sich abrupt von ihrem Stuhl und warf sich in einer ungeschickten Geste der Empörung ihren Schal um den Hals. Als sie weitersprach, tat sie es mit leiser Stimme. »Du kannst so viele Witze machen, wie du willst, Persephone, aber du solltest besser vorsichtig sein.«
Ich blickte zu meiner Mutter hinüber und war überrascht, dass sie ihre Aufmerksamkeit wieder unserer Unterhaltung zugewandt hatte.
»Anrüchiges zieht Anrüchiges an«, murmelte Mrs. Bailey, ohne uns anzusehen. »Und nach allem, was dein Vater getan hat, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass …«
»Ich glaube, das reicht jetzt, Rita.« Meine Mutter stand von ihrem Stuhl auf und fixierte die alte Dame mit finsterem Blick. »Sophie kann auf sich selbst aufpassen. Sie weiß, wann sie vorsichtig sein muss.«
»Ja«, stimmte ich ihr zu, hatte aber längst das Gefühl, kilometerweit weg zu sein. Ich musste daran denken, wie ich mich vergangene Nacht selbst in Schwierigkeiten manövriert hatte. Bei der Erinnerung daran kehrte das Brennen in meinen Knien zurück.
4
Der Brief
Mrs. Baileys Worte hatten etwas in mir entfacht, an das ich mich in den letzten eineinhalb Jahren meines Lebens nur allzu sehr gewöhnt hatte: Dad-bezogene Schuldgefühle.
Zurück in der willkommenen Privatsphäre meines Zimmers, setzte ich mich im Schneidersitz auf mein wie immer ungemachtes Bett. Ich hielt den letzten aus dem Gefängnis eingetroffenen Umschlag in der einen Hand, zog mit der anderen vorsichtig den Brief heraus und tauchte wieder in das Leben meines Vaters ein, was sich, zumindest für den Moment, auf die Seiten beschränkte, die er mir alle zwei Wochen zuschickte.
Liebe Sophie,
es tut mir leid, dass ich Dir eine Weile nicht geschrieben habe. Ich warte gern, bis ich wirklich etwas zu erzählen habe, auch wenn es nicht so interessant ist wie das Leben bei euch in Cedar Hill. Ich fände es furchtbar, wenn Du denken würdest, ich sei jetzt noch langweiliger als früher, bevor ich euch verlassen habe. Um die Wahrheit zu sagen, versuche ich, das Beste aus meiner Zeit hier zu machen. Ich möchte Dir wieder etwas geben, worauf Du stolz sein kannst.
Du wirst Dich freuen zu hören, dass ich Catch-22 in nur zwei Tagen ausgelesen habe, was auch bedeutet, dass ich beim Lesen endlich schneller werde. Wenn ich wieder zurückkomme, werde ich bestimmt über das Wissen eines Englisch-Professors verfügen, und vielleicht schreibe ich ja sogar selbst ein Buch.
Ich hoffe, Du hattest bisher einen schönen Sommer. Versuche, Dir nicht allzu viele Gedanken darüber zu machen, dass Du zu wenig raus in die Sonne kommst – Du wirst zuletzt lachen, wenn all Deine Freunde vorzeitig altern, während Du immer noch die Haut eines jungen Mädchens hast.
Wie läuft’s denn so im Diner? Ich hoffe, Onkel Jack kümmert sich gut um Dich. Ich weiß, dass er wirklich sein Bestes gibt, also sei nicht so streng mit ihm. Wenn Du ihn darum bittest, bin ich mir sicher, dass er Dir eine Weile freigibt, damit Du mit Millie verschwinden kannst – ein Abenteuer erleben.
Wo wir gerade bei Deinem Onkel sind: Ich hab mir gedacht, Du solltest ihm vielleicht auch ein bisschen Lesestoff vorschlagen. Das wäre eine gute Möglichkeit für ihn, ein wenig Stress abzubauen. Vielleicht irgendwas mit bunten Bildern und großer Blockschrift? War nur Spaß. Erzähl ihm ja nicht, dass ich das gesagt hab! Trotzdem: Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn, auch wenn das vielleicht ironisch klingt, wenn man die Umstände bedenkt. Aber ich verlasse mich darauf, dass Du ihn und seinen Blutdruck im Auge behältst. Wir werden schließlich beide nicht jünger, leider.
Wie geht’s Deiner Mom? Hat sie daran gedacht, die Spülmaschine reparieren zu lassen, oder musstest Du Deinen Plan in die Tat umsetzen und die Spüle komplett mit Geschirr vollstapeln? Ich hoffe, sie hat aufgehört, so viel zu arbeiten, auch wenn ich weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Bitte sag ihr, dass ich an sie denke, falls sie Dich fragt, und ich hoffe, das tut sie. Ich habe seit einer Weile nichts mehr von ihr gehört, aber ich weiß natürlich, dass sie die ganze Sache immer noch verarbeiten muss. Es ist schwer für sie, genau wie für dich, nehme ich an.
Es ist schon so lange her, dass ich Dich gesehen habe. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Du mich besuchen kommen würdest, wenn Du mal freihast. Wie wär’s nach Deinem Geburtstag, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat? Jack fährt Dich bestimmt, wenn Du ihn fragst. Ich vermisse Deinen jugendlichen Sarkasmus, ganz egal, was Du vielleicht denkst.
Das wär’s erst mal. Ich freue mich schon auf Deinen nächsten Brief. Ich denke wie immer an Dich und zähle die Tage.
In Liebe,
Dad
Ich steckte den Brief in den Umschlag zurück und legte ihn auf den Nachttisch, dabei versuchte ich, die Melancholie aus meinem Kopf zu vertreiben. Selbst nach all den Briefen, die mein Vater mir geschickt hatte, war ich immer noch traurig, wenn ich sie las, auch wenn ich wusste, dass es noch tausendmal schmerzhafter wäre, sie nicht zu bekommen.
Mit schwerem Herzen lehnte ich meinen Schreibblock gegen meine Knie und begann mit meiner Antwort, wobei ich die negativen Seiten meines Lebens zensierte und die positiven besonders hervorhob. Selbst wenn die Welt um mich herum zusammenbrechen sollte, würde ich meinem Vater nichts davon schreiben, weil er mehr als alle anderen Menschen in meinem Leben gute Nachrichten gebrauchen konnte, ganz egal, in welcher Form sie ihn erreichten. Und ganz egal, wie wütend und frustriert ich auch war, ich würde ihm immer geben, was er brauchte, um zu überleben.
Hi Dad,
ich sitze hier, balanciere meinen Block auf zwei aufgeschürften Knien und schreibe dir mit verstauchter Hand. Falls du dich fragst, warum: Ich bin gestern Abend nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg mit dem Gesicht voraus auf den Asphalt geknallt.
Ein unheimlicher Schatten ist mir nachgejagt und hat mich zu Boden gerissen. Aber es ist alles okay, weil ich nämlich nicht zugelassen habe, dass er mich umbringt – gern geschehen –, obwohl ich mir inzwischen ziemlich sicher bin, dass das sowieso nicht seine Absicht war. Er hat mich wahrscheinlich nur wie ein Irrer verfolgt, um mich zu fragen, warum ich mitten in der Nacht ganz allein in seiner Einfahrt herumschnüffele. Teenager eben, stimmt’s?
Zum Glück habe ich überlebt und kann jetzt davon berichten, auch wenn ich nicht behaupten kann, dass das auch für meinen Stolz gilt. Trotzdem finde ich, dass sich die Geschichte ganz gut als Eröffnung für diesen Brief macht, und ich wette, sie hat dich wenigstens ein bisschen zum Lächeln gebracht.
Ich hoffe, das Ganze hatte letzten Endes auch etwas Gutes, weil ich mit schrecklichen Schmerzen und total paranoid nach Hause gerannt bin.
Es ist schön zu wissen, dass du liest. Ich finde, ein Buch zu schreiben, ist eine tolle Idee. Sie sagen ja immer, das sei eine gute Therapie.
Ich weiß allerdings nicht, wer »sie« sind oder ob das tatsächlich stimmt. Und ich hoffe sehr, dass du mit »Buch« keine Autobiografie meinst, weil ich wirklich nicht scharf darauf bin, die Geschichte deines Mordprozesses noch mal im Taschenbuchformat zu durchleben, ganz gleich, wie beruhigend sich das auf deine Psyche auswirkt. Und ich finde auch die Vorstellung nicht besonders verlockend, demnächst noch mal mit anzusehen, wie Mom eine Panikattacke durchmacht.
Ich hatte diesen Sommer noch nicht wirklich Gelegenheit, etwas anderes zu tun als zu arbeiten, aber ich gewöhne mich langsam daran.
Ich habe mich mit der Monotonie meines momentanen Lebens abgefunden.
Onkel Jack ist toll. Er versucht immer noch sein Bestes, um Deinen Platz einzunehmen, auch wenn er ein bisschen grummeliger ist als du. Vielleicht ist das ja schon die Midlife-Crisis? ;-) Er fährt ziemlich oft in die Stadt. Millie und ich haben die Theorie entwickelt, dass er da eine Frau kennengelernt hat, denn was könnte er sonst schon so oft »Geschäftliches in der Stadt« zu erledigen haben? Was glaubst du: unser Jack, ein Casanova? Hmm … Da hast du was, worüber du nachdenken kannst. Falls es wirklich so ist, dann müssen wir uns um seine Gesundheit keine Sorgen machen, glaube ich. Zumindest nicht, solange sein Herz mitmacht.
Aber so, wie ich Onkel Jack kenne, wette ich, dass es eher eine schmutzige Affäre ist als eine märchenhafte Romanze. Bisher konnte nichts auch nur annähernd die Leere füllen, die du in seinem Leben hinterlassen hast.
Danke, dass du gesagt hast, ich würde irgendwann später zuletzt lachen, wenn alle meine Freunde wie Dörrpflaumen schrumpeln, weil sie jetzt ihre ganze Freizeit in der Sonne verbringen.
Ich fühle mich geschmeichelt, dass du damit andeutest, ich hätte immer noch mehr als eine echte Freundin, und ich hoffe, dass du das auch wirklich denkst. Wenn du wüsstest, wie viele Leute sich von mir abgewandt haben, würde es dir das Herz brechen, glaube ich.
Und, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht draußen in der Sonne bin, weil ich weiß, dass mich all die Zeit, die ich drinnen verbringe, meinem Endziel näher bringt: meinem eigenen Auto. Ich weiß noch nicht, wie ich meinen 17. Geburtstag feiern will, aber wahrscheinlich wird es eher was Kleineres.
Millies Eltern fahren weg, deshalb feiern sie und Alex eine riesige Party bei sich zu Hause, zu der auch alle seine College-Freunde kommen. Ganz sicher wärst du nicht damit einverstanden, wenn du hier wärst. Aber das bist du ja nicht.
Ich glaube, Mom will mir ein Kleid für die Party nähen. Jedes Mal, wenn sie mich in einer Jogginghose sieht, sehe ich, wie das Leuchten in ihren Augen ein kleines bisschen verblasst. Wenn ich nicht bald mal was Damenhaftes trage, stirbt wahrscheinlich ein Teil von ihr. Letzten Samstagmorgen hab ich sie dabei erwischt, wie sie an mir Maß genommen hat, als ich noch geschlafen hab.
Wenn ich auch nur eine Rüsche oder einen Hauch von Glitzerkram sehe, wird das ein unschönes Ende nehmen.
Sie arbeitet mehr denn je, aber es scheint ihr wirklich Freude zu machen.
Auch die meisten ihrer Freunde haben sie im Stich gelassen, nach allem, was passiert ist. Aber auch die, die das nicht getan haben, kommen nicht mehr so oft vorbei. Ich glaube, Mom hat ihren sozialen Glanz verloren.
Ich weiß, dass das vergangene Jahr für uns alle sehr schwer war, aber sie wirkt jetzt glücklicher. Und ich bin mir sicher, dass sie dich genauso sehr vermisst wie ich.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie dich hasst, genau wie alles andere, was deine Gefängnisstrafe mit sich gebracht hat. Und manchmal ist es bei mir genauso.
Mrs. Bailey kommt jetzt wieder sonntags vorbei. Ich bin erst vorhin zu dem Schluss gekommen, dass sie wahrscheinlich die nervtötendste Person ist, die je auf diesem Planeten gelebt hat. Glaubst du, es ist möglich, dass sie von Luzifer abstammt? Nur so ein Gedanke.
Nervtötend ist noch gelinde ausgedrückt. Du hast ja keine Ahnung, was für einen Mist sie über dich verbreitet. Und Millie hat mir wahrscheinlich sowieso nur die Hälfte davon erzählt.
Sie war heute Morgen hier und hat uns von der neuen Familie erzählt, die in das alte Priestly-Haus eingezogen ist. Ich schätze, sie müssen entfernte Verwandte sein. Seltsam, was? Ich hab immer gedacht, das Haus würde bis in alle Ewigkeit leer stehen.
Es ist voller Jungs, Jungs, Jungs.
Ich komme dich in ein paar Wochen besuchen, nach meinem Geburtstag, wenn ich im Diner mal ein bisschen freihabe. Ich kann es wirklich kaum erwarten.
Ich fürchte mich davor zu sehen, wie hager und unglücklich du aussiehst. Jedes Mal, wenn ich daran denke, könnte ich in Tränen ausbrechen.
Das wäre im Moment alles. Ich vermisse dich so sehr.
So sehr, dass es manchmal sogar körperlich wehtut.
Ich denke immer an dich.
Ich wünschte, ich könnte einfach einen Schalter umlegen und es abstellen.
Und zähle die Tage.
Zähle die Jahre.
Ich hab dich lieb und drücke dich ganz fest,
Sophie
5
Die Priestly-Brüder
Ich stand vornübergebeugt, presste meine Nase gegen die Thekenplatte und wünschte mir sehnlichst, die Zeit würde schneller vergehen. Selbst in den geschäftigsten Stunden des Tages wurde das Diner zwar nicht unbedingt von Gästen überrollt, aber heute Abend war es ungewöhnlich ruhig. Nur noch eine Stunde, bis ich nach Hause gehen konnte, aber die Minuten schienen unendlich langsam zu verstreichen. Und was das Ganze noch schlimmer machte: Die Klimaanlage war kaputt, durch die erdrückende Schwüle kräuselten sich meine Haarspitzen, und der Lieferant war schon den dritten Tag in Folge nicht aufgetaucht, was wiederum bedeutete, dass uns allmählich einige Sachen auf der Speisekarte ausgingen.
Millie stand hinter mir und tippte mir ohne Unterbrechung auf die Schulter. Sie war nun mal halb Frau, halb Frage. »Wenn diese neuen Priestly-Verwandten gerade erst eingezogen sind, dann war der Schattenmann wahrscheinlich auch einer von den fünf Jungs, oder?«
»Ja«, antwortete ich gähnend. »Wahrscheinlich.«
Sie lachte, als sei es das Lustigste, was sie jemals gehört hatte. »Wie peinlich für dich.«
Ich hob den Kopf. »Lieber peinlich als tot.«
Sie grinste. »Oh, komm schon, Soph, wo bleibt dein Sinn für Abenteuer?«
Ich tat, als würde ich über ihre Frage nachdenken. »Ich glaube, der liegt ganz tief unter meinem natürlichen Überlebensinstinkt begraben.«
»Du hättest mit einem Schatten rummachen können!« Ihr Gesicht glühte förmlich.
»Oder brutal von einem ermordet werden«, konterte ich.
»Ach, du bist so eine Spaßbremse.«
»Wie klingt das?«, schlug ich vor. »Wenn ich das nächste Mal in einer prekären Lage mit einem völlig Fremden stecke, verspreche ich, dass ich versuchen werde, mit ihm rumzumachen.«
»Bah! Mach keine Versprechen, die du sowieso nicht halten wirst. Ich will meine Hoffnungen nicht zu hoch schrauben.«
Die Glocke über der Tür klingelte und drei Mädchen schlenderten ins Diner. Zwei von ihnen kannte ich aus der Schule. Erin Reyes und Jane Leder bestanden nur aus zickiger Gehässigkeit und langen Beinen und hätten sicher sofort einen Vollzeitjob angenommen, wenn man dabei nur über Leute lästern und urteilen dürfte. Ich war überrascht, sie im Gracewell’s zu sehen – es war meilenweit von den teuren Läden entfernt, in denen sie sonst so abhingen. Andererseits bot das Diner ihre Lieblingsattraktion – mich. Es mochte vielleicht schon knapp anderthalb Jahre her sein, seit mein Vater ins Gefängnis gegangen war, aber es war immer noch Erins Lieblingsthema.
Sie erhaschte meinen Blick und grinste hämisch, und ich versuchte, nicht zusammenzuzucken, als sie dem dritten Mädchen, das mich bereits mit gespannter Aufmerksamkeit betrachtete, bühnenreif zuflüsterte: »Das ist sie. Sie arbeitet tatsächlich hier. In dem Laden, in dem es passiert ist. Ist das zu fassen?«
Die beiden anderen kicherten, und ich spürte, wie meine Wangen zu glühen begannen.
»Würg«, sagte Millie, die genauso viel Geduld für professionelle Zicken hatte wie ich. »Ich mach das schon. Und wenn sie nicht aufpassen, serviere ich ihnen zur Speisekarte als Beilage meinen Schuh in ihrem …« Den Rest konnte ich nicht mehr hören, weil sie bereits um die Theke herumging, um die Bestellung der drei aufzunehmen.
Ich lächelte ihrem Hinterkopf dankbar nach. Ins Gracewell’s Diner kamen hauptsächlich Leute, die in der Stadt arbeiteten, oder Familien aus der Nachbarschaft, die schon seit Jahren zu den Stammgästen zählten. Hin und wieder schauten jedoch auch neugierige Giftschlangen aus der Schule im berühmt-berüchtigten Restaurant von Michael Gracewell vorbei, und Millie steckte diesen Schlag jedes Mal ein und bediente sie, damit ich es nicht tun musste.
Geistesabwesend band ich die herunterhängenden Bänder meiner Schürze zu einer ungleichmäßigen Schleife zusammen.
»Willst du auch mal irgendwann was arbeiten, Sophie?«
Ursula, die stellvertretende Restaurantleiterin, war aus der Küche zurückgekehrt. Sie war zwar beinahe so alt wie Mrs. Bailey, aber unendlich viel cooler: Ihr lila Haar sah absolut lässig an ihr aus, und sie konnte sich mit mir unterhalten, ohne dabei meinen Lebenswillen negativ zu beeinflussen. Sie nickte in Richtung Millie, die den drei Mädchen gerade die Speisekarten reichte.
»Oh, komm schon. Hier ist doch sonst niemand und ich kann ja schlecht die leeren Tische bedienen«, protestierte ich.
Ursulas Lachen klang heiser und verriet sofort, dass sie seit Jahren starke Raucherin war. »Ich will damit ja nur sagen, dass du heute Abend ein wenig abgelenkt wirkst.« Sie schob ihre runde Brille auf der Nase nach oben, bis sie wieder richtig saß und ihre Augen auf das Doppelte vergrößerte. »Oder sollte ich sagen, noch abgelenkter als gewöhnlich?«
»Das liegt daran, dass sie abgelenkt ist, Ursula.« Millie war zurück und zog ihre Schürze aus. Sie machte eine Stunde vor mir Feierabend und in diesem Moment nahm ich ihr das ein kleines bisschen übel. »Wir sollten es Ursula sagen.«
»Ja, sollten wir«, wiederholte Ursula, schob sich seitlich näher und lehnte sich neben mir gegen die Wand. Wir waren beide genau gleich groß und sie konnte mir ohne große Mühe und sehr eindringlich direkt in die Augen schauen.
»Aber ich habe gar keinen Klatsch und Tratsch«, schwor ich.