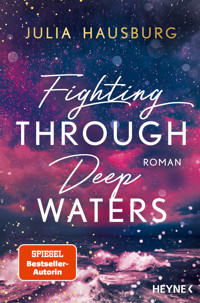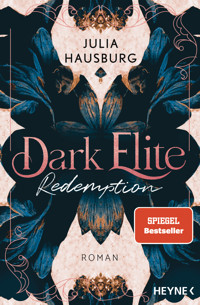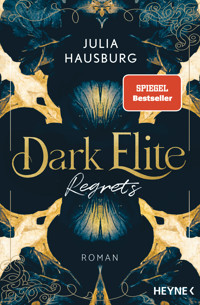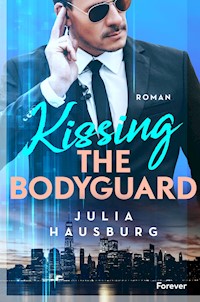12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dark-Elite-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wem kannst du vertrauen in einem Spiel ohne Regeln?
Mit farbig gestaltetem Buchschnitt – nur in der gedruckten Ausgabe
Als Elora an der Eliteuniversität Corvina Castle auf den unnahbaren Gabriel trifft, ahnt sie, dass mehr hinter seiner verschlossenen Fassade stecken muss. Die beiden stehen sich als Konkurrenten im Wettbewerb um den begehrten Platz in der einflussreichen Studentenverbindung Fortuna gegenüber. Elora kämpft für ihre Zukunft als Ärztin, Gabriel will den Tod seiner Schwester aufklären. Als sie herausfinden, dass die Verbindung in dunkle Machenschaften verstrickt ist, sind sie längst selbst zu Spielfiguren geworden. Sie müssen zusammenarbeiten und kommen sich dabei zunehmend näher. Bis Gabriel eine Entscheidung trifft, die Elora in Lebensgefahr bringt, und er lernen muss, die Vergangenheit loszulassen, wenn er Elora nicht für immer verlieren will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Als Elora an der Eliteuniversität Corvina Castle auf den unnahbaren Gabriel trifft, ahnt sie, dass mehr hinter seiner verschlossenen Fassade stecken muss. Die beiden konkurrieren miteinander um einen begehrten Platz in der einflussreichen Studentenverbindung Fortuna. Elora kämpft für ihre Zukunft als Ärztin, Gabriel will den Tod seiner Schwester aufklären. Als die beiden herausfinden, dass die Verbindung in dunkle Machenschaften verstrickt ist, sind sie längst selbst zu Spielfiguren geworden. Sie müssen zusammenarbeiten und kommen sich dabei zunehmend näher. Bis Gabriel eine Entscheidung trifft, die Elora in Lebensgefahr bringt. Er muss lernen, die Vergangenheit loszulassen, wenn er Elora nicht für immer verlieren will.
Die Autorin
Julia Hausburg wurde 1998 geboren und studierte Bildungswissenschaften, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Katzen in Südbayern, liebt warmen Sommerregen und Schreibnachmittage im Café. Wenn sie nicht gerade an ihrem nächsten Buch arbeitet, findet man sie mit einem spannenden Liebesroman in ihrer eigenen kleinen Bibliothek.
JULIA HAUSBURG
Roman
Band 1 der Dark-Elite-Reihe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Liebe Leser:innen,dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet sich auf S. 415 eine Triggerwarnung.Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.Julia Hausburg und der Heyne Verlag
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 10/2023
Copyright © 2023 dieser Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Nina Bellem
Covergestaltung: www.buerosued.de
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-30821-6V004
www.heyne.de
»Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten.«
Selma Lagerlöf
Kapitel 1
Gabriel
Ich habe mir nie Gedanken über den Tod gemacht. Wieso auch? Wenn man neunzehn Jahre alt ist, fängt das Leben gerade erst an. Wundgetanzte Füße nach langen Partynächten und Muskelkater in den Armen nach gewonnenen – oder auch mal verlorenen – Ruderregatten: Das machte bis vor Kurzem noch mein Leben aus, und ich genoss jeden Tag in vollen Zügen. Inzwischen weiß ich, wie dumm ich war. Wie naiv. Und wie fest ich meine Augen vor der Wirklichkeit verschlossen habe. Es ist vollkommen gleichgültig, wie alt ein Mensch ist. Der Tod ereilt uns alle, oft, wenn wir es am wenigsten erwarten.
Regentropfen trommeln rhythmisch auf den Sarg, der langsam in die Erde hinabgelassen wird. Mit jedem Zentimeter bricht mein Herz ein kleines bisschen mehr. Am liebsten würde ich nach vorne laufen und die Beerdigung stoppen. Den Sarg öffnen, damit mir meine Zwillingsschwester in die Arme springen und laut »Reingefallen!« rufen kann. Annabelle hat ein Faible für schlechte Scherze. Hatte, korrigiere ich mich.
Obwohl es jetzt, da sie fort ist, nichts Kostbareres mehr gibt als meine Erinnerungen an sie – an uns, wünschte ich, ich könnte sie löschen. Jede Einzelne von ihnen, bis alles, was wir zusammen erlebt haben, und alles, worauf ich mich gefreut habe, mit dem Schmerz verschwindet. Unser gemeinsamer Uni-Abschluss, die ersten Kinder. Füreinander da zu sein, wenn unsere Eltern alt werden. Einfach füreinander da zu sein. Immer.
Tränen rinnen mir über die Wangen und vermischen sich mit dem Regen. Mein schwarzer Anzug klebt mir nass und kalt am Körper, aber ich nehme ihn kaum wahr. Alles, woran ich denken kann, ist, dass Annabelle nie wieder den Regen auf ihrer Haut spüren wird.
Mit einem dumpfen, endgültigen Geräusch wird der Sarg auf dem Boden des ausgehobenen Lochs abgesetzt. Die Wassertropfen perlen von dem dunklen Holz ab und verschwinden in der Erde. Genau wie sie. Der Gedanke trifft mich wie ein Schlag in die Magengrube.
Meine Eltern treten vor und werfen orangefarbene Dahlien auf den Sarg. Annabelles Lieblingsblumen. Mein Vater schlingt seine Arme um die bebenden Schultern meiner Mutter und hält sie fest, während sie schluchzt.
Mir wird übel. Jetzt bin ich an der Reihe.
Als ich an das Grab herantrete, sind meine Fingerspitzen taub. Soll ich etwas sagen? Mich entschuldigen? Annabelle liegt meinetwegen da unten. Weil ich nicht da war, als sie mich gebraucht hat. Weil ich nicht besser auf sie aufgepasst habe. Weil ich erst gemerkt habe, dass sie in Gefahr schwebt, als es längst zu spät war.
Zwischen uns gab es schon immer dieses unsichtbare Band. Ich konnte fühlen, was sie fühlte, auch wenn wir Hunderte Kilometer voneinander entfernt waren. Aber an jenem Abend funktionierte unsere Verbindung nicht. Ausgerechnet in Annabelles letzten Augenblicken auf dieser Welt versagte sie.
Das Band ist immer noch da, ich schleppe es wie eine Last mit mir herum. Es hängt schlaff herab, das andere Ende wird von niemandem mehr gehalten. Bei jedem Atemzug spüre ich, dass sie fehlt. Ich bin unvollständig. Und werde es für den Rest meines Lebens sein.
Wir haben alles zusammen gemacht, uns jede Sorge anvertraut. Wie soll ich ohne sie weiterleben? Wer bin ich überhaupt, jetzt, da ein Teil von mir fehlt? Annabelle war der Tag, ich war die Nacht. Jetzt ist mein Licht weg. Übrig ist nichts als Dunkelheit.
»Ich vermisse dich«, murmle ich und werfe meine Dahlie in das Grab. Sie landet neben denen meiner Eltern. Drei armselige Farbkleckse in einem scheinbar endlosen Meer aus Braun.
In Gedanken gebe ich meiner Schwester ein Versprechen, während der Pfarrer ein paar abschließende Worte sagt. Ich schwöre ihr, die Schuldigen für ihren Tod zur Rechenschaft zu ziehen. Die Lüge, Annabelle wäre bei einem tragischen Unglück umgekommen, werde ich entlarven und die Wahrheit herausfinden. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Täter ihre gerechte Strafe bekommen haben.
Sie werden büßen, Annabelle.
Zum Abschied schüttelt uns der Pfarrer die Hände. Er sagt etwas zu mir, doch ich verstehe ihn nicht. Das Rauschen in meinen Ohren ist zu laut. Wie auf Autopilot stolpere ich meinen Eltern hinterher. Wir verlassen den Friedhof und kehren zum Parkplatz zurück. Vor knapp einer Stunde fing die Beerdigung an. Jetzt ist nichts mehr, wie es einmal war. Meine Brust zieht sich zusammen, und ich muss mich am Autodach abstützen, weil meine Knie nachzugeben drohen. Erst jetzt wird mir so richtig bewusst, dass Annabelle wirklich fort ist.
Wer bin ich ohne sie? Wer bin ich? Wer bin ich?
Ich presse mir eine Hand gegen die Brust, weil es so verdammt wehtut. Wie kann mein dämliches Herz immer noch schlagen, obwohl Annabelle tot ist?
Plötzlich spüre ich eine Berührung auf meiner Schulter. Ich blinzle gegen den Regen an … oder sind es Tränen? Meine Sicht ist verschleiert, doch mir steigt das blumige Parfum meiner Mutter in die Nase. Sie zieht mich an sich, und wir weinen gemeinsam.
Ich verliere jegliches Zeitgefühl. Irgendwann löst sich meine Mutter aus der Umarmung und streicht mir eine nasse Haarsträhne aus der Stirn. Eine vertraute Geste aus meiner Kindheit, die sie zu beruhigen scheint, daher lasse ich sie gewähren.
»Möchtest du wirklich nicht mit uns nach Hause kommen?«
»Nein«, sage ich mit überraschend fester Stimme. »Ich werde zurück zur Uni gehen.«
»Bist du sicher, dass du … dorthin zurückwillst? Wir finden eine andere Universität für dich.«
Dorthin. Zurück an den Ort, an dem meine Schwester gestorben ist. Zu dem See, in dem sie ertrunken ist. Meine Mutter ahnt nicht, warum ich die Uni nicht wechseln will, nicht wechseln kann. Dass die Schuldigen für Annabelles Tod noch immer dort sind. Aber das ist auch gut so. Meine Eltern haben schon genug durchzustehen.
»Mach dir keine Sorgen, ich komme klar.«
Mein Vater legt mir eine Hand auf die Schulter. »Pass auf dich auf, Gabriel.«
»Das werde ich, versprochen.«
Erneut schließt meine Mutter mich in ihre Arme. Sie klammert sich an mir fest, als hätte sie Angst, mich auch noch zu verlieren. Kurz ringe ich mit mir, doch bei meinen Eltern zu bleiben. Aber die Universität ist mein Zuhause. Das war sie auch für Annabelle, die jahrelang hart dafür gekämpft hat, dort angenommen zu werden. Ich bin es ihr schuldig zurückzukehren. Ich spüre, dass sie das so gewollt hätte. Außerdem werde ich den Erinnerungen ohnehin nie entkommen können. Egal, wie weit ich laufe. Egal, wo ich wohne und was ich tue. Warum dann überhaupt fortgehen? Nein, ich werde mein Astronomiestudium fortsetzen und mit der Suche nach der Wahrheit beginnen. Entschlossen straffe ich die Schultern und atme tief durch, froh, ein Ziel vor Augen zu haben, auf das ich mich konzentrieren kann.
Ich verabschiede mich von meinen Eltern, und wir steigen in unsere Autos. Ich in einen grauen BMW, der mehr PS hat, als vernünftig ist, den ich aber abgöttisch liebe. Meine Eltern in eine Audilimousine, die mein Vater heute zur Abwechslung selbst fährt. Er hat darauf bestanden, dass nur wir drei zur Beerdigung gehen. Keine entfernten Verwandten, kein Personal. Nur wir – weil Annabelle es sich so gewünscht hätte.
Ich sehe dem Auto meiner Eltern nach, bis es hinter der nächsten Ecke verschwunden ist. Dann atme ich tief durch, starte den Motor und fahre los. Ich schalte die Sitzheizung ein, weil ich anfange, in meinen nassen Klamotten zu zittern. Zum Glück dauert die Fahrt nur eine gute Stunde.
Ich lasse meine Heimatstadt Küsnacht hinter mir und fahre auf die Autobahn, am Zürichsee vorbei geht es in Richtung Süden. Je näher ich meinem Ziel komme, desto stärker wird das Gefühl, mich jeden Augenblick übergeben zu müssen. Meine Gedanken kreisen, finden keinen Fixpunkt, womöglich sollte ich in diesem Zustand gar nicht Auto fahren. Aber wenn ich jetzt anhalte, werde ich niemals die Kraft aufbringen, an die Universität zurückzukehren, dessen bin ich mir sicher.
Nach einer Dreiviertelstunde entdecke ich den Walensee am Horizont. Eingebettet zwischen zerklüfteten Bergen, liegt er im Schatten und fast bedrohlich vor mir. Ich umklammere das Lenkrad fester, bis meine Fingerknöchel weiß hervortreten. Es ist alles okay. Ich schaffe das. Jetzt ist es nicht mehr weit. Nur noch ein paar Kilometer über die Serpentinenstraße, bis ich das Universitätsgelände erreiche. Wo sich die alten Gebäude aus grauem Stein mit Türmchen und Zinnen an den See schmiegen, die Studierenden in der gigantischen Bibliothek über zerlesenen Büchern brüten oder die nächste Party planen.
Der Ort, von dem meine Zwillingsschwester stets geträumt hat. Und der letztendlich zu ihrem Albtraum wurde.
Corvina Castle.
Kapitel 2
Zwei Jahre später
Elora
Als ich das Esszimmer betrete, glitzert hinter der breiten Fensterfront der Genfer See in der Sonne. Das türkisblaue Wasser hat heute nur wenig Seegang, daher schaukelt das Boot meines Stiefvaters an unserem hauseigenen Steg sachte hin und her. Im Hintergrund recken sich die Alpen in den Himmel. Von hier aus erscheinen sie mir winzig. Sie erinnern mich jeden Tag aufs Neue daran, dass ich mich genau so fühle, seit ich in diese luxuriöse Villa eingezogen bin. Klein. Und nicht wie ich selbst. Genau deswegen muss ich hier so bald wie möglich weg.
»Guten Morgen«, flötet meine Mutter, die mit meinem Stiefvater Ludovico am Esstisch sitzt. Sie reicht mir einen Umschlag. »Der ist für dich mit der Post gekommen.«
Sobald ich den Absender lese, schlägt mein Herz so heftig, als wolle es mir aus der Brust springen. Die Pestalozzi-Stiftung. Endlich! Auf diesen Brief warte ich seit Wochen.
An Ort und Stelle reiße ich den Umschlag auf und ziehe ein einzelnes Blatt mit ein paar maschinengeschriebenen Zeilen heraus.
Sehr geehrte Elora Farraro,
nach hinreichender Prüfung Ihrer Unterlagen müssen wir Ihnen heute leider mitteilen, dass wir Ihnen kein Stipendium durch unsere Stiftung gewähren können. Wir bedanken uns für Ihr …
Ich lese nicht weiter, sondern stopfe das Papier frustriert zurück in den Umschlag. Meine Augen brennen, aber hastig blinzle ich die Tränen weg. Ich werde auf keinen Fall anfangen zu weinen. Nicht vor Ludovico und meiner Mutter.
»Und?«, fragt sie aufgeregt und streicht sich eine honigblond gefärbte Haarsträhne aus der Stirn. Früher war ihr Haar genauso dunkelbraun wie meins. Auch das hat sich geändert, nachdem Ludovico in unser Leben getreten ist.
Ich schüttle nur den Kopf, weil ich nicht fähig bin zu sprechen. Das war meine letzte Chance auf ein Stipendium. Alle anderen Stiftungen haben mir schon vor Wochen abgesagt. Enttäuscht setze ich mich an den Tisch und lege den Brief beiseite.
Ludovico räuspert sich. »Du weißt, dass deine Chancen auf ein Stipendium schlecht standen.«
»Ja, dank dir.«
Mein Stiefvater ist der Inhaber einer milliardenschweren Firma. Als mir meine Mutter vor ungefähr drei Jahren von ihrem neuen Freund erzählte, der ein wohlhabender Unternehmer aus Genf ist, hielt ich das zunächst für einen Scherz. Aber dann ging alles Schlag auf Schlag. Ludovico machte ihr einen Heiratsantrag, sie sagte Ja, und plötzlich zog ich von einem kleinen Dorf in Deutschland in die reichste Stadt der Schweiz. Von einem öffentlichen Gymnasium wechselte ich auf eine teure Privatschule, und statt mit dem Bus zu fahren, wurde ich mit einer Limousine herumkutschiert.
Was ich wollte, spielte keine Rolle. Ich war sechzehn Jahre alt und musste mich fügen. Dass meine gesamte Welt auf den Kopf gestellt wurde und ich alles verlor, was mir etwas bedeutete, spielte keine Rolle. Ich ließ mein Zuhause zurück, genauso wie meine Freunde, die meine Mutter und mich Goldgräberinnen nannten, und schließlich gar nicht mehr mit mir sprachen. Dadurch, dass ich mitten im Schuljahr auf eine neue Schule wechselte, fand ich auch dort keinen Anschluss. Weder im Unterricht noch bei meinen neuen Mitschülern. Nur eine Sache blieb mir. Eine Sache, die sich nie verändert hat: mein Traum, Medizin zu studieren.
Und genau der droht nun zu platzen.
»Du könntest einfach mein Angebot annehmen«, sagt Ludovico und deutet auf den Brief. »Das war deine letzte Bewerbung um ein Stipendium, oder?«
Zögerlich nicke ich und nehme mir von dem Rührei, das Ludovicos Haushälterin besser macht als jedes Restaurant. »Ich weiß, du meinst es nur gut, aber das will ich aus eigener Kraft schaffen.«
»Und wie?«
Ja, wie, verdammt? Wenn ich das wüsste, säße ich schon längst nicht mehr hier. Dann hätte ich mir bereits irgendwo eine eigene Wohnung gesucht, weit weg von Genf und dem mit allerlei Pflichten verbundenen Reichtum meines Stiefvaters. Leider ist ein Medizinstudium nicht so leicht zu stemmen. Wenn ich nebenbei noch arbeiten muss, werde ich das Lernpensum nicht schaffen, das ist mir vollkommen klar. Ich bin niemand, dem das Lernen leichtfällt. Schon immer musste ich für gute Noten hart arbeiten.
Ich hasse es, wie zufrieden Ludovico aussieht, weil er genau weiß, dass mir nach der Absage keine andere Wahl bleibt, als sein Angebot anzunehmen. Aber dann wäre ich exakt das, was meine früheren Freundinnen mir vorgeworfen haben: eine Goldgräberin, die sich von ihrem Stiefvater aushalten lässt. Dabei könnte die Realität nicht weiter davon entfernt sein. Ich möchte eigenständig sein. Der ganze Reichtum ist mir egal. Er ist die Eintrittskarte zu einer oberflächlichen Welt, in der jeder jedem ein Messer in den Rücken sticht, sobald etwas für ihn oder sie dabei herausspringt.
Vor meinem inneren Auge sehe ich nichts als Dunkelheit, dann blaue, flackernde Lichter. Ich höre einen lauten Knall und spüre Angst, die meinen Brustkorb wie ein Schraubstock zerquetscht. Hastig blinzle ich, um Erinnerungen an die Nacht, in der ich hautnah miterleben musste, wie falsch die oberen Zehntausend sein können, zu vertreiben. Ich brauche keine schicken Kleider und teuren Autos. Alles, was ich will, alles, was ich jemals wollte, ist, Ärztin zu werden, um Menschen zu helfen.
Menschen wie meinem Vater.
Sofort verdränge ich die schmerzhaften Gedanken an ihn. Ich stehe auch so schon kurz davor, in Tränen auszubrechen. Mich an den Tod meines Vaters zu erinnern, würde das Fass zum Überlaufen bringen.
»Du solltest noch einmal in Ruhe darüber nachdenken«, holt Ludovico mich aus meinen düsteren Gedanken zurück. »Bevor es zu spät ist, dich für das kommende Semester einzuschreiben.«
Mir ist klar, im Grunde hat er recht. Ist meine Sturheit es wirklich wert, meinen Traum aufs Spiel zu setzen? Warum kann ich es mir nicht leicht machen und sein Angebot annehmen? Zwei Buchstaben trennen mich von einer sorglosen Studienzeit. Doch ich bekomme sie partout nicht über die Lippen.
Ich schiebe mir einen weiteren Bissen Rührei in den Mund, aber der Appetit ist mir längst vergangen.
»Dir würde es auf Corvina Castle sicher gut gefallen«, fügt er hinzu. Natürlich lässt er nicht locker. Er ist es gewohnt zu bekommen, was er will. »Viele berühmte Ärzte und Ärztinnen der Schweiz haben dort studiert. Die Universität ist international anerkannt für ihre erstklassige Ausbildung, insbesondere der Studiengang Medizin gilt als einer der besten überhaupt.«
Ludovico klingt, als würde er aus einer Informationsbroschüre vorlesen. In meiner Magengegend kribbelt es verräterisch. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass mich eine Begeisterung packt, die ich nur zu gern verdrängen würde. Mit seiner Bedingung, dass ich an der Eliteuniversität Corvina Castle studieren muss, damit er mir mein Studium finanziert, will er mich manipulieren. Dennoch habe ich mir online Bilder der Uni angeguckt. Ich konnte einfach nicht anders, meine Neugier war zu groß. Corvina Castle liegt eine Stunde von Zürich entfernt am Walensee. Eine traumhafte ruhige Lage, in der ich mich ganz auf mein Studium konzentrieren könnte. Mit einer riesigen Bibliothek und renommierten Dozenten.
Und dennoch … »Ich glaube nicht, dass Corvina Castle der richtige Ort für mich ist.« In den letzten drei Jahren war ich durchgängig von reichen Schnöseln umgeben, das reicht mir für ein ganzes Leben. Selbst wenn es hier um meinen großen Traum geht.
»Warum nicht?«, fragt meine Mutter, die mal wieder gar nichts versteht. Sie begreift nicht, wie wenig ich der Welt, in der wir inzwischen leben, abgewinnen kann. Dass ich viel lieber in unserem kleinen Dorf im Allgäu geblieben wäre, als mich von einem Chauffeur und mit einem prickelnden Glas Champagner in der Hand zum Shoppen durch Genf kutschieren zu lassen.
»Es gibt viele Stipendiaten an der Universität, außerdem würdest du endlich Lucia kennenlernen«, führt Ludovico an. Als er seine Tochter erwähnt, wird seine Stimme weicher. Ich höre eine Spur Kummer darin.
Bisher habe ich Lucia nicht einmal gesehen, obwohl meine Mutter und ich seit fast zwei Jahren in der Villa Salvari wohnen. Ihr Vater und sie haben sich kurz vor der Hochzeit heftig zerstritten, und seitdem war Lucia nicht zu Hause. Worum es bei dem Streit genau ging, hat Ludovico mir nie verraten, doch anhand von ein paar aufgeschnappten Gesprächsfetzen vermute ich, dass Lucias Studienwahl eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat.
Sie scheint mutig zu sein, wenn sie es geschafft hat, sich gegen Ludovico durchzusetzen. Ich kann nicht verhindern, dass mich die Neugier packt. Wer ist meine Stiefschwester? Würden wir uns gut verstehen? Könnten wir gemeinsam diesem Wahnsinn trotzen, dem ich mich seit zwei Jahren allein stellen muss? Ich habe mir immer eine Schwester gewünscht.
»Wie gesagt, denk noch einmal in Ruhe darüber nach«, bittet Ludovico.
Ich schiebe die Reste des Rühreis auf meinem Teller hin und her. Soll ich die Chance, die sich mir bietet, nutzen? Studiere ich an der besten Universität der Schweiz und lerne auch noch meine Stiefschwester kennen? Oder probiere ich es weiter allein und riskiere, dass mein Traum nicht in Erfüllung geht?
»In Ordnung«, sage ich schließlich. »Ich denke darüber nach.«
Seufzend lehne ich den Kopf gegen das kühle Fensterglas und schaue nach draußen. Laubbäume, deren Blätter wirken, als hätte ein Künstler sie in orange und gelbe Farbeimer getaucht, reihen sich an die vom Regen nasse Straße. Sie führt in Serpentinen einen Berg hinauf. Ab und an blitzt hinter den Bäumen ein See auf. Im Sommer kann man sich bestimmt gut darin abkühlen, vorausgesetzt man schwimmt gerne. Was ich von mir nicht behaupten kann. Seit ich denken kann, hege ich eine unerklärliche Abscheu gegen Wasser. Zu mehr als dem Seepferdchen hatten meine Eltern mich nie überreden können.
Ich lasse die Trennwand herunter, die mich vom Chauffeur isoliert. »Wie lange fahren wir noch?« Ich habe bereits versucht, in einer Navigationsapp nachzuschauen, aber das mobile Internet ist hier so schlecht, die Karte lädt nicht einmal.
»Noch eine Viertelstunde, allerhöchstens.«
Das ist gut. Langsam habe ich nämlich das Gefühl, dass mir von den vielen Kurven flau im Magen wird.
Ich wünschte, ich hätte eine andere Wahl gehabt. Ich schnaube verächtlich, als ich daran denke, dass ich nun wirklich und wahrhaftig in der Welt meines Stiefvaters angekommen bin. Alles ist käuflich, alles hat seinen Preis. Auch ich und mein größter Traum.
Da die Trennwand noch immer unten ist, entdecke ich durch die Windschutzscheibe plötzlich ein Auto am Straßenrand. Es ist vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geknallt.
»Stopp!«, schreie ich im selben Moment, in dem der Chauffeur auf die Bremse tritt. Die Reifen quietschen, das Auto schlingert, und noch bevor es ganz zum Stehen kommt, reiße ich die Tür auf und stürze nach draußen.
»Warten Sie!«, ruft der Chauffeur, doch ich ignoriere ihn.
Ich renne zur Unfallstelle und hoffe, ich komme nicht zu spät. Hinter mir schlägt eine Autotür zu, als der Fahrer ebenfalls aussteigt. Wieder ruft er nach mir, aber ich habe nur Augen für das Auto vor mir. Die Motorhaube wurde zusammengedrückt wie ein Akkordeon, Rauch steigt auf, und ich weiß, ich muss mich beeilen.
Durch die Fensterscheibe entdecke ich eine junge Frau. Sie lehnt regungslos im Fahrersitz. Aus einer Wunde an ihrer Stirn sickert Blut, das sicher von dem Aufprall mit dem Airbag stammt, der nun schlaff um das Lenkrad hängt.
Meine Hände schließen sich um den Griff der Tür.
»Was machen Sie denn da? Weg vom Auto!«
Der Chauffeur klingt panisch, und ich schreie: »Rufen Sie den Notarzt!«
Dann reiße ich die Tür auf und ziehe die Frau vorsichtig heraus. Erst ein paar Meter hinter dem Auto lege ich sie ab. Ein beißender Geruch steigt mir in die Nase, doch ich versuche, mich voll und ganz auf sie zu konzentrieren. Ich streiche ihr die Haare aus dem Gesicht und realisiere, dass sie ungefähr in meinem Alter ist. Sie ist hübsch, daran kann auch das Blut nichts ändern, das ihr über die Schläfe rinnt. Gleichzeitig wirkt sie unendlich zerbrechlich.
Für einen winzigen Augenblick bleibt mir die Luft weg, und dann … fange ich an zu kämpfen.
Die Umgebung verschwimmt, während ich ihre Atmung überprüfe. Nichts, nicht einmal der kleinste Hauch strömt zwischen ihren Lippen hervor. Daher lege ich meine Hände auf ihre Brust und beginne mit den Reanimationsmaßnahmen. Ich konzentriere mich ganz auf meine Aufgabe, keine Straße, keine Bäume, kein panischer Chauffeur sind noch von Bedeutung.
Als würde sie meine Bemühungen, meine wachsende Verzweiflung spüren, schlägt die Frau plötzlich die Augen auf. Sie sieht mich direkt an, ich erkenne Angst in ihrem verschleierten Blick.
Sie hustet, und Blut läuft über ihre Lippen. Verdammt, ich weiß, was das bedeutet: innere Blutungen. Kein Arzt dieser Welt könnte sie jetzt noch retten, erst recht nicht ich. Ich greife nach ihrer Hand und drücke ihre eiskalten Finger, um ihr Trost zu spenden. Auf einmal realisiere ich, was der Schleier in ihren Augen bedeutet. Es ist der Tod.
Wieder hustet sie einen Schwall Blut. Ihre Lippen bewegen sich, aber kein Laut kommt hervor.
»Es ist alles gut«, versuche ich sie zu beruhigen und streiche ihr eine dunkle Haarsträhne aus der Stirn.
»Fortuna aeterna«, krächzt sie so leise, dass ich sie beinahe nicht verstanden hätte.
Und dann macht sie ihren letzten Atemzug.
Ich sitze da wie versteinert, während ich ihre zarten Finger weiter umklammert halte. Nein. In meinem Kopf ertönt dieses Wort wie in einer Dauerschleife. Tränen treten mir in die Augen, und mein Atem geht schwerer.
Plötzlich dringt ein Schrei an meine Ohren. »Feuer!«
Ich schrecke aus meiner Trance auf. Im selben Moment kann ich ihn riechen, den beißenden Qualm. Endlich lasse ich die Frau los und komme auf die Füße. Meine Hände, mein Pullover, sogar meine Leggings sind blutverschmiert. Aber das ist mir egal. Ich drehe mich um und renne los. Von dem Unfallauto weg, in die Richtung, aus der der Chauffeur schreit.
Sobald ich ihn erreiche, höre ich auch die Sirenen. Zu spät, will ich schreien. Ihr kommt zu spät! Aber ich kann nicht, meine Kehle fühlt sich eng an, wie zugeschnürt. Ich habe kein Problem mit dem Tod. Das wäre als angehende Ärztin auch schwierig. Menschen leben, und irgendwann müssen sie diese Welt verlassen. Die meisten sind dann alt und grau, aber diese Frau? Sie war so jung. Und das lässt mich keineswegs kalt.
»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, sich so dicht an ein qualmendes Auto zu wagen? Wissen Sie, was hätte passieren können, wenn es explodiert wäre? Dann wären Sie jetzt tot, und ich würde verklagt werden!«
Ehrlich? Darüber macht sich der Mann mit den grauen Haaren und dem maßgeschneiderten Anzug in diesem Augenblick Sorgen? Wütend funkle ich ihn an. »Erstens: Ein Auto kann nicht explodieren, so etwas passiert nur in Actionfilmen. Und zweitens: Sie arbeiten für mich. Also sollten Sie lieber aufpassen, wie Sie mit mir reden.«
Gott, ich hasse es, diese Karte auszuspielen, aber sie funktioniert, denn der Chauffeur stammelt sofort eine Entschuldigung.
Knackend schießt eine Stichflamme aus der Motorhaube des verunglückten Wagens empor. Das Geräusch geht beinahe im Sirenengeheul des Rettungswagens unter. Er hält an, und ein Sanitäter springt heraus.
Die nächsten Minuten ziehen an mir vorbei, aber ich bin nicht wirklich anwesend. Der Arzt stellt den Tod der Frau fest und wendet sich anschließend an mich, um mich zu befragen. Kurz darauf rückt eine Feuerwehreinheit an, um den Brand zu löschen.
Der Chauffeur ist unterdessen wieder ins Auto eingestiegen. Dahinter bildet sich eine Schlange weiterer Fahrzeuge. Wir befinden uns auf der einzigen Straße, die zur Universität führt. Vermutlich war die junge Frau im Unfallwagen eine Studentin aus Corvina Castle.
Ich blicke an mir hinunter. Das Blut ist mittlerweile getrocknet. Bei dem Anblick schluchze ich auf. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich weiß, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, trotzdem kann ich den Gedanken nicht abschütteln, versagt zu haben.
Am Kofferraum säubere ich meine Hände mit einer Flasche Wasser. Ganz bekomme ich das Blut nicht weg. Für den Rest muss später eine gute Seife herhalten.
Wir warten, bis die Einsatzkräfte ihre Arbeit verrichtet haben. Erst dann wird die Straße wieder freigegeben, und der Chauffeur fährt die letzten Kilometer bis zur Universität. Je näher wir dem Gelände kommen, desto besser wird das Internet. Ich öffne die Suchmaschine und tippe die beiden Worte ein, die die Frau kurz vor ihrem Tod gesagt hat. Sie scheinen ihr wichtig gewesen zu sein. Wie ich schon vermutet habe, handelt es sich um Latein. Für mein Studium werde ich die Sprache benötigen, daher habe ich bereits im Vorfeld versucht, mir ein paar Vokabeln beizubringen. Doch in der Situation eben war eine Übersetzung undenkbar.
Im nächsten Augenblick lässt mir die Bedeutung der Worte einen Schauer den Rücken hinunterlaufen.
Erfolg währt ewig.
Kapitel 3
Gabriel
»Hey, kommst du mit Volleyball spielen?«, ruft mein Mitbewohner Aidan durch die geschlossene Zimmertür.
»Keine Zeit, sorry!«
Diese Antwort habe ich ihm in den letzten zwei Jahren schon mindestens ein Dutzend Mal gegeben. Meistens eine lahme Ausrede, um ihn loszuwerden, heute ist es jedoch die Wahrheit.
Ich seufze. Warum habe ich mich noch mal freiwillig für das Mentorenprogramm gemeldet? An diesem herrlichen Spätsommertag könnte ich mir wirklich Schöneres vorstellen, als einen Erstsemester durch Corvina Castle zu führen. Aber jetzt ist es leider zu spät, um noch einen Rückzieher zu machen.
Nur dieses eine Jahr, sage ich mir. Damit Professor Belkova mich für den Zusatzkurs Himmelsmechanik und Raumfahrt, für den er nur eine Handvoll Studierende zulässt, auswählt. Schrecklich, dass dieser alte Mistkerl derart beeinflussbar ist.
Es klopft an der Tür. Mann, ist Aidan heute nervig!
»Was?«, knurre ich.
Die Tür öffnet sich, doch es ist nicht mein Mitbewohner, der seinen Kopf hereinstreckt, sondern meine beste Freundin Lucia. »Wow, du freust dich aber, mich zu sehen.«
»Ich dachte, du wärst Aidan. Was willst du?«
Lucia kommt herein, unter ihrem Arm einen Laptop sowie eine Tüte Chips. Wie selbstverständlich wirft sie sich auf mein Bett und macht es sich gemütlich. »Da gibt es diese neue BBC-Dokumentation über die Royal Family, die ich mir ansehen will.«
»Hast du kein eigenes Zimmer?«
Sie seufzt und bindet ihre langen blonden Haare zu einem Messy Bun, der mich an ein Vogelnest erinnert. »Sara dreht schon wieder durch.«
»Immer dieses Drama. Ich habe da gerade echt keinen Nerv für.«
»Glaubst du, mir gefällt das? Sie ist schon seit ein paar Tagen so merkwürdig drauf. Keine Ahnung, wir reden ja nie miteinander über Privates, und eigentlich geht es mich auch nichts an. Aber … gerade eben hat sie geheult, als wäre die Queen erneut gestorben! Das pack ich heute echt nicht. Hoffentlich hat sie sich nachher beruhigt. Kann ich so lange hierbleiben?«
»Meinetwegen«, murre ich und greife nach der Mappe. »Aber ich muss jetzt leider los.«
»Was? Wohin? Ich dachte, wir schauen uns die Doku zusammen an.«
Knisternd öffnet Lucia die Chipstüte. Der Geruch allein verrät mir, dass es diese grausige Sorte ist, die sie so abgöttisch liebt: Kichererbsen mit Sour-Cream-Geschmack.
»Ich habe mich als Mentor gemeldet, schon vergessen?«
Lucia stopft sich eine Handvoll Chips in den Mund. »Ach. Stimmt ja«, nuschelt sie. »Viel Spaß bei dem langweiligsten Job auf dem gesamten Campus!«
Auf dem Weg zur Tür werfe ich einen Kugelschreiber nach ihr, dem sie geschickt ausweicht, sodass er gegen die Wand prallt und hinter meinem Bett verschwindet. Ihr Lachen begleitet mich bis auf den Flur.
Die Unterkünfte auf Corvina Castle sind halb in den Stein gebaut, sodass jeweils nur von einer Seite der langen Korridore Zimmer abgehen. Jedes davon bietet Blick auf den Walensee. Was für die meisten Studierenden purer Luxus ist, bedeutet für mich eine tägliche Erinnerung an den schlimmsten Tag meines Lebens. Gleichzeitig ist es aber auch eine Ermahnung daran, meine Mission nicht aus den Augen zu verlieren. Leider habe ich in den letzten zwei Jahren kaum Fortschritte erzielt. Egal, wie hartnäckig ich es versuche, die Schuldigen lassen mich nicht an sich heran. Aber ich werde nicht aufgeben.
Fünf Minuten später öffne ich die schwere Tür, die nach draußen führt. Vor dem Unterkunftsgebäude stehen Bänke, auf denen unzählige Studierende sitzen und sich in der Sonne aalen. Heute Morgen hat es noch geregnet, kein Wunder, dass jetzt so viele hier draußen sind, um sich ihre tägliche Portion Vitamin D abzuholen. So kurz vor dem Start des neuen Semesters haben die meisten noch genug Freizeit, um die Sonne zu genießen. Nächste Woche werden die Sonnenbrillen und Klatschmagazine von Kaffeebechern und Fachbüchern abgelöst werden.
Ich überquere eine steinerne Brücke, die sich über den Bachlauf spannt und die Unterkünfte mit den Hauptgebäuden der Universität verbindet. Wasser kommt plätschernd aus den Bergen hinunter, fließt über moosbedeckte Steine und mündet im See. Auf dem Brückengeländer sitzt eine Eidechse, die sich auf den warmen Steinen sonnt. Als ich vorbeigehe, huscht sie davon. Auf der gegenüberliegenden Uferseite erkenne ich einige Gebäude und die Autobahn A3. Der Lärm der Fahrzeuge dringt nicht bis zu uns herüber. Hier ist es immer ruhig, weil unsere Seeseite bis auf die Universität nicht bebaut ist. Dadurch bietet sie den idealen Ort zum Lernen. Keine Ablenkung durch Stadtlärm, keine Boutiquen oder Nachtclubs in der Nähe. Gleichzeitig bedeutet das Abgeschiedenheit. Corvina Castle ist eine kleine Welt für sich. Gerade mag vielleicht die Sonne scheinen, aber ich weiß es besser. Ich weiß, welche Monster hinter dem alten Gemäuer lauern.
Obwohl ich spät dran bin, ist noch kein Ersti zu sehen, als ich am Treffpunkt vor dem Hauptgebäude ankomme. Nur die anderen Mentoren, die ich bei einer Infoveranstaltung kennengelernt habe, stehen in einem lockeren Kreis zusammen und unterhalten sich. Die Kiesstraße, die zum Eingangstor und hinaus in die Berge führt, ist verlassen. Merkwürdig.
»Hi«, begrüße ich die Gruppe. »Ist noch niemand angekommen?«
Ein großer Kerl mit grau gefärbten Haaren antwortet mir: »Nein. Professor Belkovas wissenschaftlicher Mitarbeiter war gerade hier. Es hat wohl einen Unfall gegeben, und die Zufahrtsstraße wurde gesperrt. Sollte aber nicht mehr lange dauern, bis sie wieder freigegeben wird. Laut seinen Informationen sind die Räumungsarbeiten fast erledigt.«
Ein Unfall? Na super. »Okay, danke.«
Hätte ich gewusst, dass ich mir hier nur die Füße in den Bauch stehe, hätte ich mich nicht so hetzen müssen. Erneut bereue ich es, mich für diesen Job gemeldet zu haben. Aber Hauptsache, ich komme in den Kurs über Raumfahrt. Für mein Physikstudium mit Schwerpunkt Astronomie wäre der eine echte Bereicherung. Die Vorstellung, dass auf anderen Planeten intelligentes Leben existiert oder Bewohnbarkeit möglich ist, hat mich schon immer fasziniert. Der Wunsch, irgendwann selbst solches Leben zu entdecken, war einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, nicht in die Fußstapfen meines Vaters zu treten und Bankier zu werden.
Da ich keine Lust habe, mich mit den anderen Mentoren zu unterhalten, stelle ich mich nicht zu ihnen, sondern setze mich abseits auf den Bürgersteig. Dann nutze ich die Wartezeit, um meine Mappe noch einmal durchzugehen. Bei der Infoveranstaltung haben wir den Namen und das Studienfach unseres jeweiligen Schützlings genannt bekommen. Mir wurde Elora Farraro anvertraut, eine Medizinstudentin. Ausgerechnet der Studiengang meiner Schwester. Ich habe versucht, jemand anderen zugeteilt zu bekommen, aber jegliche Diskussion mit Professor Belkova war zwecklos. Es gibt dieses Jahr keinen anderen Mentor aus dem Fachbereich Medizin. Da sich immerhin einige meiner Physikkurse mit diesem Studiengang überschneiden, bin ich – zumindest laut Professor Belkova – die beste Wahl für Elora.
Zehn Minuten später fährt ein schwarzer Audi durch das Tor und hält auf dem runden Vorplatz. Die hintere Tür öffnet sich, und eine junge Frau steigt aus. Ihr Haar hat die Farbe von Rosinen. Sie ist klein und zierlich, hat jedoch an genau den richtigen Stellen Kurven, die von den Leggings, die sie trägt, betont werden. Alle Aufmerksamkeit gilt ihr, als sie um das Auto herum und zum Kofferraum läuft. Gelassen wuchtet sie ihren Koffer heraus, statt sich von dem Chauffeur helfen zu lassen.
Immer mehr Autos fahren auf den mit Schotter ausgelegten Platz, und schon bald herrscht emsiges Gewusel. Wie soll ich in diesem Chaos meinen Schützling finden?
Mein Blick huscht zurück zu der Brünetten. Ich kann mir nicht einmal erklären, warum. Eigentlich ist sie recht unscheinbar. Hübsch, aber äußerlich sticht nichts an ihr heraus. Doch die Art, wie sie ihren Chauffeur behandelt, fasziniert mich. Ich habe das Gefühl, sie ist kein reiches Töchterchen. Vielleicht eine Stipendiatin? Aber warum dann das schicke Auto?
Wie auch immer, ich habe einen Job zu erledigen. Ich klappe die Mappe zu und erhebe mich vom Bürgersteig. Am besten fange ich beim ersten Auto an und frage mich nach hinten durch.
»Elora Farraro?«, spreche ich die junge Frau an.
Sofort hält sie inne. »Ja?«
Na sieh mal einer an. Das ging schnell. »Willkommen auf Corvina Castle. Ich bin Gabriel, dein Mentor.«
»Mein … Was?«
»Dein Mentor?«
Sie lacht. »Sorry, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll.«
Verarscht sie mich? »Als dein Mentor ist es meine Aufgabe, dich über den Campus zu führen und dir zu zeigen, wo deine Kurse stattfinden.«
»Oh, nicht nötig. Ich komme allein zurecht.«
Fassungslos starre ich sie an und umklammere die Mappe fester. »Wie bitte? Warum hast du dich dann für das Programm angemeldet?«
»Ganz sicher habe ich mich nicht … Oh.« Ein Schatten huscht über ihr Gesicht. »Dieser Mistkerl!« Sie schnaubt wütend und kramt in ihrer Handtasche nach ihrem Handy, als würde sie den Mistkerl – wer auch immer er ist – direkt anrufen wollen. Mir fällt auf, dass ihre Hände von dunklen Flecken übersät sind. Ist das … Blut?
Elora folgt meinem Blick und hält schlagartig inne. »Wenn du mich unbedingt herumführen willst, dann starte doch bitte bei einem Waschraum.«
Ich nicke nur, weil meine Kehle sich auf einmal staubtrocken anfühlt. Was ist auf dieser Straße passiert? War sie in den Unfall verwickelt?
Ein aufgedunsener Körper, blaue Lippen, mein aussichtsloser Versuch, das erstarrte Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Die Erinnerungen prasseln mit voller Wucht auf mich ein und rauben mir für einen Augenblick den Atem.
»Was ist, kannst du kein Blut sehen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, dreht Elora sich um und verabschiedet sich von ihrem Chauffeur. Das Gesicht des armen Kerls sieht aus, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen. Hastig steigt er ein und startet den Motor.
Elora wendet sich wieder an mich. »Also? Was ist jetzt?«
»Geht schon wieder.«
»Ich meinte, mit dem Waschraum.«
Ihr unschuldiges, süßes Äußere täuscht, sie ist ein unerträgliches Biest. Ich beiße die Zähne zusammen und konzentriere mich auf meine Aufgabe. Der Kurs ist es wert, Elora für ein paar Stunden zu ertragen.
»Folge mir bitte«, sage ich betont emotionslos und lotse sie zum Hauptgebäude. Die helle Fassade ist von dichtem Efeu bewachsen, der aber weit zurückgeschnitten ist, damit man die Verzierungen über den Türen und Fenstern erkennen kann. Das Gebäude wirkt wie aus einem anderen Jahrhundert entsprungen, die Zinnen ragen wie Dolche in den Himmel. »Hier befinden sich das Audimax, die Bibliothek sowie jegliche Verwaltungseinrichtungen und das Büro des Universitätspräsidenten Prof. Dr. Morelli.«
Elora wirft einen Blick über ihre Schulter und schaut zu den Bergen hinauf. Sie wirken wie ein natürlicher Zaun, der das Gelände umschließt, nur durchbrochen von dem Tor, das auf die Straße hinausführt. »Wird das Tor nachts geschlossen?«
»Ja, aber in dem kleinen Häuschen daneben sitzt rund um die Uhr ein Sicherheitsangestellter, der dich nach Vorlage deines Studentenausweises rein- oder rauslässt.«
Sie lacht auf. Kein fröhlicher Laut, sondern einer, der bitter klingt. »Wie in einem Gefängnis.«
»Du hättest ja nicht herkommen brauchen«, entgegne ich wütend. Diese Uni bedeutet mir alles, nicht zuletzt, weil Annabelle sie so geliebt hat. Sie hat jeden einzelnen Tag hier genossen, und es regt mich auf, dass diese Schnepfe kein Auge für die Schönheit des Geländes hat. Ich hätte alles dafür gegeben, um meiner Schwester noch einen letzten Blick auf die Berge zu ermöglichen, aber Elora nimmt das alles missmutig auf.
Daraufhin schweigt sie, was wahrscheinlich auch besser ist. Unsere Führung hat noch nicht einmal richtig begonnen, und ich habe jetzt schon das Bedürfnis, irgendwas Zerbrechliches gegen die Wand zu pfeffern.
Meine guten Manieren habe ich dennoch nicht vergessen. Ich halte ihr die Eingangstür auf, und wir treten ein. Zwischen den Büros hängen Urkunden und Auszeichnungen, die Studierende im Laufe der Jahre errungen haben. Gleich rechts hinter dem Eingang befinden sich die Toiletten.
Elora stellt wortlos ihren Koffer neben mir ab und verschwindet hinter der Tür. Ich atme einmal tief durch. Das wird ein langer Tag.
Kapitel 4
Elora
Das Blut lässt sich abwaschen, dennoch fühle ich mich, als würde der Tod an jedem Millimeter meines Körpers haften. Wer war diese Frau? War sie glücklich? Welche Pläne hatte sie für ihre Zukunft? Hatte sie einen Partner oder eine Partnerin? Ich lasse die Schultern sinken und wische mir über die Augen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie gestorben ist. Ich habe alles versucht, um sie zu retten. Am liebsten würde ich mich für den restlichen Tag mit einem Sachbuch in meinem Bett verkrümeln. Meinen Kopf mit Wissen zu füllen hat schon immer geholfen, mich auf andere Gedanken zu bringen. Oder eine Partie Schach. Aber stattdessen …
Ich seufze und wappne mich dafür, diesem arroganten Gabriel wieder gegenübertreten zu müssen. Seit er mich angesprochen hat, zieht er ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Und was fällt ihm eigentlich ein, mich derart von oben herab zu behandeln? Er ist genau so, wie ich mir die Studierenden an dieser Universität vorgestellt habe. Alles verwöhnte Arschlöcher, die sich für etwas Besseres halten, nur weil ihre Eltern Geld haben.
Was hat Ludovico sich nur dabei gedacht, mich ohne mein Wissen für dieses Mentorenprogramm anzumelden? Ich brauche niemanden, der mich herumführt wie einen Hund an der Leine, ich komme auch allein zurecht.
Mit gestrafften Schultern verlasse ich die Toilette. Gabriel lehnt lässig an der gegenüberliegenden Wand, die Arme vor der Brust verschränkt. Eine seiner dunklen Haarsträhnen fällt ihm widerspenstig in die Stirn. Er spitzt die Lippen und pustet sie weg, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen. Mir wird heiß, und ich schlucke schwer. Was …? Nein, ich muss mich konzentrieren! Ohne dass ich es will, mustere ich ihn weiter, seine sehnigen Unterarme, diese eng sitzenden Jeans und seine himmelblauen Augen. Wie attraktiv er ist, fällt mir erst in diesem Moment auf. Ausstehen kann ich ihn trotzdem nicht.
In sicherer Entfernung zu ihm bleibe ich stehen. »Zeigst du mir bitte, wie ich zu meinem Zimmer komme? Den Rest finde ich dann schon allein.«
Er stößt sich von der Wand ab und kommt langsam auf mich zu. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Verdammt, was ist nur los mit mir? Seit wann lasse ich mich vom guten Aussehen eines Typen blenden?
»Sorry, das geht nicht. Ich mache das hier nicht ohne Grund, und ich habe keine Lust, Ärger zu bekommen«, sagt er. »Aber wir können die Führung gerne kurz halten. Es ist auch in meinem Sinne, so wenig Zeit wie möglich damit zu verschwenden.«
Warum ist er überhaupt Mentor, wenn er mit dieser Tätigkeit doch nur seine Zeit verschwendet? Obwohl ich ihm viel lieber geigen würde, was ich von ihm halte, gebe ich mich geschlagen. Je schneller wir diese Führung hinter uns bringen, desto eher bin ich auf meinem Zimmer. Allein.
Ich will nach meinem Koffer greifen, doch das goldene Ungetüm, das mir meine Mutter vor der Abreise gekauft hat, ist verschwunden. »Wo ist mein Gepäck?«
»Deinen Koffer habe ich weggebracht. Keine Sorge, da kommt niemand dran. Nur wir Mentoren haben einen Schlüssel für den Raum.«
»Nimmst du ständig anderer Leute Dinge, ohne zu fragen?«
»Ich wollte nur helfen, damit wir keine Zeit verlieren.«
»Indem du …«
»Lass es gut sein, okay?«, schnauzt er mich an.
Arschloch. Ich funkle ihn wütend an. Für wen hält er sich? Für den König dieser Universität, der sich alles erlauben kann?
Ich öffne gerade den Mund, um etwas zu erwidern, als Gabriel seufzt. »Hör zu, es tut mir leid«, sagt er. Überrascht blinzle ich ihn an. Ich hätte nicht gedacht, dass in diesem Kerl genug Anstand für eine Entschuldigung steckt. »Das hier ist wichtig für mich, aber ich hätte dich nicht so anblaffen dürfen.«
Er fährt sich mit der rechten Hand durch sein Haar. Ein schmales Lederband in der Farbe von Vollmilchschokolade hängt daran. Darin eingeflochten ist eine silberne Plakette, auf der etwas eingraviert ist, aber ich kann nicht erkennen, was. Vielleicht der Name seiner Freundin? Ich spüre, wie meine Wangen rot werden. Er lässt die Hand wieder sinken. Sein Haar ist jetzt vollkommen durcheinander, die braunen Strähnen stehen in alle Richtungen ab, doch es scheint ihn nicht zu kümmern.
Ich balle die Hände zu Fäusten, weil mich der Drang überkommt, sein Haar wieder in Ordnung zu bringen. Es ist, als würde mich ein unsichtbares Gewicht zu ihm ziehen. Reiß dich zusammen, Elora! Ich kenne Gabriel kaum, ich kann ihn ja nicht mal leiden! Dennoch fasziniert er mich. Da ist diese leise Stimme in mir, die mir einflüstert, dass in ihm noch mehr steckt als sein ruppiges Auftreten und diese kurze Entschuldigung. Und dass mich hinter dieser kalten Fassade weitere Überraschungen erwarten. Ich war schon immer ein neugieriger Mensch. Mein Vater pflegte stets zu sagen, dass mich diese Eigenschaft irgendwann in Schwierigkeiten bringen wird.
Gabriel räuspert sich. »Wir sollten jetzt anfangen.«
»Sehr gerne«, gebe ich bissiger als nötig zurück, um diese merkwürdige Anziehung zu unterbinden. »Schließlich wollen wir ja keine Zeit verlieren.«
Gabriel zeigt mir das Büro des Präsidenten, das des Dekans meiner Fakultät und die Studienberatung. Er führt mich in das Untergeschoss, und wir werfen einen kurzen Blick in das Audimax. Unter dem modernen Namen habe ich mir definitiv etwas anderes vorgestellt. Der bestuhlte Versammlungsraum, in dem fakultätsübergreifende Vorlesungen und Vorträge stattfinden, befindet sich komplett unter der Erde und hat keine Fenster. Mit den hohen Decken und den antiken Kerzenhaltern an den Wänden würde er für mich eher in das Kellergewölbe einer Kirche passen, in der heimliche Rituale abgehalten werden. Ich schaudere. Zum Glück halten wir uns nur kurz darin auf, bevor Gabriel die Führung in der medizinischen Fakultät fortsetzt. Er erklärt mir ausführlich, wie die Räume nummeriert sind, damit ich ohne Probleme zu meinen Kursen finde.
Anschließend schauen wir uns die Bibliothek an, die mich gegen meinen Willen beeindruckt. Studiertische aus dunklem Holz stehen zwischen deckenhohen Bücherregalen, die ich am liebsten sofort auf der Suche nach Büchern über Medizin durchstreifen würde. Ich kann beinahe die Buchrücken unter meinen Fingerspitzen fühlen, den Duft alter Ledereinbände habe ich bereits in der Nase. Genüsslich atme ich ein. In den kommenden Jahren bleibt mir noch genug Gelegenheit, die Bibliothek zu nutzen, und langsam freue ich mich auf das Medizinstudium hier.
Was Lucia wohl studiert? Und wo sie gerade ist? Ich wünschte, Ludovico hätte mir ein bisschen mehr über sie erzählt.
Auf einmal flitzt eine schwarze Katze an meinen Beinen entlang und schlüpft durch die offene Tür aus der Bibliothek. Irritiert blicke ich ihr nach.
»Hast du die Katze gesehen?«, frage ich Gabriel.
»Ja, das ist Calma, die Universitätskatze. Meistens hält sie sich in der Bibliothek auf oder liegt auf einem der großen Steine am See in der Sonne. Manchmal kommt sie aber auch mit in die Vorlesungen. Nur streicheln solltest du sie nicht, sie kann ziemlich biestig werden. Obwohl …« Er wirft mir einen kurzen Seitenblick zu und hebt die Brauen. »Vielleicht kommt ihr beiden ganz gut miteinander aus.«
Ich schnaube. »Na, vielen Dank auch. Jetzt weiß ich immerhin, auf wen ich sie zuerst ansetzen werde.«
Seine Mundwinkel zucken. Nur ganz kurz, aber ich bemerke es trotzdem, und mein Herz macht einen albernen kleinen Satz. Er sieht wie ein anderer Mensch aus, wenn er lächelt. Fast lächelt, korrigiere ich mich und betrachte ihn noch einen Moment länger.
Wir verlassen die Bibliothek und anschließend das Hauptgebäude über den Hinterausgang. Schmale Stufen führen zu einem gepflasterten Weg hinunter, an den sich der Uferbereich des Walensees schmiegt. Bänke stehen auf der breiten Wiese, und an einem Steg schaukeln Ruderboote, die bei jeder Bewegung ächzen.
»Rudern gehört zum Universitätssport. Corvina Castle hat eine eigene Mannschaft, die recht erfolgreich ist«, erklärt Gabriel. »Es gibt außerdem eine Schwimmhalle, eine Turnhalle sowie einen Fitnessbereich. Den sehen wir uns gleich noch an. Aber erst einmal kommen wir zu dem kleinen Supermarkt und der Kantine.«
Der gesamte Komplex von Corvina Castle erinnert mich mit den vielen spitzen Türmen, den Zinnen und den Mauern aus grobem Stein an eine Mischung aus einer normannischen Villa und einer Burg. Unwillkürlich schleicht sich ein Lächeln auf meine Lippen.
Die Kantine ist im Obergeschoss eines modernen Gebäudes untergebracht, darunter befindet sich der Supermarkt. Direkt daneben schließt sich ein länglicher Anbau mit Flachdach an. In geschwungenen Lettern steht über dem Eingang des Anbaus Seaside. Das Lokal ist eine Mischung aus Restaurant und Café, mit einer riesigen Glasfront und einer vorgesetzten Terrasse, die auf den Walensee hinauszeigt.
»Das Seaside ist ein beliebter Treffpunkt zum Lernen«, erklärt Gabriel und deutet auf die Terrasse, deren Tische fast alle besetzt sind. »Es hat keinen Ruhetag, was wirklich praktisch ist. Außerdem gibt es einen separaten Barbereich. Samstags finden dort Themenpartys statt. Die Betreiber überlegen sich jede Woche ein anderes Motto. Falls du interessiert bist, solltest du ihrem Insta-Account folgen. Dort werden die Mottos und zusätzliche Partys, wie zum Beispiel die an Halloween, bekannt gegeben. Man kann die Bar übrigens auch mieten. Für Geburtstagsfeiern oder so was.«
Corvina Castle hat wirklich alles, was das Studentenherz begehrt. Es gibt praktisch keinen Grund, das Gelände zu verlassen. Da ich Ludovicos Angebot, mir ein Auto zu kaufen, abgelehnt habe, ist das wahrscheinlich auch besser so. Ich bezweifle, dass die abgelegene Universität über eine Bushaltestelle verfügt.
»Klingt nett«, sage ich nur und habe nicht vor, dem Insta-Account zu folgen. Nicht nur, weil ich neben meinem Studium ohnehin kaum Zeit für Partys haben werde, sondern auch, weil ich nicht unbedingt scharf darauf bin, mich mit meinen überprivilegierten Kommilitonen zu betrinken.
Hinter dem Seaside ragt ein Felsen auf. Gabriel hält zielstrebig darauf zu, bis ich den schmalen Weg bemerke, der seitlich daran vorbeiführt. Eine Art metallener Steg, der von Stelzen ein paar Meter über dem Wasser gehalten wird und mit einem Geländer gesichert ist. Er schmiegt sich an den Stein, verengt sich an einer Stelle, sodass wir kurz hintereinandergehen müssen, und offenbart anschließend den Eingang zu einem weiteren Gebäudekomplex.
Bei jedem Schritt über das Wasser ist mir mulmig zumute. Gabriel hat sein Tempo ebenfalls angezogen, vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Der Steg führt uns auf eine große Freifläche, auf der eine Tartanbahn, eine Sporthalle und eine Schwimmhalle untergebracht sind. Nahe dem Wasser steht ein kleiner Schuppen. Gabriel sagt, dort werden im Winter die Ruderboote gelagert.
»Dieser Bereich der Universität sowie das Seaside wurden erst im letzten Jahrhundert angefügt. Die Unterkünfte und das Hauptgebäude sind schon wesentlich älter. Sie wurden bereits 1486 gebaut, kurz bevor Corvina Castle gegründet wurde. Der Name ist übrigens inspiriert von der Weinsorte Corvina, die früher an den Uferhängen angebaut wurde.«
»Interessant«, sage ich. »Hast du das extra für deinen Job als Mentor auswendig gelernt, oder bist du einfach ein wandelndes Geschichtsbuch?«
Mein Scherz verfehlt offenbar seine Wirkung, denn Gabriel runzelt skeptisch die Stirn. »Eine Freundin von mir studiert Geschichte, sie nervt mich ständig mit historischen Fakten.«
Ein unangenehmes Schweigen entsteht, und ich bin froh, dass Gabriel im nächsten Moment vorschlägt, den Rückweg anzutreten. Hoffentlich geht es jetzt endlich auf mein Zimmer.
Wir passieren gerade erneut das Hauptgebäude, als Gabriel schlagartig stehen bleibt. Seine Aufmerksamkeit gilt einer jungen Frau, die ihm panisch entgegenläuft. Sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Kurz bevor sie uns erreicht, sehe ich, dass ihr Gesicht tränenüberströmt ist.
»Gabriel«, schluchzt sie und wirft sich in seine Arme. »Es gab einen schrecklichen Unfall. Sara … Sara ist tot.«
Mein Mentor zuckt zusammen. »Was?! Du meinst, deine Mitbewohnerin Sara?«
Die Frau nickt. Ob sie seine Freundin ist? Womöglich steht ihr Name auf seinem Armband? Ich komme mir total fehl am Platz vor. Bei dieser intimen Szene sollte ich nicht anwesend sein und dennoch … Die Rädchen in meinem Kopf beginnen sich zu drehen und rasten ruckartig ein.
Ich blicke auf meine Hände hinab, als könnte ich das Blut noch daran kleben sehen.
Sara. So hieß die Frau, die ich nicht retten konnte. Die Frau, die in meinen Armen gestorben ist. Fortuna Aeterna. Warum hat sie das gesagt? Was haben die Worte zu bedeuten? Vielleicht wissen Gabriel und seine Freundin mehr darüber, aber jetzt ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt, um sie danach zu fragen.
»Sht«, macht Gabriel. »Es wird alles gut, Lucia.«
Moment … Was hat er gesagt? Auf einmal verstehe ich, warum sie mir so bekannt vorkommt. Die spitze Nase, der strenge Zug um die Lippen. Haare in der Farbe von Sonnenstrahlen und hellblaue Mandelaugen mit dichten Wimpern. Sie sieht aus wie ihr Vater. Noch dazu spricht sie Hochdeutsch, kein Schweizerdeutsch, was verrät, dass sie in einem anderssprachigen Teil der Schweiz aufgewachsen ist.
Die Frau in Gabriels Armen ist meine Stiefschwester.
Kapitel 5
Gabriel
Sara ist tot. Tot. Tot. Tot. Das Wort rauscht in einer Endlosschleife durch meinen Kopf und hält mich fest in seinen eiskalten Klauen gefangen. Wir befinden uns direkt neben dem See, was es mir umso schwerer macht, mich gegen die Panik zu behaupten, die mich bei diesem Wort überkommt. Ich bin wie erstarrt, und mein Herz schlägt so schnell, als würde es mir aus der Brust springen wollen.
Ich bin nicht mehr hier, sondern am Seeufer, zu einer anderen Zeit. Damals habe ich die Panik das erste Mal gespürt. Ich hielt meine leblose Zwillingsschwester in den Armen und konnte nichts tun, um ihr zu helfen. Weinend wartete ich auf die Rettungskräfte, obwohl ich längst wusste, sie würden zu spät kommen.
Lucia vergräbt ihr Gesicht an meinem Schlüsselbein, ihre Tränen benetzen mein Shirt. Sie so aufgelöst zu sehen, legt einen Schalter in meinem Inneren um. Sie braucht mich jetzt, und dieses Wissen verschafft mir genug Kraft, um die Vergangenheit von mir zu stoßen. Ich reibe ihr in gleichmäßigen Kreisen über den Rücken und versuche, sie zu beruhigen, indem ich ihr sage, dass alles gut werden wird. Auch wenn ich mich sofort mies dafür fühle, bin ich insgeheim froh, dass Lucia ihrer Mitbewohnerin nicht allzu nahestand.
Elora habe ich fast vergessen, bis sie fragt: »Lucia?«
Meine beste Freundin löst sich aus meinen Armen und wirbelt herum. »Was?«
»Bist du Lucia Salvari?« Eloras Stimme wird etwas höher. Sie klingt aufgeregt.
O nein, das gibt Ärger, denke ich, bin aber klug genug, die Klappe zu halten und meine beste Freundin ihre Probleme selbst lösen zu lassen. Sie wird nicht zum ersten Mal angesprochen, weil irgendwer ihren Vater kennt, aber es ist immer wieder unangenehm. Als Erbin eines Milliardenimperiums ist Lucia eine wertvolle Connection. Es gibt viele Studierende, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit versuchen, ihr in den Arsch zu kriechen.
Auch wenn es total bescheuert ist, bin ich enttäuscht. Ich hätte mehr von Elora erwartet. Es hat mich beeindruckt, wie bissig und schlagfertig sie ist. Als würde sie auf nichts und niemanden außer sich selbst etwas geben.
Lucia strafft die Schultern und reckt das Kinn. »Ja, die bin ich«, sagt sie mit fester Stimme. Jede Träne um Sara, all ihre Gefühle sind mit einem Schlag fort. Sie hat sich diese kalte Hülle übergestülpt, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn sie sich angegriffen fühlt. »Aber bevor du mich jetzt bittest, meinem Vater irgendwas Banales auszurichten oder dir einen Praktikumsplatz bei ihm klarzumachen, lass es lieber bleiben. Ich habe keine Lust auf dieses scheinheilige Getue.«
Elora wirkt aus dem Konzept gebracht. Sie beißt sich auf die Unterlippe, und mein Blick bleibt etwas zu lange an ihrem Mund hängen.
Im nächsten Moment zieht sie ihr Handy aus der Tasche und hält es hoch. »Wenn ich deinem Vater etwas mitteilen will, rufe ich ihn einfach an«, sagt sie mit zuckersüßer Stimme. »Wenn du in den letzten beiden Jahren mal zu Hause gewesen wärst, wüsstest du, dass Ludovico mein Stiefvater ist. Und ich bin deine Stiefschwester.«
Lucia zuckt so heftig zurück, als hätte Elora sie geschlagen. »Wie bitte?«
»Ich bin deine …«
»Was fällt dir ein?!«, schreit Lucia, sodass sich einige der Studierenden, die auf der Wiese am Seeufer in der Sonne liegen, zu uns umdrehen. »Ich weiß nicht, was sich mein Vater davon erhofft. Oder du. Aber halt dich von mir fern, verstanden? Ich will nichts mit dir zu tun haben!«
Tränenspuren glänzen auf ihren Wangen. Ich kann mir nicht einmal ausmalen, wie sie sich gerade fühlen muss. Erst die erschütternde Nachricht über ihre Mitbewohnerin, und jetzt hetzt ihr verrückter Vater ihr auch noch ihre Stiefschwester auf den Hals? Hat er sie nicht schon genug unter Druck gesetzt?
Lucia schnaubt. »Zu versuchen, über meinen besten Freund an mich heranzukommen. Das ist echt armselig! Sogar für meinen Vater. Hat er, habt ihr, wirklich gedacht, das würde funktionieren?«
Ich stutze, daran habe ich im ersten Moment gar nicht gedacht. Hat Ludovico es womöglich so eingefädelt, dass mir Elora zugeteilt wird? Ich weiß, Professor Belkova ist beeinflussbar. Aber so sehr? Elora hat behauptet, sie hätte sich nicht freiwillig für das Programm angemeldet, sondern … Natürlich! Der Mistkerl. Damit muss sie Ludovico gemeint haben. Nach allem, was Lucia mir über ihren Vater erzählt hat, ist mir klar, er würde sehr weit gehen, um den Kontakt zu ihr wiederherzustellen.
»Ich wusste nichts davon«, behauptet Elora. »Bis vor einer Stunde wusste ich nicht einmal etwas von dem Mentorenprogramm!«
Lucia schnaubt. »Na sicher, wer’s glaubt.«
»Das ist die Wahrheit. Er hat mir nie etwas über dich erzählt, egal, wie oft ich ihn gefragt habe. Nichts darüber, warum du nicht mehr nach Hause kommst, und nicht einmal, was du studierst.«
Sagt sie die Wahrheit? Hat sie wirklich nichts von Ludovicos Intrigen gewusst? Ich fixiere Elora, suche in ihrem Gesicht nach Anzeichen, die sie verraten. Aber da ist nichts außer Schock und Traurigkeit.
»Das ist mir so was von egal. Halt dich einfach von mir fern«, zischt Lucia, bevor sie sich an mich wendet. »Ich kann jetzt nicht auf mein Zimmer zurück. Nicht, wenn Sara …«
»Schon okay«, unterbreche ich sie hastig. »Du kannst bei mir warten.«
»Danke.«
Lucia wirft ihrer Stiefschwester einen letzten giftigen Blick zu, bevor sie davonrauscht. Elora schaut ihr lange nach, und ich kann das Mitleid nicht abschütteln, das mich dabei überkommt. Wer ist diese Frau? Eine Figur in Ludovicos Spiel? Oder zieht sie selbst die Fäden? Und warum, verdammt noch mal, interessiert mich das überhaupt? Das ergibt keinen Sinn. Ich konzentriere mich immer auf mich selbst, auf mein Studium und meinen Plan. Allein Lucia hat es mit ihrer unkomplizierten ruhigen Art geschafft, einen Platz in meinem Leben zu ergattern. Aber auch sie kennt nur die Oberfläche. All den Kummer und Schmerz, all die Gefühle, die darunter verborgen liegen, lasse ich niemals jemanden sehen. Das ist meine oberste Regel, denn Schwäche zu zeigen, macht angreifbar. Etwas, das ich mir nicht erlauben kann. Ich muss stark und auf der Hut sein, jederzeit.