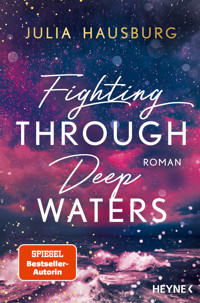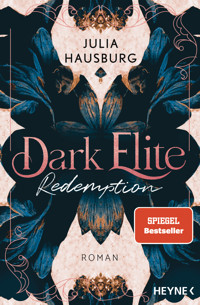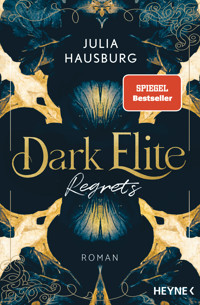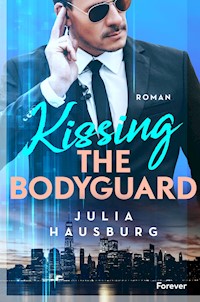3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anny flieht nach New York, um dort undercover zu studieren. Sie kann sich nach einem traumatischen Vorfall nicht mehr vor Paparazzi retten. In Manhattan beginnt sie das anonyme Leben, nach dem sie sich immer gesehnt hat: Sie arbeitet in einem kleinen Café, lernt neue Freunde kennen und wiegt sich endlich in Sicherheit. Und dann taucht Mason in ihrem Café auf, mit seinen hinreißenden grünen Augen und dem schiefen Lächeln. Anny kann sich Masons Bann nicht entziehen. Doch Mason ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und die Wahrheit über ihn kann alles zerstören, was sie sich so mühsam aufgebaut hat … »Eine einzige gemeinsame Sekunde mit Mason hat die Macht mich zu zerstören, wenn sie nicht länger unsere eigene bleibt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Facing Fate
Die Autorin
Julia Hausburg, Jahrgang 1998, arbeitete als freie Mitarbeiterin für eine Regionalzeitung, bevor sie 2019 ein Studium in Bildungswissenschaften abschloss. Sie ist als freischaffende Autorin tätig, verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Geretsried bei München. Mit ihrer Young Adult Reihe Hesitant Heart und dem New Adult Roman Hunting Hopes sowie zahlreichen Buchempfehlungen hat sie sich auf Instagram eine täglich wachsende Community von über 4.600 Abonnenten aufgebaut.
Das Buch
Anny flieht nach New York, um dort undercover zu studieren. Sie kann sich nach einem traumatischen Vorfall nicht mehr vor Paparazzi retten. In Manhattan beginnt sie das anonyme Leben, nach dem sie sich immer gesehnt hat: Sie arbeitet in einem kleinen Café, lernt neue Freunde kennen und wiegt sich endlich in Sicherheit.
Und dann taucht Mason in ihrem Café auf, mit seinen hinreißenden grünen Augen und dem schiefen Lächeln. Anny kann sich Masons Bann nicht entziehen. Doch Mason ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und die Wahrheit über ihn kann alles zerstören, was sie sich so mühsam aufgebaut hat …
Julia Hausburg
Facing Fate
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin März 2022 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrusISBN 978-3-95818-679-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Leseprobe: Hook me up
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 1
LuxFrágil, Lissabon, Portugal
Der Schein, die Arroganz, das Drama – ich habe das alles so satt.
Der Mann in der Sitznische gegenüber bestellt eine weitere überteuerte Flasche Champagner und legt seine Arme um zwei freizügig gekleidete Frauen. Arroganz. Das Schluchzen der Blondine neben mir am Bartresen wird lauter. Ich kann es sogar über die elektronische Musik hinweghören, die durch den angesagten Club LuxFrágil dröhnt. Drama. Sie wird von einer Freundin getröstet, die giftige Blicke zu dem Mann hinüberwirft. Schein.
Abneigung drückt mir in die Eingeweide wie zu enge Jeans, und ich wende mich ab, um an meinem Cocktail zu nippen. Dabei steche ich mir mit dem Strohhalm fast das rechte Auge aus. Immerhin hätte ich dann einen Grund zu gehen.
»Die neue Gucci-Kollektion ist der absolute Wahnsinn!« Mein Gesprächspartner, sein Name ist Ed, streckt mir unter dem Bartresen seinen Fuß entgegen. Ein prolliger Schuh kommt zum Vorschein, auf dem ein grün-roter Streifen und das goldene Markenemblem prangen. »Oder etwa nicht?«
Zur Antwort lächele ich nur schief. Es könnte mir nichts gleichgültiger sein, als ob der blonde Angeber No-Name-Schuhe oder die einer Luxusmarke trägt.
»Alessandro Michele ist ein alter Freund von mir. Vielleicht nehme ich dich zur Mailänder Fashion Week mal mit auf seine Show.« Er zwinkert mir zu. Fehlt nur noch, dass er sich wie ein Gorilla auf die Brust trommelt.
»Nicht nötig, danke.«
Ich greife nach dem Trinkhalm und leere meinen Cocktail mit einem großen Schluck. Als nur noch die Eiswürfel am Boden des Glases klirren, schnappe ich mir meine Handtasche. Es ist höchste Zeit, diese dämliche Party endlich zu verlassen. Meine Aufgabe ist erledigt. Genau so, wie Papá verlangt hat.
Ich hüpfe vom Barhocker und kehre Ed ohne ein weiteres Wort den Rücken zu.
»Warte! Wo willst du hin?« Eds Stimme kommt kaum gegen den wummernden Bass an, sodass ich mit ruhigem Gewissen so tun kann, als hätte ich ihn nicht gehört. In der nächsten Sekunde bin ich zwischen den Partygästen verschwunden.
Ich dränge mich durch die Menge der Tanzenden und benutze rücksichtslos meine Ellbogen, um zum Ausgang des Clubs zu gelangen. Nur noch wenige Meter trennen mich von der marmornen Treppe, die hinauf in die Eingangshalle und an die frische Luft führt. Die Bässe werden schwächer, je näher ich meiner Freiheit komme. Ich habe es fast geschafft. Fast.
Auf einmal höre ich jemanden hinter mir meinen Namen rufen. Obwohl ich es besser wissen sollte, bleibe ich stehen und drehe mich um. Ich bin viel zu höflich, um ohne eine Erklärung davonzulaufen.
»Du gehst schon?«
Ed kratzt sich im Nacken, und kurz habe ich Mitleid mit ihm. Sicher hat er sich mehr von unserem Gespräch erhofft, mich vielleicht sogar schon auf seinem Hotelzimmer gesehen. Aber dann erinnere ich mich wieder daran, wie er die letzte halbe Stunde von seinen Connections und seinem Geld geprahlt hat. Jetzt habe ich Mitleid mit mir.
»Danke für den Drink, Ed, aber aus uns wird nichts.«
Möglichst würdevoll drehe ich mich um – und pralle mit jemandem zusammen.
Ich hebe den Kopf, und plötzlich dreht sich die Welt ein kleines bisschen langsamer. Meine Knie werden weich, weil ich in die grünsten Augen blicke, die ich jemals gesehen habe.
Ach du Scheiße … Ist das der Cocktail, oder ist der Kerl wirklich so verdammt heiß? Ich blinzele. Dass ich so schnell wie möglich hier wegwollte, rückt völlig in den Hintergrund. Ich kann mich schlichtweg nicht von dem Mann losreißen. Nicht von dem leichten Bartschatten auf seinen Wangen oder den Grübchen, die sich beim Lächeln in seine Mundwinkel graben. Würde mein Herz nicht schon so schnell rasen, würde es spätestens durch die Grübchen beschleunigt.
»Entschuldigung«, murmele ich peinlich berührt auf Englisch, da der Großteil der Gäste im Club Touristen sind.
Das Gesicht meines Gegenübers strahlt, als wäre er nicht soeben von einer schwitzenden, gehetzten Frau umgerannt worden. Er winkt ab und sagt mit amerikanischem Akzent: »Schon gut, das passiert jedem mal. Aber du willst mich doch sicher was fragen, oder?«
Seine Stimme ist kräftig und tief. Sie dringt mir durch Mark und Bein und wirft den irrsingen Wunsch hervor, nie wieder eine andere als seine hören zu wollen. Oh Gott. Das muss definitiv der Cocktail sein.
Erst einen Moment später erfasst mein Gehirn seine Worte, und ich hebe irritiert eine Braue. »Was meinst du?«
»Bekomme ich ein Autogramm?«, antwortet er.
Mein Herz setzt einen Schlag aus, nur um anschließend umso heftiger weiterzupochen.
Nein. Ich weiche vor ihm zurück. Angst ergreift mich und lässt meine Hände zittern.
Die schönen schilfgrünen Augen des jungen Mannes weiten sich, und er macht Anstalten, den Abstand, den ich zwischen uns gebracht habe, zu verringern.
Ich reiße einen Arm hoch. »Bleib bloß weg von mir.«
Meine Gedanken überschlagen sich. Panisch blicke ich mich um. Sind irgendwo Journalisten? Doch bis auf uns ist der schmale Gang leer. Offenbar hat Ed das Interesse an mir verloren und ist zur Party zurückgekehrt.
»Nein, nein, schon gut«, beteuert der Mann.
»Nichts ist gut. Ich sagte, bleib weg!«
»Du nimmst mich auf den Arm, oder?« Seine hohe Stirn kräuselt sich, und ich kämpfe mit dem irrsinnigen Verlangen, sie glatt streichen zu wollen.
Doch obwohl mich alles zu dem Fremden hinzieht, ist meine Angst stärker. »Nein. Ich meine es ernst, komm bloß keinen Schritt näher.«
»Sonst was?« Seine Lippen verziehen sich zu einem breiten Grinsen, und ich erkenne, dass er versucht, witzig zu sein.
Ich schlucke das trockene Gefühl in meinem Hals hinunter. »Sonst schreie ich.« Etwas Besseres fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
Er durchschaut meine leere Drohung sofort. »Nur zu, schrei ruhig. Die Musik ist da drinnen so laut, dass dich ohnehin keiner hört.«
Ein Lächeln zupft an meinen Mundwinkeln. Ich muss den Verstand verloren haben, dass ich Gefallen an diesem Geplänkel finde. »Du bist ein kranker Psycho.«
Die Beleidigung prallt vollkommen an ihm ab. »Dir ist schon klar, dass es nicht besonders hilfreich ist, so gemein zu mir zu sein?«
»Ich sehe keinen Grund, warum ich freundlich zu dir sein sollte.«
»Für das Autogramm?«
Ich stöhne. »Jetzt fängst du schon wieder damit an.«
»Ich habe sogar meinen besten Stift dabei.«
Arroganter Mistkerl.
Er klimpert mit den Wimpern.
Hm, vielleicht doch charmant?
»Vergiss das Autogramm«, sage ich.
Er runzelt die Stirn. »Na gut, dann eben kein Autogramm … Wie wäre es mit einem Foto?«
Offenbar hat mein Herz jetzt auch noch den Verstand verloren, denn es hüpft in meiner Brust, ohne sich um meine Angst zu scheren.
»Was verstehst du nicht an einem Nein?«
»Was willst du dann noch von mir?«
Ja, was eigentlich?
Ich starre ihn an, bis das Grün seiner Augen mir wie Feuer in der Seele brennt. Meine Gedanken rasen. Ich sollte zurück ins Hotel gehen, trotzdem bewegen sich meine Füße keinen Schritt von der Stelle, als hätte der Fremde mir unsichtbare Fesseln angelegt. Und er macht ebenfalls keinerlei Anstalten, auf die Party zurückzukehren. So stehen wir einander gegenüber, vollkommen regungslos, während nur der Bass die Stille zwischen uns durchdringt.
Ich komme mir vor wie in einer schlechten Liebeskomödie und reiße mich von seinem Anblick los. »Ich gehe jetzt.«
»Auf Wiedersehen, Fremde.«
Ich schnaube. »Oh, ich hoffe nicht.«
Seine Augen weiten sich, was mir eine seltsame Genugtuung verschafft. Schwungvoll drehe ich mich herum, um einen filmreifen Abgang hinzulegen.
»Hey!«, ruft der Kerl mir nach. »Verrätst du mir deinen Namen?«
Fassungslos halte ich inne. Verarscht er mich? Erst fragt er nach einem Autogramm, und nun gibt er vor, meinen Namen nicht zu kennen?
Ich wirbele herum. Auf meinen hohen Absätzen gar nicht mal so leicht, sodass ich kurz das Gleichgewicht verliere. »Was soll das? Ist das irgendein Trick?«
»Ein Trick?« Er greift in die Tasche seiner Lederjacke und zieht einen Stift hervor. Nach einigem Wühlen folgt ein zerknittertes Kärtchen. »Ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber ein Trick ist das nicht. Hier …«
Mit den Lippen zieht er die Kappe vom Stift und kritzelt ein paar Zahlen auf das Kärtchen. Dann streckt er es mir entgegen. Warum ich es annehme, kann ich mir nicht erklären. Weil ich durcheinander bin? Oder zu höflich, um abzulehnen? Ohne einen Blick auf die Visitenkarte zu werfen, lass ich sie in meine Umhängetasche und dort blind in mein Portemonnaie gleiten. Ich nehme mir vor, sie gleich bei meiner Ankunft im Hotel wegzuwerfen.
»Ich würde mich freuen, wenn du anrufst.«
Ich schüttele den Kopf, auf einmal fühlt sich mein ganzer Körper schwer und erschöpft an, als würden meine Gliedmaßen von Gewichten nach unten gezogen werden. »Ich werde dich nicht anrufen. Und am besten vergisst du meinen Namen.«
Man könnte fast meinen, er ist irritiert. Aber ich weiß, dass das nicht sein kann. Warum sonst hat er mich nach einem Autogramm gefragt?
»Verstanden?«, hake ich nach, weil ich noch immer keine Antwort von ihm bekommen habe.
Er öffnet den Mund. Und dann lacht er.
»Das ist nicht witzig!«
Der Kerl lacht weiter. So laut, dass wir sicher gleich die Aufmerksamkeit der gesamten Party auf uns gezogen haben.
»Sei still!«, fauche ich. »Ich meine es ernst, hörst du?«
Der Kerl hört auf zu lachen. »Du hast sie doch nicht mehr alle.«
Ich öffne die Lippen und setze zu einer nicht sonderlich netten Erwiderung an, als ich hinter mir eine Bewegung wahrnehme.
»Gibt es ein Problem?«, unterbricht uns Ed. Wo kommt der denn auf einmal her?
Ich unterdrücke ein Stöhnen und drehe mich zu ihm um. Mitten in der Bewegung erstarre ich. Ich blicke geradewegs in die Linse einer Spiegelreflexkamera. Warum hat Ed eine Kamera?
»Was zur Hölle?« Meine Stimme zittert vor Angst, und ich weiche zurück. Eigentlich müsste ich nun erneut gegen den attraktiven Fremden prallen. Doch er steht nicht länger hinter mir. Wo …? Plötzlich wird mir schummrig.
»Was …« Ich schlucke. Meine Zunge ist schwer, und in meinem Kopf dreht sich alles. »Was willst du von mir?«
»Ich habe einige Fragen zum Fall Peter McKinley.«
»Nein, lass mich in Ruhe.«
Ed knurrt. »Erst wenn ich ein Geständnis von dir habe, dass deine Anschuldigungen Lügen sind.«
Meine Beine verwandeln sich in Pudding und drohen unter mir wegzuknicken. Denn endlich kapiere ich. Ed ist gar kein reicher Angeber. Dadurch hat er nur versucht, an mich heranzukommen. Scheiße.
»Verschwinde auf der Stelle, oder ich rufe die Polizei!«
Er lacht, dann blitzt die Kamera. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Ich will weg, einfach nur weg. Aber auf einmal kann ich mich kaum noch bewegen.
Der attraktive Fremde! Ich bete, dass er noch in Hörweite ist.
Mit letzter Kraft richte ich mich auf und suche den winzigen, dunklen Flur nach ihm ab. Da! Dahinten ist er.
Er beobachtet uns. Doch warum unternimmt er nichts? Bemerkt er nicht, dass Ed mich bedrängt?
Unsere Blicke treffen sich.
»Hilf mir! Bitte!« Ich weiß nicht, ob ich die Worte laut ausgesprochen habe oder ob mein Mund stumm geblieben ist.
Der Mann dreht sich um. Und geht.
Mir wird übel. Tränen schießen mir in die Augen. Ed hält weiterhin die Kameralinse auf mich.
Ich öffne die Lippen, um zu schreien, aber meine Zunge ist bleischwer.
»Dein Geständnis«, fordert Ed.
Meine Beine sacken weg.
»Gestehe, und dir wird nichts passieren.«
Die Angst lähmt mich. Ich kann mich nicht bewegen, nicht mehr denken, nicht mehr atmen.
Die Kamera klickt.
»Sieh dich nur an. Nach diesen Bildern wird dir keiner mehr glauben.« Er lacht bellend. »Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Anani Marcella nach Drogeneskapade auf Party. Kann man ihren Aussagen noch trauen?«
Drogen?
Dann realisiere ich es.
Der Cocktail. Ed muss etwas in mein Getränk getan haben, um mich zu einem Geständnis zu zwingen.
Mir wird schlagartig eiskalt. Ich habe meinen Drink doch nur für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen. Was wird Ed mir antun?
Ich öffne die Lippen, aber meine Zunge ist taub.
»Du willst das nicht?«
Ich kann nur krächzen.
»Dann gestehe!«
Er streckt die Hand nach mir aus, wie um mich zu schlagen. Instinktiv will ich zurückweichen, doch mein Körper ist so starr wie Stein. Ich bin machtlos und Ed vollkommen ausgeliefert.
Plötzlich sackt Ed zur Seite. Die Kamera knallt zu Boden, und ich höre einen Aufschrei. Ed? Noch immer kann ich mich nicht bewegen, spüre meine Gliedmaßen kaum. Arme packen mich, und ich versuche zu schreien. Aber ich bleibe stumm.
»Ganz ruhig, ich tue dir nichts. Ich versuche nur, dir zu helfen.« Die fremde Stimme dringt wie mit Watte verpackt an meine Ohren. Dann geht ein Ruck durch meinen Körper, als ich hochgehoben werde. »Jetzt ist alles gut. Der Journalist wird dir nichts mehr antun.«
Die Kamera. Was ist mit den Bildern, die Ed von mir gemacht hat?
»Die Fotos dieses Verrückten habe ich gelöscht. Und nicht nur das …« Mein Retter lacht. »Die Kamera ist Schrott.«
Erleichterung durchströmt mich. Ich will die Lippen öffnen, ihm danken. Aber … Wofür? Ich bin verwirrt, spüre, wie meine Gedanken davondriften. Ich will sie greifen, festhalten und bei Verstand bleiben.
»Ich bringe dich in ein Krankenhaus, und …« Die Stimme verklingt.
Es ist genug. Ich will das alles nicht mehr.
Fort, ich muss fort von hier. Ich brauche … einen Neuanfang.
Kapitel 2
Carman Hall, New York City, USA
»Ihr Name?«, blafft die Mittvierzigerin hinter dem Empfangstresen.
Ich versuche, ihren Unmut nicht persönlich zu nehmen. Schließlich hätte ich genauso wenig Lust wie sie, einen ganzen Tag lang Zimmerschlüssel an orientierungslose Erstsemester-Studenten zu verteilen.
»Anani Marcella.« Mir stockt die Stimme, doch ich fange mich schnell. Ich schenke der Concierge mein bestes Lächeln und hoffe, dass sie eine stinknormale Amerikanerin mit Vorliebe für Football ist und keine Ahnung von europäischen »Soccer«-Clubs hat.
Sie hebt langsam eine Augenbraue – nur eine, was mich überaus fasziniert – und wirft mir einen prüfenden Blick zu. Wahrscheinlich soll er mir Angst einjagen und klarmachen, dass mit ihr nicht zu spaßen ist. Allerdings verfehlt er seine Wirkung um Längen, da ich mich immer noch frage, wie man seine Augenbrauen einzeln steuert. Ich bin mir fast sicher, dass mein Körper anatomisch nicht einmal dazu in der Lage ist. Eisern widerstehe ich dem Drang, es auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass die Empfangsdame das genauso amüsant finden würde wie ich.
Endlich zieht sie eine Plastikkiste unter dem Tresen hervor, stellt sie vor sich auf den Tisch und blättert die vielen Briefumschläge darin durch. Einer nach dem anderen fällt durch ihre Musterung. Mein Herz klopft wie verrückt, und ich bete, dass mein Name auf irgendeinem der weißen Papiere steht. Es wäre ein absoluter Albtraum, wenn sie mir gleich eröffnen würde, dass sie eine Anani Marcella leider nirgendwo findet.
Doch dann zieht die Frau einen Umschlag hervor, wirft einen letzten prüfenden Blick darauf und reicht ihn mir über den Tresen. Eilig greife ich danach und drehe ihn zwischen den Fingern. Mein Ticket in die Freiheit.
»Ihr Zimmer hat die Nummer 404 und befindet sich im vierten Stock. Auf Ihrem Schreibtisch werden Sie eine Mappe mit den Hausregeln und wichtigsten Informationen finden. Diese lesen Sie sich bitte äußerst sorgfältig durch. Jeder Regelverstoß wird geahndet und führt unweigerlich zum Rausschmiss aus Carman Hall«, erklärt die Concierge streng.
Offenbar hält sie mich für eine Rebellin. Was ihr wohl das Indiz gegeben hat? Etwa meine langen, dunklen Haare mit den unbezähmbaren Wellen? Oder doch die sonnengebräunte Haut, die mich auch im Winter so aussehen lässt, als wäre ich geradewegs von den Bahamas gekommen? Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, in Kombination mit meinem ausländischen Nachnamen. Dabei bin ich genau genommen sogar Amerikanerin. Denn ich habe nicht nur die portugiesische Staatsbürgerschaft, sondern auch die amerikanische.
Aber da ich heute einen besonders guten Tag habe – schließlich stehe ich bereits mit einem Fuß in meinem neuen Leben –, lächele ich weiter und bedanke mich freundlich.
»Sollten noch Fragen aufkommen, können Sie jederzeit auf mich oder einen Ihrer Kommilitonen zukommen.«
»Vielen Dank«, sage ich erneut. »Das werde ich.«
»Willkommen an der Columbia University«, wünscht sie mir, bevor sie mich mit einer Handbewegung fortscheucht.
Ich greife nach dem Henkel meiner Reisetasche und mache mich auf den Weg zu den Aufzügen.
Carman Hall könnte früher einmal ein Hotel gewesen sein. Der ganze Stil erinnert mich an den mehrstöckigen Hotelbunker, in dem ich die letzte Nacht verbracht habe. Die holzverkleideten Wände, die silbernen Zahlen an den Türen und der abgetretene Teppichboden, durch den an manchen Stellen schon der Untergrund hindurchschimmert. Schlimmer sind jedoch die Flecken, die ihn zieren. Ich will gar nicht erst darüber nachdenken, woher sie stammen könnten. Vor allem nicht, wenn ich überlege, wie lange Carman Hall schon ein Studentenwohnheim ist.
Im vierten von insgesamt dreizehn Stockwerken angekommen, öffnet der Aufzug seine Türen und spuckt mich auf einen langen Gang hinaus. Meine Finger krallen sich enger um den Umschlag, bis der Schlüssel darin sich durch das Papier in meine Handfläche bohrt. Prüfend schaue ich auf die aufsteigenden Zimmernummern, und meine Nervosität steigt mit jedem Schritt. Gleich ist es so weit. Das Verstecken und die Isolation haben ein Ende, und ich beginne offiziell mein neues Leben. Endlich muss ich mir keine Sorgen mehr darum machen, erkannt zu werden. Ich kann mutig und selbstbewusst und einfach nur ich selbst sein.
404. Ich bleibe stehen und starre die Tür an, die ebenso fleckig und von den vielen Jahren der Benutzung gezeichnet ist wie der Teppichboden.
Das ist es, mein neues Zuhause.
Ich habe diesem Tag so lange entgegengefiebert, dass die Gefühle mit mir durchgehen. Hastig blinzele ich die Tränen fort, die hinter meinen Augenlidern brennen. Dann klopfe ich an das dunkle Holz.
Angestrengt lausche ich, doch es reagiert niemand. Daher stecke ich meinen Schlüssel ins Schloss und öffne die Tür.
Mit pochendem Herzen blicke ich mich um und nehme all die Details in mich auf. Das Zimmer ist kahl, die Möbelstücke nur die nötigsten. Zwei schmale Einzelbetten, zwei Schreibtische, über denen schiefe, verstaubte Regalbretter hängen, und zwei Kommoden, die ebenfalls schon bessere Zeiten erlebt haben. Ich wusste zwar, dass ich eine Mitbewohnerin haben werde, dennoch lassen die gespiegelten Wandseiten die altbekannte Angst in mir aufkeimen.
Hastig schüttele ich sie ab und trete ein. Meine Füße tragen mich über den fleckigen Linoleumboden bis hin zu dem schmalen Fenster, welches sich genau gegenüber der Tür befindet. Es klemmt, als ich versuche, es zu öffnen, weswegen ich meine Reisetasche kurzerhand loslasse. Mit einem dumpfen Aufprall fällt sie zu Boden. Dennoch lassen sich die beiden Haken, die das Fenster am Rahmen halten, nicht lösen. Ich ziehe und zerre daran herum, und fluche leise. Warum lässt sich das blöde Ding nicht öffnen?
»Oh. Mein. Gott!«, kreischt plötzlich jemand hinter mir, und ich zucke so heftig zusammen, dass ich mit dem Hinterkopf gegen die Wand knalle.
»Scheiße!« Ich reibe mir die schmerzende Stelle und fahre herum.
Eine junge Frau steht im Türrahmen. Ihre langen blonden Haare, die ihr bis zur Hüfte reichen, wehen hinter ihr her wie ein Umhang.
»Oh nein«, murmelt die Unbekannte und blickt sich mit geweiteten Augen um. Sie betrachtet die staubigen Regalbretter und die in die Jahre gekommenen Betten. »Das darf doch wohl nicht wahr sein!«
Ihre knallrot geschminkten Lippen verziehen sich zu einer schmalen Linie, als sie die weißen Flecken am Boden entdeckt, deren Ursprung ich mir nicht einmal ausmalen möchte. Je mehr sie von dem Zimmer sieht, desto blasser wird ihr Gesicht, sodass ich fürchte, sie könnte jeden Moment aus ihren schwarzen, scheißteuer aussehenden High Heels kippen.
»Ähm … hallo«, sage ich, um die Frau auf mich aufmerksam zu machen.
Ihre Mundwinkel heben sich zu einem umwerfenden, einnehmenden Lächeln. »Hi, ich bin Rachel.«
Sie streckt mir ihre perfekt manikürte Hand entgegen, und ich ergreife sie.
»Anny.« Für eine so spindeldürre Figur ist ihr Händedruck bemerkenswert kräftig.
Wir lassen einander wieder los, und Rachel dreht sich in Richtung eines der Betten.
»Das ist eine Katastrophe!« Sie rümpft die Nase und zupft an der Bettdecke. »Darauf soll ich schlafen?«
Ich trete neben Rachel und betrachte das fleckige Bettzeug. Wer darin wohl schon alles genächtigt hat? Beinahe schüttelt es mich vor Ekel. Dann fällt mir wieder ein, dass ich gerade genauso gut am anderen Ende der Welt mit beiden Beinen im Chaos stehen könnte. Jahrzehnte altes Bettzeug hin oder her, dieser Ort ist meine Rettung.
»Wenn du eine hübsche, kuschelige Bettwäsche draufziehst, sieht die Sache schon ganz anders aus«, sage ich, um sie aufzumuntern.
»Du bist anscheinend eine Optimistin.«
Jetzt, da wir uns so nah sind, kann ich erkennen, dass sie eisblaue Augen hat und nicht nur ihre Lippen stark geschminkt sind. Auf ihren Wangen glitzert Highlighter, und über ihre Lider zieht sich eine perfekt geschwungene schwarze Linie.
»Entweder das, oder ich müsste die Bettwäsche im hohen Bogen aus dem Fenster werfen«, antworte ich ihr und verschweige lieber, dass sich das Fenster nicht einmal öffnen lässt.
Doch meine Aussage hat das gewünschte Ergebnis. Rachel wirft den Kopf in den Nacken und lacht. Sobald sie sich wieder beruhigt hat, legt sie mir eine Hand auf die Schulter. »Ich glaube, ich mag dich, Anny.«
»Das hoffe ich doch, schließlich werden wir die nächsten Jahre gemeinsam in diesem Zimmer wohnen.«
»Ja, leider.«
Rachel bemerkt meinen verletzten Gesichtsausdruck und hebt die Hände. »Oh, nein, entschuldige. So war das überhaupt nicht gemeint.«
Sie seufzt und setzt sich auf die Bettkante, springt aber sofort wieder auf und klopft sich die Hose ab, als hinge eine Horde Spinnen an ihrem Hintern.
»Ich brauche eigentlich gar kein Zimmer hier, denn ich wohne nur wenige Minuten von der Uni entfernt auf der Upper East Side.« Sie knirscht mit den Zähnen. »Aber mein Vater hatte den tollen Einfall, dass es mir guttun würde, ins Wohnheim zu ziehen, damit – um es mit seinen Worten zu sagen – ich auf den Boden der Tatsachen zurückgelange und mit jemand ›Normalem‹ zusammenlebe.«
Wenn Rachel wüsste … Aber wenn mein erster Eindruck auf sie normal wirkt, habe ich alles erreicht, was ich mir für meinen Umzug nach New York gewünscht habe.
»Das tut mir leid«, antworte ich und hoffe, dass ich möglichst verständnisvoll rüberkomme. Ich habe keine Ahnung, wie sich jemand Normales in einer solchen Situation verhält.
Rachel winkt ab. »Schon gut, du kannst ja nichts dafür.«
Sie dreht sich um, läuft zurück auf den Flur und holt ihre Koffer. Während ich mit einer kleinen Reisetasche um die halbe Welt gereist bin, hat Rachel drei große, knallpinke Koffer mitgebracht. Der Unterschied zwischen uns beiden könnte nicht größer sein, obwohl ich meiner zukünftigen Mitbewohnerin bis vor wenigen Monaten ähnlicher war, als sie ahnt.
Doch seitdem ist einiges passiert.
Ich grabe meine Fingernägel in meine Handflächen, um meine Angst im Keim zu ersticken. Ich darf mich nicht mehr in den Erinnerungen verlieren, keinen Moment länger in der Vergangenheit ertrinken.
»Ist dir eine der Seiten lieber?« Rachel deutet zwischen den beiden Wandseiten hin und her.
Ich schüttele den Kopf, und Rachel wählt die linke Seite. Sie pustet den Staub von der Kommode und macht sich daran, ihre Koffer auszupacken.
Meine Reisetasche liegt noch immer auf dem Boden neben dem Fenster und kommt mir im Vergleich zu Rachels gigantischen Hartschalenkoffern viel zu leicht vor. Kein Wunder, ich habe ja auch kaum etwas eingepackt, als ich Portugal verlassen habe. Nur meine liebsten Kleidungsstücke, einen iPod, ohne dessen Musikauswahl ich nicht leben könnte, und den Laptop für die Uni. Alles andere habe ich mit der Vergangenheit zurückgelassen, fest verschlossen hinter der Tür meines Jugendzimmers.
Rachel dreht sich zu mir um und bemerkt den kläglichen Inhalt meiner Tasche. »Wo kommst du denn eigentlich her?«, fragt sie mich und würde beiläufig klingen, wenn sie nicht auf meine wenigen Habseligkeiten starren würde.
Ein heißer Schauer fährt durch meinen Körper. Soll ich die Wahrheit sagen oder lieber lügen? Wenn Rachel erfährt, woher ich stamme, wie lange wird es dauern, bis sie eins und eins zusammenzählt? Bis sie herausfindet, wer ich bin?
Das darf auf keinen Fall passieren. Niemals. Nicht umsonst habe ich mein altes Leben hinter mir gelassen und mich mit einem Spitznamen vorgestellt.
»Aus Seattle«, lüge ich, weil das die erste Stadt ist, die mir in den Sinn kommt. Was vielleicht daran liegt, dass ich mir auf dem Flug hierher die Zeit mit Grey´s Anatomy vertrieben habe.
Rachel lächelt vage und schaut mir prüfend ins Gesicht. »Du sprichst aber nicht wie jemand aus Washington State.«
Ihre Feststellung lässt mir das Herz in die Hose rutschen. Warum habe ich ausgerechnet Seattle gesagt? Das Lügen muss ich definitiv noch üben, wenn ich nicht bereits nach wenigen Tagen auffliegen will.
»Meine Eltern stammen ursprünglich nicht von dort.« Wieder nicht die Wahrheit, aber auch keine direkte Lüge. Hoffentlich stellt sie diese Erklärung zufrieden.
Glücklicherweise wirkt Rachel nicht länger misstrauisch und wendet sich wieder ihren Koffern zu. Da ich wenige Minuten später meine spärlichen Sachen in die Kommode einsortiert habe, mache ich mich daran, den Raum zu erkunden. Mit gerümpfter Nase wische ich die fette Staubschicht von dem Regal über dem Schreibtisch, dass die grauen Flusen nur so durch die Luft fliegen. Bücher habe ich keine dabei, sodass das Regalbrett vorerst leer bleibt. Doch ich hoffe, es bald mit vielen Fachbüchern aus dem Universitätsbuchladen füllen zu können.
Es war eine miese Idee, das Regal mit der Hand abzuwischen, da nun der Dreck und Staub von wer weiß wie vielen Jahren daran klebt. Ich verziehe das Gesicht und laufe zu der schmalen, unscheinbaren Tür neben meinem Schreibtisch. Wenn mich nicht alles täuscht, muss sich dahinter das Bad verbergen.
Mit wachsender Neugier öffne ich die Tür, die prompt laut quietscht. Das Geräusch erregt Rachels Aufmerksamkeit, und sie dreht sich zu mir um.
»Ist das unser Badezimmer?«, fragt sie.
Ich trete einen Schritt in den Raum hinein und taste mit meiner sauberen Hand an der Wand nach einem Lichtschalter. Die Neonröhren an der Decke springen klickend an und flackern kurz, dann erhellen sie den winzigen Raum.
»Oh Gott«, entfährt es mir, bevor ich mich zurückhalten kann.
»Was?« Rachels Stimme klingt so alarmiert, dass ich schnell wieder aus dem Raum hinaustrete und die Tür mit Schwung hinter mir zuwerfe, damit meine Mitbewohnerin auf keinen Fall hineinsehen kann. Ich fürchte, dass sie sonst auf der Stelle umkippen würde und ich meine kaum vorhandenen Erste-Hilfe-Maßnahmen anwenden muss.
Rachel lässt die trendige Jeanshose fallen, die sie gerade zusammengelegt hat. Mit schnellen Schritten kommt sie auf mich zu.
»Was ist da?« Sie versucht, sich an mir vorbeizuschieben.
Hastig drücke ich mich mit dem Rücken gegen die Tür und versperre ihr somit den Weg. »Das Badezimmer, aber …« Ich presse die Lippen aufeinander. Wie soll ich es ihr am besten sagen? Wie wird sie auf das Bad reagieren, wenn sie wegen des Wohnraums schon so entsetzt war?
»Aber was?«, zerschneidet sie mit scharfer Stimme meine Gedanken.
»Vielleicht solltest du dir das Bad lieber nicht ansehen. Du kannst auch zu dir nach Hause fahren, um dort zu duschen«, schlage ich vor und komme mir dabei langsam selbst dämlich vor.
Sie hebt die Brauen und sieht mich abwägend an. Aber ich denke nicht mal daran, meinen Wachposten aufzugeben.
»Na los, zeig schon her. Ich verspreche auch, keinen Anfall zu bekommen.« Sie streicht sich eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr, bevor sie lächelt.
»Erwarte bloß keine Hilfe, wenn doch«, sage ich halb im Scherz und trete einen Schritt beiseite, damit sie die Tür öffnen kann.
Mit gestrafften Schultern betritt Rachel das Badezimmer und erstarrt, sobald ihre Füße sie über die Schwelle trugen. Völlig reglos steht sie da, ein, zwei, drei Sekunden lang, bevor sie sich die Hände vor den Mund schlägt.
»Ach du Scheiße!« Der Fluch dringt erstickt unter ihren Fingern hervor. Dann macht Rachel auf dem Absatz kehrt und flüchtet so hastig aus dem Raum, dass sie beinahe über ihre hohen Schuhe stolpert.
»Das ist … das ist einfach …«, stammelt sie fassungslos und wedelt mit den Armen. Sie sucht offenbar nach den richtigen Worten, um das Badezimmer zu beschreiben.
Erneut werfe ich einen Blick in den winzigen Raum, in dem es lediglich ein von Rissen durchzogenes Waschbecken, eine Toilette und eine schmale Dusche gibt. In den Fugen haben sich Schimmelränder gebildet, und der Boden ist völlig verdreckt. Natürlich hat das Bad kein Fenster, wodurch sich die vielen Stockflecken an der Decke erklären lassen.
»Unzumutbar!«, ruft Rachel, als ihr endlich ein passendes Wort eingefallen ist.
Ich schalte das Licht im Bad aus. Der ganze Schmutz ekelt mich und kratzt an meiner Selbstbeherrschung. Am liebsten würde ich genauso entsetzt wie Rachel durch den Raum stöckeln und mich darüber aufregen, wie heruntergekommen dieses Wohnheimzimmer ist. Doch im Gegensatz zu ihr habe ich keine Luxuswohnung um die Ecke, zu der ich flüchten kann, wenn es mir in Carman Hall zu viel wird. Mich trennen Tausende Kilometer von meinem Zuhause, und die Wartelisten für andere Wohnheime sind lang. Ich muss mich wohl oder übel hiermit abfinden.
Und mir einen Notfallplan überlegen. Was brauche ich alles, um den Schimmel zu entfernen und einen benutzbaren Raum aus dem Badezimmer zu machen?
Rachel hat sich längst ihr Handy geschnappt und tippt aufgeregt auf das Display ein. Dann hebt sie es an ihr Ohr und wartet mit tippender Fußspitze darauf, dass ihr Anruf angenommen wird.
»Na komm schon, Dad.« Sie flucht. »Geh doch wenigstens nur ein einziges Mal ans Telefon!«
Mit gerunzelter Stirn blickt sie an mir vorbei aus dem Fenster. Dann hellt sich ihr Gesicht schlagartig auf.
»Dad!« Rachel seufzt erleichtert in den Hörer. »Gut, dass du rangehst, ich …«
Eine männliche Stimme unterbricht sie, doch ich kann nicht verstehen, was sie sagt. So unauffällig wie möglich schiebe ich mich an Rachel vorbei zum Schreibtisch, weil ich ihr Gespräch nicht belauschen möchte.
Ich klappe meinen Laptop auf und verbinde ihn mit dem Wohnheim-Wifi. Dass es grottenschlecht und superlangsam ist, bemerke ich, sobald ich nach einem Supermarkt in der Nähe googele.
»Aber …«, beginnt Rachel hinter mir, bevor sie unterbrochen wird. Wenige Sekunden später ist das Gespräch vorbei.
Ich drehe mich zu ihr um und ertappe sie dabei, wie sie sich über ihre feuchte Wange wischt. Sobald sie meinen Blick bemerkt, strafft sie die Schultern und setzt einen unbeteiligten Gesichtsausdruck auf.
»Dad muss gerade arbeiten, ich telefoniere später noch mal mit ihm.« Ihre Stimme ist eine Spur zu heiter. Wüsste ich nicht genau, wie sie sich fühlt, könnte sie mich täuschen. Ich selbst habe mein Leben lang im Schatten meines Vaters gestanden.
Daher tue ich so, als hätte ich nicht bemerkt, wie sehr das kurze Telefonat sie enttäuscht hat. Ich deute auf den Bildschirm meines Laptops. »Hier in der Nähe ist ein Supermarkt. Wir kaufen uns Putzzeug, einen netten, flauschigen Vorleger und ein hübsches Pflänzchen – und dann sieht das Bad gleich ganz anders aus«, sage ich, um sie aufzuheitern.
Rachel lacht auf. »Ein Teppich und eine Pflanze? Wirklich? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass irgendwas dieses Drecksloch retten könnte!«
»Alles ist besser als der jetzige Zustand.« Ich klappe den Laptop zu. »Also, was ist, kommst du mit?«
Sie grummelt etwas, greift im nächsten Moment aber nach ihrer Handtasche.
»Wie kannst du nur so positiv bleiben?«
»Wenn ich die Situation nicht positiv sehen würde, würde ich in Tränen ausbrechen und einen Anfall kriegen. Und das ist für mich keine Option«, antworte ich.
Ich schnappe mir Geldbeutel und Handy und stopfe beides in die Taschen meiner Jeans. Dann verlassen Rachel und ich das Zimmer.
»Es gibt nur eine Sache, die mich heute noch aufmuntern kann«, sagt sie, als wir auf einen der Aufzüge warten.
»Und die wäre?«
»Pizza«, seufzt Rachel. »Eine große Pizza Funghi und eine Zweiliterflasche Cola. Mit Zucker natürlich. Davon schicke ich dann meinen Eltern ein Bild, und sie holen mich schneller zurück nach Hause, als ich Schimmel sagen kann.«
Sie meint es bitterernst, dennoch muss ich lachen. Rachel ist mir auf eine verschrobene Art und Weise sympathisch. Sie ist eine Dramaqueen, neigt zur Überreaktion und hat eindeutig zu hohe Ansprüche. Doch ihre selbstbewusste, witzige Art lässt mich zum ersten Mal seit Monaten wieder herzhaft lachen. Und das hat schon lange niemand mehr geschafft. In mir beginnt ein Funken Hoffnung zu keimen, dass ich es schaffen kann, die Vergangenheit endlich hinter mir zu lassen.
»Na, dann los!« Ich drücke den Knopf für das unterste Stockwerk. »Zeig mir, wo es die beste Pizza der Stadt gibt.«
Kapitel 3
Am Freitagnachmittag seufzt Rachel theatralisch. »Was für eine Woche!« Sie drückt die gläserne Flügeltür auf, die aus dem Vorlesungsgebäude nach draußen führt. »Es ist gerade mal eine Woche Uni rum, und ich fühle mich, als wäre ich um hundert Jahre gealtert.«
Mittlerweile bin ich es gewohnt, dass Rachel dazu neigt, maßlos zu übertreiben. Obwohl sie nicht ganz unrecht hat, die vergangene Woche sind wir jeden Abend todmüde ins Bett gefallen.
»So schlimm war es doch gar nicht«, antworte ich ihr und richte den Träger meines Rucksacks. Durch die Unmengen an Bibliotheksbüchern ist er heute schwerer als sonst.
Rachel beäugt mich kritisch. »Deine Tasche platzt fast aus allen Nähten.«
»Darin befinden sich ja auch die Bücher für Literatur, Physik, Anthropologie …« Ich zähle die einzelnen Fächer an meinen Fingern ab. In den ersten beiden Jahren des Studiums liegt der Schwerpunkt auf Allgemeinbildung, bevor wir uns endgültig auf ein Hauptfach festlegen. »Ich habe so ziemlich die gesamte Literaturliste ausgeliehen.«
Rachels Augen weiten sich. »Wann hast du das denn gemacht?«
»Während du dir in der Mittagspause einen extragroßen Vanilla-Latte bei Starbucks geholt hast.« Ich kann den leicht vorwurfsvollen Unterton in meiner Stimme nicht verbergen.
Rachel runzelt die Stirn, ihr Blick wandert vom Rucksack zu mir und zurück. »Sorry, Anny, aber wenn die Wahl zwischen Kaffee und Büchern steht, dann wird die Bibliothek mich wohl niemals zu Gesicht bekommen.«
Ich muss so sehr lachen, dass der Träger erneut von meiner Schulter rutscht. Während der letzten Woche sind mir Rachels sarkastische Kommentare ans Herz gewachsen. Sie macht sich keinen Kopf darüber, was andere von ihr denken, und strahlt ein Selbstbewusstsein aus, von dem ich nur träumen kann.
Irgendwann, verspreche ich mir selbst. Schritt für Schritt hole ich mir die Kontrolle über mein Leben zurück und lasse meine Ängste und Dämonen hinter mir.
»Kulturbanause«, hüstele ich. In den Büchern verbergen sich unzählige Seiten Wissen, die wir in Diskussionsgruppen besprechen werden. Wenn ich schon die ersten beiden Jahre Uni schleifen lasse, werde ich mit meinen Plänen, später im Hauptfach Jura zu wählen, nicht weit kommen.
Ein durchdringendes Läuten reißt mich aus meinen Gedanken.
»Meins ist es nicht.« Rachel hat ihr Handy bereits gezückt.
Ich hole mein Telefon aus meiner Hosentasche. Das Display zeigt einen eingehenden Anruf von Mom.
»Geh ruhig schon mal vor«, sage ich zu Rachel. »Das ist meine Mutter. Durch die Zeitverschiebung möchte ich sie ungern warten lassen.«
»Na klar, bis später.« Meine Mitbewohnerin verabschiedet sich winkend von mir und biegt um die nächste Ecke.
Ich nehme den Anruf an.
»Hello, Mom«, begrüße ich sie auf Englisch. Meine Mutter ist gebürtige Amerikanerin und kommt aus einem kleinen Vorort von New York. Sie hat ebenfalls an der Columbia studiert, sodass mir die Wahl der Universität nicht schwerfiel. Mittlerweile wohnen unsere engsten Verwandten alle in Portugal, aber meine Eltern haben mich bilingual erzogen, sodass ich beide Sprachen fließend spreche.
»Anani!«, ruft sie gleichermaßen erleichtert wie tadelnd. »Wieso hast du dich nicht gemeldet? Ich mache mir Sorgen, mein Schatz.«
»Letzte Woche war einiges los. Die Einführungsveranstaltungen haben mich ganz schön auf Trab gehalten.«
»Na gut, aber ab jetzt meldest du dich wieder regelmäßig, versprochen?«
»Versprochen«, antworte ich lächelnd. Meine Mutter schafft es selbst durch das Telefon hindurch, dass ich mich geliebt fühle.
»Aber jetzt erzähl mal. Wie ist es dir letzte Woche ergangen? Ich will jedes Detail hören!«
Ich blicke mich im Innenhof um und entdecke eine Bank im Schatten eines ausladenden Baumes. Zielstrebig gehe ich darauf zu.
»Geht es dir denn gut?«, fragt meine Mutter, als ich eine Weile nicht reagiere.
»Ja, Mom, mir geht es gut. Ich fühle mich hier wirklich wohl. New York ist groß, voll und laut. Die Stadt ist perfekt für jemanden wie mich.«
»Für jemanden wie dich?«
»Du weißt schon …«
Sie schweigt einen Herzschlag lang, dann nimmt ihre Stimme einen strengen Unterton an. »Wann wirst du endlich aufhören, so ein schlechtes Bild von dir zu haben, Anani? Du bist wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Dein Vater hat keine Krankheit, seine Berühmtheit ist kein Fluch. Wann verstehst du das endlich?«
Und doch bin ich anders, füge ich in Gedanken hinzu. Aber es hat keinen Zweck, mit meiner Mutter zu diskutieren. Dieses Gespräch haben wir schon Hunderte Male geführt.
»Jedenfalls …« Ich wechsele das Thema. »Die Uni ist toll. Bisher haben wir noch nicht viel gelernt, aber gerade eben hatte ich meine erste richtige Vorlesung.«
»Das freut mich zu hören, mein Schatz. Bist du dir denn immer noch sicher mit deinen Plänen für deinen Major?«
Nicht nur New York ist ein Streitpunkt mit meinen Eltern gewesen. Dass meine Wahl ausgerechnet auf Jura gefallen ist, missfällt ihnen ebenso. Sie sind der Meinung, dass ich überstürzt und emotional handele. Dass meine Entscheidung für die Juristerei allein daher rührt, was mir in der Vergangenheit und in Lissabon widerfahren ist.
Und ja, möglicherweise haben sie recht. Früher wäre mir niemals in den Sinn gekommen, Jura zu studieren. Doch jener Abend vor acht Monaten hat mir die Augen geöffnet. Jetzt kann ich mir kein anderes Fach mehr vorstellen außer Recht, weil ich mich nicht länger machtlos fühlen und der Vergangenheit Gerechtigkeit zollen will.
»Entspann dich, Mom. Ich muss mich doch erst im nächsten Studienjahr für ein Hauptfach entscheiden«, antworte ich schließlich.
»Gut.« Mehr sagt sie dazu nicht, und ich bin froh drüber. Ich möchte mich nicht mit ihr streiten. Nicht, wenn ich Tausende Kilometer von ihr entfernt bin.
»Hör mal, Anani. Dein Vater und ich wollten noch mit dir über eine andere Sache sprechen.«
»Ja?« Ich runzele die Stirn. Sie klingt besorgt, und ich habe das Gefühl, dass mir diese Sache nicht gefallen wird.
»Du weißt, wir unterstützen dich sehr gerne in allem, was du tust. Aber dass du so weit weg bist, bereitet uns Sorgen. Daher haben wir uns informiert, und es ist immer noch möglich, zum Wintersemester hier in Portugal an einer Universität für Jura eingeschrieben zu werden.«
Eigentlich dachte ich, wir sind längst über diese Diskussion hinaus. »Mom, wir haben das doch geklärt. Ich möchte hier sein, in New York.«
»Wenn dir etwas passiert, können wir dir nicht helfen. Wir sind viel zu weit weg!«
»Ich bin alt genug, ich kann mir selbst helfen«, sage ich wütend. Wann hören sie endlich auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln?