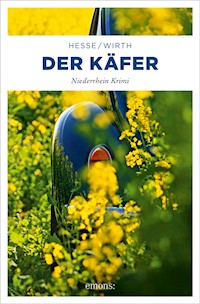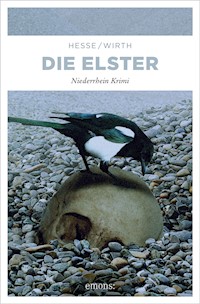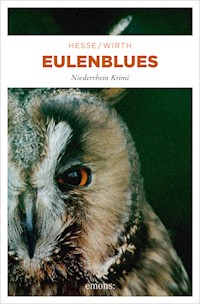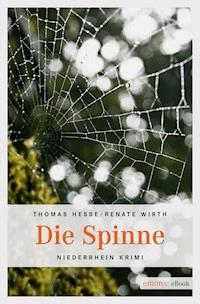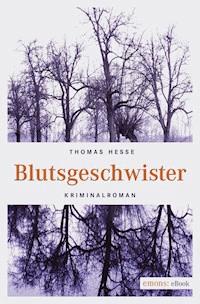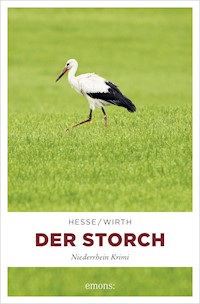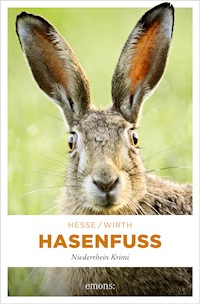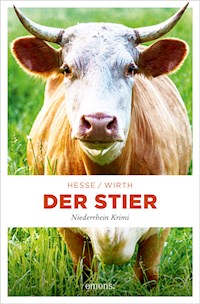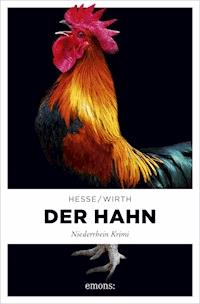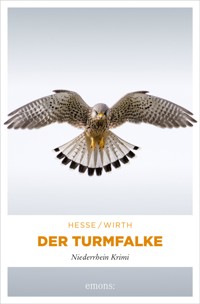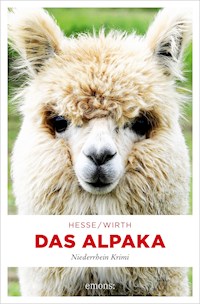
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Krafft
- Sprache: Deutsch
Heimatverbundene Niederrheiner, gierige Kiesbarone und störrische Altbauern – ein Krimi aus dem Herzen der Region. Am Niederrhein brodelt es: Die Kiesindustrie mit ihrem Landhunger trifft auf Widerstand – und spaltet Generationen. Junge Öko-Bauern geraten in Konflikt mit ihren konventionell ackernden Vätern und wollen zu allem Überfluss auch noch Alpakas züchten! Der Streit eskaliert, als ein Bauer tot im Schweinekoben gefunden wird. Der Staatsanwalt hält dessen Sohn für den Täter, doch Kommissarin Karin Krafft will unbedingt ein Fehlurteil verhindern. Innerhalb des Weseler K1 entbrennt ein hitziger Disput, der die Abteilung für immer zu zerreißen droht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hesse, Jahrgang 1953, lebt in Wesel, ist gelernter Germanist, Kommunikationsberater und Journalist. Er war bis Ende 2014 in leitender Position bei der »Rheinischen Post« am Niederrhein tätig. Heute ist er freier Autor, Journalist und Publizist.
Renate Wirth, Jahrgang 1957, arbeitet als Gestalttherapeutin für den Deutschen Kinderschutzbund, ist Künstlerin und Autorin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: picture alliance/imagebroker
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-608-1
Niederrhein Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Da jagen sich die Rätsel: Warum is hier nix los un doch alles los? Un woanders is alles los un gar nix los? Der Niederrhein, denk ich immer, macht einem nix vor.
Prolog
Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich hier vorgetragen. Auf mehr als dreißig Seiten habe ich, Stefan van de Sandt, niedergeschrieben, was passiert ist in diesem Fall, der mich vor das Schwurgericht gebracht hat. Ich habe ein reines Gewissen, und ich weiß nicht, wie dieser verdammte Fuß in den Schweinekoben gekommen ist. Auf unserem Bauernhof herrscht Ordnung, überhaupt werden Vadders Tiere nicht mit Fleischresten gefüttert. Wir haben einen Biohof oder zumindest fast, wenn die Umstellung weg von der konventionellen Arbeitsweise beendet ist. Wenn alle Zertifikate vorliegen und wir damit werben können, einer der wenigen biodynamischen Betriebe zu sein.
Der Hofladen beginnt sich schon zu rentieren. Das kleine Café ist beliebt, Radfahrer steuern uns an. Wir könnten jetzt einen Spielplatz anlegen, das passende Ziel für Familienausflüge. Gesunde Lebenshaltung und saubere Lebensmittel lassen sich die Leute etwas kosten. Nicht alle, im Grunde eine gesundheitsbewusste Elite, die es sich leisten kann. Aber die Bewegung, die für eine verträgliche Lebensweise kämpft, wächst. Die finanziell dürre Zeit des Wechsels muss ich eben einkalkulieren, ich denke vom langen Ende her. Das hat der Alte nicht kapiert. Er hat es mit seiner sturen Art auf einen Knall, ach was, ein Zerwürfnis ankommen lassen. Im Grunde auf das Ende einer heilen Familie, er hat gespalten. Eine Schlacht der alten gegen die neue Welt.
Jetzt ist er weg, wie in Luft aufgelöst. Nur ein ominöser Fuß ist geblieben, der Rest eines makabren Mahls für einen Zuchteber. Mehr weiß ich nicht.
Alles, was ich zu sagen hatte, habe ich niedergeschrieben. Ja, das ist die reine Wahrheit, doch ich muss sie noch und noch wiederholen. Ich habe nichts getan, ich bin unschuldig. Ich habe vorgelesen von dreißig dicht beschriebenen Blättern, damit ich mich vor Aufregung nicht verhaspele. Das muss jetzt genügen.
Ohne Hast schiebe ich die vor mir liegenden Ausdrucke zusammen, ein kantengenauer Stapel verschwindet in meiner Aktenmappe. So ordentlich und gerade wie mein Leben. Die Wahrheit wird siegen.
Nein, ich stehe jetzt nicht auf und gehe einfach hinaus in die Freiheit. Man glaubt mir einfach nicht. Ja, ich muss aufpassen, dass meine Gedanken nicht Karussell fahren. Ich sitze hier vor dem Schwurgericht, das als auswärtige Strafkammer in Moers tagt. Nur weil dieser unglaubliche Mord links vom Rhein passiert ist in meinem winzigen geliebten Alpen-Drüpt. Der Tatort bestimmt die Zuständigkeit, eigentlich überflüssiges Wissen. Nur in meiner Situation nicht.
Eine gezielt gebaute Machtdemonstration ist dieses Gericht mit seinen hohen Räumen und präsidialen Aufgängen, dass man sich verdammt klein fühlt als Angeklagter. Ich habe gelernt, dass ich hier in Moers von einem Staatsanwalt angeklagt werde, der alles getan hat, um in den zwei Landgerichtsbezirken Duisburg und Kleve tätig sein zu können. Ein harter Hund, wie man landläufig sagt. Das ist mein Verhängnis.
Seit zwei Wochen hocke ich hier auf der seitlichen Bank im Gerichtssaal, ich sitze nicht selbstbewusst aufrecht, ich verfolge zusammengesunken Rede und Gegenrede, Vernehmungen und Zeugenaussagen und das Plädoyer, bei dem sich der gegenüber der Angeklagten- und Verteidigerbank stehende Staatsanwalt in Rage redet.
Der Mann, der mir als Staatsanwalt Haase bekannt geworden und menschlich fremd geblieben ist als einer, der Härte ausstrahlt und in einer weltfernen juristischen Sprache selbstgewiss auftritt, als sei meine Verurteilung als Mörder nur eine Formsache, soll eine Berühmtheit sein und schon viele Schwerkriminelle überführt haben. Sagt man mir mit bedenklicher Miene. Ich habe zuvor noch nie etwas von ihm gehört.
Er steht kerzengerade. Eine Erscheinung, die man als imposant bezeichnen könnte und die den größten vorstellbaren Gegensatz zu mir darstellt. Zu dem Menschen vom Land, jung, groß gewachsen, braun gebrannt zwar und sehnig, aber unsicher und fahrig. Wie bin ich nur hierhergekommen?
Die Richterin und die Geschworenen blicken Staatsanwalt Haase aufmerksam an.
»Und so ist es eindeutig, dass der im Schweinekoben des van de Sandtschen Anwesens unter schrecklichen Umständen aufgefundene Fuß einem bestimmten Opfer zuzuordnen ist. Dieses Opfer, der Vater des Angeklagten, ist bis zum heutigen Tag verschwunden.«
Haase macht eine Kunstpause, schaut die Geschworenen direkt und offen an und spricht ebenso ruhig wie überzeugend: »Die Indizien sind eindeutig, die Kette der Beweise kennt keine Lücke. Auch wenn die Kriminalpolizei Wesel sicher Fehler gemacht hat. Zweifel hat die Staatsanwaltschaft nicht, dass der Angeklagte der Täter ist. Ein heimtückischer Mord innerhalb der Familie.«
Ich sacke nicht zusammen, ich weiß, auf welches Urteil er hinauswill. Ich habe es erwartet. Es steht auf des Messers Schneide. Ich lasse mich auch nicht ablenken durch das harte hölzerne Geräusch im Zuschauerraum, als habe jemand den Klappsitz vor die Rückenlehne geschlagen. Es regt mich auch nicht auf, dass der Mann in der Robe nebenbei die Kriminalpolizei vorführt.
Staatsanwalt Haase, der so viele Fälle gemeinsam mit dem Weseler K1 bearbeitet hat, kennt nur die eine Richtung in seinem Plädoyer: ein Mordurteil, lebenslänglich, sogar Sicherheitsverwahrung angesichts besonderer Heimtücke. So kommt es, seine Forderung hallt in der Stille des Gerichtssaals wie ein von der Holzvertäfelung lautstark vervielfältigtes Echo in den Raum. Ich will aufspringen, ihm ein »Nein« entgegenschleudern. Doch ich kann nicht.
Im Zuschauerraum jedoch entsteht nach einer ohnmächtigen Sekunde Raunen und Rufen. Einer sagt: »Der Haase will einen Erfolg, vom Ehrgeiz zerfressen.« Ein anderer stimmt zu.
Über einen solch persönlichen Antrieb habe ich nie nachgedacht. Von den Ambitionen dieses Staatsanwalts habe ich nie gehört. Sie hätten mich nicht interessiert. Mein Verteidiger ist blass geblieben im Vergleich zum Auftritt der Anklage, geradezu abgefallen. Es geht vor Gericht doch um Recht und Gerechtigkeit. Ich glaube an das Gute und an die Wahrheit, die sich durchsetzt. Ich bin naiv, doch bin ich einfach ein zu gutgläubiger Provinzler?
»Lassen Sie mich vorbei.« Eine energische Stimme dringt zu mir durch. Ich blicke auf. Die Hauptkommissarin ist aufgesprungen, dort, woher das hölzerne Geräusch gekommen ist. Karin Krafft heißt sie, sie hat mich fair behandelt in den Verhören. Ihr Gesicht schaut zerfurcht aus, ihr Blick ist steinern. Sie macht eine wegwerfende Geste in Richtung Haase. Ich bin ihr dankbar, dass sie im Zeugenstand ihre Ermittlungsergebnisse kritisch dargestellt hat. Sie will nicht die unfehlbare Superfrau vom K1 in Wesel sein, die schon so viele spektakuläre Fälle durchgestanden hat. Sachlich nennt sie die Punkte, die im Zweifel für den Angeklagten sprechen. Nun drängt sie sich durch die Zuschauerreihen. Nur weg hier.
Ich höre, wie einer sagt: »Die Krafft haut ab. Ein glänzendes, ein schlüssiges Plädoyer, das hat sie nicht verkraftet. Das gibt eine Verurteilung.«
Der Nachbar erwidert: »Das wäre ein Fehlurteil.«
Zwei Meinungen, eine wird sich bei der Beratung des Gerichts durchsetzen müssen. Staatsanwalt Haase hat für die Richtung gesorgt. Karin Krafft hat sich ihre Meinung schon gebildet.
Ich weiß, wie das Urteil heißen wird. Ich, Stefan van de Sandt, ein Vatermörder.
EINS
Stefan van de Sandt lehnte sich an die Wand neben der Stalltür. Er hörte die Unruhe, die zweihundert Schweine bei der Fütterung verursachten. Das Quietschen und Grunzen schwoll zu einer höllischen Lautstärke an, die die automatische Futterstraße übertönte. Er wusste, dass es sinnlos war, den Stall zu betreten, sein Vater würde ihn nicht hören, würde die Augen nicht von seinen Schweinen lassen.
Vadder war bei der täglichen Inspektion, beobachtete gründlich, ob alle Tiere über ausreichenden Appetit verfügten. Der kleinste Hinweis auf ein Unwohlsein wie mangelhafte Futteraufnahme konnte einen riesigen Verlust bedeuten. Es gab Krankheiten, die sich blitzschnell in einem ganzen Bestand ausbreiteten, in einem Landstrich, einer kompletten Region. Schweinebauer Willy van de Sandt und seine Zunft fürchteten die Schweinepest, schauten den wandernden Wildvögeln skeptisch nach, die im Verdacht standen, als Überträger von Erregern zu fungieren, fürchteten die Wildschweine in den nahen Wäldern. Dem Alten entging nichts. Zweihundert Mastschweine, fast schlachtreif, beste Zuchtsauen, ein preisgekürter Eber, da galt es besonders aufmerksam zu sein.
Stefan, sein einziger Sohn, hatte die Schweine nie ausstehen können, verweigerte die Arbeit im Stall, das Ausbringen der Gülle. Schon als Kind hielt er sich die Ohren zu, wenn der Viehhändler die Tiere in den Transporter trieb. Der Alte freute sich über das Geschäft und wartete auf den Nachwuchs, für den sein ganzer Stolz, der Zuchteber Willi, immer wieder willig seinen Samen spendete. Klein-Stefan stand nur wie versteinert an der Stalltür und verzog angeekelt das Gesicht. Jahrelang hatte der alte Viehzüchter geglaubt, alles läge nur daran, dass der Junge ohne seine Mutter aufwachsen musste.
Komisch, was ihm durch den Kopf ging, während drinnen der Tumult abebbte.
Mutter war an einem Aneurysma gestorben, einer geplatzten Ader im Hirn, innerlich verblutet, im Stall, bei den Schweinen, wo der Junge sie fand und zum Aufstehen bewegen wollte. Noch heute, sagte der Alte, höre er ihn in verzweifeltem Ton unablässig rufen: »Mama, steh doch auf. Du musst aufstehen. Mama, steh doch auf …« Vadder hatte ihn am Arm gepackt und auf die Bank neben der Küchentür gesetzt, bevor er den Hausarzt anrief, der gleichzeitig mit einem Rettungswagen eintraf. Wie in Trance hatte Stefan dagesessen, sich nicht von der Stelle gerührt, bis der große schwarze Wagen erschien, zwei dunkel gekleidete Männer eine Kiste auf Rädern aus dem Heck in den Stall rollten und wieder hineinschoben. Erst nachdem das letzte fremde Fahrzeug vom Hof gefahren war, hatte sich der Vater zu seinem Sohn gesetzt, die Kappe in die Hand genommen und nur einen Satz gesagt: »Sie hat uns alleine gelassen.«
Dieser Satz ging Stefan jetzt, fünfundzwanzig Jahre nach ihrem plötzlichen Tod, wieder durch den Kopf. Seine Mutter hatte den Vater und ihn allein gelassen. Sie wäre begeistert gewesen über seine neuesten Vorhaben, die er gemeinsam mit seiner Frau Bine vom Nachbarhof entwickelt hatte.
Der Alte war mit Teil eins seiner Zukunftspläne noch zufrieden gewesen: Stefans Heirat mit seiner Liebsten vor fünf Jahren. Sabine Brömkamp-van de Sandt hieß sie nun. Das sei niederrheinischer Adel, hatte Willy van de Sandt bei der Hochzeit nach der zweiten Flasche Korn zufrieden herumposaunt. Hinter seiner Freude stand der Gedanke, dass ihm früher oder später mit dieser Einheirat auf dem nachbarlichen Gehöft mehr Ackerfläche zum Futteranbau für seine Schweine zur Verfügung stehen würde. In Gedanken baute er am Tag nach der Hochzeit, als der ausgewachsene Kater seinen Kopf wieder verlassen hatte, einen modernen zweiten Schweinestall und prophezeite seinem Zuchteber Willi weitere vielzählige Nachkommenschaft, während er ihm den Nacken schrubbelte. Statt des eigenen Sohnes lief ein Lohnarbeiter durch den Stall, Georg Brunner half wortkarg, zuverlässig.
Stefan und Bine hatten andere Pläne, nahmen an Fortbildungen teil, ließen die Böden prüfen, stellten künstliche Düngung, chemische Bearbeitung und auch das Ausstreuen von Schweinemist ein, und bevor Willy van de Sandt sich’s versah, wurde der verheißungsvolle Nachbarhof umgewandelt in einen Biohof, auf dem die Kinder ökologischen Gemüseanbau betrieben. Grünzeug.
Schließlich eröffneten sie auch noch eine kleine Holzhütte, wie man sie neuerdings an manchen Hofeinfahrten sah, verkauften eigene Produkte an Menschen, die von Fahrrädern abstiegen oder sich aus dicken SUVs schälten. »Bines Bauernlädchen«. Stefan wusste, schon das Schild ließ seinen Vater erschauern. Van de Sandt senior verstand die Welt nicht mehr, wartete insgeheim auf das Scheitern, das der Vater seiner Schwiegertochter milde lächelnd akzeptieren würde. Die Jungen wüssten schon, was sie tun. »Sollen sie machen, was sie wollen, ich habe damit nichts mehr zu schaffen.«
Willy van de Sandt hatte seinen Nachbarn Gisbert Brömkamp bereits vor Jahren für bekloppt erklärt.
Im Stall wurde es ruhiger, Stefan stand in der prallen Sonne, schwitzte, wusste nicht einzuschätzen, ob es an der Hitze oder dem bevorstehenden Gespräch mit seinem Vater lag. »Gespräch« war der falsche Begriff. Er ahnte, dass es in einem Streit enden würde. Bine hatte ihm den Auftrag erteilt, den störrischen Alten zu informieren.
Die Stalltür sprang auf, ein Schwall Mief verfolgte den Landarbeiter Brunner, der fast täglich für ein paar Stunden half und mit knappem Gruß an ihm vorbeilief. Dann erschien der Patriarch, vom Kopf über den prallen Bauch bis zum Fuß ganz und gar der alte Schweinebauer, dem es nur selten gelang, nicht nach seinem Viehbestand zu riechen.
»Stefan, seltener Besuch. Willst du mal wieder die echten Gerüche der Welt schnuppern?«
Der Sohn wich der entgegengestreckten Hand des Vaters aus. »Ich muss mit dir reden.«
»Worüber? Hast du sie endlich geschwängert?«
Damit hätte er rechnen müssen, es traf ihn unvermittelt. »Kannst du an was anderes denken als an Enkelkinder?«
»Wat isset dann?«
»Wir haben Tiere gekauft, die werden morgen hergebracht. Bine meint, du sollst Bescheid wissen.«
Stefan folgte dem Alten, der eilig und von der täglichen Arbeit gekrümmt in Richtung Wohnhaus lief. Mitten auf dem Hof fragte er seinen Sohn im üblichen niederrheinischen Dialog kurz und knapp: »Und?«
»Wie, und?«
»Ja, wat wird et?«
»Was meinst du? Was wir gekauft haben?«
»Ja, nu sachet endlich, werden schon keine Elefanten sein.«
Noch war der Alte in Bewegung, noch lief er auf die Küche zu. Stefan schluckte einmal, räusperte sich, spuckte die Worte auf den gepflasterten Untergrund.
»Morgen werden vier Alpakas bei uns einziehen.«
Willy van de Sandt blieb stehen. »Wat?«
»Bine will Alpakas.«
Der Alte stand sehr schnell ganz nah vor dem Jungen, der Schweinegeruch stieg ihm in die Nase. Die Antwort war begleitet von kleinen, zornig fliegenden Spucketröpfchen, denen es geschickt auszuweichen galt.
»Wat willst du mit diesen langhaarigen Viechern? Die fressen dein Gras, die brauchen Platz im Stall, die kannst du nicht essen, und die legen keine Eier. Alpakas! Bine will Alpakas, und du bestellst gleich ein Quartett. Wat sollen die Nachbarn sagen? Alpaka-Hippies – so nützlich wie Meerschweinchen. Obwohl man die ja noch essen könnte. Wat will deine Frau mit diesen glotzäugigen Vierbeinern?«
»Eine Zucht aufbauen. Alpakas und Alpakawolle vom Brömkampshof.«
Der Alte kochte und sah keinerlei Grund, dies vor seinem Sohn zu verbergen. »So eine hirnverbrannte Idee! Alpakahof. Tzz, ›Bines Bauernlädchen‹ ist schon so eine Spinnerei, oder könnt ihr inzwischen davon leben? Und sich jetzt auch noch statt wat richtig Lukratives mehr Arbeit an et Bein zu binden – ihr könnt doch nicht ganz richtig im Kopp sein.«
Stefan schnaubte, ballte seine Fäuste, ging ein paar Schritte rückwärts, wandte sich ab und lief. Er ließ seinen Vater stehen, drehte sich nach einigen Schritten noch einmal um. So wütend war er selten auf den Alten. Er erschrak über die Lautstärke seiner Stimme. »Immer musst du alles kritisieren, regelrecht in den Boden stampfen. Du bist so … so verbohrt, echt!«
Er kam wieder drei Schritte auf seinen Vater zu, deutete mit dem Zeigefinger auf ihn.
»Alle Menschen lieben Alpakas! Alle außer dir. Dieser possierliche Blick aus den großen, dunklen Augen mit den langen Wimpern dringt in jedes Herz, es sei denn, es ist so versteinert wie deins. Das sind friedfertige Pflanzenfresser. Sie liefern Wolle, besonderen, teuren Rohstoff für hochwertige Kleidung. Zugegeben, sie stammen aus Südamerika, aus den Anden, es gibt riesige Herden in Peru, aber unsere kommen aus einer hiesigen Zucht in Ringenberg.«
Stefan sah seinem Vater die Unbeugsamkeit an, wollte jedoch nicht weichen, dieses Mal nicht.
»Und zum Glück ist es kein Muss, Tiere zu essen. Seit ich denken kann, dreht sich in deinem Kopf alles um Schnitzel, Filet und Schweinshaxen, du denkst in Kilopreisen und Reingewinn. Weißt du was? Du kotzt mich einfach nur an.«
Stefan wandte sich grußlos ab, stieg auf sein Fahrrad und trat in die Pedale. Daheim gab es Besseres zu tun, als sich von einem Sturkopp beschimpfen zu lassen.
Der Alte schaute seinem Sprössling kopfschüttelnd nach, bevor er vor der Küchentür die Gummistiefel von den Füßen streifte.
»Alpakas! Gibbet in keiner Fleischtheke.«
***
Es war der heißeste Sommer aller Zeiten. Egal, wen man fragte, jeder bestätigte das Ungewöhnliche, für die niederrheinischen Breiten Traumatische, beklagte die unerträgliche Hitze, verbunden mit der permanenten Trockenheit. Wälder und Felder gingen in Flammen auf, das Getreide mickerte auf rissigen Böden. Der historische Tiefststand des Rheinpegels ließ die Binnenschiffer nur halbe Ladungen transportieren und fand sich, mit Foto, als Nachrichtenzeile in der New York Times wieder. Die lokalen Zeitungen waren sowieso voll vom Thema Dürre. Wochenlang.
Stefan van de Sandt stand ungläubig vor dem summenden Stromzähler an der Kellerwand und beobachtete, wie sich das gezahnte Rad unaufhörlich drehte, die Zahlen unbarmherzig dokumentierten, was sich auf der Rechnung wiederfinden würde. Diese Saison entwickelte sich zum Desaster. Das neue Bauernlädchen würde ihm und seiner Frau finanziell das Genick brechen. Er musste einen kühlen Kopf bewahren. Trotz der besorgniserregenden Aussichten, denn eine Wetteränderung war nicht in Sicht.
Er mochte den Keller des alten Bauernhauses nicht verlassen. Es war kühl hier unten, noch setzte sich das alte Gemäuer erfolgreich gegen die Hitze zur Wehr. Hier roch es immer würzig, erdig. In den Vorratsräumen waren die Böden herausgebrochen und gegen gestampfte lehmige Erde ersetzt worden, so entstand ein natürlich kühles Klima zur Lagerung diverser Gemüse und Obstsorten quer durch ein Gartenjahr. Die elektrische Kühlung war den schnell verderblichen Waren vorbehalten, Käse, Joghurt, Butter, Wurst, Milch, die sie seit einem Jahr mit ins Programm genommen hatten. Der Stromverbrauch schoss wegen der nötigen Bewässerung aller Pflanzen rapide in die Höhe. Da half es wenig, am frühen Morgen zu gießen, denn bis zum Nachmittag lechzte alles wieder nach Feuchtigkeit.
Wer tadelloses Gemüse und Beeren mit Gehalt ernten wollte, der musste das kostbare Nass aus der Tiefe an die Oberfläche pumpen und bodennah versickern lassen, damit es die Wurzeln erreichte, statt umgehend wieder zu verdunsten. Immerhin stand das Grundwasser noch hoch genug. Dieser verheerende heißeste Sommer, den Stefan in seinen knapp dreißig Jahren erlebt hatte, stellte eine Bewährungsprobe für den ökologischen Gemüseanbau dar. Noch kamen zumindest die Stammkunden regelmäßig in das Lädchen und deckten sich mit frisch geernteten Produkten ein.
Draußen schrie alles nach Wasser, Stefan konnte seinen Blick nicht vom Stromzähler lassen. Sie würden ihn hochstufen nach diesem Verbrauch. Hätte er sich vor zwei Jahren vehement durchgesetzt, würde eine moderne Photovoltaikanlage auf dem Dach des alten Stalles für eigenen Strom sorgen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Damals reichte der Kreditrahmen nicht, und weder sein Vater noch der Schwiegervater waren zu finanzieller Zuwendung zu bewegen, von einer Beteiligung ganz zu schweigen. Dass Gisbert Brömkamp der Umwandlung seines Hofes in einen Ökohof zugestimmt hatte, grenzte schon an ein Wunder. Es war nicht das einzige Hindernis, das sie mit Bravour gemeistert hatten.
Wie oft er seinen eigenen Vater daran gehindert hatte, bei schlecht stehendem Wind seine Felder zu spritzen, konnte er nicht mehr zählen. An manchen Tagen hatte er sich schon morgens in Lauerstellung begeben und den Hof beobachtet, der in Sichtweite lag. Er wusste ja, wann der Alte Herbizide, Pestizide, Kunstdünger und auch mal Gülle zur verbotenen Zeit ausfahren würde, schließlich hatte er sich in seiner Kindheit und Jugend ausgiebig damit beschäftigt, sich erfolgreich um diese Aufgaben herumzudrücken. Jetzt war es ernst. Es mussten die Nachweise für unbelastete Böden erbracht werden. Eine leichte Kontamination der eigenen Ernte, von der regelmäßige Proben eingereicht und überprüft wurden, hätte seine Bioproduktion wieder um Jahre zurückgeworfen.
Oft hatten die Männer sich wutschnaubend gegenübergestanden, Stefan breitbeinig mit verschränkten Armen auf dem Acker und sein Vater auf dem Traktor mit den ausgefahrenen Sprüharmen, sich nicht von der Stelle gerührt, minutenlang, auch stundenlang angemault, angeschrien, gewütet, bis van de Sandt senior unverrichteter Dinge den Rückwärtsgang einlegte.
Auf dem Ökohof lief es ruhiger, aber keineswegs besser. Der alte Brömkamp war nicht überzeugt, nur zu alt und zu müde, um sich den Vorhaben seiner Tochter zu widersetzen. Er hatte es schwer gehabt im Schützenverein, bei seinem Stammtisch, mit dem Nachbarn, Stefans Vater. Sie hatten ihn oft genug auf die Schüppe genommen, als der Verkauf von zertifiziertem Demeter-Gemüse in dem hölzernen Blockhaus startete und Sabine sich mit dem Namen des Unternehmens stolz in der Öffentlichkeit präsentierte. Sie hatte die regionale Presse eingeladen, posierte für die in der Region bekannte Lokalreporterin Hanne van Hagen gemeinsam mit ihrem Mann vor dem neckisch mit Ringelblumen bemalten Schild, ließ das gesamte Vorgehen reichlich ablichten, als ein Freund der beiden es am Giebel des Blockhauses befestigte. »Bines Bauernlädchen«, darunter: »Eigene Ernte aus ökologischem Anbau«. Anschließend gab es wohlwollende Berichte, eine Reporterin war extra auf den Hof gekommen und hatte sich für nachhaltiges Landwirtschaften begeistert, gleichzeitig wurde die Einweihung auf der extra angelegten Website im Internet präsentiert. Dort priesen sie auch das frisch geerntete Saisongemüse an. Man konnte Wochenkisten bestellen, in denen eine abwechslungsreiche Zusammenstellung verschiedener Gemüse für sieben Tage bis vor die Haustür geliefert wurde.
Brömkamps Schützenbrüder hatten ihn auf einem der Fotos im Hintergrund entdeckt und sich darüber lustig gemacht – er sei nur noch eine kleine Spielfigur auf seinem Hof, kein König, ein Bauer. Eine Aktion, die nachhaltig für schlechtes Klima zwischen den Jungen und dem Alten gesorgt hatte. Seit dieser Schmach hatte sich der Schwiegervater als Gegner des Lebensprojektes der jungen Leute direkt Willy van de Sandt angeschlossen, der keine Gelegenheit ausließ, sich lauthals über den Quatsch auszulassen, den die Kinder veranstalteten. Seinen Hof würden sie nicht kriegen, hatte er prophezeit, eher würde er alles verscherbeln und auf den Kopf hauen. Wer seine Schweinezucht und den konventionellen Ackerbau ablehnte, den stufte er wahlweise als Scharlatan oder als Feind ein. Keinen Quadratzentimeter Land würden sie von ihm bekommen.
Schluss, aus, keine Diskussion. Den Spruch kannte Stefan noch von früher, nur verschaffte der zu hohe Blutdruck, gekoppelt mit regelmäßigem Alkoholkonsum, seinem Vater jetzt einen bedenklich wirkenden hochroten Kopf, sobald er bei »keine Diskussion« angelangt war. Stefan tat das, was früher immer geholfen hatte, wenn er mit seinem Vater unterschiedlicher Meinung war: Er ließ geduldig Gras über die Sache wachsen.
Bei dem Gedanken stieß er jetzt die Luft heftig aus, rieb sich die Hände und bemerkte, dass der Aufenthalt in diesen wohltemperierten Gemäuern ihm kühle Finger beschert hatte. Auf die Wirksamkeit dieser Erdkühlung konnte er sich verlassen. Was hatte Gisbert Brömkamp dagegen gezetert!
Sein Vater ging ihm nicht aus dem Kopf. Stefan war maßlos enttäuscht von ihm. Erst vor Tagen war er wutentbrannt von dessen Hof gefahren, weil der Dickschädel ihn immer wieder spüren ließ, dass er nichts, aber auch gar nichts von neuen Ideen hielt. Dabei war der Zeitpunkt, sich auf das Altenteil zurückzuziehen, eigentlich schon überfällig. Es würde lange brauchen, die vom Vater bewirtschafteten Flächen für ökologischen Anbau nutzen zu können. In kühnsten Träumen dachten er und Bine bereits über eine Erweiterung ihres Angebots nach, sie könnten auf den Wochenmärkten verkaufen und an die großen Bioläden liefern. Aber nein, mit stoischem Trotz hielt van de Sandt senior an seiner Meinung und seinem Grund und Boden fest, obwohl es Tage gab, an denen er mehr in den Stall kroch, als aufrecht zu gehen. Nur nichts dem verqueren Sohn überlassen!
Stefan hörte die Kellertür, die sich über ihm öffnete, das konnte nur Bine sein.
»Bist du da unten?«
»Ja, und ich habe angenehm kalte Finger. Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht hier unten schlafen, bis der Himmel uns nicht mehr zu Dörrfleisch verarbeiten will.«
Bine kam die halbe Treppe herunter, hockte sich auf eine Stufe, konnte ihn so sehen.
»Lass uns nachher darüber reden. Sie sind da, Stefan, im Anhänger, ich habe die Alpakas durch die Ritzen lugen sehen, sie sind zauberhaft. Ich werde den Fahrer bitten, gleich Fotos mit meinem Smartphone zu machen. Das Quartett muss mit uns beiden zusammen umgehend ins Internet. Und dann lassen wir unsere Kunden nach Namen suchen.«
Stefan löste sich vom Surren des Zählers und kam auf sie zu. »Das würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen. Stell dir vor, die Mehrheit spricht sich für ›Schröder‹ oder ›Caligula‹ aus, du würdest Höllenqualen leiden.«
Sie musste herzhaft lachen, das geschah viel zu selten.
»Da hast du recht, das wäre furchtbar. Kommst du?«
»In einer Minute.«
Er schaute ihr nach, wie sie mit Leichtigkeit, vergleichbar mit der eines Kindes, die Treppe hinaufflog. Bines Traum, die Produktion ökologischer Alpakawolle, würde Jahre brauchen, bis er sich amortisierte. Aber seine Frau war so unglaublich begeisterungsfähig, da konnte er sich nicht entziehen. Zumal es mit ihrer ersehnten Schwangerschaft einfach nicht klappte. Da gingen schon mal andere Wünsche in Erfüllung, die ansonsten der harten Prüfung konträrer Meinungen ausgesetzt wären.
Von draußen drang ein Geräusch zu ihm, das ihm wohlbekannt war. Der alte Benz seines Vaters rollte auf den Hof. Oh Gott, Bine mit den neuen Tieren und beiden Vätern allein da oben, das konnte nicht gut gehen. Jetzt hastete er die Treppe hinauf, nicht ganz so leichtfüßig wie seine Frau, dennoch mit beachtlicher Geschwindigkeit.
***
Karin Krafft hatte eine Woche freigenommen. Ihr Überstundenkonto quoll über, und die Gelegenheit zum Ausgleich bot sich an, da ihr Sohn aus erster Ehe überraschend seine Rückkehr aus Myanmar angekündigt hatte. Moritz hatte seinen langfristigen Aufenthalt mit Tätigkeiten für unterschiedliche Delegationen der UNESCO abgebrochen, um in Deutschland ein Studium zu beginnen, was seine Mutter sehr begrüßte. Am Vortag hatten ihr Ehemann Maarten und sie im Internet auf die Flugpläne des Frankfurter Flughafens geschaut, die Maschine aus Singapur würde pünktlich landen, und sie ließen es sich nicht nehmen, ihn abzuholen. Nun war er zurück, bevor sie ihn in Myanmar besuchen konnten.
In der Ankunftshalle des Airports war ihnen ein strahlender, braun gebrannter junger Mann entgegengekommen, ordentlich frisiert, bekleidet mit einem kurzärmeligen Hemd und Longhi, dem traditionellen Wickelrock der Myanmari. An den Füßen Flip-Flops, die ebenfalls ein Großteil der dortigen Bevölkerung trug. »Er wirkt so fremd, so erwachsen«, hatte Karin Maarten zugeflüstert, als ihr schon die Freudentränen über die Wangen liefen. Maarten schaute gerührt, sie rannte ihrem Sohn entgegen, und sie umarmten sich sekundenlang. Karins hellen Begrüßungs-Singsang kannte Maarten wohl noch nicht. Auch er wischte sich angesichts solcher Wiedersehensfreude ein Tränchen aus dem Gesicht, bevor auch er die Chance bekam, den Heimkehrer zu begrüßen.
Den Großteil der Rückfahrt nach Xanten und des folgenden Tages hatte Moritz verschlafen, nach ausgiebigem Hallo und dem Verteilen seiner Mitbringsel saßen sie nun entspannt lachend um den Frühstückstisch, an dem er seine zweite Reismahlzeit verschlang.
»Im Flieger gab es nur europäisches Essen, völlig ungewohnt.«
»Nur falls es dir entgangen ist, Sohn: Du bist wieder in Europa«, bemerkte Karin.
Maarten lachte und klopfte Moritz nahezu väterlich auf die Schulter. »Ich finde deine Entscheidung zu studieren einfach toll, und du glaubst gar nicht, wie erleichtert deine Mutter darüber ist, dass du wieder im Lande bist. Unsere Telefonrechnung wird drastisch sinken.«
Moritz sprang auf. »Apropos Telefon, ich muss mal eben mit einem alten Kumpel sprechen, habe ich fast vergessen, bin gleich zurück.«
Maarten tätschelte Karins Hand über den Tisch hinweg. Sie war erleichtert, und er hatte sie wohl lange nicht mehr so entspannt gesehen.
Aus dem Garten drangen juchzende Geräusche zu ihnen. Karins und Maartens Tochter Hannah sprang mit großem Vergnügen in den Pool, schaute immer wieder zu ihnen, suchte Moritz mit den Augen, den großen Bruder. Sie hatte sich eher einen Jugendlichen vorgestellt, keinen erwachsenen Mann, ihn dennoch auf Anhieb neu ins Herz geschlossen.
Moritz kam mit dem Telefon in die Küche, jeder konnte hören, dass etwas klargehe und Moritz sich freue, am Nachmittag vorbeischauen würde und, sein Gesprächspartner hieß Stefan, er seine Bine grüßen solle.
Die Hauptkommissarin in Karin kombinierte. »Sag mal, war das dein alter Freund Stefan aus Xantener Zeiten?«
»Ja, richtig.«
»War der nicht ein paar Jahre älter als du? Der Junge, der immer einen Hauch von Schweinestallgeruch reinbrachte, wenn er zu uns kam?«
Moritz setzte sich wieder zu ihnen und verschlang den Rest seiner Reismahlzeit. »Ja, wir haben uns gut verstanden. Der hat nichts mehr mit Schweinen zu tun, die Zucht gehört alleine seinem Vater. Er hat die Sabine Brömkamp geheiratet, und die beiden betreiben nun einen Bioladen auf ihrem Hof. Vielleicht kennt ihr ja ›Bines Bauernlädchen‹, hinten in Alpen-Drüpt. Die bauen das ganze Gemüse selber an, das sie dort verkaufen, mit Demeter-Zertifizierung.«
In Karins Kopf rumorte es. Der Stefan van de Sandt. Sie hatte ihn als stillen, höflichen Jungen in Erinnerung, dem es im Hause Krafft immer gefiel, der sich einfügte wie ein zweiter Sohn, der das Miteinander genoss, als gäbe es bei ihm kein Familienleben. Aber in den letzten Jahren am Niederrhein hatte Moritz sich kaum noch mit ihm verabredet. Oder hatte sie da etwas Entscheidendes nicht mitbekommen? Waren sie immer noch dicke Freunde?
Moritz bemerkte ihre Nachdenklichkeit und lachte. »Du hast dich nicht verändert, dir steht immer noch das Grübeln auf die Stirn geschrieben.«
»Dann weißt du ja schon, welche Fragen ich dir stellen möchte.«
Moritz trank seinen Tee aus und richtete sich kerzengerade auf. »Also ich habe bereits von Myanmar aus Kontakt zu Stefan aufgenommen, und nun ist alles in trockenen Tüchern.«
Er schien es zu genießen, seine Mutter ein wenig zappeln zu lassen.
»Ich fange mal von vorne an. Ihr wisst ja, dass ich studieren möchte.«
Karin grinste breit und flachste: »Ich finde das sehr löblich und kann deinen Entschluss nur unterstützen. Hauptsache, du planst keine Karriere bei der Polizei. Du kennst das, ein Haufen Überstunden, grenzwertige Belastungen, durchgeknallte Kollegen, und man braucht einen verständnisvollen Partner, der auch bereit ist, immer wieder Alleinerzieher zu sein.«
Moritz lächelte sie an, seine Stimme wurde jedoch ernst. »Ich plane ein Bachelor-Fernstudium zum Agraringenieur mit den Schwerpunkten auf Ausbildung und Beratung sowie Qualitätssicherung, Handel und Transport.«
Maarten schaute erstaunt von seiner Kaffeetasse auf. »Das sind klare Ziele, Respekt. Was hast du mit dem Abschluss vor?«
Moritz saß da in seinem Longhi, mit dem es ihm in der ungewöhnlichen Hitze daheim sehr gut ging, sie war vergleichbar mit dem feuchtheißen Klima in Asien. Er leerte seinen Teller bis auf das letzte Reiskorn und schenkte sich grünen Tee nach.
»Ich werde damit zurückgehen nach Myanmar. Es gibt noch viel zu tun in diesem Land, das ist mir in der ganzen Zeit bewusst geworden. Und ich habe Kay Kay versprochen, ihr und ihrem Dorf im Goldenen Dreieck auf die Beine zu helfen.«
Karin drückte sich stumm an die Stuhllehne, Maarten sprach aus, was ihr durch den Kopf schwirrte.
»Du gehst wieder zurück?«
»Ja, das habe ich vor. Ich lerne auch schon fleißig Burmesisch. Es ist so ein wunderbares Land, die Menschen, die Kultur, die Religion, alles begeistert mich. Da schlummern ungeahnte Möglichkeiten für die Bevölkerung, man muss sie einfach unterstützen.«
Maarten zog seine Stirn kraus. »Und das ausgerechnet in der Grenzregion zu Thailand und Laos? Im Goldenen Dreieck …«
»Ganz genau. Und jetzt komm du als Niederländer mir bitte nicht mit althergebrachten Bildern von Opiumhöhlen und Drogenhandel. In Kay Kays Dorf geht es nicht um Schlafmohn, sondern um den Anbau von lebensnotwendigen Produkten wie Reis, diversen Früchten, grünem Tee, um die Ansiedlung von Nutztieren. Es geht um Landwirtschaft und Nutzung von Ressourcen.«
Jetzt fand Karin aus ihrer perplexen Stummheit zurück. »Und wer ist Kay Kay?«
Moritz zog sein Smartphone aus der Hemdtasche und brauchte nur einen kurzen Moment, um ihnen ein Foto auf dem Display zu präsentieren. Eine hübsche junge Frau mit langem dunklem Haar und braunen Augen lächelte ihnen entgegen.
»Das ist Kay Kay. Sie studiert gerade Elektrotechnik und wird fast zum gleichen Zeitpunkt fertig sein wie ich. Sie ist, also wir sind, ja, so was wie verlobt. Ich wollte es euch persönlich sagen, nicht über WhatsApp oder Skype.«
Karin schoss die Erwiderung heraus. »Ach! Deiner ganzen Planung liegen keine sachlichen Entscheidungen zugrunde, sondern du bist über beide Ohren verliebt.«
Es klang schärfer als gewollt, sie nahm sich zurück, es lag ihr noch auf der Zunge zu sagen, diese Spinnerei würde sich mit der Zeit legen, doch sie wechselte zur inneren Abkühlung ungeschickt das Thema. »Und was hat das alles mit Stefan van de Sandt zu tun?«
Moritz musste unwillkürlich schmunzeln und schüttelte den Kopf. »Im Abbügeln von unliebsamen Themen warst du schon immer gut. Mütterliche Freude sieht anders aus, aber um deine Frage zu beantworten: Mein Kontakt zu Stefan hat mit meiner Zukunft zu tun, ich habe mir das gut überlegt. Ich brauche einen Praktikumsplatz. In einer Woche fange ich dort an, mit fachmännischer Anleitung und einem festen kleinen Einkommen. Ich bin bescheiden geworden in Myanmar, man kommt dort mit wenig aus. Wenn ich hier wohnen bleiben könnte, das würde mir sehr entgegenkommen.«
Wie auf Knopfdruck erschien seine kleine Halbschwester Hannah in der Küche, bewirkte eine deutliche Deeskalation der angespannten Lage und lenkte die Erwachsenen ab, weil sie triefnass aus dem Pool kam. Hinter ihr trottete Woodstock, der alte Bouvier, ebenso eine feuchte Spur hinter sich herziehend, ins Haus. Der Hund wurde sofort wieder nach draußen geschickt.
Hannah stand in einer Pfütze. »Ich habe vergessen, ein Handtuch mitzunehmen.«
»Nix passiert, Karin«, bremste Maarten sie aus, reichte Hannah eines der Tücher, die auf der Eckbank gestapelt lagen, und meinte, der Fußboden sei in kurzer Zeit wieder trocken.
Hannah quetschte sich, in das Tuch gehüllt, neben Moritz auf die Eckbank, sie war begeistert von ihrem großen Bruder und betrachtete ihn immer wieder sekundenlang lächelnd wie ein Wunder. Sie hätte ihn sogar in ihrem Zimmer schlafen lassen, was als außergewöhnliche Ehre galt. Nur dass er schon zum Frühstück Reis aß und einen Wickelrock trug, fand sie befremdlich.
»Komm doch mit mir raus, das Wasser ist echt erfrischend.«
Moritz versprach, gleich nachzukommen. »Erst habe ich noch was mit Mama und Maarten zu besprechen.«
Als Hannah draußen wieder mit einem lauten Juchzer in den kleinen Pool sprang, gefolgt von dem Hund, stand Karin abrupt auf, nahm entgegen ihren Prinzipien einen langen Schluck aus einer Mineralwasserflasche.
»Entschuldige, Moritz, aber ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, dass mein Sohn ernsthaft plant, in einem Land zu leben, in dem es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen kommt und wo es vielerorts an Infrastruktur mangelt. Wie weit ist das nächste Krankenhaus von Kay Kays Dorf entfernt? Und wie kommt man im Notfall dorthin?«
Moritz schien für einen Moment zwischen Sachlichkeit und Emotionalität zu schwanken, entschied sich für eine höfliche Erwiderung.
»Kriminalität, rechter, linker, islamistischer Terror sind in europäischen Köpfen und Städten präsenter als in buddhistischen. Und in den wenigen Fällen, in denen es notwendig ist, spielt es keine Rolle, wie weit der Weg zum Krankenhaus ist. Dort gibt es nicht die Vielzahl an Herzinfarkten, Schlaganfällen, Diabetes, die hier schnell und effektiv behandelt werden müssen. Man lebt einfach und gesund. Ich werde auf mich achtgeben, so wie in den letzten Jahren.«
Ein Moment des Schweigens entstand.
»Das ist mein Weg, Mutter.«
***
Der Fahrer hatte den Anhänger vor das Tor des neuen Gatters rangiert, Bine hielt es geöffnet, und nun liefen die vier Kamele von der Rampe in die trockene Wiese, schauten sich um, blieben dicht beieinander, suchten den Schatten des alten hohen Kirschbaums. Ein schöner Anblick, zwei schwarze Stuten, eine cremefarben, eine braun, lange Hälse, neugierige Augen unter dichten Ponys, flinke Beine.
Reporterin Hanne van Hagen kam in ihrem Kleinwagen auf den Hof geflitzt. Sie bremste hart ab, ließ so eine Staubwolke in die flirrende Luft steigen. Zielbewusst und immer in Eile griff sie nach ihrer Kamera. Die Alpakas auf der Weide staksten noch unsicher in der ungewohnten Umgebung, doch blickten sie schon aufgeweckt und vorwitzig.
»Was Neues für Bines Lädchen, wie schön. Leser mögen Tiergeschichten, diese, diese … wie heißen die Viecher noch? … liefern Bilder, die zu Herzen gehen, wunderbar«, rief sie, fotografierte, griff sich dann Block und Stift und schickte sich an, Bine zu befragen. Hanne van Hagen liebte Tiere, hasste Lokalpolitik, über die sie trotzdem schreiben musste, aber am liebsten war sie Polizeireporterin auch für krasse Verbrechen. Hier allerdings war kriminellenfreie heile Welt, auch das hatte etwas.
Drei Kunden, die gerade auf den Hof gefahren waren, kamen neugierig an den Zaun gelaufen.
»Sind das Lamas?«
»Die hier sind viel kleiner, das sind Alpakas. Ob die auch spucken?«
»Alpaka-Wanderungen am Niederrhein, das stelle ich mir echt toll vor.«
»Wie süß, ich hätte auch gerne so eins.«
Bine hatte sich auf derlei Fragen vorbereitet und antwortete höflich und mit Stolz, das Ursprungsland der domestizierten Kamelart namens Alpaka sei das Hochland von Peru. Dort gebe es große Herden zur Gewinnung feinster Wolle. In Europa habe das Produkt inzwischen einen hohen Marktwert, die Qualität würde nach jeder Schur in Australien überprüft, weil man sich dort traditionell auf Wolle verstehe, und ab jetzt seien die vier hier daheim.
Hanne von Hagen schrieb eifrig mit.
Bine schmunzelte. »Und sie spucken nur in arger Bedrängnis oder bei Rangkämpfen, also eher selten. Doch wenn, wird das eine feuchte Angelegenheit.«
»Muss ich nicht haben«, sagte Hanne von Hagen mit einem Unterton, der einen gewissen Ekel verriet.
Das Gezeter aus dem Hintergrund holte Stefan bei seinem faszinierten Blick auf die Tiere ein. Die krächzende Stimme seines Vaters übertönte den leicht stotternden Motor seines Wagens. Nach über dreihunderttausend Kilometern lief die Maschine nicht mehr rund. Wegen Schwierigkeiten beim Starten ließ van de Sandt den Motor bei kürzeren Stopps einfach laufen. Das konnte schon mal eine Stunde sein oder auch zwei.
»Die gehören hier nich hin! Wat en Blödsinn.«
Stefan konnte sich kaum bremsen. »Mach den Motor aus, alter Mann, du verpestest hier die Luft.«
»Dat is meine Sache.«
Eine Vorlage für Stefan, der konterte: »Und die Alpakas sind unsere Sache.«
Gisbert Brömkamp stieg wie immer gern ins Lamentieren ein. »Und umsonst waren die Viecher bestimmt nich. Dat hat Sabine von ihrer Mutter, die konnt auch Geld verplempern für jeden Scheiß.«
Er öffnete eine Flasche Korn und füllte zwei Pinnekes, offenbar mussten die beiden alten Männer das Elend, das sich vor ihren Augen auftat, gründlich begießen. »Schafe hätten et auch getan, aber nee, et müssen so neuartige Modeviecher werden.«
Bine war die Enttäuschung anzusehen, sie hatte damit gerechnet, dass der Charme der Tiere zumindest ihren Vater überzeugen würde. Und dieses Theater spielte sich auch noch vor Kundschaft und Presse ab, wie peinlich. Gut, dass die Reporterin gerade aufbrach.
Stefan sah Bine mit energischen Schritten zu den Männern laufen. Es fiel ihr nicht leicht, ihre Stimme zu dämpfen. »Ihr verbohrten Sturköpfe! Wenn sie euch nicht gefallen, dann schreit es doch wenigstens nicht in die Gegend. Da stehen Kunden, und die sind ebenso begeistert wie Stefan und ich.«
Ihr Vater schaute sie abschätzig an. »Dem einen sin Uhl is dem andern sin Nachtigall. Mir gefallen se nich, die sind nich von hier, und ich lass mir auf meinem Hof nich den Mund verbieten! Und der Willy braucht auch vor lauter Unverständnis erst mal en Klaren, wa, Willy?«
Die Pinnekes knallten aneinander. »Hopp, hopp, in de Kopp.«
Bine ließ sie stehen und kam zurück zu Stefan gelaufen, hatte Tränen in den Augen vor Wut und wusste nicht, wohin damit. In der Nähe standen noch immer die Kunden, mit leuchtenden Augen und einem breiten Lächeln versuchten sie, den Disput in ihrem Rücken zu ignorieren. Man mischt sich nicht ein in familiäre Angelegenheiten am Niederrhein.
Und dann geschah, was dem Paar den tiefsten Stich versetzte, immer schön in der offenen Wunde stochern, das konnten die beiden Stinkstiefel. Brömkamp stieß erneut mit van de Sandt an und verkündete für alle gut vernehmbar: »Wenn dein Stefan die Sabine endlich schwängern tät, dann bräuchte se nich so ’n weichgespültes Viehzeug.«
Einer ging noch. Van de Sandt ließ das nicht auf seiner Genschiene sitzen.
»Wenn deine Sabine et nich packt, dann wird et hier in Zukunft von so fremdartigem Zeugs nur so wimmeln, quasi als Ersatz.«
Stefan hielt Bine fest im Arm, ganz fest, spürte ihr Beben, zitterte selbst, schaffte es kaum, sich zurückzuhalten, schluckte, räusperte sich, flüsterte. »Ich hoffe inständig, dass sich dieses Problem altersbedingt möglichst schnell von selber löst.«
Bine atmete tief ein und aus, mehrmals, wurde langsam ruhiger. »Wenn du da mal nicht völlig danebenliegst. Die beiden sind in Alkohol eingelegt, die halten ewig«, unkte sie.
»Die sind so rücksichtslos …«
»… und gemein. Lange halte ich das nicht mehr aus.«
In Stefan brodelte es, verborgen vor der Kundschaft und vor den beiden Alten, die in der kurzen Zeit bereits die halbe Flasche geleert hatten. Er schaute zu ihnen hinüber, dann hauchte er den Satz in Bines Ohr: »Irgendwann bringe ich die beiden um.«
»Sag doch nicht so was.«
Hanne von Hagen war zufrieden mit der Zeitungsgeschichte. Sie ahnte nicht, dass sie sich unter ganz anderen Umständen mit dem Ort, an dem die Alpakas wohnen, beschäftigen würde. Bald, in nicht ferner Zukunft, würde sie wiederkommen. Als Polizeireporterin.
ZWEI
»Mia, du wirst auch immer fetter. Du machst dem Mastvieh noch Konkurrenz.«
Maria Calvers schaute sich um. Willy van de Sandt schlurfte in die Küche, er sah furchtbar aus, verschlafen, das Kopfkissen hatte bizarre Falten in seine Wange gegraben, die wenigen Haare standen auf Sturm, Hemd und Hose hatte er bestimmt seit ihrem letzten Besuch nicht gewechselt, und am Vortag musste es reichlich Alkohol gegeben haben. Er stank nach Schwein und altem Mann, und es war nicht auszumachen, welche Geruchsnote überwog.
»Und du wirst immer schlampiger. Schau dich an. Ab ins Bad und zieh dir was anderes an. Ich habe doch beim letzten Mal die frische Wäsche in deinen Schrank gelegt.«
»Erst mal einen Kaffee.«
»Dann mach ich schon mal das Wohnzimmer.«
Willy hockte sich breitbeinig auf den wackeligen Küchenstuhl, der zwischen Anrichte und Tisch stand, genau im Griffradius von Tasse, Kaffeekanne und Tischplatte. Aus dieser Position heraus schaffte er es mit letzter Kraft, sich vorzubeugen und Mia im Vorübergehen einen Klatscher auf ihr ausladendes Gesäß zu geben. Sie kicherte kurz, er grunzte und hustete gleich darauf ausgiebig die Reste der Nacht aus seinen Bronchien.
So lief das zwischen ihnen, seit Willys Frau gestorben war. Seit fast zwanzig Jahren also. Mia, selbst alleinstehend, nie verheiratet gewesen, war nach zwei tiefen Enttäuschungen vorsichtig mit den Männern. Diesen hier, den Willy van de Sandt, den hätte sie schon gern gehabt. Eine gute Partie.
Sie machte ihm zweimal in der Woche den Haushalt, zu einem Stundensatz, der sich seit Einführung des Euro nicht verändert hatte. Das war ihr egal. Sie sah sich als die geheime Frau im Hause van de Sandt, träumte davon, dass er eines Tages ihre Hand ergriff, sie einfach festhielt und fragte, ob sie nicht zu ihm auf den Hof ziehen wollte. Nein, er würde sie nicht fragen, er würde es bestimmen, so wie er alles bestimmte. »Mia, du ziehst hier innet Haus. Schluss, aus, keine Diskussion.«
Er war einfach zu schüchtern, und insgeheim wartete sie auf seine kleine Frivolität, genoss es, dass er ihr auf den Po klatschte, stellte sich vor, was er noch mit ihr machen würde, wie er sie auf seinen Schoß zog, seine Hände zupackten, ach, dieses Bild von einem Mann. Sie ging extra nah an ihm vorbei, einmal bei jedem Putzeinsatz. Ohne sie würde er verkommen.
Damals hatte es schlimm ausgesehen im Haus und rundherum, nachdem er plötzlich allein gewesen war. Nicht ganz allein, es gab noch den kleinen Sohn, und Willy schien keine Ahnung davon zu haben, wie man ein Kind behandelte oder erzog. Zu der Zeit hatte Mia ihre Stunden auf den Nachmittag verlegt. Wenn Klein-Stefan aus der Schule kam, war wenigstens zweimal in der Woche jemand da und kümmerte sich um Hausaufgaben, gewaschene Haare, geschnittene Fingernägel, um saubere Kleidung und passendes Schuhwerk. Der Junge lernte schnell, auf sich selbst zu achten, und so wenig der Schweinezüchter mit dem Kind konnte, konnte der Sohn mit seinem Vater.
Der Junge mochte die Schweine nicht leiden. Sie waren ihm zu laut, zu ungestüm, wenn es ums Füttern ging, stanken zu sehr, er hasste den Blick aus den kleinen blauen Augen und wie sie sich gebärdeten, wenn der Viehhändler sie in den Hänger trieb. Dann versteckte er sich in seinem Zimmer und presste sich das Kopfkissen auf die Ohren. Es war Willy nicht beizubringen, dass der Händler kommen sollte, wenn Stefan nicht da war. Da müsse der Junge durch, meinte Willy, schließlich sollte er den Betrieb eines Tages übernehmen. Schluss, aus und so weiter.
Bei Mia fand das Kind Verständnis und stundenweise Mütterlichkeit.
Irgendwann war Stefan aus dem Haus gegangen, als könnte es nicht schnell genug gehen. Er heiratete auf dem Nachbarhof ein, um etwas so Entgegengesetztes aufzuziehen wie ökologischen Gemüseanbau. Da hätte er auch abstrakter Maler werden können, das hätte sein Vater ebenso wenig verstanden.
Willy hatte sich nie bedanken oder sie für ihren Einsatz loben können, so etwas kannte er nicht, und Mia erwartete es auch nicht, schließlich hatte sie ihren Plan. Das Einzige, was er jemals anerkennend zu ihr gesagt hatte, war, dass etwas für sie in seinem Banksafe liege.
Nun sah sich Mia im Wohnzimmer um, alles war wie immer. Die Gläser und Teller der letzten Abende standen auf dem Couchtisch, die leeren Bierflaschen daneben, alles war verkrümelt und unordentlich, eben so, als fehle die Frau im Haus. Wenn er doch mal endlich ihre Qualitäten erkennen würde und ihre Willigkeit, dann hätte dieses Lotterleben ein Ende.