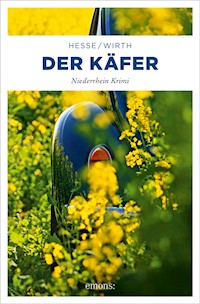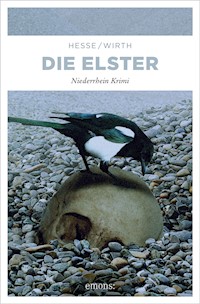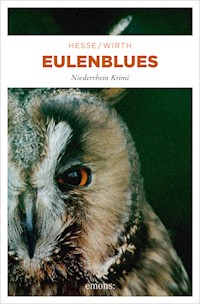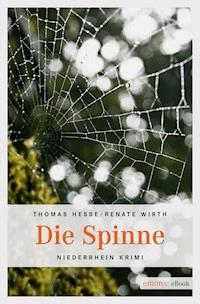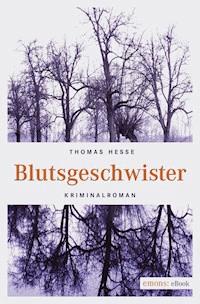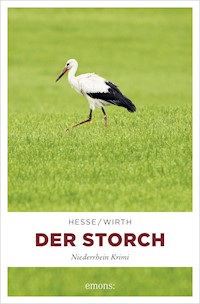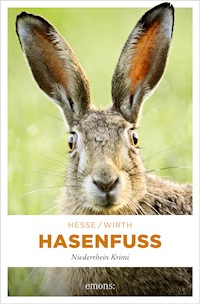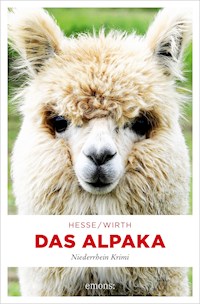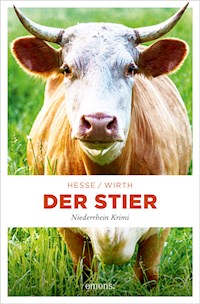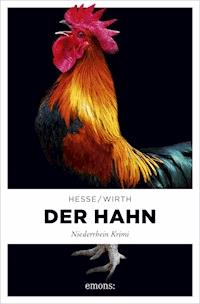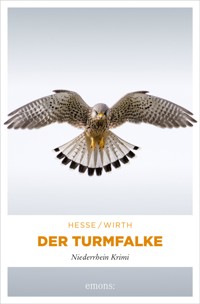Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Niederrhein Krimi
- Sprache: Deutsch
Über die Leiche des wichtigsten Mannes des Dorfes Bislich-Büschken zieht eine Schnecke ihre Schleimspur. Die Weseler Kommissarin Karin Krafft, selbst ein Dorfgewächs, trifft auf Menschen, die zusammenhalten, keine Nestbeschmutzer mögen und einem kleinen, wenn auch illegalen Nebengeschäft nicht abgeneigt sind. Die Fahnderin kämpft sich durch den Mikrokosmos Dorf. Und als sie sich auch noch Hals über Kopf in einen netten Niederländer verliebt, kommt entscheidendes Tempo in die Aufklärungsmaschinerie in Wesel, Xanten, Hamminkeln, Rheinberg und Kalkar. Ein humorvoller Roman, eine spannend kombinierte Geschichte mit einem überraschenden Knalleffekt zum Schluss. Mit steigendem Tempo entwickelt sich in diesem atmosphärischen und geschickt konstruierten Kriminalroman ein bis zum Ende spannender Mordfall vor dörflicher Kulisse. Mit lebendigen Figuren und authentischen Schauplätzen fesselt das Buch auch durch seinen humorvollen und flüssigen Erzählton. Ein Krimi, der Spaß macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hesse, Jahrgang 1953, lebt in Wesel, ist gelernter Germanist, Kommunikationswissenschaftler und Journalist. Er war bis Ende 2014 in leitender Position bei der »Rheinischen Post« am Niederrhein tätig. Heute ist er freier Autor, Journalist und Publizist. Bekannt wurde er u.a. durch Niederrhein-Krimis zusammen mit Thomas Niermann und Renate Wirth.
Renate Wirth, Jahrgang 1957, ist Gestalttherapeutin, Künstlerin und Autorin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlung, Personen und manche Orte sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
© 2021 Hermann-Josef Emons Verlag
Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-882-5
Niederrhein Krimi 12
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Für Eva und Martin, unsere besseren Hälften, die genau wissen, wie viel Zeit ein Krimi benötigt, und für Ben, den Jüngsten der Berater, stellvertretend für alle anderen, die unsere Fragen mit Geduld und Fachwissen beantwortet haben
I.
An und für sich bot die Siedlung am Ortsrand von Bislich paradiesische Bedingungen für das relativ kurze und unspektakuläre Leben einer Wegschnecke. Die Gärten der Einfamilienhäuser lockten mit einer Vielfalt an Nahrung und Möglichkeiten zum Unterschlupf, jedoch äußerst selten mit reellen Überlebenschancen. Hinter dem Ortsschild, am Feldrand oder im kleinen Wald, dem Büschken, lebte es sich wesentlich primitiver, aber länger. Sogar die kargen Vorgärten der beiden Mehrfamilienhäuser an der Ecke Himmelsstiege und Alte Ziegeleistraße waren relativ sichere Orte für die Spezies Arion rufus. Der allgegenwärtige Wolle Kaschewski fluchte zwar lauthals über Kreaturen, die ihm kriechend, krabbelnd oder surrend zu nahe kamen, schritt jedoch nur selten zur Tat. Er verbrachte die warmen Tage auf seinem weißen Gartenstuhl unter dem windschiefen Kunststoffpavillon thronend und proklamierte täglich ab mittags, Hansa Pils in der rechten, gestopfte Zigarette in der linken Hand, seine neuesten Erkenntnisse, die ihm den Weg zu Höherem ebnen sollten. Hausmeister war er ja schon fast. Von seiner Position aus ließ sich das dörfliche Leben bequem überblicken. Ständige Anwesenheit war wichtig, um dieses kleine Viertel im Auge zu haben. Angesichts einer Schleimspur, die sich spätabends im Laternenlicht vor seinen Füßen dahinzog, kam ihm die bahnbrechende Idee.
»Alles betonieren und grün streichen hier, oder Asphalt wär auch nich schlecht. Kannze gut sauber halten und zieht nich so viel Kroppzeug an. Werd ich dem Alten mal vorschlagen.«
Wolle Kaschewski, Meister im Geiste, schritt innerlich zur Tat. Im Gegensatz zu ihm lösten die passionierten Gartenbesitzer links und rechts der engen alten Himmelsstiege das Problem auf pragmatische Weise.
Im Eckhaus lebte die Witwe Maria Steinbrink unscheinbar und zurückgezogen mit ihren geistig zurückgebliebenen Zwillingen. Maria schwor seit Jahr und Tag auf das bewährte Schneckenkorn, um ihre sorgsam gehegten Gemüsebeete zu schützen. Sie war auf die Ernte angewiesen und übertrug einen Teil der Gartenarbeit ihren Söhnen, die sich einen Spaß daraus machten, vertrocknete, schrumpelige Leichen zwischen Kohl und Bohnenstangen zu sammeln.
»Zweiunddreißig beim Radieschenbeet«, triumphierte Jakob, den jeder hier Köbes nannte, überlegen zu seinem Bruder blickend.
Theodor, im Dorf nur Tiez genannt, verharrte still und starr. Leichte Zuckungen des linken Mundwinkels verrieten humorvoll zurückhaltende Überlegenheit.
»Einundvierzig beim Salat. Sieger! Sieger!«
Soweit es seine zu enge, kurz geratene Hose zuließ, tänzelte er betont locker um Köbes herum, dessen Unterlippe in seinen Hemdkragen zu kriechen drohte.
»Hast schon wieder gewonnen. Du mogelst bestimmt.«
»Gar nicht, gar nicht. Du bist nur ein schlechter Verlierer.«
Maria Steinbrink beobachtete hinter der Wohnzimmergardine das kindliche Treiben ihrer bulligen Söhne, die mit Ach und Krach die Sonderschule beendet hatten und nicht in der Lage waren, ihren Alltag zu meistern. Sie erledigten Gelegenheitsarbeiten auf den Bauernhöfen der Umgebung und brachten so ein paar zusätzliche Euro in die schmale Haushaltskasse. Zuverlässig und stark waren sie und wegen ihrer Naivität zu gut für diese Welt. Ihr Vater hatte in den ersten Jahren noch mit Stolz von sorgenloser Zukunft geträumt und war mit zunehmenden Problemen immer depressiver geworden. Er ließ die Zwillinge seine Ablehnung bis zu seinem Tod deutlich spüren. Für Maria war klar, dass ihre Pflicht nun darin bestand, ein Leben lang mit Gottergebenheit für ihre Söhne zu sorgen. Zufrieden waren sie ja. Meckerten nie darüber, Vaters Kleidung auftragen zu müssen, und waren wunschlos glücklich, wenn es nur Eintopf gab.
Maria löste ihren Blick von dem Geschehen im Garten, griff ein Staubtuch aus ihrer Kitteltasche und widmete sich dem Wohnzimmerschrank. Immer diese Fingerspuren, immer so viel Arbeit mit den Zwillingen.
Von Tiez’ und Köbes’ Ausgelassenheit gereizt, kläffte der Schäferhund von Bert Schreiber, während er zwischen Tannen und Zaun auf und ab rannte und in ihre Richtung geiferte.
»Rocky, aus!«
Berts Stimme veranlasste den Hund zum sofortigen Senken des Kopfes, und mit eingezogener Rute verschwand er aus dem Steinbrink’schen Blickfeld. Nichts durfte Bert in seinem Refugium stören. Blickgeschützt durch Tannen, die er persönlich auf drei Meter Höhe hielt, saß er auf der Bank vor seinem Gartenhäuschen und bewunderte den prachtvollen Rasen mit der Fahnenstange in der Mitte. Hier hatte Rocky das Parieren gelernt und seine Isolde das Rasenmähen und Kantenschneiden. Still sein und nichts kaputtmachen beherzigten Christian und Ingrid inzwischen, und spielen konnten sie schließlich auf dem Spielplatz. Kurz geschorener Zierrasen und benadelter, trockener Boden unter den Tannenbäumen waren selbst für Wegschnecken nicht sonderlich attraktiv. Entdeckte Bert trotzdem ein verirrtes Exemplar, gab es zwei unterschiedliche Reaktionen, die in unmittelbarem Zusammenhang zu seiner Tagesform standen. In ausgeglichener Verfassung warf er das Weichtier in hohem Bogen gekonnt in Alma Argonds Garten. Heute war er gereizt, entdeckte Arion rufus auf einem der Trittsteine vor dem Gartenhaus. Er blickte angewidert hinab, hob den linken Fuß und beschrieb mit dem stabilen Absatz seiner professionellen Gärtnerschuhe kraftvolle, knirschende Drehbewegungen. Hier hatte er alles unter Kontrolle.
Jeden Morgen, bevor er zur Arbeit nach Dinslaken fuhr, hisste er die Fahne, und abends, punkt neunzehn Uhr, holte er das schwarzrot-gelbe Tuch wieder vom Mast. Bei Wind und Wetter, Isolde treu an seiner Seite. War er fort, löste sie ihren Zopf und wechselte den Sender des kleinen Küchenradios. Hatte schon merkwürdige Hobbys, ihr Berti.
Exotisches Vogelgezwitscher drang aus Alma Argonds Voliere, als sie die Tür öffnete, um die Futternäpfe und den Wasserspender neu zu füllen. Sie lebte nach dörflichen Maßstäben zurückgezogen und einsam, fand sich selbst jedoch stets in bester Gesellschaft. Elf Katzen und fünf Hunde bildeten ihre häusliche Lebensgemeinschaft, und die Zebrafinken und Wellensittiche lebten in einem eigenen Haus im Garten hinter Schreibers Tannen. In ihrem Garten ließ Alma wachsen, was sich ansiedeln wollte, und so beherbergte sie nicht nur eine reichhaltige einheimische Flora, sondern auch eine beachtliche Igelpopulation, die sich das Katzenfutter sicherte, wenn die Stubentiger nicht aufpassten. Fressen und Gefressenwerden bestimmten das nicht domestizierte Leben in diesem urwüchsigen Dickicht.
Alma betrachtete ihren Nachbarn zur Linken nicht ohne Argwohn. Er warf Schnecken oder tote Maulwürfe über seine leblosen Nadelbäume. Sie traute ihm alle Schlechtigkeiten der Welt zu, nachdem sein Hund eine ihrer Katzen so schlimm zugerichtet hatte, dass sie eingeschläfert werden musste. Schreiber hatte seine Kampfmaschine angefeuert, und wenig später fand sie ihren Schnurri zerbissen neben der Voliere. Alma ging diesem Gernegroß aus dem Weg.
Gut, ein wenig passte sie sich an. Niemand würde ihr ins Gesicht sagen, was er von ihrem verwilderten Garten hielt. Es gab die stille Post, zufällige Dialoge vor dem Haus.
»Hat auch was, so mehr wild.«
»Also, ich weiß nicht. Ich persönlich brauch ja Struktur und ordentliche Bepflanzung. Aber wem es gefällt …«
Hinter dem Küchenfenster erreichte Alma die Botschaft. Zeit, ein wenig zu entkrauten. Nur vorn, um des lieben Friedens willen.
Die Nachbarn zu ihrer Rechten waren ruhige, friedliche Leute. Redeten nicht viel, jedenfalls nicht miteinander, grüßten immer höflich und warfen ihr keine Toten über den Zaun. Ein stattlicher Mann, der Friedrich Kaldewei. Machte irgendwas mit Spekulationen, Anlageberater oder so, jedenfalls sahen er und seine Gertrud nach viel Geld aus. Einen riesigen Swimmingpool hatten sie sich anlegen lassen, und das halbe Grundstück war plattiert. Um die winzige verbliebene Gartenfläche kümmerte sich zweimal im Monat ein Landschaftsgärtner. Gertrud hasste es, wenn die Wegschnecken nachts in den Pool fielen und ihre Filteranlage verstopften. Nichts war ihr so widerlich wie totes Getier. Sie ließ sich in Fachgeschäften beraten und kaufte schließlich ein garantiert biologisch verträgliches Schneckenkorn mit dem zweifelsfreien Vorteil, dass sich Arion rufus nach Kontakt zum Sterben ins Versteck zurückzog. So streute Gertrud, die Hände in gelben Gummihandschuhen, zweimal wöchentlich Mengen der leuchtend grünen Körnchen, um ihren Garten hermetisch abzuriegeln. Ein vergeblicher Versuch, den die Natur ignorierte.
Den ganzen Tag lang organisierte sie den Augenblick der Heimkehr ihres Mannes. Wenn sich abends das Tor ferngesteuert zur Seite schob, die Garagentür auf Knopfdruck zusammenfaltete und die Außensensoren die Beleuchtung zur Haustür regelten, stand innen eine elegante, frisch frisierte Gertrud lächelnd vor dem gedeckten Esstisch. Die abgekauten Fingernägel verbarg sie durch gekrümmte Haltung, wobei die Kuppen die Daumen berührten. Friedrich Kaldewei war ein viel beschäftigter Mann, der es des Öfteren versäumte, seiner Frau mitzuteilen, dass er später oder gar nicht kommen würde. An solchen Abenden wurden aus den verkrampften Händen kraftvoll geballte Fäuste, und das Lächeln mutierte zu einer wutverzerrten Miene. Das Essen landete in der Mülltonne. Gertrud ahnte jedes Mal, wo ihr Mann war. Ihre Gefühle versteckten sich seit Jahren wie die sterbenden Tiere in ihrem Garten. Am nächsten Morgen ging sie mit einem strahlenden Gesicht Brötchen holen.
Den muskulösen jungen Landschaftsgärtner beobachtete sie verstohlen durch ihre verspiegelte Sonnenbrille, während sie am Terrassentisch frühstückte.
Gegenüber von Kaldeweis stand das liebevoll dekorierte Haus von Johanna Krafft. Quer durch die Welt war sie mit ihrem Mann gereist, und Souvenirs wie Riesenmuscheln, Holzstelen mit Eingeborenenmalerei, Skulpturen und beschnitzte Baumwurzeln bildeten Schwerpunkte in den lebhaften Blumenbeeten. Der Garten war ein Ort lebendiger Erinnerung an ihren Leonard, der vor knapp drei Jahren tödlich verunglückt war.
Johanna hatte im Grunde nichts gegen Schnecken. Ihr Einsatz gegen sie begann erst, wenn die Tierchen sich zu rabiat von ihren Pflanzen ernährten.
»Ach nee, Frau Krafft kauft Bier! Isset wieder so weit?«
Die Kassiererin an der Supermarktkasse wusste genau, was zum Standard ihrer Kunden gehörte, und Frau Krafft befand sich in der Eierlikör- und Weißweinkategorie.
»Tja, Frau Behle, die haben mir heute Nacht das Kreuzkraut klein gekaut, da muss ich mal energisch durchgreifen und meine Bierfallen aufstellen.«
»Ist bestimmt ein schöner Tod, so bierselig an dem Ort, der so verlockend roch.«
»Na ja, Frau Behle, ob man das schön nennen kann? Ich weiß nur eins: In jedem Frühjahr rede ich mit den Tieren über mäßige Verluste, warne sie vor Überschreitung meiner Toleranzgrenze, und spätestens im Juni buddele ich die Löcher für die Bierfallenbecher. Wie eine Horde Siebtklässler lernen sie es einfach nicht.«
Beide lachten herzhaft, während Johanna ihre Einkäufe in Stoffbeuteln verpackte. Vor der Tür traf sie Gertrud, die aus der Bankfiliale nebenan kam. Gemeinsam machten sie sich über den Brunnenplatz auf den Heimweg.
»Gertrud, schau mal, was hängt denn da aus dem Fenster?«
Die Umgebung der Mehrfamilienhäuser befand sich mal wieder in bedenkenswertem Zustand. Aus einem ungeputzten Fenster mit schräg baumelnder Gardine hing ein rotes, bedrucktes Stoffrechteck.
»Das ist eine Ferrarifahne. Kennst du die nicht? Sonntags werden immer die Formel-1-Rennen übertragen, und wenn Ferrari siegt, hängen die Fans ihre Fahnen raus.«
»Passt gut zu dem ganzen Sperrmüll.«
In Höhe des Hauses der jungen Familie Lürsen erweckte eine helle Frauenstimme die Aufmerksamkeit der beiden Frauen.
»Schneck, Schneck, komm heraus, strecke deine Fühler aus …«
Silke Lürsen hockte neben ihrer kleinen Tochter im Gras, ein gelb geringeltes Schneckenhaus auf der Handfläche tragend, und sang diesen alten Reim.
»Da, Merle, schau, da kommt das Schnecklein hervor. Sei ganz ruhig, sonst erschrickt es und versteckt sich wieder.«
»Widerlich«, flüsterte Gertrud im Vorübergehen, »die weiß doch gar nicht, wie viel Last man mit den Viechern hat.«
»Komm, Gertrud, haben wir in dem Alter auch nicht gewusst. Die sind doch erst vor drei Monaten eingezogen und sehen ihren Garten noch mit ganz anderen Augen.«
»Hast ja Recht. Du, und die passen vorzüglich zu Uhlenbooms mit ihrer Naturschutzeinstellung. Werner und Käthe adoptieren doch auch alles, was kreucht und fleucht.«
»Stell dir vor, die beiden hätten auf der Seite noch so einen Nachbarn gekriegt wie den Alfred.«
Beide kicherten bei der Vorstellung. Ein kleines Lachen mit leichtem Schauer auf dem Rücken, denn einen zweiten Alfred Paessens würde niemand in dieser Siedlung ertragen. Einer reichte. Wenn jemand die Bezeichnung »Pedant« verdiente, dann er, der akribisch genau Längenwachstum von Rasen und Hecke beihielt und mehrmals in der Woche den Bürgersteig fegte.
»Johanna, weißt du eigentlich, wie er mit der Schneckenplage fertig wird?«
»Nein, ich werde ihn auch nicht fragen. Ich hasse Antworten, die sich über Stunden hinziehen.«
»Habe ich auch nicht von ihm, sondern von Herta.«
»Herta spricht?«
»Ich nehme sie manchmal im Auto mit nach Wesel, da ergibt es sich. Stell dir vor, der Kerl hat gegen Schnecken eine alte Schere neben der Mülltonne liegen. Ahnst du, was er damit macht?«
»Nein, du meinst doch nicht, dass er …«
»Doch, genau das macht er. Jede einzelne, die er spätabends mit der Grillzange in einer Blechdose sammelt, schnipp und schnapp!«
Johanna überkam ein leichtes Schütteln.
»Iih, erzähl bitte nicht weiter, sonst wird mir schlecht.«
Als Gertrud bereits vor ihrer Haustür stand, rief Johanna über die Straße. »Sehen wir uns heute Abend bei der Versammlung?«
Gertrud schüttelte den Kopf.
»Da geht Friedrich hin. Ich habe abends genug in der Küche zu tun.«
Sie hockten zu Tausenden unter flachen Steinen, in Erdmulden, unter Blättern, die den Boden berührten. Braun und orangerot, feucht glänzend warteten die gefräßigen Weichtiere auf die Dämmerung.
Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass die Zeitungsbotin ein paar Wochen später im Morgengrauen die Siedlung mit einem gellenden Schrei wecken würde. Die bedauernswerte Frau würde lange brauchen, um den Anblick der Wegschnecken zu vergessen, die im fahlen Licht gemächlich ihre schleimig glänzende Spur über ein lebloses Gesicht zogen und ein makabres Schneckenrennen veranstalteten.
Kneipenmief schlug Werner Uhlenboom entgegen, als er im Eingangsbereich der Gaststätte »Zum Schützen« die Finger ordnend durch die Frisur zog. Vereinzelte Gäste hockten an Tischen mit steif gemangelten Decken und Kunstblumenbuketts. Die vergilbte Tapete zierten gerahmte Fotografien ganzer Dynastien stolzer Schützenkönige nebst Throngefolge. Mit schweren Königsketten behangene Männer, von den Strapazen des Kampfes gezeichnet. Das Unbehagen, ausgelöst durch Schlips und Kragen, konnten sie nur knapp verbergen. Frauen in pompösen Kleidern, seidig glänzend, standen einmal im Leben im dörflichen Mittelpunkt. Über den Tresen lappten die Banner der ortsansässigen Vereine und Verbände. Demnächst würde ein neues Prachtstück dazukommen. Der Verein zur Verschönerung des Dorfes e.V. wartete auf die Auslieferung des eigens entworfenen Emblems, welches zukünftig seine Aktivitäten kennzeichnen sollte.
»Guten Abend, Wilma.«
»’n Abend, Werner. Bist aber spät dran heute.«
Wilma blickte kurz auf, ging routiniert und gewissenhaft ihrer Montagstätigkeit nach. Sie leerte die einzelnen Kästchen des Sparclubs, zog jedes heraus, zählte, notierte fein säuberlich den Betrag in einem eigens dafür angelegten Heft und schob es zurück. Pro Sparer zog sie bei der wöchentlichen Leerung fünfzig Cent für die Vergnügungskasse zur Finanzierung der jährlichen Clubfeier ein. Sie ließen ungefähr fünfzigtausend Euro in jedem Jahr hier, Wilmas Stammkunden, die mit dem Trinkgeld knauserten. Kaum zu glauben, eine solche Sparsumme. Sie staunten selbst jedes Mal über das Ergebnis ihres zwanghaften Gruppenverhaltens.
»Ich musste noch zu einer außerordentlichen Konferenz, die ausnahmsweise nicht zum obligaten Punkt, zehn Minuten vor Beginn der Tagesschau, endete. Die Sitzung da drinnen dürfte schon fast vorbei sein, oder? Unsere Zusammenkünfte dauern doch nie länger als eine Stunde.«
»Zu Ende? Und wovon träumst du dienstags? Hinter dieser Tür ist der Teufel los.«
Sie wies mit dem Kopf zur geschlossenen Doppeltür des Hinterzimmers, in dem alle hiesigen Vereine im Laufe des Jahres ihre Versammlungen abhielten.
»Gibt es Streit wegen des Vorschlages, sich am diesjährigen Wettbewerb zu beteiligen?«
»Ach was, wenn ich die Bruchstücke richtig zusammengesetzt habe, hält euer Nachbar Paessens den Verkehr mit unzähligen Fragen auf. Die Volksseele kocht. Was kann ich dir bringen?«
»Ein Alt, wie immer.«
Werner Uhlenboom begab sich in den Hexenkessel. Frank Lürsen, sein neuer Nachbar, schien glücklich, ein bekanntes Gesicht zu entdecken, und wies auf den leeren Platz neben sich. Die Luft war zum Schneiden verqualmt und vibrierte vor Anspannung. Erhitzte Häupter blickten ernst zum Podium unter der Dorffahne, zu Friedrich Kaldewei.
»Der Verein zeichnet sich durch uneingeschränkte Gemeinnützigkeit aus und verbietet jegliche Zahlungen von Aufwandsentschädigungen an die Vorstandsmitglieder.«
»Moment mal …«
Alfred Paessens war in seinem Element heute Abend. Vereinsrecht, genau sein Fachgebiet. Die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins zur Verschönerung des Dorfes und Traditionspflege e.V. wurde seit mehr als einer Stunde hartnäckig durch seine Fragen blockiert. Von den etwa vierzig zahlenden Mitgliedern war knapp die Hälfte anwesend und lehnte sich beim kleinsten Ton von Alfred abgenervt in den Stühlen zurück. Ein Raunen ging durch den Nebenraum der Gaststätte »Zum Schützen« im Bislicher Ortsteil Büschken.
Der amtierende Vorsitzende Kaldewei befand sich nach vier Alt und diversen Versuchen, Satzungsinhalte zu rechtfertigen, eindeutig im Bereich des Bluthochdrucks. Rotgesichtig und schwitzend fingerte er an dem viel zu engen Kragen seines Hemdes, während er Alfred feindselig anblitzte. Was hatte dieser Querulant jetzt schon wieder einzuwenden? Friedrich kochte, denn aufgrund seiner Überzeugungskunst war Paessens diesem Verein beigetreten. Ein Fachmann für Vereinsrecht in den eigenen Reihen wäre nicht schlecht, hatte er gedacht. Zwei neue Mitglieder gab es zu begrüßen, ihn und den jungen Lürsen. Gleich heute, in Alfreds erster Versammlung, verzögerte er den ordnungsgemäßen Ablauf durch penetrante Zwischenfragen. Zehn Tagesordnungspunkte standen in der Einladung. Punkt drei war die Vorstellung der neuen Satzung, eine reine Formalie, und da blieben sie unerbittlich kleben. Für Friedrich war dies mittlerweile ein Akt blanker Willkür. Paessens war kein Fußballfan, schlicht nicht daran interessiert, die Übertragung des UEFA-Cup-Spiels um einundzwanzig Uhr zu sehen. Hoffentlich würde Gertrud den Rekorder klarmachen und diesmal auch an die Kassette denken. Das hier konnte dauern.
Alfred Paessens kannte sich als Oberjustizangestellter mit Paragraphen und deren Auslegung aus und war einzig darauf bedacht, bei der neuen Satzung keine Punkte zu akzeptieren, die er später bereuen würde. Alles musste seine Ordnung haben, gerade in Vereinen. Er hatte sich Stichpunkte an den Rand der Satzung notiert, die der Einladung beigefügt war. Mit einem Filzstift hakte er jeden geklärten, jeden fragwürdigen Punkt ab.
Für die anderen Mitglieder war besagtes Papier notwendiges Beiwerk, ausgetüftelt von vertrauenswürdigen Köpfen und keiner Diskussion wert. Alfreds Einwände stießen auf Unverständnis. Bert Schreiber, das fünfte Glas Bier in der Hand, warf ihm einen giftigen Blick zu und wäre am liebsten mit ihm vor die Tür gegangen. Exakt das hatte seine Isolde ihm nachdrücklich verboten. Er sei doch allmählich zu alt für Kneipenschlägereien. Hatten doch beide keine Ahnung, weder seine Frau noch Paessens. Die konnten nicht erahnen, was es hieß, den Anpfiff eines wichtigen Spieles zu versäumen.
»Mensch, Paessens, kannst du nicht endlich deinen Rand halten? Du blöder Hornochse hältst den ganzen Betrieb auf.«
Zustimmendes Gemurmel von allen Seiten, flankiert von unterschwelliger Erbostheit über die dreiste Bemerkung. Alma Argond meldete sich fingerschnippend aus dem Hintergrund.
»Ich finde, Herr Schreiber sollte den blöden Hornochsen zurücknehmen. Das ist eine Beleidigung, denn Tiere sind im Allgemeinen sehr schlau. Den Rest kann ich unterstützen.«
Tiez und Köbes saßen schenkelklopfend da und amüsierten sich prächtig, da sie in Mutters Abwesenheit ganz männlich zwei Pils und zwei Korn konsumiert hatten.
»›Hornochse‹ hat er gesagt.«
»Und ›blöd‹.«
»›Böses Wort‹, wird Mama sagen, Alfred und ›blöder Hornochse‹.«
Wolle Kaschewski strich sich mit der Rechten den Bierschaum aus dem Schnäuzer und kam in Fahrt.
»Macht ihr euch nur lustig, ihr zu groß geratenen Kindsköppe. Wat meint ihr, wie oft ich über euch lachen könnte, wenn ich dat genau so machen tät wie ihr. Nix inne Birne, aber über andere ablachen.«
Friedrich waltete energisch seines Amtes als Vorsitzender.
»Damit es überhaupt ein Fortkommen gibt, schlage ich vor, Bert nimmt den ›Hornochsen‹ zurück, und wir vertagen die Satzung auf die nächste Versammlung, damit wir zeitig Schluss machen hier.«
Zustimmendes Geplauder, drängende Blicke verfolgten Bert Schreiber.
Wilma stand mit einem vollen Tablett nachbestellter Getränke kopfschüttelnd im Türrahmen. Was für ein Kindergarten!
Frank Lürsen wandte sich flüsternd an Werner.
»Sag mal, geht das hier immer so ab?«
»Nein, in der Regel verlaufen diese Treffen einträchtig und relativ harmonisch. Traditionsbewusste Schöngeister beschimpfen sich nicht. Du siehst, wohin es führt, einen Verein für alle zu öffnen und gleichzeitig die Sitzung auf einen Fußballabend zu legen.«
Bert schlug mit der rechten Faust auf den Tisch, dass die Gläser wackelten, und schrie:
»Euch geht der doch genauso auf den Senkel wie mir. Nu seid auch ehrlich genug und gebt es zu. Na gut, Hornochse war falsch. Besser wäre …«
»Bert! Lass jetzt gut sein«, mischte sich Johanna Krafft in die Szene, die erneut zu eskalieren drohte, »du bist Friedrichs Vorschlag nachgekommen. Ich lass es jedenfalls so gelten, und nun lass Alfred einfach in Ruh, sonst kommen wir garantiert heute nicht mehr nach Hause. Alfred, vielleicht erklärst du uns mal allgemein verständlich, warum dich all diese Kleinigkeiten in der Satzung stören.«
Der biedere Mann in dem braun karierten Jackett mit den Lederflicken auf den Ellenbogen saß grübelnd vor seinen Papieren.
»Komm, Alfred, sag was.«
Werner Uhlenboom wusste sofort, was hier ablief, nachdem er Stifte, Papiere und Mineralwasserflasche in Reih und Glied vor seinem Nachbarn aufgebaut erblickt hatte. Vor Jahren hatte er mit ihm und den einseitig talentierten Steinbrinkbrüdern Doppelkopf gespielt. Er musste aufgeben, weil mehr über Spielregeln gezankt als Karten gekloppt wurde. Korinthenkacker nannten die Zwillinge den Alfred seither, und Werner hatte beschlossen, nur noch über unverfängliche Themen wie Blumen, Wildgänse oder das Wetter, aber niemals mehr über konfliktträchtige Inhalte mit ihm zu reden. Sie lebten zufrieden nebeneinander, plauderten über den Zaun hinweg oder mit einem Bierchen vorn an der Mauer. Jetzt saß er da, Oberjustiziar Paessens, ein stolzer Fuchs von der Meute in die Enge getrieben, und sprach kein einziges Wort mehr.
»Vorwärts, Mann, die Zeit läuft.«
Bert wurde zusehends unruhiger und rutschte auf der Sitzmulde des Holzstuhls hin und her. Johanna brachte das Problem schließlich auf den Punkt.
»Mal anders formuliert, Alfred: Alle hier haben die Satzung in ihrer Post gehabt, haben sie zu Hause durchgelesen und sind mit ihr einverstanden. Alle, außer dir. Wenn du deine Zeit partout lieber mit der Auslegung von Paragraphen verbringen willst, mach es, aber bitte nicht hier. Nu gib dir einen Ruck, erkenn das Dingen an, damit wir noch über die Aufgabenverteilung wegen der Bewertung durch die Kommission reden können. Die Alternative wäre, gleich wieder auszutreten, was, Moment, laut neuer Satzung, zu diesem Zeitpunkt noch ohne Kündigungsfrist geht.«
Tosender Beifall, zustimmende Rufe, Wilma blickte erstaunt zur Tür herein. Euphorische Geräusche passten nicht zu der ungewöhnlich gereizten Stimmung.
Die Bäuche der Steinbrinkbrüder wogten in pubertär gackernden Lachsalven und spannten die begürtelten, viel zu engen, hochgezogenen Hosenbunde zum Bersten. Beide Burschen fanden kein Ende, selbst als alles rundherum wieder zur Ruhe kam.
Wolle fühlte sich bestätigt.
»Da, wat sach ich, in so ein Verein gehör’n nur Leute mit wat inne Birne, die wo auch wat erreichen können. Bei den beiden is der Docht einfach zu kurz für dat Licht.«
»RUHE!«
Friedrich befand sich haarscharf am Rand eines cholerischen Anfalls, klopfte wild mit seinem edlen Waterman-Kugelschreiber auf die Tischplatte.
»Ich unterstütze Johannas Eingabe. Alfred, deine Entscheidung bitte.«
Alfred strich sich im Zeitlupentempo mit beiden Händen das schüttere Haar zum Hinterkopf, stapelte ebenso mit Bedacht seine Utensilien, stand auf und ging. An der Tür drehte er sich noch einmal um.
»Ich trete hiermit aus diesem Verein aus und werde dies auch noch in schriftlicher Form dem ersten Vorsitzenden mitteilen und entsprechend begründen. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt, alle, wie ihr da sitzt.«
Die Erfüllung des insgeheim kollektiv gehegten Wunsches traf die Vereinsmitglieder unvermittelt. Alfred war fort. Bert Schreiber richtete sich zufrieden lächelnd auf.
»Los, Friedrich, mach voran, dann schaffen wir es noch zur zweiten Halbzeit.«
Derweil begann das Spiel Juventus Turin gegen Schalke 04 ohne die anderweitig beschäftigten Fans aus Bislich Büschken.
»Sollte irgendjemand auch nur im Entferntesten vorhaben, weiter an der Scheißsatzung herumzumeckern, könnt ihr euch gleich einen neuen Vorsitzenden suchen.«
»Ach was, Friedrich. Einstimmig angenommen, oder?«
Johanna wollte ebenfalls nach Hause, aber mehr wegen des Zusammentreffens von rheumatischen Gelenken und unbequemen Sitzmöbeln. Keine einzige Gegenstimme, keine Enthaltung, Aufatmen. Körperhaltung und Gesichtszüge der Anwesenden entspannten sich leicht.
»Gut. Lasst uns über das Projekt ›Unser Dorf soll schöner werden‹ beraten. Wir sind vom Kreis angeschrieben worden, ob Büschken an dem Wettbewerb teilnehmen möchte. Wie im letzten Jahr besprochen, habe ich uns angemeldet.«
Zustimmendes Tischklopfen, vereinzelte Ja-Rufe.
»Hurra, hurra, wir machen mit, hurra …«
Köbes freute sich wie ein Lottokönig, riss seinen Bruder halbwegs mit, dessen Kopf sich bereits mit halbgeschlossenen Augen zur Seite neigte, und wieder fand Johanna der Situation angemessene Worte.
»Köbes, setz dich und hör gut zu, damit du der Mama nachher alles genau erzählen kannst. Wilma, ich glaube, die beiden möchten ab sofort nur noch Mineralwasser.«
Friedrich fuhr fort mit seinen Erläuterungen.
»Ihr wisst, worum es geht. Bewertet werden attraktive, liebevoll, mit viel Eigeninitiative gestaltete Siedlungen. Ihr erinnert euch an die Fotoaktion im letzten Frühsommer. Ich habe eine kleine Broschüre zusammengestellt, die uns zur Präsentation sehr nützlich sein kann. Gemeinsame Aktionen werden ebenfalls positiv gepunktet. Ich dachte mir, die Mitglieder der Kommission zu unserem diesjährigen Brunnenfest einzuladen.«
Alma Argond meldete sich mit erhobenem Arm aus der Hinterbänklerposition.
»Bevor ihr anfangt zu mosern, ich werde meinen Vorgarten auf Vordermann bringen, so leid es mir auch um ein paar der Wildkräuter sein wird. Den Zaun streiche ich ebenfalls.«
Diesmal gab es Applaus, da Alma sonst stundenlang von gemeinschaftlichen Vorhaben überzeugt werden musste.
»Danke für dein Entgegenkommen, Alma. Viel mehr liegt mir der verlotterte Zustand der beiden Häuser am ›Goldenen Eck‹ im Magen.«
»Mann, so schade, dass die Pinte damals abgebrannt ist. Wisst ihr noch, wenn man durch die alte Eichentür reinkam, der alte geflieste Boden, die niedrigen Holzdecken und der Biergarten im Sommer. Das war ein richtiges Schmuckstück, da an der Ecke. Kaschewski, hörst du, ein Schmuckstück!«
»Wat meins du damit, he, willse mich vonne Seite anbaggern?«
»Komm, Kaschewski, sei friedlich. Erinnere dich ans letzte Jahr, da wolltest du unbedingt in diesen Verein und hast uns versprochen, für ein bisschen Ordnung zu sorgen. Und? Guck dich um. Nichts als Sperrmüll und verwilderte Anlage. So schwer kann das doch gar nicht sein, ein wenig Disziplin in diese Häuser zu kriegen.«
Wolles Gesicht wechselte die Farbe.
»Hab ich die Pinte abgefackelt und die Mietshäuser dahin gesetzt, oder wat? Ey, wenn mich hier einer fertig machen will, lernt der mich ma kennen.«
Werner Uhlenboom entdeckte mit fachmännischem Lehrergespür aufkommendes Konfliktpotenzial. Gebotene Distanz und Sachlichkeit würden beruhigend wirken. Erprobte Oberstufenstrategie.
»Herr Kaschewski, niemand will Sie hier angreifen, nur als inoffizieller Sprecher der insgesamt zwölf Familien in den beiden Häusern verfügen Sie über nicht unerheblichen Einfluss auf das Verhalten Ihrer direkten Nachbarn. Ihre Intervention könnte eine Veränderung des bedauernswerten Zustandes der Vorgärten bewirken.«
»Wat will der mir damit sagen, he?«
»Aufräumen, Wolle, Sperrmüll weg, Unkraut rupfen, ein paar Euro vom Vermieter locker machen zum Blumenpflanzen und dann auch darauf achten. Deine Bleibe liegt gegenüber vom Brunnenplatz. Wenn die Bewertungskommission zu dem Fest kommt und stundenlang euren Müll vor Augen hat, ist sie gleich wieder weg.«
Bert wusste, wie und was Wolle verstand. Johanna setzte noch ein unschlagbares Argument drauf.
»Mensch, Wolle, du mit deinem Grips kriegst das doch den anderen verklickert, oder?«
»Klaro, wird schon schief gehen.«
Davon schienen einige skeptische Gesichter fast überzeugt.
Im Schankraum saß eine Hand voll Gäste mit hochgerecktem Hals vor der Theke und verfolgte das Spiel auf dem kleinen Fernseher, der über der Tür zu den Toiletten auf einem Schwenkarm befestigt war. Bert vergaß sein drängendes Bedürfnis sowie die Versammlung und gesellte sich spontan dazu. Wilma zog beiläufig Gläser über die Spülbürsten. Eine Kippe hing gekonnt in ihrem linken Mundwinkel und gab der sonst hausbackenen Frau im mittleren Alter etwas Verrufenes. Sie drohte bei jeder Bewegung aus den Lippen zu fallen, worauf manch ein Stammgast seit Jahren wartete. Vergeblich, denn selbst sprechen konnte Wilma, so fingerlos rauchend, und, wenn es darauf ankam, sogar brüllen.
»Keine Sorge, hast nichts verpasst. Unsere spielen wie die Luschen. Immer noch null-null. Sag mal, Bert, was habt ihr denn mit dem Paessens gemacht? Der zitterte ja richtig, als der sein Wasser bezahlte. Und murmelte die ganze Zeit was von: Ihr würdet schon sehen und hättet es so gewollt.«
»Da, Tooor! Von wegen Luschen, hast du das gesehen? Genau in die freie Ecke. Superpass. Was sagst du, Wilma? Ach, der Alfred, der ist freiwillig gegangen, und keine Ahnung, was er damit meint.«
»Seid ihr bald fertig da drinnen?«
»Nein, wir sind gerade – hast du das gesehen? Warum pfeift die Flasche von Schiedsrichter nicht? Foul, glattes Foul!«
An diesem Punkt mischte sich der schwerbauchige Club der anonymen passiven Thekenfußballer ein. Die Fachmänner mit unbewegten Gesichtern, hart antrainiertem Sportwissen und Stemmvermögen für das Bierglas in Reichweite.
»Quatsch, der ist von hinten in die Beine gerutscht. Da konnte der gar nichts zu.«
»Guck, hat sich selber verletzt, ziemlich, da, das schmerzverzerrte Gesicht.«
»Alles nur Theater bei den Italienern.«
»Ist kein Italiener, ist Brasilianer.«
»Egal, spielt in einer italienischen Mannschaft und passt sich den Sitten an.«
»Mann, Mann, Mann, das war aber verdammt knapp.«
»Wieso, hat er doch souverän gehalten.«
»Guck dir die faule Sau an, noch keine fünfhundert Meter gelaufen bis jetzt. Beweg deinen Hintern endlich mal!«
Wilma wunderte sich immer wieder über die Kommunikationsfähigkeit von Fußballfans, die sich zehn Minuten nach dem Spiel nicht mehr kannten.
Mittlerweile trat Bert unruhig von einem Bein auf das andere. Werner bemerkte ihn erst, als er von der Toilette kommend an ihm vorbeilief.
»Mensch, Bert, wir brauchen dich da drinnen. Es geht langsam um die Aufgabenverteilung, komm, die paar Minuten wird die Mannschaft auch ohne dich spielen.«
Bert war erst nach einem weiteren Tor, das seiner Mannschaft den Sieg in greifbare Nähe brachte, in der Lage, seine Aufmerksamkeit vom Spielgeschehen zu lösen.
Im Hinterzimmer herrschte pure Sachlichkeit. Die Steinbrinkbrüder lehnten ihre geplagten Köpfe aneinander und schnarchten leise. Wolle blickte gelegentlich kopfschüttelnd hinüber. Friedrich beschriftete ein vorbereitetes Organigramm mit Namen und Daten.
»Johanna, du kümmerst dich auch in diesem Jahr um die dekorative Ausrichtung des Brunnenfestes, in Ordnung? Blumenschmuck, Lampions und so, du weißt schon. Und, bitte, frag im Supermarkt, ob der Azubi wieder die Anlage beim Parkplatz richten kann.«
Johanna nickte nur kurz.
»Und du kennst dich so phantastisch mit allem aus, was Leib und Seele zusammenhält. Organisierst du das Essen?«
»Auch das, wenn ihr mir das anvertraut. Rechnungen an den Verein, richtig?«
Werner Uhlenboom übernahm die Vorbereitung des Festplatzes inklusive Stromversorgung und Wasseranschluss. Frank Lürsen meldete sich, um den dahinter liegenden Spielplatz in Ordnung zu halten. Der grenzte an sein Grundstück und wurde auch von seinen Kindern regelmäßig frequentiert.
Bert Schreiber wurde zum Ansprechpartner für die Bepflanzung der Beete zu Füßen der kugeligen Ebereschen ernannt. Vor jedem Haus befand sich eine teilweise bereits liebevoll gepflegte, rechteckige Anlage zwischen Gehsteig und Straße. Alles sollte für die Kommission gehörig aufgepeppt werden.
Alma Argond raunte ihren Unmut über Friedrichs zweifelhafte Entscheidung in Johannas Ohr.
»Da hat er glatt den Bock zum Gärtner gemacht. Unser Förster vom abgebrochenen Schwarzwald soll bunte Blumen säen. Mal sehen, was er darunter versteht.«
Wolle Kaschewski nickte unentwegt bei der Übernahme seines Aufgabenbereiches, den kein anderer auch nur scheibchenweise geschenkt haben wollte. Kein Zuckerschlecken, im Goldenen Eck für Ordnung zu sorgen, Sisyphusarbeit, nicht hundertprozentig bedenkenlos in seine Hände gelegt.
»Dann haben wir es fast. Ach, hätte ich beinahe vergessen.«
Friedrich zog einen Pappkarton unter dem Tisch hervor.
»Im letzten Jahr haben wir doch die Fähnchengirlanden geplant. Wisst ihr noch? Jedes Haus sollte eine erwerben, um sie bei besonderen Gelegenheiten quer über die Straße zu spannen. Hier sind sie nun, vor zwei Wochen angekommen. Bert, du verfügst über Erfahrung mit Fahnen, und weil es dein Vorschlag war, bin ich dafür, dass du der Fahnenwirt der Siedlung wirst.«
Bert Schreiber wuchs über seine durchschnittlichen körperlichen Ausmaße hinaus, hörte imaginären Applaus, sah sich genötigt aufzustehen, sich dem huldigenden Volk zu stellen, die nicht enden wollenden Ovationen anzunehmen. Seine Fahnen, seine Idee, abgekupfert vom Schützenverein in Büderich-Gest, weit genug weg auf der anderen Rheinseite. Sein Lebensmotto würde bei festlichen Anlässen die gesamte Siedlung schmücken, an wetterfesten Kordeln jeweils fünfzehn grün-weiße kleine Fähnchen, jedes dritte mit dem Schriftzug »Glaube, Sitte, Heimat« neben einem Bildnis des heiligen Johannes. Dazu waren das Kapellenhäuschen, das außerhalb des Dorfes am Wäldchen steht, sowie die Eberesche mit roten Beerendolden symbolisch für die Himmelsstiege aufgedruckt. Mit glasigen Augen stand er da.
»Bert, hallo. HALLO!«
Es bedurfte letztlich eines heftigen Rucks an seinem Ärmel, um lebenswichtige Funktionen wie das Durchatmen wieder in Gang zu bringen und ihn auf den Boden des Hinterzimmers zurückzuholen.
»Es ist euch klar, dass nichts im Leben umsonst ist. Ich habe die preisgünstigste Variante gewählt, gedruckt auf Drachenstoff, gefertigt im Ausland. Dadurch haben wir eine Menge gespart, aber es bleiben für jedes Haus achtundsechzig Euro zu zahlen.
Wolle erwachte schlagartig aus seinem Dämmerzustand.
»Wat, achtundsechzig Moppen? Willze ’nem nackten Mann inne Tasche packen?«
Bert weilte rein rhetorisch wieder unter ihnen.
»Reg dich ab, Kaschewski, das gilt nur für Hausbesitzer, nicht für Vorgartenbesetzer.«
Friedrich schob geräuschvoll seine Papiere zusammen, legte den Stapel in eine Mappe und ließ die Verschlussgummibänder auf den Kunststoffdeckel knallen. Die Aufmerksamkeit des Komitees war ihm sicher.
»Ich schlage vor, dass alle Verantwortlichen sich ab jetzt jeden Montag hier treffen, um sich über den Stand der Dinge auszutauschen. Ich selbst werde die Festauslegung koordinieren und über die Finanzen wachen. Lasst uns Schluss machen für heute. Bis nächste Woche, zwanzig Uhr.«
Müdes Tischklopfen.
Das Spiel war abgepfiffen. Schalke 04 hieß der Sieger, und die schwergewichtige Thekenmannschaft hatte das Stadium der Spielanalyse bereits lallend hinter sich gelassen.
In kleinen Grüppchen, zu zweit oder allein wie Wolle Kaschewski, begaben sich die Vereinsmitglieder auf den dunklen Heimweg. Allen voraus torkelten eng umschlungen und einander brüderlich stützend die Zwillinge. Jeder Schritt war eine Herausforderung an Schwerkraft und Fliehkraft, und mit dem verbliebenen Minimum ihrer Wahrnehmungsfähigkeit bemerkten sie nicht die Scharen aus dem Schutz der Dunkelheit kriechender Wegschnecken, deren einziges Bestreben in der Überquerung des Gehsteigs lag. Mit jedem Schritt kam vielfach der Tod. Denen, die das Schicksal verschonte, begegnete Minuten später ein euphorisch gestimmter Bert, der, erst in Höhe seines Grundstückes nach unten blickend, schnell und gezielt zutrat, obwohl seine Laune mehr nach Weitwurf verlangte. Zu viele Zeugen.
Als die letzte Haustür ins Schloss fiel, kehrte noch lange keine Ruhe ein.
Die Frau wich mit angstverzerrtem Gesicht, rückwärts gehend, sich seitlich duckend, den Fausthieben aus, die sie auf sich zukommen spürte, obwohl die Hände des Mannes noch nicht geballt waren. Es würde geschehen. Heute, gleich, wie immer, wenn er nicht mehr ansprechbar war, sie anstarrte, sich langsam auf sie zubewegte, bis sie nicht mehr weiterkonnte, mit dem Rücken zur Wand der Willkür und Gewalt ausgeliefert war.
»Bitte nicht, nein, tu es nicht, bitte. Ich kann doch nichts dafür. Bitte, lass mich gehen, mach den Weg frei, bitte …«
»Zartjunger Dienstag, drei Minuten nach Mitternacht. Hier ist Radio KW mit dem Programm bis in den frühen Morgen. Wie gewohnt an dieser Stelle heißt es ›Seelentalk nach Mitternacht‹. Mein Name ist Fee von Schlarenberg, hellwach und in der kommenden Stunde mit dir auf Sendung. Liebeskummer, Frust oder Freude zum Platzen, und niemand da, mit dem du quatschen kannst? Ruf an, wir reden drüber. Die Telefonnummer gibt der Ingo vom Ton nach der aktuellen Straßenlage durch. Kommt sicher an den Radarkontrollen vorbei nach Hause und macht es euch gemütlich. Nur Mut, tief durchatmen, das Telefon griffbereit legen. Wir hören uns, bis gleich.«
Nichts los auf den niederrheinischen Straßen. Ingos Ansage war kurz und belanglos. Nach der Telefonnummer blendete Fee das erste Musikstück ein. Jazz vom Feinsten stellte als musikalisches Erlebnis die Fahrt durch eine nächtliche Großstadt dar. Ingo hob den Daumen hinter der Scheibe. Fee bewies einen guten Geschmack und entdeckte regelmäßig außergewöhnliche Stücke, die ihren Talk untermalten und unaufdringlich, aber einprägsam ganz verschiedene Altersstufen ansprachen.
»Für alle, die es genau wissen wollen, und damit die Leitung frei bleibt für dein Gespräch mit mir: Dies war ›Drive Time‹ von Chris Botti. Ihr habt seine Trompete schon mal gehört, wetten? Er spielte unter anderem in der Band von Sting. Gleich mehr von City Jazz.«
Die ersten Anrufer waren Teenager, die sich kichernd produzierten und zum Schluss den Versuch unternahmen, ihre unzähligen Freunde zu grüßen. Ein Wettlauf mit Fees linkem Zeigefinger, der den Regler für die Musik rasant hochschob, um zu verdeutlichen und zu beenden, was nicht in ihr Konzept passte.
Ingo bohrte mittlerweile in der Nase, was nicht seine einzige schlechte Angewohnheit war, als der Anruf kam, der Fees Fähigkeiten herausforderte.
»Guten Abend, Frau von Schlarenberg.«
»Fee, bitte sag Fee zu mir. Dir ebenfalls einen guten Abend. Mit wem spreche ich?«
»Bitte, legen Sie nicht auf. Ich kann meinen Namen nicht nennen. Ich weiß genau, dass Sie das nicht mögen, denn ich verpasse keine einzige Sendung. Aber verstehen Sie bitte meine Situation. Ich komme in Teufels Küche, wenn bekannt wird, dass ich mit Ihnen spreche. Ich weiß doch sonst nicht, wohin.«
Die blitzschnelle Entscheidung, die Anonymität dieser Frau zu akzeptieren, traf Fees Stimme, ohne den Kopf eingeschaltet zu haben.
»Okay, du bist hier richtig. Atme tief durch, gemeinsam mit mir. Jetzt, so, ja, gut so. Erzähl mir deine Geschichte.«
»Mir persönlich geht es gut, wirklich. Sie müssen nicht glauben, ich hätte Probleme. Ich brauche einen Rat wegen einer Freundin.«
»Deine Freundin hat Sorgen?«
»Ja, ziemlich große. Wie soll ich bloß anfangen?«
»Erzähl einfach, was dich am stärksten berührt.«
»Ihr Schmerz, ich glaube, mich berührt ihr Schmerz.«
»Welcher Schmerz?«
»Der körperliche und gleichzeitig der seelische. Wissen Sie, ihr Mann verprügelt sie.«
»Deine Stimme ist ganz belegt, du hast einen Kloß im Hals.«
»Ja.«
»Lass dir Zeit.«
Schwere Atemzüge wurden hörbar leichter.
»Geht es wieder?«
»Ja, danke, Sie sind so aufmerksam.«
»Wie fühlst du dich?«
»Ein wenig ruhiger.«
»Magst du noch einmal beginnen?«
»Ja, also ich habe da eine Freundin. Eigentlich meine einzige Freundin. Sie ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Zuerst habe ich mich immer gewundert, wenn unsere Verabredungen von ihr abgesagt wurden.«
»Ihr seht euch regelmäßig?«
»Ja, außer wenn sie sich nicht bewegen kann. Er schlägt sie nie so, dass man etwas sieht, immer auf den Körper, Brustkorb, Rippen, Bauch.«
»Das ist ja furchtbar. Du fühlst richtig mit, stimmt’s? Ich höre deine Betroffenheit zwischen deinen Worten, sag …«
»Ich muss aufhören, ich darf mich doch wieder melden, ja? Bitte, ich …«
Fee spielte das nächste Stück ein. »Dancing in the sunshine of the dark« von der Gruppe Fury. Nachdenklich nahm sie einen tiefen Atemzug und hatte das Gefühl, ihren Kopf frei zu bekommen, um diesem Dialog nachzuspüren. Fees Methode. Nach aufreibenden Gesprächen hätte sie sich eigentlich gern mit Ingo ausgetauscht. Sie sah auf. Er saß auf seinem Platz und verdrückte gerade einen nächtlichen Snack aus einer Fastfood-Box, schleckte seine Finger ab, heftig schluckend, um den nächsten Anruf entgegenzunehmen. Wenigstens diese Tätigkeit übte er vorwiegend mit leerem Mund aus. Ingo reagierte auf visuelle Signale oder akustische Reize, hörte jedoch niemals bei den Talks zu.
Während sie telefonierte, lagen Karins Beine bequem übereinander geschlagen auf ihrem Schreibtisch.
»Ach Karin, du wärst schreiend aus der Sitzung gelaufen. Wie die Kinder haben die sich benommen, teilweise noch schlimmer, und ein paar fähige Hände müssen doch tatkräftig an der Golddorf-Ehre arbeiten, oder?«
»Klar, aber müssen das unbedingt deine sein? Weißt du was? Melde dich, wenn ich dir helfen kann, versprochen? Im Moment ist es relativ ruhig hier, und mein berühmter Aktenberg misst weniger als zwanzig Zentimeter reale Höhe, ist also ignorierbar. Moment eben … Mensch, Burmeester, verzieh dich, siehst du nicht, dass ich telefoniere? Hast du noch nie Frauenbeine gesehen, oder warum glotzt du so? … So, da bin ich wieder. Das war unser neuer Assistent, Mann, geht der mir jetzt schon auf den Geist.«
»Sag mal, bringst du mir den Moritz am Wochenende? Wir wollen doch nach Wesel ins Kino. So etwas Fortschrittliches gibt es ja bei euch drüben nicht.«
»Ja, lästere du nur. Dafür gibt es in Xanten prima Angebote in der JuKuWe.«
»Wo?«
»In der Jugend-Kultur-Werkstatt, da wird den Kids Spannung ohne Kommerz vermittelt. Irgendwas ist da los am Samstag, das hat er schon angekündigt. Ich frage ihn nachher, okay?«
»Gut, meine Liebe, dann lass uns Schluss machen. Ich habe noch einige Gärtnereien abzuklappern, bis ich alle Preise zusammenhabe, und draußen geht irgendwas Außergewöhnliches vor sich. Ich muss mal nachschauen, wer da so herumlärmt. Wir hören uns, pass auf dich auf.«
So ganz konnte sich Johanna Krafft immer noch nicht damit anfreunden, dass ihre Tochter bei der Kripo arbeitete. »Mordkommission« hatte seinen anfangs spannenden Klang für sie verloren und war nach dem Tod eines Kriminalbeamten aus Hamminkeln vor einigen Jahren nur noch bedrohlicher und voller Gefahren. Es war die freie Entscheidung ihrer quirligen Karin, seinen Posten zu übernehmen. Im Betrugsdezernat würde sie versauern, hatte sie damals gesagt, und er würde nicht wieder lebendig, wenn ein anderer seinen Job übernehmen würde. Also tat sie alles, um ins K 1, zuständig für Kapitalverbrechen, zu kommen. Sie war zufrieden mit ihrem Beruf, das war die Hauptsache.
Der Lärm auf der Straße entwickelte eine schärfere Tonlage. Johanna nahm sich einen schmalen Streifen Streuselkuchen auf die Hand und ging mit ihrem dickwandigen Kaffeepott in der anderen hinaus. Eine ungewöhnliche Szene tat sich auf. Werner Uhlenboom und Alfred Paessens stritten sich auf dem Gehsteig.
Werner fuchtelte aufgeregt mit den Armen, schritt auf Alfred zu, wich wieder zwei Schritte zurück.
»Verrate mir bitte, was dich, nach all den Jahren nachbarschaftlicher Eintracht, dazu veranlasst hat, mir das Ordnungsamt zu schicken, weil mein Schneeballstrauch über den Zaun ragt!«
»Er ist eben zu groß, dein Strauch, behindert den freien Durchgang und verdreckt den Bürgersteig, der bei dir sowieso nur zu Ostern und Weihnachten gefegt wird.«
Werner kam erneut näher.
»Warum, bitte schön, kannst du mir derartige Kritik nicht selbst sagen, sondern schickst stattdessen einen Amtsbüttel her?«
»Nur, damit alles seine Ordnung hat.«
Alfred ließ Werner stehen und fegte weiter, mit regelmäßigen, routinierten Bewegungen, um letztlich das winzige Häuflein verirrten Laubes und Staubes per Kehrblech in seine Mülltonne zu befördern.
Johanna verstand die Welt nicht mehr, blieb jedoch weise im Hintergrund. Sie hockte auf der blauen Bank vor dem Haus, die einen kräftigen Kontrast zu den maifrischen Blättern der alten Hortensien darstellte, die sie einrahmten. Von hier aus konnte sie, die Abendsonne genießend, die Himmelsstiege gut überblicken. So entging ihr nicht, dass Werner sich resigniert zurückzog. Die Steinbrinkbrüder beschäftigten sich intensiv mit der Fassade des Eckhauses und hatten hörbaren Spaß dabei. Mehrere Kinder tobten ausgelassen vom Feldweg neben ihrem Grundstück auf die Straße. Der silberne Sportflitzer mit dem Stern vorn und hinten und mit Friedrich Kaldewei am Steuer rollte in gemäßigtem Tempo in seine Einfahrt. Kaldewei stieg aus und rief die Kinderbande zu sich, statt wie sonst umgehend im Haus zu verschwinden. Offensichtlich schickte er alle bis auf den Kaschewskijungen schnell wieder fort, sprach mit ihm, ließ sich etwas erklären, einen Gegenstand geben. Aus der Ferne betrachtet eine diffuse Situation, bis der Junge, triumphierend die Arme schwenkend, den anderen folgte. Johanna wunderte sich über die Szene, da Kaldewei mit Kindern rein gar nichts zu schaffen hatte. Er war der typische kinderlose Karrierist mit dem Zweisitzer und dem Krokodil auf dem Polohemd, der seine Golftasche auf dem Beifahrersitz Platz nehmen ließ, bevor er rasant davonbrauste.
Wolle Kaschewski erschien auf der Bildfläche, seinen Kevin hinter sich herzerrend. Er schellte bei Friedrich, und kaum, dass dieser öffnete, entfuhr Wolle eine gut hörbare Tirade.
»Wat hast du den Kevin zwanzig Euro inne Hand zu geben, he? Wat hat der dafür machen müssen? Der erzählt so ’ne erstunkene Geschichte von ein kaputten Becher, den er im Wald gefunden hat und den du ihn abgekauft has. Mit mir nich und mit mein Kevin auch nich! Lass bloß deine dreckigen Finger von mein Kind und pack den nie wieder an, sonst lernze mich ma kennen!«
Wolles Handy klingelte in der Tonfolge von Big Bens Glockengeläut, was seinen Auftritt bei Friedrich endgültig beendete. Der schloss kopfschüttelnd die Tür, ohne ein einziges Wort gesagt zu haben.
»Ja, wo bisse? Ich bin gleich zu Hause. Ja, is gut, zweimal ›Herr der Ringe‹, kannze am Abend abholen. Eins-a-Qualität, wie üblich. Jau, gleicher Preis. Bis dann, Alter.«
Er scheuchte während des Gespräches seinen Jungen vor sich her.
»Und wehe, du nimms noch mal Geld von den Kerl. Klar kannze dir die Terminatorfigur davon kaufen, schieß ab. Und lass dir nich in den Kopp kommen, davon Zigaretten zu holen!«
Johanna musste unweigerlich grinsen. Dieser Mann war so herzerfrischend eindeutig im Umgang mit seinen Mitmenschen, dem würde niemals einfallen, das Ordnungsamt zu schicken.
Sie ging zurück ins Haus und setzte sich mit Branchenbuch, Stift und Papier ans Telefon.
»Was war denn?«
Gertrud kam mit einem Strauß Frühjahrsblumen aus dem Garten, arrangierte ihn auf dem bereits eingedeckten Esstisch.
»Ach nichts. Bin noch eben im Büro und will nicht gestört werden.«
Friedrichs Arbeitszimmer befand sich im Souterrain. Es war Büro, Herrenzimmer, Rauchersalon in einem, sein Refugium und Fluchtort vor dem Ordnungswahn seiner Frau. Hier wurde nichts nach Größe sortiert, etagenförmig drapiert, paarig aufgestellt und mit Spitzendeckchen unterlegt. Derbe, undekorative Sachlichkeit, technisch voll aufgestattet, Hi-Fi, TV, PC, seine Videosammlung mit Uschi Glas auf dem Cover und Dolly Buster auf dem Band. Früher durfte Gertrud hier schon mal putzen, nackt mit kleinem Schürzchen. Derartige Aktionen hatten leidenschaftlich auf dem altenglischen Ledersofa geendet oder auf dem schweren Schreibtisch. Heute mochte er nicht mehr daran denken. Und zum Saubermachen schwenkte irgendeine Putzservicefrau ab und zu ihren Hintern hier durch, natürlich nur in seiner Anwesenheit. Er hatte sich angewöhnt, sein Heiligtum zu verschließen, egal, ob von innen oder außen.
Mit leicht zittrigen Händen stellte er seinen Schatz in den Lichtkegel der ultramodernen Schreibtischlampe. Aus dem Augenwinkel heraus entdeckt, in einer Kinderhand an ihm vorüberschaukelnd, ganz hier in der Nähe gefunden. Viel verstand Friedrich nicht von Altertümern. Noch nicht, aber dass dieser Becher verdammt alt war, sah man ihm an. Das machte Sinn. Bislich und damit Büschken waren nur wenige Kilometer von der alten Römersiedlung bei Xanten entfernt, auch wenn durch den Rhein von ihr getrennt. Heute. Es war noch gar nicht so lange her, dass der Fluss bei Hochwasser sein Bett wechselte und die geografische Trennlinie verlagerte. Funde waren also an vielen Stellen möglich, schlussfolgerte Friedrich.
Er wählte sich ins Internet ein und gab den Begriff »Römische Ausgrabungen« in die Suchmaschine. Nach einigen Umwegen gelangte er auf die Seiten des Archäologischen Parks in Xanten und erkannte den Becher wieder. Römisch also, verdammt alt, in der Tat, und bestimmt auch sehr wertvoll, denn Sammlerherzen zahlen jeden Preis. Wäre doch gelacht, wenn da nicht noch mehr zu holen ist. Der Geschäftsmann witterte Berge von Euroscheinen, die an der Steuer vorbei in seine Taschen flatterten.
»Ich geh noch mal raus.«
»Wohin gehst du denn?«
»Spazieren.«
»Aber das Essen ist gleich fertig.«
Die schwere Haustür fiel ins Schloss.
Insgeheim liebte Bert Schreiber eine Reihe kleiner Besonderheiten an seiner Frau, was er ihr gegenüber niemals erwähnen würde. Dazu gehörte ihre ausgeprägte Wachsamkeit.
»Ich werde nie begreifen, wie man gleichzeitig mit dem Rücken zum Fenster Kartoffeln schälen, sich unterhalten und mitkriegen kann, was auf der Straße los ist. Irgendwie seid ihr Frauen ja ziemlich gestört.«
»Pass bloß auf, sonst kriegst du keine Tipps mehr von mir.«
Isolde hatte ihren Mann darauf aufmerksam gemacht, dass Friedrich Kaldewei die Nachbarskinder zu sich zitierte, woraufhin Bert mit Stift und Papier ganz flott mal eben die Anlagen kontrollieren gegangen war. Mit verschränkten Armen hockte er am Küchentisch. Sie schaute ihn erwartungsvoll an.
»Und?«
»Wie, und?«
»Mensch, Bert, jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Was war los mit den Blagen? Erzähl mir nicht, Kevin Kaschewski hätte nichts angestellt.«
Isolde band sich die glatten, schulterlangen Haare zusammen und rieb die geschälten Kartoffeln auf einer Metallreibe mühevoll zu Brei.
»Weiß ich nicht genau. Ich konnte Friedrich verdammt schlecht verstehen, der sprach wohl extra leise. Kevin blökte wie seines Vaters Sohn. Irgendwas hat er im Wald gefunden, bei einem umgestürzten Baum. Alter Kram, für den sein Opa Kurt Geld abdocken würde. Da hat der Kaldewei ihm glatt fünf Euro geboten.«
»Was für alter Kram aus dem Wald?«