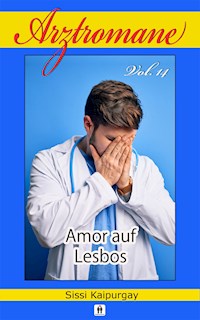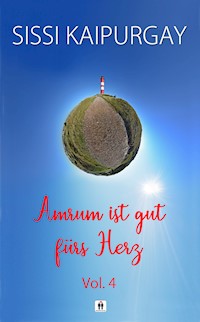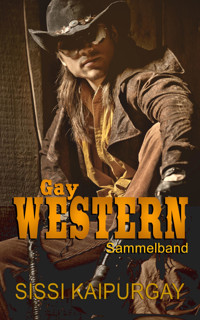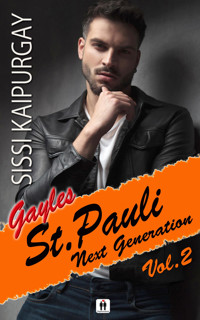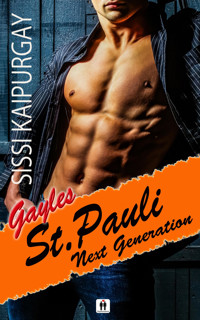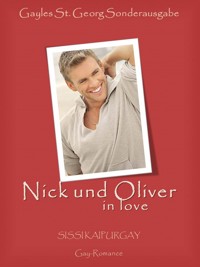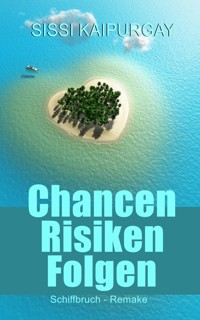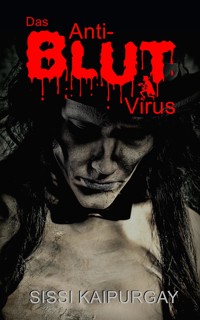
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Felix, 1460 als Gustav Stoiber geboren, hat sich mit seinem Leben - oder heißt es Nicht-Leben? - als Vampir eingerichtet. Als er von einer Seuche hört, die einige Artgenossen befallen hat, ist er erstmal nicht alarmiert. Schließlich trifft es immer nur die anderen. Tja, falsch gedacht ... Weitere Hauptrollen: Igor, ein Hardcore Rocky-Horror-Fan sowie Sandro, der an Wochenenden seine weibliche Seite rauslässt. Warnhinweis: Enthält Unmengen an Sahne. Für Allergiker ungeeignet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Anti-Blut Virus
Prolog – Anno 1479
Gegenwart
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Epilog
Epilog 2 – ein Jahr später
Das Anti-Blut Virus
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten sind frei erfunden, Ähnlichkeiten rein zufällig. Der Inhalt dieses Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Covermodels aus. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.
Texte: Sissi Kaipurgay/Kaiserlos
Korrekturen: Aschure, Dankeschön!
Fotos: shutterstock_115514563, Depositphotos_44132967_l-2015
Kontakt:
Sissi Kaiserlos/Kaipurgay
c/o Autorenservice Karin Rogmann
Kohlmeisenstieg 19
22399 Hamburg
Das Anti-Blut Virus
Felix, 1460 als Gustav Stoiber geboren, hat sich mit seinem Leben - oder heißt es Nicht-Leben? - als Vampir eingerichtet. Als er von einer Seuche hört, die einige Artgenossen befallen hat, ist er erstmal nicht alarmiert. Schließlich trifft es immer nur die anderen. Tja, falsch gedacht ...
Weitere Hauptrollen: Igor, ein Hardcore Rocky-Horror-Fan sowie Sandro, der an Wochenenden seine weibliche Seite rauslässt.
Warnhinweis: Enthält Unmengen an Sahne. Für Allergiker ungeeignet.
Prolog – Anno 1479
Gustav blinzelte in die Dunkelheit. Irgendetwas hatte ihn geweckt. Ein Käuzchen schrie. Es raschelte im Unterholz. Vielleicht ein Dachs oder ein anderes nachtaktives Tier. Über ihm flitzten Schatten zwischen den Baumstämmen hin und her. Fledermäuse. Als er sie das erste Mal erblickte, hatte er sich gefürchtet. Inzwischen war das vorbei. Er näherte sich dem Erwachsenenalter, womit solche Ängste wohl verschwanden. All das waren gewohnte Geräusche, also nichts, das ihn aus dem Schlaf reißen würde.
Wie immer hatte er einen Platz so weit wie möglich von Franz entfernt gewählt. Sein Herr schnarchte zwar nur, wenn er dem Branntwein zugesprochen hatte, doch es war zur Gewohnheit geworden.
Seit zehn Jahren tingelte er mit Franz, einem Bader, durchs Land. Er hatte gelernt, wie man Männer rasierte, Zähne zog, Wunden und Fieber behandelte. Auch Lesen und Schreiben hatte Franz ihm beigebracht.
Gustav war der Erstgeborene von sieben Geschwistern. Im Alter von neun Jahren hatten seine Eltern ihn dem Bader als Lehrling übergeben, damit sie ein Maul weniger stopfen mussten. Im Ganzen ging es ihm bei Franz besser als daheim. Er litt keinen Hunger, brauchte keine harte Feldarbeit verrichten und sein Bett nicht mit drei Geschwistern teilen.
Im Winter übernachteten sie in Scheunen oder bei Leuten, die ihnen gegen eine Behandlung Logis anboten. Im Frühjahr, Sommer und Herbst schliefen sie unterm Himmelszelt.
Bert, der Haflinger, der ihren Karren zog und den sie in der Nähe an einen Baum gebunden hatten, schnaubte. Gustav spähte hinüber. Im selben Moment huschte eine Gestalt über die Lichtung. Das geschah so lautlos, dass es unbemerkt geblieben wäre, hätte er nicht hingesehen. Oder hatte er sich geirrt? Nein! Da war sie wieder. Im Licht des halben Mondes beobachtete er, wie sie sich über Franz beugte. Ein Räuber? Sollte er sich still verhalten oder Alarm schlagen?
Er vernahm ein ersticktes Keuchen, dann einen Seufzer. Handelte es sich um eine Dirne? Solchen Frauenzimmern begegneten sie manchmal auf ihren Reisen. Ab und zu nahm Franz die Gelegenheit wahr, mit einer von ihnen hinter einen Busch zu gehen.
Wie gebannt beobachtete er die dunkle Gestalt. Nach einer gefühlten Ewigkeit richtete sie sich auf und guckte zu ihm rüber. Ihre Augen schienen rot zu leuchten. Ein eisiger Schauer rann ihm über den Rücken. Sein Verstand riet ihm, sein Heil in der Flucht zu suchen, doch er konnte sich nicht bewegen. Es war, als ob der Blick ihn lähmte.
Die Gestalt pirschte auf ihn zu. Bert wieherte schrill, genauso wie damals, als ein schlimmer Sturm aufzog. Gustav wurde von so großer Angst heimgesucht, dass seine Blase drohte, sich zu entleeren.
Dann war die Gestalt bei ihm. Ein wachsbleiches Gesicht, in dem tatsächlich rote Augen glühten, schaute auf ihn runter. Langsam kniete sie nieder, wobei sie die Zähne bleckte. Spitze Zähne, die im Mondschein weiß schimmerten.
Er musste träumen. Solche Monster gab es gar nicht! Gustav hatte Geschichten über sie gehört, glaubte aber nicht daran.
Die letzten Zentimeter überwand die Gestalt schnell und versenkte die scharfen Eckzähne in seinem Hals. Das fühlte sich nur im ersten Augenblick unangenehm an. Im zweiten war es auf morbide Art erregend. Das war das letzte, was ihm durch den Kopf schoss.
Im Morgengrauen weckte ihn ein Vogelkonzert. Gähnend schälte er sich aus der Decke, in die er sich gewickelt hatte und begab sich, um seine Notdurft zu verrichten, hinter einen Baumstamm. Was für ein böser Traum. Bestimmt war ihm der Kanincheneintopf, den Franz am Vorabend gekocht hatte, nicht bekommen.
Als er zur Feuerstelle ging, warf er einen prüfenden Blick auf seinen Herrn, der daneben lagerte. Franz‘ Augen waren geschlossen und er wirkte blass ... wie ein Toter. Alarmiert näherte er sich seinem Herrn, wobei er sich am Hals kratzte.
Eigentlich war es unnötig, denn er hatte schon viele Leichen gesehen, dennoch kniete er nieder und suchte nach Franz‘ Puls. Nein, nichts zu finden.
Er empfand Bedauern, doch weniger wegen Franz‘ Tod, sondern weil er nun auf sich allein gestellt war. Sein Herr hatte ihn zwar meist gut behandelt, doch manchmal, wenn lange keine Dirne zur Verfügung gestanden hatte, auf widerwärtige Weise benutzt. Insofern sah er Franz‘ frühes Ableben als gerechte Strafe an.
Ein Mal an seinem Hals erregte Gustavs Aufmerksamkeit. Er beugte sich tiefer, um es zu untersuchen. Zwei winzige Löcher, eine Spur getrockneten Blutes. Sein Traum fiel ihm wieder ein. Oder war es gar keiner und wirklich ein Vampirwesen auf der Lichtung gewesen?
Einige Momente starrte er Franz an, bevor er aufstand und zum Karren ging, um einen Spiegel aus einer der Kisten zu kramen. In seiner Halsbeuge entdeckte er zwei bereits verschorfte Einstichstellen. Der Grund, weshalb es dort fortwährend juckte. Die Indizien sprachen für sich: die Gestalt hatte ihn gebissen, aber am Leben gelassen. Franz hingegen war von ihr ausgesaugt worden.
Diese Erkenntnis ließ er ein Weilchen sacken, dann kehrte er zu Franz zurück und zog die Decke, unter der jener lag, über dessen Gesicht. Anschließend erledigte er seine morgendliche Routine, wie Feuer machen, um Wasser zu erhitzen und Bert füttern. Dabei dachte er nach. Der Karren gehörte nun ihm, genau wie Bert und alle anderen Habseligkeiten. Wissen besaß er genug, um als Bader zu arbeiten und die Leute in den Dörfern kannten ihn bereits.
Die Frage war, ob der Biss Folgen für ihn hatte. In den Schauermärchen wurde man dadurch zu einem Geschöpf der Nacht. Da er Helligkeit weiterhin vertrug hoffte er, dass sich auch sonst keine Veränderung ergab.
Beim Frühstück bekam seine Hoffnung einen Dämpfer Das Gebräu, das er normalerweise gerne trank, erzeugte bei ihm Übelkeit und allein der Anblick einer Brotscheibe reichte, um bei ihm Ekel zu erzeugen. Vielleicht war es nur der Umstand, dass er neben einem Leichnam hockte, dass es ihm an Appetit mangelte.
Nachdem er Franz‘ leblosen Körper mit Reisig und Moos bedeckt hatte, räumte er Decken und Geschirr in den Karren, spannte Bert an und verließ die Lichtung.
Im Laufe des Tages wurde es zur Gewissheit: Das Vampirwesen hatte ihn in ein Monster verwandelt. Wann immer er ein Lebewesen sah, spürte er unbändigen Durst nach Blut.
Gen Abend stillte er seinen Hunger an einer Bäuerin, die allein auf einem Feld arbeitete. Ihm war bewusst, dass so etwas eine Ausnahme bleiben musste. Er durfte keine Spur aus Leichen hinterlassen, sonst würde man ihn schon bald an den Galgen bringen. Oder war er nun unsterblich? Konnte nur ein Pflock in sein Herz, wie es in den Gruselmärchen hieß, ihn töten? Ausprobieren wollte er das lieber nicht. Er sollte sich also überwiegend von Tierblut und nur selten von Menschen ernähren.
Gegenwart
„Wir nehmen an, dass es sich um eine Art Allergie handelt“, dozierte Ralf, Vorsitzender des Vampirrats und Heilpraktiker. „Die Erkrankten entwickeln eine Aversion gegen alles tierische und wenden sich der veganen Lebensform zu. Ausgelöst wird das vermutlich durch die grassierende Ernährungsumstellung der Studierenden an Hochschulen und Universitäten.“
„Mit anderen Worten: die werten Herren haben keine Ahnung“, flüsterte Michel in Felix‘ Ohr. „Und Sperma ist keineswegs vegan.“
Vor rund siebzig Jahren hatte Gustav seinen Namen geändert, weil ihm der ursprüngliche nicht mehr zeitgemäß erschien. Auch seinen Nachnamen hatte er den gängigen angepasst. Aus Stoiber war Müller geworden. Felix Müller ging in der Menge unter. Genau das war als Vampir wichtig: Sich unsichtbar zu machen. Deshalb war er bestrebt, stets unter dem Radar der Öffentlichkeit zu bleiben.
Michel hatte sich aus den gleichen Gründen umbenannt. Michelangelo war in dieser Zeit einfach zu auffällig.
„Wie immer“, gab er ebenso leise zurück.
Karsten, der in der Reihe vor ihnen saß, warf einen giftigen Blick über die Schulter und zischte: „Ruhe!“
Grinsend zeigte Michel dem armen Würstchen den Stinkefinger. Armes Würstchen, weil Karsten mit fünfzig gebissen wurde und zu dem Zeitpunkt in ziemlich schlechter Verfassung war. Durch die Wandlung hatte sich zwar der Bierbauch vermindert, doch der Kahlkopf war geblieben. Mit chirurgischen Eingriffen könnte man daran einiges ändern, aber dafür fehlten Karsten die monetären Mittel. Beruflich war der Typ nämlich eine Niete.
Während Ralf statistische Fakten runterleierte, wanderten seine Gedanken zurück zu dem Tag, an dem ihn das Schicksal ereilt hatte. Bis heute wusste er nicht, wer oder was ihn gebissen hatte. Sicher war nur, dass von diesen Wesen damals nur wenige existierten. Im Laufe der Jahrhunderte waren es mehr und mehr geworden.
Inzwischen gab es weltweit eine flächendeckende Population. Viele saßen an entscheidenden Stellen, um den Nahrungsnachschub und ihre Tarnung zu garantieren. Viele verdienten sich damit eine goldene Nase. Nun, Karsten gehörte nicht dazu.
„Mir schlafen die Füße ein“, flüsterte Michel ihm zu.
Erneut wurden sie von Karsten mit einem bösen Blick bedacht.
„Ein Gegenmittel haben wir bisher noch nicht gefunden. Ich biete aber eine Hypnose-Therapie an, von der ich mir einigen Erfolg verspreche. Wer Interesse daran hat, kann sich bei mir melden“, redete Ralf weiter. „Das wär’s für heute. Oder hat jemand ein Anliegen, das wir dringend besprechen müssen?“
Karsten hob die Hand. „Ich stelle den Antrag, einen Fond für finanziell benachteiligte Mitglieder zu gründen.“
„Wende dich bitte an Belinda“, bat Ralf. „Sie wird dir helfen, eine schriftliche Eingabe zu formulieren.“
Belinda war Buchhalterin und Sekretärin des Vereins. Wenn Ralf keinen Bock auf etwas hatte, verwies er an sie. An ihr biss man sich die Zähne aus ... nicht, dass das jemals ein Mitglied probiert hätte.
„Aber ...“, setzte Karsten zum Protest an, doch Ralf unterbrach ihn: „Diejenigen, die mein Angebot nutzen wollen, bleiben bitte noch. Dem Rest wünsche ich eine erfolgreiche Nacht.“
Alle strömten so eifrig nach draußen, als gäbe es irgendwo Freiblut. Felix steuerte auf seinen Porsche zu, Michel im Schlepptau.
Das Treffen hatte in Hannover stattgefunden, weshalb sie mit seinem PS-Monster gefahren waren. Für Meetings, die weiter entfernt abgehalten wurden, benutzten sie ihre zweite Gestalt. Als Fledermaus war man querfeldein schneller als mit 480 Pferdestärken unterwegs, zumal sie ihre tierischen Artgenossen an Geschwindigkeit weit übertrafen. Der Nachteil: Man hatte am Ziel keine Klamotten parat. Dafür wurden stets Bademäntel bereitgestellt, denn es waren ja alle weit Angereisten von diesem Manko betroffen. Felix zog es jedoch vor, in seiner eigenen Kleidung an solchen Events teilzunehmen.
Michel schimpfte oft darüber, dass der Wandlungsvorgang in Vampir-Filmen derart verzerrt dargestellt wurde. Schwupps!, stand der eben noch in Fledermausgestalt herumflatternde Schauspieler in vollem Ornat und in menschlicher Gestalt da. Das ergäbe nur Sinn, wenn die Klamotten ein fester Bestandteil des Vampirkörpers wären; also wenn sich Vampire nicht ausziehen könnten.
Ab und zu warf Felix in solche Monologe ein, dass es künstlerische Freiheit gab, was Michel stets zu weiteren Schimpftiraden animierte. „Künstlerische Freiheit heißt nicht, sich in Unlogik zu wälzen! Das heißt nur, dass man sich keinem Diktat von oben unterwirft. Wenn die Drehbuchschreiber zu faul oder zu prüde sind, um uns richtig darzustellen, sollen sie den Job wechseln!“
Meist hatte er keine Lust, Michel anzustacheln. Er konnte zwar gut auf Durchzug schalten, aber Stille war ihm lieber.
Nachdem sie den Parkplatz verlassen hatten, ergriff Michel das Wort: „Was hältst du von dem Scheiß?“
„Unnötige Panikmache.“ Mal im Ernst: Ihm war noch kein Artgenosse begegnet, der anstelle von Blut Sperma bevorzugte.
„Ich denke auch, dass die aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber mal rein theoretisch: Was würdest du tun, wenn es dich trifft?“
„Es wird mich nicht treffen.“ Vor Krankheiten und Allergien war er gefeit, so, wie jeder andere Vampir.
„Aber mal angenommen ...“
„Keine Ahnung. Ich denke, dann werde ich mir selbst einen Pflock in das Loch, wo mal mein Herz war, treiben.“
„Harakiri auf vampirisch?“ Michel lachte. „Davon mal abgesehen, hast du ein Herz.“
„Ach ja?“ Er lenkte den Wagen in eine scharfe Kurve.
„Sonst würde Igor nicht bei dir wohnen.“
„Igor wohnt nicht bei mir. Er ist nur interimsweise bei mir untergekommen.“
„Klar.“ Erneut gluckste Michel. „Seit mittlerweile ... sind es schon zwanzig Jahre?“
„Für unsereiner ein Klacks.“
„Schon, aber es sieht nicht so aus, als ob er nach einer neuen Bleibe sucht.“
In der Tat. Igor betrachtete sich als Felix‘ unabkömmlicher Diener. Ehrlich gesagt würde er den Kerl vermissen. „Ich werde demnächst mit ihm darüber reden.“
„Mhm“, machte Michel und öffnete das Handschuhfach, um darin herumzukramen. „Hey! Keine Bonbons?“
„Sorry. Ich muss neue besorgen.“
Seufzend klappte Michel das Fach zu. „Wenn Ralfs Zahlen stimmen, müssten in Hamburg ungefähr fünfzehn spermaabhängige Artgenossen rumlaufen. Wieso habe ich noch nie einen von denen gesehen?“
„Denkst du, die rennen rum und binden jedem auf die Nase, dass sie neuerdings Schwänze lutschen?“
„Auch wieder wahr, wobei man ja nicht lutschen muss, um an Wichse zu kommen. Schließlich gibt es Samenbanken und die Möglichkeit, vorher abgemolkenes Zeug zu trinken.“
Darüber wollte er lieber nicht nachdenken. Zu seiner Erleichterung, weil ihm das Thema Unbehagen verursachte, zückte Michel sein Handy und hüllte sich den Rest der Fahrt in Schweigen.
Nachdem er seinen Kumpel abgesetzt hatte, steuerte er sein Zuhause an. Er lebte in einer ruhigen Seitenstraße in Rahlstedt, in einer Villa, die er vor rund fünfzig Jahren erworben hatte. Dank hoher Mauern war das Anwesen vor neugierigen Blicken abgeschirmt. Kontakte zu Nachbarn pflegte er keine. Es schien auch niemand darauf Wert zu legen.
Viele Artgenossen mussten häufig – wobei häufig eine andere Bedeutung als die unter Menschen üblichen besaß, denn unter Artgenossen entsprach das einer Zeitspanne von etwa zwanzig Jahren – ihren Wohnort wechseln, um keinen Argwohn zu wecken. Ihm blieb das, wegen der Abgeschiedenheit seines Heimes, glücklicherweise erspart.
Gerade hatte er die Einfahrt zu seinem Grundstück erreicht, da vibrierte sein Smartphone. Er zog es aus der Jackentasche, warf einen Blick aufs Display, steckte es zurück, wendete und schlug den Weg in Richtung seiner Arbeitsstelle ein.
2.
Felix arbeitete im Wandsbeker Krankenhaus. Er könnte mit seinem jahrhundertealten Wissen auch als Gehirnchirurg praktizieren, zog aber den weniger anstrengenden Job des Anästhesisten vor. In dieser Position brauchte er keinen Schichtdienst schieben, sondern hatte lediglich Rufbereitschaft. Nur wenn ein eingelieferter Notfall nicht bis zum nächsten Werktag warten konnte, wurde er angefordert. Zudem bot diese Position noch andere Vorteile.
Er stellte den Porsche nicht auf dem Personalparkplatz ab, sondern auf dem für Besucher. Niemand brauchte mitbekommen, dass er solchen Wagen besaß. Das verursachte nur Spekulationen.
Als erstes ging er in die Notaufnahme. Agnes, die am Tresen Dienst tat, schenkte ihm ein müdes Lächeln. „Hi. Du bist aber schnell.“
„War gerade auf dem Heimweg. Was ist Sache?“
„Der Patient hat Stichwunden am Oberkörper. Stark alkoholisiert. Doktor Schubert will ihn so schnell wie möglich auf dem OP-Tisch haben.“
Er eilte ins Bereitschaftszimmer, tauschte seine Jacke gegen einen Kittel, wusch und desinfizierte seine Hände und kehrte zu Agnes zurück. Sie überreichte ihm ein Klemmbrett mit den Unterlagen des Patienten. „Er ist in Raum 9.“
Während er über den Flur eilte, überflog er den Einweisungsbericht. Stichverletzungen am Thorax. Die Lunge schien intakt zu sein, die Leber weniger.
Bei dem Patienten handelte es sich um einen Zwanzigjährigen mit Migrationshintergrund. Als er sich dem Mann näherte, schlug ihm einen Spritwolke entgegen.
„Guten Abend. Mein Name ist Doktor Müller. Ich bin Ihr Anästhesist und muss Ihnen ein paar Fragen stellen“, sprach er den Patienten an.
Mit Mühe und Not bekam er die nötigen Informationen aus dem benebelten Typen raus. Er bereitete eine Spritze mit der passenden Dosis vor, injizierte sie dem Patienten und kontrollierte dessen Puls, während das Medikament seine Wirkung tat.
Sobald der Mann im Reich der Träume war, verriegelte er leise die Tür, bevor er sich einen Snack gönnte. Der Kerl besaß seine favorisierte Blutgruppe, die durch den Alkohol noch besser schmeckte. Anschließend überprüfte er im Spiegel überm Waschbecken, ob seine Augen, die im Blutrausch stets rot leuchteten, wieder ihre normale Farbe angenommen hatten. Dann schloss er die Tür auf und informierte Agnes, dass der Patient nun bereit für den OP war.
Es gab Artgenossen, die Whisky und andere harte Getränke vertrugen. Für ihn galt das nicht. Ihm bekam nur das Blut von alkoholisierten Menschen. Igor experimentierte zwar an einer Methode, solches Gemisch mit Tierblut herzustellen, doch das Projekt war bislang noch kein Erfolg.
Wenig später lag der Patient auf dem Edelstahltisch in OP 3. Die Leber war zur Hälfte zerstört. Schubert musste ein Teil des Organs entfernen. Somit war die Trinkerkarriere des Burschen beendet, aber es gab ja noch andere schöne Hobbys.
Kurz nach Mitternacht verließ er die Klinik. Der Patient war wie geplant aus der Narkose erwacht und schlief nun seiner Genesung entgegen. Zwischendurch hatte Felix Igor, der sich bestimmt Sorgen machte, angerufen und informiert, dass er spät nach Hause kommen würde.
Er hatte den Alten damals, bei einem nächtlichen Streifzug, getroffen.