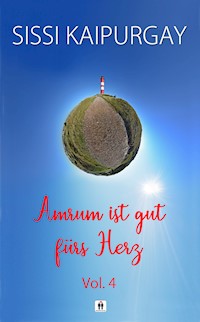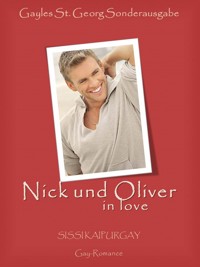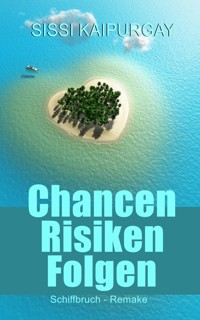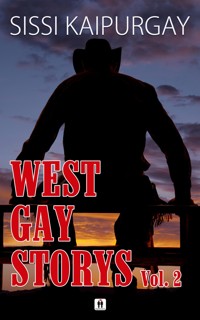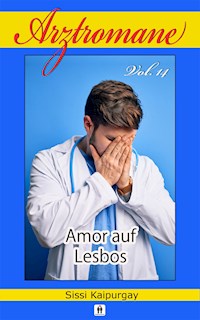
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Joscha, Allgemeinmediziner, leistet gemeinnützige Arbeit auf Lesbos im Flüchtlingscamp. Bevor er den Dienst in der Praxis seines Vaters antritt, will er noch ein bisschen fremde Atmosphäre schnuppern. Es ist allerdings nicht leicht, sich von dem Elend, das er jeden Tag sieht, abzugrenzen. Eine Familientragödie geht ihm besonders unter die Haut. Vielleicht hätte er sie verhindern können, wenn er eher von dem Leiden der Mutter gewusst hätte. Sein schlechtes Gewissen bringt ihn dazu, etwas Selbstloses zu tun.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Amor auf Lesbos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Epilog - 2 Jahre später
Arztromane Vol. 14 - Amor auf Lesbos
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten sind frei erfunden, Ähnlichkeiten rein zufällig. Der Inhalt dieses Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Covermodels aus. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.
Anmerkung: Alle Vorgänge und Umstände sind nach bestem Wissen und Gewissen geschildert. Das Erlernen einer Sprache ist natürlich langwieriger, (außer bei Überfliegern), und wurde aus dramaturgischen Gründen verkürzt.
Copyright Texte: Sissi Kaipurgay/Kaiserlos
Fotos: Cover: Cover: Shutterstock Bild Nummer: 1654477501 von Krakenimages.com, Engel: Depositphotos_7970685_xl-2015
Cover-Design: Lars Rogmann
Korrektur: Aschure, dankeschön!
Kontakt:http://www.bookrix.de/-sissisuchtkaiser/ https://www.sissikaipurgay.de/
Sissi Kaiserlos/Kaipurgay
c/o Karin Rogmann
Kohlmeisenstieg 19
22399 Hamburg
Amor auf Lesbos
Joscha, Allgemeinmediziner, leistet gemeinnützige Arbeit auf Lesbos im Flüchtlingscamp. Bevor er den Dienst in der Praxis seines Vaters antritt, will er noch ein bisschen fremde Atmosphäre schnuppern. Es ist allerdings nicht leicht, sich von dem Elend, das er jeden Tag sieht, abzugrenzen. Eine Familientragödie geht ihm besonders unter die Haut. Vielleicht hätte er sie verhindern können, wenn er eher von dem Leiden der Mutter gewusst hätte. Sein schlechtes Gewissen bringt ihn dazu, etwas Selbstloses zu tun.
1.
Manchmal bereute Joscha seine Entscheidung. Das geschah immer dann, wenn er hasserfüllte Szenen zwischen Flüchtlingen und Helfern beobachtete oder selbst involviert war. Er verstand, dass im überfüllten Lager Emotionen hochkochten und die Hoffnungslosigkeit einen in den Wahnsinn trieb. Dafür konnten die, die sich für diese Leute aufopferten, jedoch am wenigsten. Sie fungierten bloß als Blitzableiter.
Er lebte in einem Appartement zusammen mit drei anderen Helfern. Lasse und Kirk teilten sich ein Schlafzimmer, Mario und er benutzten das andere. Bezüglich des Badezimmers kam es gelegentlich zu Engpässen, doch im Vergleich zur Situation der Zeltbewohner war es trotzdem Luxus. Sie hatten weder mit Kälte, Überschwemmungen, dreckigen (infolge der starken Frequenz) Sanitärräumen, Ungeziefer noch Essensmangel zu kämpfen.
Im Gegensatz zu seinen Mitbewohnern war Mario für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Die anderen drei arbeiteten für den Verein Hilfe für Lesbos und das je für drei Jahre. Ein langer Zeitraum, den er niemals aushalten würde. Die drei Monate, für die er sich gemeldet hatte, reichten ihm vollauf.
Joscha war ein Überflieger. In der Schule hatte er zwei Klassen übersprungen, ein Einser-Abi hingelegt und sein Medizin-Studium mit Bravour abgeschlossen. Sein Vater, in dessen Gemeinschaftspraxis er einsteigen sollte und wollte, war begeistert gewesen, als er den Wunsch äußerte, erstmal eine Auszeit zu nehmen.
Als er von seinen Plänen erzählte, hatte sich das geändert. Seine Eltern versuchten ihn zu überreden, statt des Dienstes an der Front - wie sie seinen Einsatz nannten - eine Urlaubsreise zu unternehmen. Darauf hätte Joscha schon Lust, aber nicht allein. Mit seinen sozialen Kontakten sah es allerdings ziemlich mau aus. Mit einem Streber wollte keiner etwas zu tun haben.
Selbst an der Uni hatte er als Außenseiter gegolten. Das mochte eher an seinem introvertierten Verhalten als seinen guten Leistungen gelegen haben. Mit Mühe und Not war es ihm zumindest gelungen, seine Jungfräulichkeit loszuwerden. Über das Wie dachte er lieber nicht mehr nach. Keine schöne Erfahrung.
Seufzend guckte er aufs Ziffernblatt des Weckers. Erst sechs. Er war schon ziemlich lange wach. In dem Bett an der anderen Wand schnorchelte Mario. Sein Zimmergenosse kannte keine Schlaflosigkeit, der Glückliche.
Joschas Dienst begann um acht. Meist stand um die Zeit schon eine Schlange vor den beiden Zelten, in denen medizinische Hilfe angeboten wurde. Husten, Fieber, entzündete Wunden, Ohren und Augen waren an der Tagesordnung. Besonders zu Herzen ging es ihm, wenn Säuglinge oder Kinder von solchen Krankheiten befallen waren. In einem Fall, in dem er nicht mehr helfen konnte, war der Säugling gestorben. Im Prinzip war das Kind schon fast tot, als man es zu ihm brachte. Den Transport ins nächste Krankenhaus hätte es nicht überstanden. Davon mal abgesehen war die Klinik eh schon restlos überfüllt und das Personal damit überfordert.
Angesichts des Elends wurde Joscha regelmäßig wütend, wenn er Artikel, in denen von Wirtschaftsflüchtlingen die Rede war, las. Oder von deutschen Bürgern, die sich gegen Überfremdung wehrten, weil sie Sorge hatten, etwas von ihrem Wohlstand einzubüßen. Die Menschen im Lager hatten ihre Heimat nicht wegen eines Luxusproblems verlassen, sondern weil ihnen jegliche Existenzgrundlage genommen worden war. Sie mussten außerdem jeden Tag um ihr Leben bangen. Etwas, das auch vielen Deutschen im 2. Weltkrieg passiert war, doch diese Generation gab es ja inzwischen nicht mehr.
Die Lage war heutzutage etwas anders. Im Grund könnte sich ein reicher Staat wie Deutschland leisten, die Flüchtlinge aufzunehmen und mit allem Nötigen zu versorgen. Eine Integration der großen Menge war natürlich schwierig, aber durfte man deshalb Menschen ins Verderben schicken?
Viertel nach sechs. Joscha schlüpfte aus dem Bett, schnappte sich seine Klamotten und schlich ins Bad. Er nutzte die halbe Stunde, bis der erste seiner Mitbewohner aufstand, um ausgiebig zu duschen und sich zu rasieren. Anschließend kümmerte er sich ums Frühstück. Eigentlich war der Küchendienst aufgeteilt, doch wenn er vor den anderen wach war, übernahm er stets diese Aufgabe. Es wäre kleinlich, sich hinzusetzen und zu warten, bis der ursprünglich Eingeteilte auftauchte.
Während er den Tisch deckte, kamen erneut frustrierende Gedanken auf, die er jedoch energisch verdrängte. Seine Mitbewohner hatten ihn mehrfach darauf hingewiesen, dass es kontraproduktiv wäre, seinen Groll zu pflegen. Es brachte nichts und half den Flüchtlingen kein Stück weiter. Zudem vergiftete es die Seele. Er stimmte dem bedauernd zu. Zu einem Weltverbesserer fehlten ihm eh der Elan und die monetären Mittel. Seine Familie war zwar begütert, doch nicht reich genug, um entscheidenden Einfluss auf die Politik zu nehmen. Dafür müsste man schon das Vermögen eines Bill Gates oder Jeff Bezos besitzen.
Mit seinem ersten Becher Kaffee verzog er sich auf den Balkon. Die Sonne hatte sich knapp über den Horizont erhoben. Sie tauchte die Umgebung in ein trügerisch idyllisches, goldenes Licht. Unten, auf der Straße, knatterte ein Mofa vorbei, ansonsten herrschte Stille.
Er trank einen Schluck und ließ den Blick über die Umgebung schweifen. Die Insel war auf raue Art schön. Schroffe Felsen wechselten sich mit grünen Flächen ab. Es gab einige Sandstrände, verträumte Häfen und Sehenswürdigkeiten. Wenn er den Zweck, wofür er hergekommen war, ausblendete, wäre Lesbos eine Wohlfühloase; das ursprüngliche Griechenland, touristisch nicht überlaufen.
Seit immer mehr Flüchtlinge die Insel bevölkerten, war der Tourismus praktisch vollkommen zusammengebrochen. Joscha konnte verstehen, dass sich die Einwohner mit ihren Sorgen alleingelassen fühlten. Dennoch ging es um Menschen, nicht um Dinge, die man einfach zurück ins Meer warf.
„Ich kann die dunklen Wolken über deiner Stirn sehen“, riss ihn Lasses Stimme aus seinen Gedanken.
„Morgen.“
„Dir auch einen guten Morgen.“ Lasse stellte sich neben ihn, ebenfalls einen Kaffeebecher in der Hand. „Danke, dass du meinen Dienst übernommen hast.“
Joscha zuckte mit den Achseln. „Ich war ja eh auf.“
„Trotzdem.“
Lasse war voll okay, genau wie Kirk und Mario. Er hatte echt Glück mit seinen Mitbewohnern. „Wofür seid ihr heute eingeteilt?“
„Küchendienst, wie üblich.“ Lasse seufzte. „Danach helfen wir bei der Errichtung einer neuen Stromversorgung. Die armen Teufel stehen ja länger Schlange vor den paar Steckdosen, als vorm Buffet.“
Buffet ... ein hochtrabender Begriff für die Essensausgabe. Joscha leerte seinen Becher und ging wieder rein. Inzwischen war auch Kirk auf. Im Bad rauschte die Dusche. In der Küche legte er letzte Hand an den Frühstückstisch und schaute anschließend nach Mario, der im entgegenblinzelte, als er in den Raum kam.
„Muss ich schon wieder aufstehen?“, fragte sein Zimmergenosse.
„Von mir aus darfst du liegenbleiben.“
„Sei doch nicht immer so ernst“, beschwerte sich Mario, gähnte und schlug die Decke zurück.
Angesichts des Zeltes, das die Morgenlatte mit Marios Pants errichtet hatte, drehte Joscha um und kehrte in die Küche zurück. Sie spielten im gleichen Team, doch es gab zwischen ihnen keine sexuelle Anziehung. Überhaupt pennte Joschas Libido seit seiner Ankunft. Wer konnte in Anbetracht des täglichen Elends noch an Sex denken? Er jedenfalls nicht.
Am Frühstückstisch herrschte vorwiegend Schweigen, wie jeden Morgen. ‚Gib mir mal die Butter‘ oder ‚Lass was von der Marmelade übrig‘ lauteten die Standardsätze, die sie wechselten.
Danach brachen Kirk und Lasse auf. Mario verschwand ins Bad, um zu duschen und Joscha räumte den Tisch ab. Sie funktionierten wie eine gut geölte Familie. Es gab selten Streit und wenn, dann war der schnell beigelegt. Beispielsweise hatte Lasse neulich Marios Biervorrat vernichtet. Nach einigen bösen Worten waren die beiden zusammen in die nächste Taverne abgezischt und sternhagelvoll wieder nach Hause gekommen.
Die Sauferei war ein echtes Problem. Joscha hatte sich auch dabei ertappt, regelmäßig nach Feierabend Alkohol zu trinken. Zu Hause tat er das nur zu feierlichen Anlässen. Mittlerweile hatte er sich deshalb ein striktes Limit gesetzt. Mehr als ein Bier oder ein Glas Wein pro Abend waren nicht drin.
Nachdem er sein Bett gemacht hatte - etwas, worüber Mario immer schmunzelte - verließ auch er die Wohnung.
Bis zum Lager waren es zwanzig Minuten Fußweg. Er genoss die kühle Brise, die vom Meer her wehte. Später, wenn die Hitze des Tages alles überlagerte, passte auch sie sich stets der Temperatur an und bot keinerlei Erfrischung mehr.
Vor den beiden Sanitätszelten stand eine Schlange, bestehend aus ungefähr zwanzig Leuten. Joscha musterte sie kurz und war erleichtert, keinen Säugling unter den Wartenden zu entdecken.
Im Zelt begrüßte ihn Mustafa, einer der Assistenten, mit den Worten: „Der Dolmetscher verspätet sich.“
Von den jüngeren Flüchtlingen sprachen viele englisch, doch die ältere Generation beherrschte meist nur wenig Brocken. Wenn es darum ging, irgendwelche Gebrechen zu erklären, war ein Übersetzer unabdingbar.
„Wir fangen trotzdem an“, entschied Joscha. Jede Verzögerung bedeutete, dass noch mehr Leute vorm Zelt standen. Andererseits kämpfte er gegen Windmühlenflügel. Manchmal hatte er den Eindruck, es kamen umso mehr Hilfebedürftige, je schneller er arbeitete.
Um Viertel vor neun - zu dem Zeitpunkt hatte er zwei Patienten versorgt - tauchte Baschar, der Dolmetscher auf. Joscha teilte sich den Mann mit seinem Kollegen, der im zweiten Zelt arbeitete. Im Prinzip hätte man auch jemanden aus dem Camp verpflichten können, doch das ging nicht, wegen der ärztlichen Schweigepflicht und aus Pietätsgründen. Die Patientinnen hatten eh schon Probleme, sich vor einem Fremden zu entblößen. Vor einem Zeltnachbarn - selbst wenn dieser hundert Reihen weiter lebte - wäre es undenkbar.
Zur Mittagszeit ebbte der Strom ab. Wer niemanden hatte, um Essen zu besorgen, musste in die Schlange vor der Feldküche wechseln. Auch die Ärzte legten eine Mittagspause ein. Niemand konnte ohne Verschnaufen den ganzen Tag durcharbeiten. Mit seinem Kollegen Michael begab er sich zu dem Zelt, in dem Mitarbeiter verpflegt wurden. Mustafa hielt unterdessen die Stellung, damit niemand medizinisches Material entwendete.
„Ich komme mir vor wie Sisyphos.“ Michael seufzte. „Gestern hab ich den Finger eines kleinen Mädchens bandagiert, heute kommt es mit der nächsten Verletzung.“
Das Lager war denkbar kinderfeindlich. Holzsplitter, herumliegender Unrat, spitze Steine - alles Gefahrenquellen. „Geht mir genauso. Unsere Arbeit ist eben nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“
Sie bedienten sich am Buffet und setzten sich an einen der Tische. Selten waren alle Plätze besetzt. Viele machten zwischendurch, wenn es gerade passte, Pause. Entsprechend gab es zwischen elf und fünfzehn Uhr ein Angebot an warmen Speisen. Die Anzahl der Helfer konnte Joscha schwer schätzen, da er sie nie auf einem Haufen sah.
Michael stammte aus Würzburg und war Assistenzarzt. Das Jahr auf Lesbos nannte er Sabbatical. Eine passende Bezeichnung, fand Joscha, wurde so doch ein Forschungssemester betitelt. Allerdings bezog sich die Recherche hier eher darauf, wie viel man Menschen zumuten konnte, bevor sie daran zerbrachen; nicht auf neue medizinische Erkenntnisse. Eher eine Art Folter-Forschung.
Als er in sein Zelt zurückkehrte, ging Mustafa zum Mittagstisch. Er nutzte die Zeit, um seine Aufzeichnungen zu vervollständigen. Da einige Patienten keine Ausweispapiere besaßen, musste er sich auf deren Angaben zu Namen, Geburtsdatum und Herkunft verlassen. Egal. Es krähte kein Hahn danach, wen er wann behandelt hatte. Seine Unterlagen dienten lediglich internen Zwecken.
Sobald Mustafa zurück war, ließen sie den nächsten Patienten herein. Ein junger Mann mit verstopftem Ohr. Danach trat eine Frau mit einem Mädchen an der Hand das Zelt. Das Gesicht der Kleinen war über und über mit Schorf bedeckt. Schuppenflechte, erkannte Joscha auf den ersten Blick. In der Zivilisation, wie er die Welt außerhalb des Lagers zynisch nannte, gäbe es einige Therapiemöglichkeiten. Hier, in seinem nur mit dem Nötigsten ausgestatteten Zelt, blieb ihm bloß die Vergabe von Salbe.
Als er das Mädchen genauer unter die Lupe nahm fiel ihm auf, dass deren Mutter extrem kurzatmig war. Bronchitis oder Asthma, diagnostizierte er, ohne seine Untersuchung zu unterbrechen. Wie vermutet, handelte es sich um Psoriasis. Er trug Kortison haltige Creme auf die betroffenen Hautpartien auf und gab der Mutter eine Tube des Präparats. Mithilfe Baschars erklärte er ihr, dass sie die Salbe nur einmal täglich anwenden durfte, um die Haut des Mädchens nicht nachhaltig zu schädigen. Er machte sich keine Illusionen. Nach dem Motto viel hilft viel, würde sie garantiert den Tubeninhalt innerhalb kürzester Zeit aufbrauchen.
Das Bild des Mädchens, mit den großen, dunklen Augen in dem entstellten Gesicht, verfolgte ihn für den Rest des Tages.
Eine Woche später tauchte die Mutter mit dem Kind wieder auf. Das Mädchen sah etwas besser aus, die Frau hingegen wirkte kränker. Sie wollte neue Salbe, woraufhin Joscha ihr welche aushändigte, aber unter der Bedingung, diesmal sparsamer damit umzugehen.
Am folgenden Tag erschien die Mutter erneut, diesmal in Begleitung eines weiteren Kindes und jungen Mannes. Es war offensichtlich, dass sie nicht freiwillig gekommen war. Die Kinder und der Mann drängten sie förmlich ins Zelt. Auf Baschars Frage hin, welcher Art ihre Beschwerden wären, schüttelte sie den Kopf und behauptete, dass ihr nichts fehlen würde.
„She’s very ill“, mischte sich der Mann ein.
Dem musste Joscha leider zustimmen, als er die Frau kurz darauf mit seinem Stethoskop abhorchte. Für eine genaue Diagnose brauchte er allerdings ein Röntgenbild der Lunge. Er bat also Mustafa, einen Termin im Krankenhaus zu vereinbaren. Wie nicht anders zu erwarten, konnte man erst einen in drei Wochen anbieten.