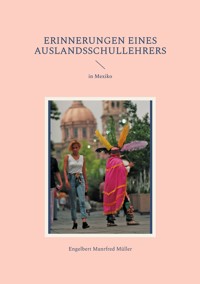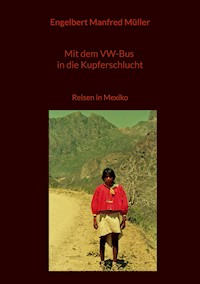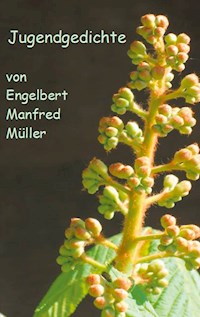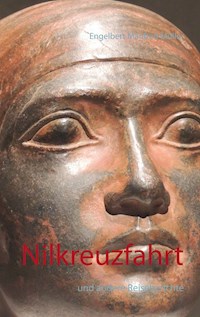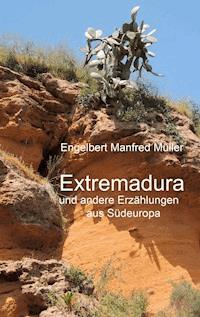Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die städtische Angestellte im Rathaus erhält von ihren Vorgesetzten einen ungewöhnlichen Auftrag. Dabei gerät sie in ein unerwartetes persönliches und politisches Abenteuer. Ein pensionierter Architekt erfährt durch einen Arbeitslosen von einem Kunstdiebstahl, in dem auch die Strippenzieher der Stadt eine Rolle spielen. Der Polizist aus dem Osten, der seine neue Heimat ebenso liebt wie die junge Marktfrau, wird plötzlich mit dem Verschwinden der jungen Frau konfrontiert. Musiker und Bettler in der Fußgängerzone, ein Don Juan als Wachmann im Einkaufszentrum, eine ehemalige Mitarbeiterin eines Beerdigungsinstituts, eine Schülerin, die etwas anders ist als ihre Mitschüler, und viele andere Personen begegnen sich und dem Leser in der Fußgängerzone einer rheinischen Großstadt, in kurzen und längeren Geschichten, in denen es um Liebe, Politik, Kunst und das Leben im Allgemeinen geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Text:
Die städtische Angestellte im Rathaus erhält von ihren Vorgesetzten einen ungewöhnlichen Auftrag. Dabei gerät sie in ein unerwartetes persönliches und politisches Abenteuer. Ein pensionierter Architekt erfährt durch einen Arbeitslosen von einem Kunstdiebstahl, in dem auch die Strippenzieher der Stadt eine Rolle spielen. Der Polizist aus dem Osten, der seine neue Heimat ebenso liebt wie die junge Marktfrau, wird plötzlich mit dem Verschwinden der jungen Frau konfrontiert. Musiker und Bettler in der Fußgängerzone, ein Donjuan als Wachmann, eine Schülerin, die etwas anders ist als ihre Mitschüler, und viele andere Personen begegnen uns in der Fußgängerzone einer rheinischen Großstadt, in Geschichten, in denen es um Liebe, Politik, Kunst und das Leben im Allgemeinen geht.
Zum Autor:
1982 kehrte Engelbert Manfred Müller von einer fünfjährigen Tätigkeit als Lehrer in Chile nach Deutschland zurück. Er wuchs in Köln auf, lebte und lehrte viele Jahre in Leverkusen und Köln. Nach einem zweiten Auslandsaufenthalt in Mexiko in den 90er Jahren ließ er sich mit seiner Familie endgültig in Bergisch Gladbach nieder. Die Erlebnisse während der neun Jahre in Lateinamerika haben ihn sehr geprägt und lassen ihn seine alte und neue Heimat mit anderen Augen sehen.
In der Stadtbücherei Bergisch Gladbach kann man etliche seiner Bände mit Gedichten und Erzählungen und den Lissabon-Roman „Nur ein Schlüsselanhänger“. ausleihen. Er ist Mitglied der Gladbacher Autorenvereinigung „Wort und Kunst“
Inhalt
Das Auge der Stadt
Die verschwundene Marktfrau
Die Immerwährende
Formel 1 im Aufzug
Die zweite Dimension
Aufzug, die dritte
Der Duft des zweiten Lebens
Vorschlag zur Heiligsprechung
Ein Brunnen mehr oder weniger
Alles ganz harmlos
Die Freundin des Punkers
Er nickt nicht immer
Die Hauptsache
Laurentiuskirmes oder Was ist normal?
Ich habe keine Kraft mehr
Komisches Deutsch
Das Auge der Stadt
„Die Zeit fällt ihr unerbittliches Urteil über Ähnlichkeiten mit lebenden Personen.“
1 Der Auftrag
„Liebe Frau Vollprecht, ab heute werden Sie das Amt der Sicherheitsbeauftragten in unserer Abteilung übernehmen. Ich bin sicher, dass Sie es zu meiner und vor allem des Bürgermeisters vollen Zufriedenheit ausfüllen werden.“
Der Bürovorsteher, dessen athletischer Gestalt man erst auf den zweiten Blick ansah, dass ihr nichts, aber auch gar nichts in seinem Inneren entsprach, der aber berühmt dafür war, dass er delegieren konnte, also Aufgaben, die ihn nicht im Geringsten interessierten, an einen Untergebenen weitergab und damit ein für alle Mal seine Pflicht als erledigt ansah, gab Rosemarie seine fleischige Hand, die sie stets ein wenig zusammenzucken ließ, wenn sie sie berühren musste.
„Aber warum gerade mir, Herr Odenthal?“
Rosemarie Vollprecht schaute in die ausdruckslosen Augen ihres Chefs und auf seine unverdient vollen Haare, die eine Vitalität vorgaben, die weder in seinem Kopf noch irgendwo darunter je vorhanden gewesen waren.
„Ach, Sie wissen doch. Ihr Mann.“
„Mein Exmann, meinen Sie“, betonte Rosemarie mit ärgerlicher Energie. „Aber was hat der mit mir und mit meiner Arbeit zu tun?“
„Bitte, Frau Vollprecht, regen Sie sich nicht auf.
Aber wir kennen doch alle den früheren und auch den heutigen Beruf Ihres Mannes, äh Exmannes. Und Sie wollen doch nicht abstreiten, dass Sie dadurch in die Materie eingeweiht sind.“
Weil Rosemarie wusste, dass es ja doch keinen Sinn hatte, sich zu sträuben und ihre Erfahrung sie gelehrt hatte, dass vieles, gegen das man eigentlich empört sein musste, sich schließlich in Wohlgefallen auflöste, gab sie innerlich schon klein bei.
„Sie werden sehen, dass es für Sie ein Leichtes sein wird, die Aufgabe zu bewältigen. Und oben kommt es sicher auch gut an.“
Dabei lachte er ein kleines dümmliches Lachen.
„Mit dem Bürgermeister ist alles abgesprochen. Und er kennt Sie ja und weiß Sie zu schätzen.“
2 Die Niederlage
In den ersten Monaten des Jahres 2025 hatte der Bürgermeister eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Nicht dass er selber hinter dieser Idee gestanden hätte. Aber seine Parteifreunde und Teile der Verwaltung machten ihn darauf aufmerksam, dass sie dringend geboten erschienen, die Überwachungsanlagen auf dem Marktplatz. Nachdem wieder einmal ein Überfall an seinem Rand geschehen sei. Dabei hatten sich fast alle Überfälle in der Nacht ereignet, und es war sehr fraglich, ob die Kameras in der Lage sein würden, taugliche Nachtaufnahmen herzustellen. Außerdem ließ die Polizeit verlautbaren, dass die Menge der Überfälle rückläufig sei. Und verhindern, da waren sich alle Experten einig, konnten die Kameras sowieso keine Tat. Sie würden allenfalls die anschließende Aufklärung erleichtern. Wenn denn ausreichend Personal zur Verfügung stände, die Aufnahmen sorgfältig auszuwerten. Und das war bei der seit langem knappen Personalsituation eher unwahrscheinlich.Trotzdem erhoffte man eine Wirkung bei den nächsten Wahlen, eine Wirkung vor allem bei dem zunehmend älteren Bevölkerungsanteil, der traditionell sein Kreuzchen bei der Partei des Bürgermeisters machte.
Die Opposition war zu dem Schluss gekommen, es sei für sie besser, die Videoanlage abzulehnen. Sie hatte gemerkt, dass solche Überfälle hauptsächlich die Journalisten der örtllichen Presse interessierten, weniger die ältere Bevölkerung, obwohl es stimmte, dass diese noch mehr als andere im abendlichen Fernsehen Krimis konsumierten, was bei vielen von ihnen ein zunehmendes Gefühl der Bedrohtheit erzeugte. Doch hatten Meinungsforscher vor kurzem herausgefunden, dass sie sich in der jüngsten Zeit weniger für Krimis begeisterten, als für Familien- und Heimatserien. Vor allem, weil schon in den Nachrichten immer häufiger Gewalttaten gezeigt wurden, die immer weniger zu ertragen waren. Die ablehnende Haltung der Opposition war natürlich in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie sich profilieren musste, egal wie, weil sie sonst keine eigenen Ideen aufzuweisen hatte. Schließlich würde sowieso das fehlende Geld den Ausschlag geben.
Das Thema selber spielte also nach kurzer Zeit keine Rolle mehr. Doch hatte es sich auf einmal im Kopf des Bürgermeisters selbstständig gemacht. In irrationaler Weise sah er zunehmend die Notwendigkeit, alles um sich herum durch Kontrolle und Beobachtung im Griff zu behalten oder in den Griff zu bekommen.Es wurde aber gemunkelt, das sei dadurch zu erklären, dass seine Ehe zu kriseln begonnen hatte. Sein Verdacht verstärkte sich aufgrund verschiedener Ereignisse und Symptome immer mehr, dass sich seine Frau insgeheim und intensiv mit einem Menschen beschäftigte, von dem er nichts wusste. Dieser Mentalitätswandel im Gehirn an der Spitze der Stadt hatte auch zu der Einrichtung der Sicherheitsbeauftragten in allen Abteilungen der Verwaltung geführt.
3 Die Anweisung
Rosemarie telefonierte gerade mit der örtlichen Presse, um einen Termin für den Bürgermeister auszumachen, als Odenthal in der Tür stand. Wenn ihr Chef sie sprechen wollte, ließ er sie normalerweise telefonisch in sein Büro bestellen. Nun stand er wieder vor ihr wie beim letzten Mal, als er ihr das Amt der Sicherheitsbeauftragten aufs Auge drückte. Er deutete sogar mit seiner schwammigen Hand an, sie solle sich nicht stören lassen und setzte sich auf einen der zwei Stühle, die vor ihrem Schreibtisch standen, Stühle für Besucher, als sei er ein Bittsteller, wie sich die Bürger häufig vorkamen, wenn sie eine Amtsstube betraten. Sie notierte den Termin in ihrem Tischkalender, legte den Hörer auf und schaute dann auf die ausdruckslosen Augen in der unverdient athletischen Gestalt vor ihr auf dem Stuhl.
„Eine Bitte des Bürgermeisters, Frau Vollprecht.“
Erwartete er, dass sie daraufhin salutierte? Sie quälte ihn bewusst mit der künstlichen Kälte ihrer Augen und ihrem abwartenden Schweigen.
„Wie soll ich sagen ….“
Wie sollte sie das wissen, was er sagen sollte? Sollte er sich endlich einmal Mühe geben!
„Wie soll ich sagen, Frau Vollprecht, der Bürgermeister fühlt sich beunruhigt.“
Aha. Sollte sie sich vielleicht eine Pistole zulegen, um die Sicherheit der Herren zu erhöhen?
„Es ist so, dass seit drei Tagen immer ein Unbekannter das Rathaus betritt.“
„Aber betreten nicht dauernd Unbekannte das Rathaus?“ konnte sie sich nun nicht enthalten zu erwidern.
„Schon. Aber er kommt angeblich immer während der Mittagspause. Wenn alle zu Tisch sind.“
Tatsächlich spuckte das Rathaus Punkt zwölf wie auf Knopfdruck einen Pulk von städtischen Beamten aus, die dann in den umliegenden Restaurants verschwanden, um sie Punkt zwei wieder aufzusaugen.
„Und da er selber seit einiger Zeit das Rathaus Mittags nicht mehr verlässt, ….Sie wissen schon warum …“
Rosemarie wusste, dass das Wort Depressionen umlief. Aber was hatte das mit ihr zu tun? Sollte sie den Therapeuten für ihn mimen?
Durch die athletische Gestalt auf dem Stuhl vor ihr ging ein ungewohnter Ruck. Er stand auf und schüttelte sich, als versuche er, eine große Last abzuwerfen.
„Also kurz gesagt: Werfen Sie mal ein Auge auf diesen Mann. Ich verlasse mich auf Sie.“
Als er aus ihrem Zimmer verschwunden war, ärgerte sich Rosemarie zuerst, weil sie wusste, dass der Auftrag für sie den Verlust des gemeinsamen Mittagstischs mit ihren Kollegen bedeutete. Gleichzeitig dachte sie daran, dass sie schon mehrmals erlebt hatte, wie der Bürgermeister in seinem Zimmer aus dem Fenster schaute, wenn sie einmal zu ihm musste, um ihm einen Termin oder ein Papier zu bringen. Von dort konnte er den Marktplatz überblicken und den Zugang zum Rathaus. Aber meistens schien er bei solchen Gelegenheiten zwar zu schauen, aber dabei nichts zu sehen. Den Eindruck hatte sie zumindest, wenn er sich auf ihren Gruß hin umdrehte und sie mit einem abwesenden Gesichtsausdruck anblickte. Er schien mit seinen Gedanken in weiter Ferne zu sein. Fast empfand sie dann so etwas wie Mitleid mit ihm.
4 Erste Begegnung
Das musste der Mann sein. Er stand unter Rosemarie im Treppenhaus und betrachtete das breite Bild gegenüber, welches zwei Gruppen von Menschen in seltsamen Trachten darstellte, Frauen in langen weiten Röcken und mit weißen Hauben, Männer mit Kniebundhosen und hohen Zylindern auf dem Kopf.
„Suchen Sie etwas Bestimmtes?“ sprach Rosemarie ihn mit der Frage an, die man neuerdings stellte, wenn man so etwas ausdrücken wollte wie „Sie haben hier doch eigentlich nichts zu suchen. Machen Sie gefälligst, dass Sie Land gewinnen.“
Als er seinen Kopf drehte, erschrak sie fast. Diese Augen! Als wenn er gerade vom Bergsteigen zurückgekommen sei. Oder von einsamen Fahrten mit dem Fahrrad durch den Wald. Diese Gedanken beherrschten einen Augenblick lang ihr Gehirn.
„Nein, danke. Ich habe im Moment alles, was ich brauche.“
Dabei nahm sein Gesicht mit dem Schnurrbart und dem Bartkamm an seinem Kinn einen verschmitzten Ausdruck an. Er wurde noch verstärkt durch den ungeordneten Haarschopf, der frech in die Mitte seiner Stirn ragte. Und dann redete er weiter, als sei sie eigens zu ihm gekommen, um sich von ihm das Bild erklären zu lassen, an dem sie tagtäglich vorbeiging, und das sie eigentlich nie richtig beachtet hatte.
„Sechzehn Augen, das muss man sich mal vorstellen.“
„Wie meinen Sie das, sechzehn Augen?“ stammelte
sie verwirrt.
„Sechzehn Augen, die zusammen die Qualität prüfen.“
Na und? dachte sie. Was soll das? Ach ja, es muss ein Verrückter sein. Der in seine eigene Gedankenwelt versponnen ist, die für andere nicht zugänglich ist. Aber gut, bei solchen wüsste man nie. Unberechenbar, in welche Taten ihr Denken mündete. Vielleicht ein Attentat? Auf ein Bild unter Umständen. Das hatte es doch damals in Amsterdam gegeben. Auf die Nachtwache, wenn sie sich recht erinnerte. Die Nachtwache von Rembrandt. Ein wertvolles, weltberühmtes Gemälde. Mit Messerstichen. Unwillkürlich schaute sie an der Gestalt ihres Gegenübers entlang. Das Einzige, was er in der Hand hielt, war ein Fotoapparat. Aber diese Wülste über den Augen. Nur dann diese Augen selber. Wie sehr sie davon berührt wurde.
„Sehen Sie hier rechts: Sogar die Augen der Großkopferten interessieren sich für die Qualität des gemeinsamen Produkts. So wie sich später Maria Zanders für das gemeinsame Produkt interessierte.“ „Das gemeinsame Produkt? Was meinen Sie damit?“
„Ja, das ist ja das Interessante: Für sie war das gemeinsame Produkt nicht nur das, was sie im engeren Sinne herstellte, also das Papier der Firma Zanders, sondern auch die Gesamtheit der Stadt, wie die Menschen lebten und die gemeinsame Kultur. Heute kaum denkbar.“
Ist er doch kein Verrückter? Aber was er da redet! So hätte Herbert, ihr Exmann, nie geredet. Wen meinte er denn mit den Großkopferten? Ach ja, da waren auch Leute in besserer Kleidung abgebildet, ein Mann mit einem Degen an der Seite, zwei Frauen in Samt und Seide. Sie hielten ein Blatt Papier in der Hand, über dessen Qualität sie sich unterhielten.
„Die entgleiste Macht sucht den kritischen Augen der Beherrschten das starre Auge der Videoüberwachung entgegenzusetzen.“
Rosemarie schaute auf das Gesicht, welches sich bei diesem Satz in eigenartiger Weise zusammenzog, fast wie eine Zitrone, die ausgedrückt wurde, damit aus ihr der kostbare Saft tropfen konnte. Sie wusste nicht, warum er das sagte. Sie suchte und fand aber das verschmitzte Lächeln, welches alles begleitete und welches sie beruhigte. Trotzdem entfuhr ihr nun ein „Ich muss weiter“, was nicht der Wirklichkeit entsprach, und was die Verschmitzheit in seiner Miene verstärkte. Sie drängte an ihm vorbei und verschwand auf der Toilette im Erdgeschoss, die sie sonst nie benutzte.
„Bis zum nächsten Mal!“ hörte sie ihn noch hinter ihr herrufen. Im Vorraum der Toilette stand sie lange vor dem Spiegel und betrachtete diese Person in der hellbraunen Lederjacke, die ihr eine Festigkeit verleihen sollte, die sie nicht hatte. Ihre Augen hatten ein Stück von der Verschlossenheit verloren, die sie wie Jalousien herunterließ, ihre Wangen waren ein wenig gerötet, wie sie sie oft als Kind gehabt hatte, wenn sie von einem atemlosen Lauf zurückkehrte. Als Kind hatte sie nichts lieber getan als laufen. Und ihr fiel auf, wie tief die Kuhlen über ihrem Schlüsselbein waren. Sie fasste mit der Hand daran, als müsse sie sie beschützen, empfand aber gleichzeitig so etwas wie Beglückung bei ihrer Entdeckung, als sei sie plötzlich jünger geworden.
5 Speaker’s Corner
Als Rosemarie nach Dienstende aus der Rathaustür trat, empfingen sie die sonoren Klänge eines Männerchors. Eine späte Sonne glänzte auf der Ochsenblutfarbe des Bergischen Löwen, die eine frühlingshafte Aufmunterung durch die rosa Blüten von Blutpflaumen und Japanischen Kirschen erhielt. Eine Menschengruppe von etwa 30 Leuten stand vor dem steinernen Podium an der Villa. Neugierig näherte sich Rosemarie und stellte sich dazu. Das Podium war vor ein paar Jahren vergrößert worden, nachdem die Bronzefigur des Papierschöpfers wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht worden war, an die Strunde, deren Wasser den Betrieb der zahlreichen Mühlen in der Stadt ermöglicht hatte. Nun diente das Podium als Speaker’ s Corner der Stadt.
„Ich habe ja eigentlich etwas gegen Männerchöre“, hörte Rosemarie eine Stimme hinter sich. Als sie sich umdrehte, sah sie ihre Kollegin Waltraud mit ihrem frechen Lächeln.
„Aber bei so einem schönen Wetter kann ich sogar die ertragen. Und das Bergische Heimatlied, naja!“ Rosemarie hatte die Melodie immer gefallen, obwohl sie immer gedacht hatte, dass der Text einmal modernisiert werden könnte.
Wo die Wälder noch rauschen….Es stimmte ja. Um die Stadt herum gab es noch immer viele schöne Wälder, in denen sie manchmal mit Waltraud und einer weiteren Kollegin am Wochenende wanderte. Alle drei einte nicht nur die Liebe zur Natur, sondern auch gewisse Vorbehalte Männern gegenüber. Besonders Waltraud konnte so richtig vom Leder ziehen, nachdem sie sich vor kurzem von ihrem dritten Mann getrennt hatte. Dabei strahlte sie mit ihren weißen vorstehenden Zähnen einen unbeugsamen Optimismus aus. Den wünschte sich Rosemarie manchmal, konnte ihn aber eigentlich nicht richtig verstehen. Woher nahm sie diese Kraft trotz der Nackenschläge, die ihr das Leben schon verliehen hatte? Oder war es einfach die Tatsache, dass sie fünfzehn Jahre jünger war als Rosemarie?
Nun traten die Sänger zur Seite und ein etwa sechzehnjähriges Mädchen trat auf das runde Podium. Sie strich sich mit der Rechten ihr langes dunkelblondes Haar hinter die Schulter, räusperte sich und sprach mit nicht lauter, aber gut verstehbarer Stimme:
„Frühlingsmorgen“
Ihr Gesicht war ernst, auch während der langen Pause, die nun folgte. Dann redete sie langsam und eindringlich weiter:
„Wenn Antwortlosigkeit der Politik
und Drohnen in Afghanistan
und Technikteppiche dir
alles überdecken,
die Luft des Taubenflugs
mit Gift und Gülle füllen,
dann lässt der Bittersaft
von Trotz und Wut
dir neben deiner Hängematte
blaue Blüten wachsen von
zarter Wieseniris und-“
Hier folgte eine fast unerträglich lange Pause
„dem Todesschlaf
des Eisenhuts.“
Kurze Verbeugung, dann trat sie zu der kleinen Gruppe direkt vor der Natursteinmauer, die den Garten der Villa vom Marktplatz trennte.
Das Klatschen der Zuhörer war noch nicht ganz verstummt, als ein blonder junger Mann mit mehreren Piercings in den Lippen sich mit einem großen Foto neben das Podium stellte, ein Foto, auf dem zwei städtische Arbeiter dargestellt waren, die nebeneinander auf der Pritsche eines Dienstfahreugs in Arbeitsorange saßen, der eine lässig an die Seitenwand gelehnt, der andere im Schneidersitz eine Zigarette rauchend, seinen Kollegen anblickend.
„Krisensitzung“ deklamierte nun ein anderer junger Mann, der das Podium betreten hatte, und wies auf das Foto. Er hatte einen sanften Blick, während seine Haare in einem provozierenden rostorange Ton von einem hellgrünen Band gehalten wurden. Dann folgte der Vortrag eines Gedichts mit einer eindrücklichen warmen Stimme:
„Wenn Raster, Normen
Aussetzer gestehen
und Produktivität als
Hermelinbesatz an
Kaisers neuen Kleidern
wir erkannt,
dann wenden unsere
Gesichter sich
einander zu und
sehn im anderen
den Bruder, der wie
wir selber
eigentlich nur
leben wollte,
nichts als leben.“
„Ich kann nur staunen über diese jungen Leute“,
meinte Rosemarie und wandte sich zu Waltraud.
„Aber ist doch toll, oder?“
„Wo kommen die eigentlich her?“
„Ich habe in der Onlinezeitung gelesen, dass sie zu
Wort und Kunst gehören.“
„Wort und Kunst?“
„Ja, die Gladbacher Schriftstellervereinigung, die
sich angeblich in der letzten Zeit sehr verjüngt hat. Und wie man sieht, ist das auch so. Pass auf, es geht weiter!“
Der Blonde mit den Piercings hatte nun das Foto gegen ein anderes vertauscht, auf dem das Porträt eines Soldaten abgebildet war. Rosemarie fiel sofort der Gegensatz zwischen der strengen Militäruniform und dem verträumten Blick des jungen Menschen ins Auge.
Nun trat ein vielleicht zwanzigjähriges Mädchen in schwarzer Lederkleidung auf die runde Stadtbühne, schaute zuerst verschmitzt in die Runde, so dass zwei gönnerhafte Grübchen neben ihrem Mund sichtbar wurden, schüttelte ihre dunkelrot gefärbte Mähne und wies dann ernst auf das Foto mit dem Uniformierten. Mit warmer Stimme rezitierte sie dann langsam:
„Suchanzeige
Wo ist die Fee,
die deiner Augen
Traurigkeit
und Härte wieder
deinen Lippen nähert
und dir selber einen
Glauben schenkt
an dich,
der auch zu Liebe
und zu Mitleid steht?“
Und dann mit liebevollem Nachdruck:
„Wie sehr
ich sie
dir wünsche!“
In diesem Moment näherte sich Rosemarie eine Gestalt in hellblauem Uniformhemd von der Seite, mit der amtlichen Dienstmütze des Polizisten auf dem Kopf.
Während die Zuhörer klatschten, legte er Rosemarie eine Hand auf den Arm.
„Hallo, Rosemarie! Schade, dass wir uns nun nicht mehr sehen!“
Jürgen, der sich immer um sie bemüht hatte, auf allen Veranstaltungen der Polizei, bei der sie dabeigewesen war. Und sie war immer dabeigewesen, bis sie sich von Herbert getrennt hatte. Wenn sie seine fleischigen Lippen sah und seine etwas glupschigen Augen, stieg ihr immer ein glucksendes Lachen in die Kehle. Für das sie sich anschließend schämte. Denn ihr war klar: Er meinte es ernst. Hatte es immer ernst gemeint. Aber dafür konnte sie doch nicht verantwortlich gemacht werden. Und doch war sie froh, dass er heute wegen des unerwartet warmen Frühlingswetters im Hemd erschien. So sah man nicht die dunkelblaue, fast schwarze Uniformjacke, die sie abgestoßen hatte, seitdem sie eingeführt worden war. Ein weiterer Schritt in die zunehmende Aufrüstung, die die Polizei betrieb. Jürgen stellte ja eigentlich eine rühmliche Ausnahme dar. Er war noch der Polizist von nebenan, dein Freund und Helfer. Ihm hätte die vertraute grüne Uniform viel besser gestanden. Er hätte auch gar nicht die allzeit bereite Pistole am Gürtel gebraucht, auch nicht die Drohung der Handschellen. Seine bloße Anwesenheit und der Ernst in der Tiefe seiner Augen genügte, seinen Zweck zu erfüllen: Den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Und ein gelegentliches Aufblitzen seiner menschenfreundlichen Lache reichte für lange Zeit aus, die Sicherheit, die die Staatsmacht garantierte, als von den Bürgern an die Exekutive geborgte zu verstehen und nicht als Anmaßung und Betrug, wie sie von Herbert rechthaberisch missbraucht wurde. Der hatte zwar noch die bürgerfreundlichere grüne Uniform getragen, als er entlassen wurde, beziehungsweise als ihm sein Ausscheiden aus dem Dienst nahegelegt wurde. Doch hätte zu ihm besser die heutige dunkle Tracht gepasst. Er hätte sie sicher gut gefunden. Hatte er doch ein ganz anderes Ideal von einem guten Polizisten. Heute schämte sie sich fast, dass sie damals auf dieses Image hereingefallen war. Ein ganzer Mann, selbstbewusst, zielsicher, kräftig. Dem keiner was vormachen konnte.
„Hallo, Jürgen.“
Sein weiblicher Mund und seine tiefen Augen waren aber gerade das, was ihn als Mann für sie unattraktiv machte. Sie wand sich innerlich schon vor der Frage, die nun kommen musste, und die er schon mehrmals geäußert hatte:
„Willst du nicht trotzdem zu unseren Festen kommen? Ich könnte dir die Einladungen zukommen lassen.“
„Mein lieber Jürgen, lass sie doch endlich in Ruhe!
Ihr Männer meint immer, wir könnten nicht ohne euch auskommen.“
Es war Waltraud, die sich nun energisch zu Wort meldete. Sie sprach lauter, da die Gedichtvorträge offensichtlich beendet waren und der Männerchor zu einem Schlusslied angesetzt hatte.
„Ja, war doch nur eine Erinnerung. Falls du Lust hast.“
Fast wie eine Entschuldigung für eine Ungehörigkeit klang es aus dem Mund des Polizisten, während er sich anschickte, seinen Rundgang fortzusetzen.
„Also, ich muss dann mal weiter.“
6 Die erste Begegnung im Ratssaal
Pflichtbewusst machte Rosemarie am nächsten Tag wieder ihren Rundgang in der Mittagszeit, nachdem das Rathaus ihre Kollegen in die umliegenden Restaurants zu Tisch geschickt hatte. Sie entdeckte aber zu ihrer Verwunderung noch etwas anderes in sich als bloßes Pflichtgefühl und die kleine Wut über dieses Amt, das sie nicht angestrebt hatte. Da war etwas, was an ihr zog, sie neugierig machte und über ihrem Magen eine Unruhe verbreitete, die sie nicht als unangenehm empfand. Im Treppenhausmit seinem weißgetünchten Fächergewölbe kam sie eine kleine Enttäuschung an. Er stand nicht wie gestern vor dem breiten Gemälde mit den Papierschöpfern. Sie erblickte nicht seinen kecken Haarschopf auf der Stirn und sah nicht seine Augen, die von langer Fahrradtour durch Wälder oder von einer Gebirgswanderung zurückgekehrt waren. Auch aus der dramatischen Gebirgslandschaft, die auf der gegenüberliegenden Seite hing, sah man keinen einsamen Wanderer heruntersteigen.
Rosemarie schaute sich auf dem unteren Flur um. Außer dem Reiterrelief des bergischen Helden Ommerborn war aber keine menschliche Gestalt zu sehen, und als sie die schweren Holztüren zum Marktplatz hin öffnete, breitete sich vor ihr nichts als mittägliche Ruhe aus. Die Sonne lag auf dem warmen Porphypflaster des Marktplatzes, der seine Schönheit wie kaum ein anderer Platz in der Region aus seiner Größe, Unregelmäßigkeit und Geschlossenheit erhielt. Nur ein aufgeregter Täuberich trippelte abwechselnd hinter einer und dann der anderen schlanken Taubendame her. Der einzige Mensch, der im Moment die Weitläufigkeit des Platzes belebte, war die Stadtstreicherin Maria. Sie saß auf der Drahtbank vor der Kirche und zog ab und zu eine Flasche aus dem Plastikbeutel hervor, um sich einen Schluck daraus zu genehmigen. Dabei schaute sie mit hochrotem Gesicht zu den Bussen an der Haltestelle und grummelte einen Protest in diese Richtung, als fühle sie sich von ihnen in ihrer Meditation gestört.
Rosemarie kehrte ins Innere des Rathauses zurück, stieg die Treppe hinauf und wollte sich wieder in ihr Büro zurückziehen. Als sie an der Tür zum Ratssaal vorbeikam, stutzte sie. Es schien ihr, als habe sie von drinnen ein Geräusch gehört, wie wenn jemand nach einem Sprung auf dem Boden gelandet sei. Sie öffnete die Tür und sah ihn, wie er in der Mitte des Saals stand und seine kleine Kamera auf die Rückseite des Raums gerichtet hatte.
Nach dem leisen Klick der Aufnahme drehte er sich zu ihr um und sprach mit ihr, als hätte es zwischen dem gestrigen Gespräch im Treppenhaus und heute keine Unterbrechung gegeben:
„Diese Reliefs sind ja keine künstlerischen Meisterwerke. Aber sehen Sie die Darstellung der Justitia. Müsste das Bewusstsein ihrer Anwesenheit nicht jeden Abgeordneten in seinen Entscheidungen beeinflussen? Interessant ist, was hier nicht dargestellt ist: keine Waage, keine Binde vor den Augen, wie man es auf vielen Darstellungen der Gerechtigkeit findet. Die Gerechtigkeit erfüllt sich also nicht in der absoluten Gleichheit für alle und ist auch nicht blind gegenüber Besonderheiten. Stattdessen hat sie hier ein Buch in der Hand, vielleicht ein Hinweis, dass Gerechtigkeit vom geschriebenen Gesetz zu erwarten ist. Und das Schwert ruht auf einer Girlande, welche von Putten gehalten wird, die vielleicht als das Volk zu verstehen sind. Die Umrandung könnte eine Glücksymbolik andeuten. Die Gerechtigkeit muss sich also dem Glück der Bevölkerung unterordnen.“
Fast atemlos hatte der Fremde Rosemarie diesen Vortrag gehalten. Nun schaute er ihr wieder in ihre grünen Augen und fuhr fort:
„Aber der große Schatz dieses Raums sind die Gemälde, die in die Täfelung eingelassen sind. Oder wie sehen Sie das?“
Rosemarie wusste zwar von der Existenz dieser Gemälde, hatte auch schon davon gehört, dass sie seltsamerweise aus der Hand von Maria Zanders stammten, der Besitzerin der größten Papierfabrik der Stadt im 19. Jahrhundert, die sich gleichzeitig einen Namen als Mäzenin für Kunst, Musik und Stadtgestaltung einen Namen gemacht hatte, hatte aber keine detaillierte Vorstellung von den dargestellten Inhalten.
Fragend schaute sie auf seine Bergsteigeraugen und seinen Mund, der ihr eine ungewohnte Freundlichkeit entgegenzubringen schien. Andererseits war sie verwirrt und ein wenig ablehnend, weil er mit dieser Selbstverständlichkeit, und ohne dass sie es gemerkt hatte, ins Rathaus eingedrungen war. Doch was hieß eingedrungen? Schließlich stand es jedermann offen. Aber an ihrer Beamtenehre kratzte es doch, dass da jemand ins Allerheiligste des administrativen und politischen Zentrums der Stadt gehuscht war, mit unbekanntem Ziel, ein unbekannter Mensch mit merkwürdigen Ansichten. Was würde er jetzt über die Gemälde von sich geben?
„Schauen Sie sich hier den alttestamentarischen Krimi an: Kain ermordet seinen Bruder Abel. Sie kennen die Geschichte, oder?“
„Ich kann mich schwach erinnern“, mumelte sie.
Wieder wurde er eifrig:
„Ja, sehen Sie nur die zwei Feuer, links das Feuer, das schön nach oben brennt, sein lichter Qualm geht über in ein Licht aus dem Himmel. Man ahnt gleich, dass es ein göttliches Licht ist. Die rechte Seite des Bilds ist dunkel, der Qualm niedrig daherzündelnden Feuers wird von der Dunkelheit erstickt. Links das Opfer des Abel, das von Gott angenommen wird, rechts das Opfer Kains mit den Feldfrüchten, das von Gott verschmäht wird.“
Nun trat Rosemaries Widerstand wieder zum Vorschein, vielleicht auch, weil sie sich zu sehr belehrt fühlte:
„Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht so fürchterlich religiös bin.“
„Ich doch auch nicht“, lachte er.
„Aber seit einiger Zeit entdecke ich religiöse Inhalte neu, weil sie ein Teil unserer Kultur sind. Und ich sehe meine Aufgabe darin, unsere religiöse Kunst neu zu interpretieren und ihren Wert dadurch zu erhalten und weiterzugeben.“
„Und was wollen uns Kain und Abel heute sagen?“ Sie verzog skeptisch ihre Mundwinkel.
„Schauen sie sich das an: Hier ist zunächst ein unglaublicher Widerspruch. Der sanfte Abel wird von einem wilden Kain getötet, obwohl er ihn noch umarmt mit der Bitte um Erbarmen. Bilder haben eine eigenartige Kraft des Überdauerns. Man muss sie nur genau betrachten, dann entwickeln sie Botschaften, die sich an die jeweilige Zeit anpassen.
Sie blicken sozusagen zurück. So wie Maria Zanders aus ihrem Porträt in der Villa Zanders dem Betrachter zu folgen scheint, egal, ob er sich oben auf der Treppe befindet oder unten auf einem Stuhl während eines Konzerts.“
Die Villa Zanders kennt er also auch schon. Hatte er nicht einen schwäbischen Akzent in seiner Stimme? Bestimmt war er nicht von hier. Aber was sollte das? Sie war doch nicht fremdenfeindlich.
„So brauchen wir auch nur dieses Bild von Kain und Abel anzuschauen,“ fuhr er unbeirrt fort, „um durch die Merkwürdigkeiten, die auf ihm dargestellt sind, eine Botschaft für uns heute zu entdecken. Wenn die Mitglieder des Rats, der hier tagt, sich der Bedeutungen mancher Bilder bewusst wäre, würde er anders entscheiden, als er es häufig tut, besonnener, mehr in die Zukunft gerichtet, mehr am wirklichen Wohl aller orientiert.“
Ach, über Ratsentscheidungen in unserer Stadt ist er informiert. Vielleicht doch kein Fremder?
„Aber was hat das jetzt mit Kain und Abel zu tun?“ fragte sie fast patzig.
Er schaute ihr aus seinen wulstigen Brauen in das Grün ihrer Augen. Sie merkte, wie sie langsam aber sicher in den Sog seiner Begeisterung gezogen wurde, fragte sich aber weiter, welche Absichten er eigentlich verfolge.
„Ein bisschen überlegen muss man schon. Das gebe ich zu. Nicht alles springt vom Dargestellten allein in die Augen. Sehen Sie, Gott verurteilt die Tat des Kain, obwohl der der Sesshafte ist, dessen Nachkommen wir sind, obwohl er als Opfergabe Früchte darbringt und keine lebendigen Tiere wie Abel. Das kann nur bedeuten, dass er uns irgendwie den Abel ans Herz legen will. Wir sollen nicht einfach in unserer Sesshaftigkeit schmoren und uns besser fühlen, sondern daran denken, wie sehr der Nomade, gemeint ist der geistige Nomade, uns fehlt. Wer sind denn die Nomaden von heute?“
Hier schaute er beinahe provozierend in ihre grünen Augen, stutzte dabei ein wenig, als habe er plötzlich die kleinen goldenen Flecken darin entdeckt, fuhr trotzdem fort:
„Das sind die Nichtsesshaften, die Beweglichen, die Obdachlosen, die Außenseiter der Gesellschaft. Das ist es, an was ein Rat gelegentlich denken sollte.“
Aus den rosa Lippen, die für ihn eine aufregende Form hatten, die er nicht beschreiben konnte, hörte er:
„Und so wollen Sie auf allen Bildern in diesem Ratssaal Botschaften herauslesen?“
Nun rückte er einen Stuhl an einen der breiten Tische heran, die an die Seiten des Ratssaals standen.
„Steigen Sie mal über den Stuhl auf den Tisch!“
Dabei hielt er ihre Hand, und zu ihrem eigenen Erstaunen kletterte sie auf den Tisch, an der Stelle, wo über ihnen ein Gemälde mit einem Regenbogen in frischen Farben hing. Er stieg hinterher und umfasste ihre Hüften mit der Rechten, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt.
Seine Linke wies auf das Bild.
„Das hier zeigt Noah mit den Seinen nach der Sintflut.“
„In diesen kleinen Figuren da oben auf dem Plateau wollen Sie Noah erkennen?“
„Nicht persönlich natürlich. Da haben Sie Recht. Aber schauen Sie nach oben. Da sehen Sie die Arche. Unverkennbar. Aber mal der Reihe nach: