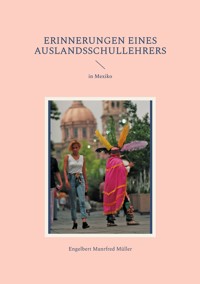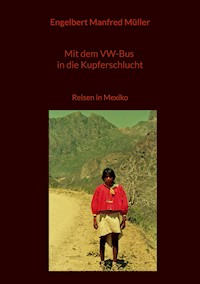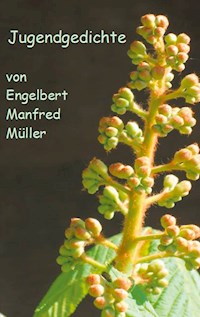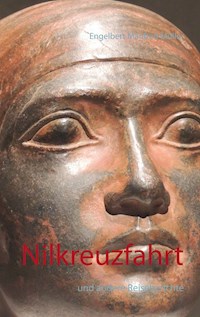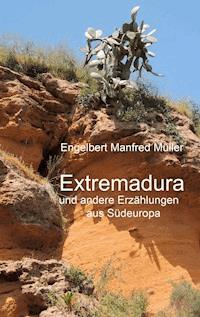Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Journalist Robert Wertmann verbringt eine Woche zum Ausspannen in Lissabon. Das hat er dringend nötig, da er gerade sowohl privat als auch beruflich gescheitert ist. Nun trifft er mit Leuten zusammen, die ihn tief in die Kultur und Geschichte der Stadt hineinführen, aber unerwarteterweise auch in seine eigene Vergangenheit. Vor vielen Jahren reiste Robert mit seinen Eltern über Portugal nach Brasilien aus und verliebte sich dabei in eine kleine Portugiesin namens Maria, die er aus seinem Bewusstsein verdrängt, aber im Grunde nie vergessen hatte. Nach und nach tauchen die Erinnerungen in ihm wieder auf. Und nun bietet sich die Gelegenheit, diese Maria wiederzutreffen. Doch gleichzeitig türmen sich merkwürdige Schwierigkeiten auf, die mit der Familie Marias und ihrer Vergangenheit, aber auch mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation zu tun haben. "Nur ein Schlüsselanhänger" ist ein Liebesroman mit einer fast krimiartigen Handlung, kann aber auch zur Vorbereitung oder Nachbereitung eines Lissabon-Besuchs benutzt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
zum Text:
Der Journalist Robert Wertmann verbringt eine Woche zum Ausspannen in Lissabon. Das hat er dringend nötig, da er gerade sowohl privat als auch beruflich gescheitert ist. Nun trifft er mit Leuten zusammen, die ihn tiefer in die Kultur und Geschichte der Stadt hineinführen, aber unerwarteterweise auch in seine eigene Vergangenheit.
Vor vielen Jahren reiste Robert mit seinen Eltern über Portugal nach Brasilien aus und verliebte sich dabei in eine kleine Portugiesin namens Maria, die er aus seinem Bewusstsein verdrängt, aber im Grunde nie vergessen hatte. Nach und nach tauchen die Erinnerungen in ihm wieder auf. Und nun bietet sich die Gelegenheit, diese Maria wiederzutreffen. Doch gleichzeitig türmen sich merkwürdige Schwierigkeiten auf, die mit der Familie Marias und ihrer Vergangenheit, aber auch mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation zu tun haben.
zum Autor:
Engelbert Manfred Müller, 1940 geboren, in Köln und Leverkusen aufgewachsen, war 40 Jahre als Lehrer an Volksschulen, Hauptschulen und Gesamtschulen tätig. Davon verbrachte er 9 Jahre an Schulen in Chile und Mexiko. Nach seiner Pensionierung 2003 tauschte er sein jahrelanges Malhobby gegen das Schreiben ein. In der Zeit von 2004 bis 2010 entstanden drei Gedichtbände, ein Kurzroman, ein Band mit Erzählungen aus Lateinamerika, einer mit Erzählungen aus Südeuropa und einer mit Erzählungen aus Deutschland.
2015 erschien der Erzählband „Das Auge der Stadt“ im Buchhandel.
Engelbert Manfred Müller lebt seit 1982 mit seiner Familie in Bergisch Gladbach.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1
„Was heißt schon leise? Wir befinden uns in Lissabon, müssen Sie bedenken!“ Es war nicht unfreundlich gemeint. Das merkte er. Und eigentlich konnte er sich hier etwas richtig Leises auch gar nicht vorstellen. Wo sollte sich ein solches Zimmer auch befinden? Nach vorne lag die Front der Pension an der Praca, die zwar schattig und baumbestanden war, aber um den kleinen Park in der Mitte herum toste, zumindest jetzt am Tage, der Verkehr. Wie selten war dagegen die Rua dos Cavaleiros von einem Fahrzeug befahren worden. Und was hatte er nicht dort in der Nacht erlebt!
„Nein, ein Einzelzimmer haben wir nicht frei.“ Ein Doppelzimmer sollte aber das Doppelte von dem kosten, was er in der vergangenen Nacht bezahlt hatte. Immer noch nicht unerschwinglich teuer, aber nicht im Rahmen dessen, was er für die paar Tage eingeplant hatte. Immerhin war er sowas wie ein Arbeitsloser, obwohl er sich an dieses Wort noch gar nicht gewöhnt hatte und sich auch gar nicht vorstellen konnte, dass dieser Zustand so bleiben sollte.
Er war zuerst ein paar Schritte um die Pension herumgegangen und hatte festgestellt, dass sie auf drei Seiten von Verkehr umgeben war. Das Gebäude an sich hatte ihm zwar gefallen. Es war ein stilvoller Bau mit Fenster- und Türblenden aus hellem Stein aus dem 19. Jahrhundert oder älter. Aber wo sollte sich hier ein ruhiges Zimmer befinden? An der vierten Seite war es an das Nachbargebäude angebaut. Da konnte also auch kein Zimmer liegen, oder zumindest keins mit Fenster, und eine Nacht, ohne das Fenster zu öffnen, war für ihn undenkbar.
„Nein, danke, dann schaue ich noch mal woanders.“ Freundliche Verabschiedung. Kein Problem. Merkwürdig! Seine Laune hatte sich schon entschieden gebessert, obwohl er sich nun wieder mit seinem großen grauen Schalenkoffer auf der Straße befand. Er hätte sich ja auch in der Pension ein Taxi bestellen lassen können. Aber es beherrschte ihn seit Tagen dieser starke Drang nach Unabhängigkeit. Er musste alleine sein, frei in seinen Entscheidungen, auf nichts warten müssen, sich möglichst nach keinem richten müssen. Nun musste er zwar wieder auf ein Taxi warten. Aber das war etwas anderes. Er stand da an der Straßenecke mit seinem Koffer, seinen kleinen schwarzen Rucksack auf dem Rücken, und fast fühlte er sich wieder wie früher, als er per Anhalter durch die Welt reiste.
Es dauerte eine Weile, bis ein freies Taxi auf sein Winken hin hielt. „Casa Mamede in der Rua da Escola Politecnica.“ Er merkte sofort, wie der Taxifahrer, der aussah, als hätte er schon die Gründung der Stadt miterlebt und auch so fuhr, durch enge, mit Autos zugeparkte Gassen bergauf und wieder bergab und wieder bergauf, neugierig auf seinen Akzent horchte, obwohl er nicht viel von sich gegeben hatte. Mit den kurzgeschorenen Haaren, die Reste von Blond aufwiesen und seiner hochgewachsenen schlaksigen Gestalt sah er nicht gerade aus wie ein typischer Portugiese. Auf der anderen Seite kam sein Portugiesisch flüssig über seine Lippen. „Sind Sie zum ersten Mal in Lissabon?“ war die diplomatische Frage, die ihm dann gestellt wurde. Das konnte ja auch bedeuten, dass er zwar Portugiese, aber halt nicht aus Lissabon sei, wieso fuhr er auch mit Koffer und Taxi durch die Stadt?
„Nicht ganz“, war seine Antwort. „1976 war ich schon mal hier.“
„76? Eine heiße Zeit. Die Nelkenrevolution war gerade vorbei.“
„Ich weiß.“
Musste dieser Fremde denn so wortkarg sein? Wieso war der damals hier gewesen? Damals musste er doch noch sehr jung gewesen sein. Wohl gerade zehn oder so. Wieso kam man damals mit zehn nach Lissabon, in einer Zeit, in der die Stadt und das ganze Land eher von Fremden gemieden wurden? Jetzt hielt er es nicht mehr aus: „Sie sind aber doch sicher kein Portugiese, oder?“
„Nein.“
„Und wieso sprechen Sie so gut unsere Sprache?“
„Ich habe mehrere Jahre in Brasilien gelebt.“
So war das. Deshalb auch dieser merkwürdige weiche Akzent. Das hatte er doch gemerkt. „Aber 76 waren Sie noch sehr jung. Da kamen Sie doch nicht alleine nach Lissabon.“
„Nein, mit meinen Eltern. Wir reisten damals nach Brasilien aus.“
„Und da kamen Sie nach Portugal?“
„Ja, mit dem Schiff. Mit dem Schiff von Genua nach Lissabon. Und von Lissabon ging es dann weiter mit dem Schiff nach Brasilien.“
***
Er hätte sicher noch seine ganze bisherige Lebensgeschichte auskramen müssen, wenn sie nicht bald angelangt wären. Casa Mamede! Ein gelbgetünchtes Haus, das ihm auf Anhieb gefiel. Und drinnen noch mehr. Die lächelnde dunkelhaarige Frau an der Rezeption sah ihn werbend aus ihren freundlichen dunklen Augen an. Sie war klein und nicht sehr schlank und wirkte doch wie die Schönste in einem Dorf auf dem portugiesischen Land. Er wusste aus seinem Reiseführer, dass auch hier ein Zimmer doppelt so teuer sein würde wie das, welches er von Deutschland aus telefonisch reserviert hatte, und in dem er die schreckliche letzte Nacht verbracht hatte. Nun hatte er sich zwar schon grundsätzlich entschieden, den Preis zu zahlen, wenn die Pension entsprechend schön war, wie sie im Reiseführer beschrieben war. Aber es stimmte dann tatsächlich auch alles. Ein stilvoller Treppenaufgang mit einem von hinten beschienenen Fenster, auf dem ein Kind mit einem Lamm dargestellt war, der heilige Mamede, wie er später erfuhr. Der Frühstücksraum mit seinem edlen Parkettfußboden, dem blauen Kachelfries ringsum und der Abendmahlsdarstellung auf blauen und gelben Fliesen.
Er hatte die ganze Reise ja schon für einen Fehlschlag gehalten. Aber nun schien doch noch alles anders zu kommen.
„Gefällt Ihnen dieses Zimmer mit den antiken Möbeln besser oder das andere hellere, das großzügiger eingerichtet ist und auch wesentlich größer?“
Die kleine Dunkelhaarige hatte offensichtlich richtig Spaß daran, ihn im ganzen Haus herumzuführen. Weil sie stolz auf die Schönheit des Hauses war, oder weil sie seine Gegenwart mochte? Dabei war sie eine Portion älter als er. Aber trotzdem wirkte sie in ihrer adretten Art recht anziehend auf ihn. Das schien sie zu spüren.
„Eine Woche würden Sie bleiben? Da mache ich Ihnen einen Sonderpreis.“ Auch angenehm. Dabei hatte er innerlich schon zugesagt. Hier stimmte doch einfach alles. Und auch das Wetter schien sich an dieses sympathische Haus anzupassen. Nicht mehr diese Schwüle von gestern. Nicht mehr diese diesige Luft, die alle Konturen und Farben verwischt hatte.
2
Als er gestern am Flughafen ankam, war er erstaunt und enttäuscht gewesen. Er war vor dem schlechten Wetter in Deutschland geflohen. Dieser ewige Regen konnte einen trübsinnig machen, wenn man es nicht schon gewesen wäre. Und im Internet hatte er gesehen, dass Lissabon wolkenlos und von angenehmen Temperaturen war. War das jetzt umgeschlagen? Auch der Taxifahrer, der ihn vom Flughafen zur Rua dos Cavaleiros brachte, war wenig portugiesisch in seiner wortkargen Art, mit miesem Gesichtsausdruck. Immerhin versuchte er nicht, unangemessen bei ihm abzukassieren. Vielleicht war es ihm auch dazu zu warm und schwül.
Die Praca Martim Moniz war tatsächlich so hässlich, wie sein Reiseführer sie beschrieben hatte, an der einen Seite ein großer städtebaulicher Kahlschlag. Baugruben, Bretterzäune, verwundete rotbraune Erde. Der Platz selber eine mühsame Ansammlung von Gestaltung aus stinkenden Wasserflächen und schattenlosen nackten Sitzgelegenheiten, die niemand benutzte, umbraust von einem ungeduldigen Verkehr, der schnell dies alles hinter sich bringen wollte. So auch das Taxi, als es an dem gewollt modernen, müde dunkelhäutige Frauen und Paare mit Einkaufsplastiktüten ausspeienden Einkaufszentrum vorbei in die enge, langsam ansteigende Rua dos Cavaleiros einbog.
Er zog seinen grauen Koffer aus dem Kofferraum, den der Fahrer geöffnet hatte, um einen Schritt zurückzutreten, wie um ihm zu demonstrieren: „Ich habe mir schon die Mühe gemacht, dich bis hierher zu bringen. Nun zieh endlich dieses überflüssige Gepäck aus meinem Wagen, und befreie mich von dir, bei diesen Tarifen, die mich kaum am Leben erhalten können!“ Für das Trinkgeld bedankte er sich nicht und erwiderte auch nicht Roberts Abschiedsgruß. Der nahm seinen Koffer von den Straßenbahnschienen, die die ganze Mitte der kopfsteingepflasterten Straße einnahmen, warf einen prüfenden Blick auf das Hotelschild mit den stolzen zwei Sternen auf der linken Seite und schritt auf die verschlossene Tür zu, auf der die graue Farbe nach dem xten Anstrich schon wieder abblätterte.
Nachdem er zum zweiten und dann zum dritten Mal geklingelt hatte, öffnete sich die Tür mit einem lauten Summen, und er stieg die enge, mit Holzimitat belegte Treppe hinauf zur ersten Etage, wo ihn hinter einer hohen Theke ein mürrisch blickender Buckliger mit Zwergenwuchs empfing, dem er seinen Namen nannte. Nach längerem Nachschauen in einem schmierigen Buch kroch der Zwerg hinter der Theke hervor und ging ihm voraus auf einen Gang, der zu einem dunklen Zimmer führte, welches immerhin auf der rechten Seite mit dem vorbestellten Bad verbunden war. „Frühstück ab neun“, murmelte er, als er Robert die Zimmertür geöffnet hatte.
***
Der schmale Schrank war mit verfilzten Decken und Bettwäsche vollgestopft und bot wenig Raum, um seine Kleider dort unterzubringen. Und da sich lediglich zwei Kleiderbügel aus verbogenem Draht darin befanden, verzichtete er darauf, seinen Koffer auszupacken, was sich am nächsten Tag als nahezu prophetisch herausstellen sollte.
Als er das Fenster öffnete, schlug ihm stickige Luft entgegen. Schwülwarm. Eine dunkelhäutige ältere Frau kam die Straße heraufgeschlichen, in einem schmuddeligen, farblich undefinierbaren Kleid von einem Umfang, als wäre sie schwanger, was in ihrem Alter aber eher unwahrscheinlich war. Aus dem kleinen Laden gegenüber trat ein Mann mit krausem Haar, der eine Flasche in der Hand hielt, die er nun öffnete und an den Mund setzte. Normalerweise faszinierten ihn solche Szenen. Aber deshalb war er nicht nach Lissabon gereist. Und auch die blätternde Fassade gleich seinem Fenster gegenüber diente nicht gerade seiner Aufheiterung. An dem rostigen Balkongitter hingen zwar Fähnchen mit den portugiesischen Farben, aber die Balkontür tauchte auch diese in eine Tristesse, die ihre Fortsetzung fand in dem überall klebenden, hängenden und verschmierten Taubenkot, dazu die zerrupften Tauben selber, die in einer trägen Geilheit den Anspruch erhoben, alles zu besetzen, Balkon, die Töpfe mit den vergammelten Blumen, die umherhängenden Elektroleitungen, die ehemals weißen Porzellanköpfe der Isolatoren, die halb herausgerissenen Pflastersteine auf der Straße und die Löcher auf dem schmalen Gehsteig.
„Wir brauchen Ihnen doch nicht zu erklären, wie sehr wir Sie schätzen. Ihre journalistische Qualifikation steht außer Frage, und viele Kollegen schätzen Sie auch als Mensch.“ Dieser Satz kam ihm jetzt wieder in den Sinn. Er würde ihn nie vergessen, aber noch weniger die zahlreichen unausgesprochenen Abers, die darin mitschwangen. Und vor allem die Unerbittlichkeit, in der er festgemauert war, so dass es überhaupt keinen Sinn hatte, darüber zu diskutieren. Das hatte er sich dann auch folgerichtig verkniffen. Ein Gefühl von Schmutz lag auf seiner Seele, Schmutz und Unausweichlichkeit, wie der allgegenwärtige Taubenkot. Aber da war ja noch etwas, viel Unangenehmeres. Diesen Gedanken verdrängte er vorläufig noch. Und damit er ihn nicht überraschte, schloss er das Fenster, um nicht noch mehr Hitze hineinzulassen, zog den dunkelroten Vorhang zu, soweit er sich zuziehen ließ, und verließ das Zimmer. Als er an der rohgezimmerten Empfangstheke vorbeikam, hatte er das Gefühl, als verstecke sich der Bucklige vor ihm, als mache er sich mit Absicht noch kleiner, weil es ihm nun selber unangenehm war, ihm ein solches Zimmer vermietet zu haben. Nur – dachte er gleichzeitig – was war an dem Zimmer eigentlich so schlimm?
***
Preiswert war das Essen, aber simpel und wenig geschmackvoll, der weiße Hauswein nicht viel besser. Er erinnerte ihn ein wenig an Moselwein, „deutschen Süßessig“, wie er ihn immer nannte, gegen die Proteste seiner Freunde, die ihn immer davon zu überzeugen versuchten, dass es auch in Deutschland leckere Weine gebe. Und er hatte auch immer wieder Versuche gemacht, ihren Geschmack nachzuempfinden, was ihm aber nie gelungen war. Im Süden schmeckten ihm aber fast alle Weine. Umso enttäuschter war er jetzt. Er saß am Rande des kleinen Platzes vor der mächtigen Fassade der Dominikanerkirche, wo einige verwegen ausschauende abgerissene Gestalten die Austretenden um ein Almosen baten, mit einer erstaunlichen Demut und Gelassenheit, wenn sie nichts bekamen, wie Robert beobachten konnte. Zumindest bei dem einen mit einem Beinstumpf hätte man aufgrund seines Äußeren, seines aggressiv wirkenden Gesichts auf die Idee kommen können, dass er einem Unbarmherzigen oder Unaufmerksamen an die Gurgel springen oder ihn wenigstens beschimpfen könnte. Aber nichts dergleichen.
Obwohl ihm auch die Gruppe von Farbigen, die links neben ihm ihre Waren herstellten oder anboten, irgendwie bedrohlich vorkamen. Merkwürdig, war er auf einmal fremdenfeindlich oder rasssistisch geworden, ging es ihm durch den Sinn.
Oder geht es einem so, wenn man selber sich nicht wohl fühlt in seiner Haut?
Und was war da rechts um die Ecke herum los, wo weitere Tische des Restaurants, in dem er sich befand, in der sich anschließenden Fußgängerzone standen? Eine resolute, rot gekleidete Schwarze von üppigen Körperformen schrie laut herum, fasste nun einen der Plastikstühle und warf ihn wütend auf den Boden. Der Kellner, der auch Robert bedient hatte, redete leise auf sie ein, versuchte sie zu beschwichtigen, aber auch zu etwas zu bewegen. Aufgrund der allgemeinen Lautstärke, die hier herrschte, konnte Robert aber nicht verstehen, um was es sich handelte. Dann sah er die Frau wutschnaubend abziehen. Einen Moment versuchte der Kellner, hinter ihr her noch etwas von ihr zu erreichen. Dann zuckte er mit den Schultern und fuhr in der Bedienung der anderen Gäste fort.
„Was war denn los mit der Frau?“ konnte er sich nicht enthalten, den Kellner zu fragen, als er die Rechnung bestellte. „Ach, die wollte nicht bezahlen“, erwiderte der lakonisch. Wollte nicht bezahlen? Merkwürdig! Normalerweise hätte er jetzt weitergefragt, wäre seine journalistische Neugierde geweckt worden. Aber war das nicht alles gleichgültig? Als er die Rechnung erhielt, wurde seine Lethargie noch mal für einen Moment aufgerüttelt. Der Preis war ja fast fünfzig Prozent höher, als er ausgerechnet hatte. Da waren doch die Kleinigkeiten, die es zu Beginn als Appetithäppchen gegeben hatte, alle separat berechnet worden, obwohl er sie nicht bestellt hatte! Aber dann sackte er wieder in sich zusammen. Diese Reise schien ja sowieso ein Fehlschlag zu sein. Einen Augenblick noch dachte er an die energische Schwarze in ihrem roten Kleid. Vielleicht wollte die ja nur nicht bezahlen, weil sie ebenso von einem überhöhten Betrag für ihr Essen überrascht worden war.
Die Scheine in seiner linken Hosentasche reichten aber nun nicht aus, um die Rechnung zu begleichen. Seit Jahren hatte er sich angewöhnt, bei Reisen in südliche Großstädte kein Portemonnaie mehr in die Hosentasche zu stecken, sondern lediglich lose Scheine und lose Münzen. Da er im Grunde etwas zu vertrauensselig war, war er immer mal wieder bestohlen worden. So hatte er schon ohne Personalausweis, ohne Führerschein, ohne Geld und ohne Kreditkarten dagestanden. Und diese Touristenbauchgürtel hatte er nie gemocht. „Ich bin doch kein Känguru!“ hatte er zu seiner Frau gesagt, als diese ihm eines Tages einen solchen gekauft hatte. Nun hatte er immer in der linken Hosentasche das Geld, von dem er annahm, dass er es brauchen würde, und in der rechten eine Reserve. In der rechten Tasche befand sich aber ebenso sein Schlüsselbund und sein Taschentuch, Gewohnheiten, von denen ihn so leicht nichts abbringen konnte. „In manchen Dingen bist du ja stur wie ein Esel“, hatten nicht nur seine Frau, sondern auch verschiedene Freunde schon zu ihm gemeint. Daran dachte er aber nicht, als er nun automatisch zuerst sein Taschentuch, dann das Schlüsselbund und schließlich die benötigten Scheine auf den Tisch legte. Als er den erforderlichen Betrag dem Kellner, der gewartet hatte, hinschob, wunderte er sich, dass der nicht das Geld an sich nahm. Er schaute ihm in sein ebenmäßiges iberisches Landgesicht und stellte fest, dass dessen Augen auf einen Gegenstand gerichtet blieben, der direkt vor Robert auf dem Tisch lag: sein Schlüsselbund offensichtlich. Wieso? Sein Blick ging zwischen dem Kellner und dem Tisch hin und her. „Gefällt Ihnen mein Schlüsselanhänger?“ fragte er harmlos. „Ja, ja, der gefällt mir“, antwortete der Kellner, wobei seine Miene eine gewisse Verwirrtheit aufwies, fast als sei er ins Schwitzen geraten.
***
Seine katholische Vergangenheit hatte Robert seit Jahren weit hinter sich gelassen. Trotzdem besuchte er auf Reisen und auch in Köln, wo er seit seiner Verheiratung wohnte, häufig Kirchen, so dass einige seiner Freunde meinten, er sei nicht wirklich antikirchlich oder sogar unreligiös, wie er von sich behauptete. „Ich besuche Kirchen nur aus historischem, kunsthistorischem oder folkloristischem Interesse“, meinte er dann, was von seinen Freunden meist mit Gelächter quittiert wurde, während er diese Bemerkung durchaus ernst gemeint hatte. So durchschritt er auch jetzt wie selbstverständlich das Portal der Dominikanerkirche, vorbei an den sitzenden und stehenden Bettlern. Das Innere überraschte ihn durch seine monumentale Größe und die geschwärzte Zerstörtheit seiner Architektur. Er hatte gelesen, dass diese Schwärzung durch einen Brand verursacht worden sei. Der einstige Reichtum war einer protzigen Armut gewichen, der sich die hier und dort verteilten Beter wie natürlich einfügten. Einerseits faszinierte ihn diese Welt, weil sie eine irrationale Abwechslung in eine durchkalkulierte Welt von heute brachte, die sich zumindest in ihrem äußeren Schein rational gebärdete, andererseits stieß sie ihn ab, weil sie nach äußerer und seelischer Ausbeutung roch, nach Autoritäten, die keinen Widerspruch duldeten, die auf Argumente und Fakten nur mit Nichtzurkenntnisnehmen, Bagatellisierung, Verdrehung oder sogar Hohn reagierten. Und davon hatte er wahrhaftig genug kennengelernt in der letzten Zeit. Wenn er daran dachte, stieg wieder dieses beklemmende Gefühl von seinem Magen in seine Brust hinauf.
Als er, von der diesigen Helligkeit geblendet, wieder ins Freie trat, einem der Bettler, der schon auf ihn gewartet zu haben schien, eine Münze in seine weiße Emailletasse gelegt hatte, wurde er am linken Ärmel gezupft und eine raue, unverkennbar spanische Frauenstimme herrschte ihn, fast unwirsch, an: „Esperame. Dejate leer la mano. – Warte, lass dir aus der Hand lesen!“ Eine ältere Frau mit harten Zügen im Gesicht hielt die linke Hand der rotgekleideten üppigen Schwarzen hin, die eben den Aufruhr im Restaurant veranstaltet hatte. Nun nahm die Spanierin –offensichtlich eine Zigeunerin in ihrem weiten roten Rock mit weißer Schürze und der großgeblümten Bluse – dankend einen Schein von der üppigen Schwarzen in Empfang, die sich dann sogleich zum Gehen wandte. „Du bist sehr allein. Das sehe ich gleich. Gib mir deine linke Hand!“ Die straff zurückgekämmten graumelierten schwarzen Haare, die hinten zu einem Dutt verbunden waren, der riesige goldene Ohrring, der in ihrem linken Ohr baumelte, und ihre knochige rechte Hand, die nun ohne zu zögern seine Linke erfasste, strahlten soviel selbstverständliche Autorität aus, dass er gar nicht auf die Idee kam, Widerspruch einzulegen. „Du bist sehr, sehr traurig. Und allein. Viele haben dich verlassen. Aber du bist noch jung. Vertraue der Jungfrau, vor allem der Jungfrau. Wenn du ihrer Spur folgst, wirst du bald dein Glück finden.“ Widerstandslos und in einem über sich selber den Kopf schüttelnd zog er den 5 €- Schein aus der Tasche, den sie von ihm verlangt hatte.
***
„Vertraue der Jungfrau!“ Der übliche Quatsch. Mit der Jungfrau war natürlich Maria gemeint, die Muttergottes. Was hatte er mit der zu tun! Was hatte er überhaupt mit solch irrationalem Unsinn zu tun. Während er nun treppauf, treppab durch die engen Gassen des Stadtteils Mouraria stieg, ziellos, planlos, schwitzend, versuchte er irgendwie seine Gedanken zu ordnen. Sie blieben widersprüchlich und wirr, auch als er jetzt auf einem kleinen geschlossenen Platz vor einer Hausfassade stehenblieb, die in eigenartigem Kontrast zu den nebenstehenden Häusern stand. Während diese zum großen Teil schnieke herausgeputzt in frisch getünchen Fassaden in Rosa, Gelb und Weiß prangten, stand hier vor ihm ein charaktervolles Haus, das einmal eine wunderschöne Fassade von blauen, gelb umrandeten Fliesen geziert hatte. Im unteren Teil bedeckte nun ein blasser graublauer Putz die Wand. Unfertig und hässlich wie mein Leben. Mit unmotivierten Löchern an Stellen, wo man es nicht erwartet. Die Balkone voller Rost. Wenn sich aus den blinden Fensterscheiben hervor jemand auf diese Gitter stützen wollte, würde er statt einer angenehmen Aussicht einen Sturz ins Bodenlose erleben. Wirr umherhängende Elektroleitungen suchen vergebens Kontakt, enden immer wieder abrupt. Und leere Türöffnungen, hinter denen wohl keiner mehr wohnt, und wenn, dann wohl nur im Elend, in feuchten und unwohnlichen Zimmern. Der turmartige Aufbau auf dem Blechdach eine Ansammlung von Wellblech, Rostblech, Brettern undefinierbarer Farbe, mit Fenstern, aus denen schon lange keiner mehr geschaut hat. Und der Putzfries über den letzten Resten vergangener Schönheit gibt zu, dass dahinter nur Dinge zum Vorschein kommen wollen, die man besser verbirgt.
„Da schauen Sie, junger Mann, nicht wahr! Aber da sehen Sie das wahre Lissabon. Vergammelnde Schönheit und daneben das unechte Aufgeputzte, für Schickimickileute oder für Touristen, die hier manchmal in Busladungen hergekarrt werden. Für die hängen hier auch schon die Girlanden, die eigentlich erst morgen aufgehängt werden dürften.“
Ein älterer Herr in peinlich sauberem Anzug stand neben Robert an einer Theke, die mit Krepppapier verkleidet war, in weißem Hemd und mit einer tadellosen Frisur, das graumelierte Haar auf der linken Seite gescheitelt. Während Robert Sandalen ohne Socken trug und ein ärmelloses T-Shirt lose über der hellen Leinenhose, war die einzige Erleichterung, die sich sein Gegenüber bei der herrschenden Schwüle gönnte, die Tatsache, dass er die Jacke seines grauen Anzugs lose über der Schulter hängen hatte. Das wurde aber schon gleich kompensiert durch die quergestreifte breite Krawatte, die korrekt aus dem Kragen des blütenweißen Hemdes heraushing.
Eigentlich passte das spontane Anreden eines ihm völlig Fremden nicht zu den strengen, leicht verbittert wirkenden Gesichtszügen. Aber Robert war das schon gewöhnt. Er selber musste irgendetwas an sich haben, das immer wieder Leute dazu brachte, sich ihm spontan zu nähern und ihm manchmal sogar unaufgefordert ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das war ihm in seiner Arbeit als Journalist oft behilflich gewesen, hatte auch oft die Bewunderung seiner Kollegen hervorgerufen, obwohl er sich selber die Ursache dieser Eigenschaft nicht recht erklären konnte. Einmal hatte ihm eine Kommunistin – ausgerechnet eine Kommunistin, wo die doch oft so ein festgelegtes ideologisches Denken an den Tag legen, das für menschliche Belange wenig Sinn zu erkennen gibt – anerkennend geäußert, er habe offensichtlich ein echtes Interesse an Menschen. Aber mit diesem Lissabonner, der da neben ihm an der provisorischen Theke stand, hatte er doch noch kein einziges Wort gesprochen. Wie konnte der also wissen ....? Vielleicht war es auch das Gläschen, das vor ihm auf der Theke stand, und das er jetzt dem Menschen mit dem wirren Haarschopf hinter der Theke zuschob, um es erneut füllen zu lassen. Der nahm eine Flasche von einem hinter ihm stehenden Brett und goss das Gläschen bis zum Rand voll, ohne dabei eine Miene zu verziehen.
„Kennen Sie Giginha? Die Muttermilch der Lissabonner, der Lissabonner Männer. Nein? Dann müssen Sie sie unbedingt probieren. Jose, bring noch ein Gläschen!“ Als der Haarige nun auch Roberts Gläschen aus einer dunklen Flasche vollgoss, sah er, dass sich in der Flasche eine dicke Schicht Kirschen befand, die auch auf dem Etikett abgebildet waren. Angenehm warm, nicht zu herb und nicht zu süß, lief es ihm die Kehle hinunter. „Erstaunlich, das tut sogar bei dieser Hitze gut“, meinte Robert zu seinem Nachbarn, in dessen Augen nun ein klein wenig Stolz das Sauertöpfische zu mildern schien.
„Ja, früher wussten die Einwohner dieser Stadt sich noch auf ihr Klima einzustellen. Heute meinen sie, sie könnten diese Schwüle nur mit aberwitzigen Mengen von eisgekühlten Getränken besiegen Aber heute muss ja überall mit Gewalt versucht werden, alles in den Griff zu kriegen. Klimaanlagen, Autos und Busse, die die sinnvollen, gemütlichen und praktischen Straßenbahnen verdrängen, und diese Hektik überall, von der Zerstörung der Stadt ganz zu schweigen. Sogar den Fado versuchen sie jetzt zu kommerzialisieren. Sehen Sie die Bühne da drüben!“
Er wies mit einer angeekelten Gebärde auf das Podium, das ihnen gegenüber aufgebaut war, und auf dem sich riesige Lautsprecher und Mikrofone mit den entsprechenden Kabelverbindungen befanden.
„Aber was wollen Sie mir da zeigen?“ fragte Robert ein wenig irritiert.
„Was ich Ihnen da zeigen will? Ja, sehen Sie denn nicht die riesigen Lautsprecheranlagen? Damit werden die Leute dann zugeballert. Da wird der Fado ermordet. Und der Fado ist die Seele dieser Stadt. Da darf man sich nicht wundern, wenn es mit ihr bergab geht.“
Robert hatte sich vor seiner Reise etwas in einem Reiseführer über Lissabon informiert. Und es war für ihn selbstverständlich, dass er sich irgendwo auch diesen charakteristischen Gesang dieser Stadt anhören würde. Deshalb wollte er nun wissen: „Ja, heißt das, es lohnt sich gar nicht mehr Fado anzuhören?“
„Lohnt sich. Lohnt sich. In Lissabon muss man sich Fado anhören.“
„Aber Sie sagten doch gerade, dass er total kommerzialisiert ist.“
„Ja, hier! Und an vielen anderen Stellen auch. Aber noch gibt es echten Fado. Gehen Sie einmal in den Dragao de Alfama. Da werden Sie Donha Mena Sobral hören. Das ist Fado aus Liebe ....“ Hier machte er eine Pause, während der sein Blick tief in sein eigenes Innere zu tauchen schien. „Das ist Fado, der mit Liebe vorgetragen wird“, verbesserte er sich nun.
Plötzlich zuckte sein rechter Hemdsärmel mit seiner knochigen Hand und ihrem dicken Goldring aus seinem übergeworfenen Jackett hervor und seine Augen wurden regelrecht hasserfüllt.
„Und die da, die gehört auch dazu!“
„Wozu?“
„Zu denen, die diese Stadt zugrunderichten“, zischte es aus seinem bitteren Mund. Neben dem Podium mit den Lautsprechern hatte sich eine Tür geöffnet und Robert sah ein rotes Kleid heraustreten. Das war doch, ja, die Schwarze, die angeblich nicht ihre Rechnung hatte bezahlen wollen. Und damit wollte sie die Stadt zugrunderichten?
Er fragte danach. Aber nun senkte sein Gegenüber die Stimme, sein Gegenüber, das ihn immer mehr an einen Küster und Chorleiter in seiner Jugendzeit erinnerte, der oft ähnlich verbittert erschien, weil er immer meinte, seine Leistungen als Chorleiter würden von der Öffentlichkeit nicht genügend anerkannt.
„Drogen!“ kam es fast flüsternd aus seinem Mund. „Die machen ebenfalls unsere Stadt kaputt. Die läuft hier nur herum, um ihre Klientel zu versorgen und neue Kunden zu finden.“
***
Irgendwann hatte Robert keine Lust mehr, sich dieses Gejammere weiter anzuhören. Da ihn eine merkwürdige Müdigkeit übermannte, entschloss er sich, sich nach einem kurzen Abendimbiss auf sein Zimmer zurückzuziehen, wo ihn allerdings eine stickige Luft empfing, die ihn seinen Rückzug gleich wieder bereuen ließ. Ohne das Fenster weit zu öffnen, war es hier nicht auszuhalten. Die imitierten Holzstufen auf der Treppe, die rohe Theke mit dem – nun schlafenden – Kopf des Zwergs in der Rezeption und die Düsternis seines Zimmers waren ihm wieder auf den Magen geschlagen.
„Die paar Autos und das gelegentliche Straßenbahngeräusch muss ich jetzt in Kauf nehmen. Das wird ja irgendwann in der Nacht aufhören“, hatte er noch gedacht, bevor er einschlief.
Sein Schlaf war nicht tief. Die Hitze des Tages hatte sich überhaupt nicht verzogen und stand unerträglich in dem kleinen Raum, drang durch das offenstehende Fenster wie geballt herein. Aber die Vorstellung, bei geschlossenem Fenster zu schlafen, war ihm unerträglich. Er glaubte dann ersticken zu müssen. Jedes Mal, wenn er aus leichtem Schlummer erwachte, waren ihm Kopfkissen und jede Falte im Betttuch im Wege. Er hatte schon Schlafanzug und Laken von sich geworfen. Trotzdem war seine Brust schweißnass. Schlief er doch einmal eine Weile, wachte er mit starkem Herzklopfen auf, das ihm noch mehr Sorge bereitete. Hatte er einen Herzfehler? Natürlich war sein Herz verletzt. Schließlich hatte sie ihn verlassen. Nur – hätte es nicht genauso umgekehrt kommen können? Nicht dass es pure Liebe gewesen wäre, die ihn jetzt vor Schmerz zu Boden warf, aber schließlich brach sein ganzes bisheriges Leben zusammen, das gemeinsame tägliche Miteinander, die gemeinsamen Urlaube, die gemeinsam eingerichtete Wohnung, die gemeinsamen Freunde, und vor allem – die gemeinsamen Kinder. Dann versank er langsam wieder in gemeinsamen glücklichen Urlauben.
Das Rollen eines nahenden Fahrzeugs auf dem groben Kopfsteinpflaster riss ihn wieder aus dem leichten Schlummer. So laut war das ja doch nicht. Das müsste er doch aushalten können. So wie er auch die Entlassung aus der Redaktion verkraften können müsste. Er kannte doch viele Kollegen, die schon öfter die Stelle wechseln mussten, zwischendurch arbeitslos gewesen waren. Ihn hatte dieses Schicksal aber bisher noch nie ereilt. Nun nahm das Rollgeräusch des Autos allerdings doch zu. Das konnte aber ja nicht endlos weitergehen. War das nicht der Höhepunkt? Musste nicht gleich der Abschwung kommen? War der Wagen nicht genau auf der Höhe seines Fensters? So wie sein Leben jetzt auch auf einem Tiefpunkt angelangt war. Da konnte es doch eigentlich nur noch aufwärts gehen. Aber – es war nicht zu fassen – das Geräusch wurde noch intensiver. Sein unregelmäßiger, heftiger Herzschlag meldete sich wieder. Musste er nicht ins Krankenhaus? War er nicht in Gefahr, einem Herzleiden zu erliegen? Und dann wurde das Geräusch so laut, dass er meinte, das Auto würde ihm stracks durch den Magen dringen. Herrgottnoch mal, ein Magengeschwür, das fehlte ihm jetzt noch! Das hatte er doch damals schon gehabt, als ihm zum ersten Mal verboten wurde, einen bestimmten Artikel zu bringen, für den er so gründliche Recherchen angestellt hatte, und der der Zeitung mit Sicherheit eine Auflagensteigerung bringen würde.
Vorbei! Endlich vorbei! Doch da meldete sich aufs Neue ein leichtes Fahrzeugrollen an. Nein, bitte nicht schon wieder! Aber war es nicht diesmal viel leiser? Nicht mehrere solcher Schicksalsschläge gleich hintereinander! Das konnte man doch nicht gesund überstehen, auch wenn man im großen Ganzen so gesund war wie er. Über seine Konstitution konnte er sich ja eigentlich nicht beklagen, wo sich seine sportlichen Aktivitäten doch durchaus in Grenzen hielten. Das bisschen Schwimmen und das gelegentliche Joggen. Eigentlich erstaunlich! Manchmal hatte er das Gefühl, dass seine geistige Regsamkeit sich auch positiv auf seine Konstitution und sogar seine Muskeln auswirkte. Rrrrums! Aber nun schon wieder eine Fahrt quer durch seinen Magen. Das konnte so nicht weitergehen!
Als er das nächste Mal schwitzend aus einem Alptraum aufwachte, hörte er Musik. Die musste von einem Platz in der Nähe der Pension aufsteigen. Ach ja, vielleicht von der Tribüne, die er gestern gesehen hatte. Ein manchmal in der Nacht verwehender melancholischer Gesang, der ihn leicht wieder einschlafen ließ, bis er aufs Neue brutal von einem Fahrzeug auf dem Pflaster aus dem Schlaf gerissen wurde, endlos diese Qual. Dann wieder einmal von ferne wie eine Heilsalbe dieser Gesang. Und waren da nicht Gitarren im Hintergrund? Und dann endlose Erschöpfung, eine Seele, die am Ende war.
3
„Das ist der heilige Mamede. Kennen Sie nicht den heiligen Mamede? Ach ja, Sie kommen aus Deutschland. Da sind Sie sicher Protestant. Die haben ja nichts mit Heiligen am Hut.“
„Nein, ich bin kein Protestant. Aber was ist das für ein Heiliger? Mamede. Habe ich noch nie gehört.“
Nun wurde der vorher so zurückhaltende Hotelmensch regelrecht eifrig. Robert hatte ihn für sich Hotelmensch getauft, weil er einerseits an der Rezeption seiner neuen Pension stand, so dass man ihn für einen Angestellten halten musste, andererseits aber so viel Distinguiertheit ausstrahlte, dass man ihn für einen Granden oder zumindest den Chef des Etablissements halten konnte, der neben diesem wohl noch etliche andere Geschäfte betrieb. In seinem schwarzen Nadelstreifenanzug mit schwarzer Weste und seinem glattrasierten Gesicht, das nach Rasierwasser zu riechen schien, wirkte er auf jeden Fall wie ein Manager, der gerade von der letzten Vorstandssitzung zurückgekehrt war. Als habe er eigentlich kaum Zeit, sich um die lächerlichen Bedürfnisse seiner Gäste zu kümmern, den Schlüssel fürs Zimmer, die Antwort auf die Frage, wo sich die nächste Bushaltestelle befinde oder ähnliche Lappalien.
Robert hatte nach der Bedeutung des Fensters im Treppenhaus gefragt, wo man einen Knaben in einer Berglandschaft sah, mit einer Palme in der einen Hand, zwischen einem Löwen und einem Stier.
„Der heilige Mamede ist ein sehr alter Heiliger, allerdings sehr jung gestorben, im 3. Jahrhundert, in Kappadokien“, erklärte der portugiesische Grande, der Joao hieß, wie Robert später von der drallen Landschönheit erfuhr.
„Kappadokien, ist das nicht die heutige Türkei?“
„Leider, ja, das ist heute die Türkei, und das damalige Cäsarea, wo Mamede lebte, nennt sich heute Kaiseri. Leider.“
„Leider? Wieso leider?“
Nun lief sogar eine leichte Röte über das Gesicht Joaos. „Leider, weil das alles urchristliches Land ist. Wo die Christen heute unterdrückt werden.“
„Unterdrückt? Das ist mir neu“, konnte sich Robert nun doch nicht enthalten zu bemerken. „Dann informieren Sie sich einmal im Internet unter der Adresse „Kirche in Not“!“
Robert zog es nun vor zu schweigen. Eine Fortsetzung des Gesprächs in dieser Richtung würde sicher nicht sehr ersprießlich enden. Aber den Grund der Heiligsprechung von Mamede wollte er dann doch noch erfahren.
„Er war Hirte und baute sich in der Einöde einen Altar, wo er den wilden Tieren die Frohe Botschaft verkündete.“
„Ach, eine Art Franziskus von Assisi“, warf Robert ein.
„Könnte man sagen. Ja.“ Joao freute sich offensichtlich, dass dieser Fremde sich nun in seine Gedankengänge einfädelte, ohne weitere kritische Fragen zu stellen.
„Und er unterstützte auch die Armen. Er verschenkte den Käse, den er herstellte, an die, die Hunger litten. Und als er zum Abschwören von seinem Glauben gezwungen werden sollte, wurde er zum Märtyrer für seine Überzeugung, wie der Palmenzweig in seiner Hand andeutet. In einem Ofen wurde er zu Tode geröstet. Wenn die Menschen heute noch so für ihren Glauben einstehen würden!“
„Die ganzen Selbstmordattentäter tun das ja, oder?“ konnte sich Robert wieder nicht enthalten. Immer wenn ihm offener oder geheimer Fanatismus begegnete, musste er mit solchen Bemerkungen reagieren.
Joao hatte schon den Mund zu einer heftigen Entgegnung geöffnet, als seine Kollegin, die ihn bald ablösen würde und sich schon in den Papieren der Rezeption zu schaffen machte, unterbrach: „Hör mal, Joao, sind die neuen Gäste aus Frankreich schon eingetroffen?“
„ Nein, aber eigentlich müssten sie schon dasein, Ana. Für neun hatten sie sich angemeldet.“
„Naja, es ist ja gerade erst halb zehn. Was wollen Sie denn heute unternehmen?“ wandte sie sich an Robert. Wollte sie das Gespräch mit Joao mit Absicht unterbrechen, weil es ihr zu kritisch wurde, oder war es wirkliches Interesse an Roberts touristischem Programm? Eigentlich etwas ungewöhnlich für eine Angestellte in der Rezeption einer Pension.
„Erste Eindrücke in der Stadt sammeln. Ich bin noch etwas unentschieden, wo“, entgegnete Robert und wärmte sich in dem Glanz ihrer dunklen freundlichen Augen.
„Dann müssen Sie unbedingt zum Cristo Rei nach Almada fahren. Von dort haben Sie die beste Aussicht auf die Stadt. Und diese gewaltige Statue! Überwältigend!“
drängte sich Joao wieder dazwischen.
„Ja, so überwältigend wie die Diktatur von Salazar.“ Der Spott in Anas Augen trieb Joao wieder die Röte ins Gesicht. Er schwieg aber dieses Mal.
„Naja“, beschwichtigte Ana daraufhin, „der Blick von dort drüben ist wirklich sehr schön. Aber für einen ersten Eindruck würde ich an Ihrer Stelle eher mit der Straßenbahn auf die Burg fahren, aufs Castelo Sao Jorge. Und wenn Sie dort sind, versäumen Sie zwei Sachen nicht, die Camera Obscura im Turm und im Innenhof der Burg den Gitarrenspieler, den