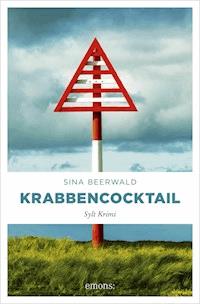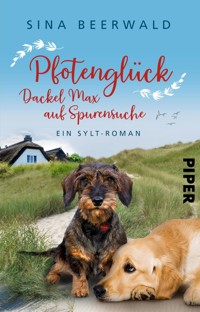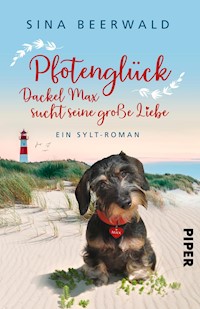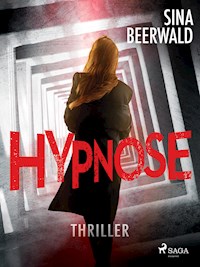4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geheimnisse, Intrigen und ein mörderisches Parfüm: ein spannender historischer Kriminal-Roman aus der Welt der Düfte Panisch flieht Amélie 1776 mit ihrer Tochter Linnea aus Paris. Mit ihrem Wissen um die Kunst der Parfüm-Herstellung, das sie sich heimlich von ihrem Mann abgeschaut hat, will sie sich auf dem Mont-Saint-Michel eine neue Existenz aufbauen. Doch obwohl Amélie selbst auf der felsigen Insel vor der Küste der Normandie geboren wurde, wird sie auf dem Mont-Saint-Michel alles andere als herzlich empfangen. Linnea kann die abgeschiedene Gemeinde vom ersten Tag an nicht ausstehen und möchte nichts lieber als zurück nach Paris. Auch die Kirche ist wenig begeistert, als Amélie ihre Duft-Werkstatt eröffnet. Bald ereignen sich auf dem Mont-Saint-Michel seltsame Todesfälle. Als Amélie eines Tages vor der Tür ihrer Werkstatt eine bestimmte Essenz findet, weiß sie, dass es nicht mehr nur um ihre Existenz als Parfüm-Herstellerin geht, sondern um Leben und Tod … Entdecken Sie auch die anderen hervorragend recherchierten historischen Romane von Sina Beerwald bei Knaur: »Das Mädchen und der Leibarzt« »Die Herrin der Zeit« »Die Goldschmiedin«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sina Beerwald
Das blutrote Parfüm
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Panisch flieht Amélie 1776 mit ihrer Tochter Linnea aus Paris. Mit ihrem Wissen um die Kunst der Parfümherstellung, das sie sich heimlich von ihrem Mann abgeschaut hat, will sie sich auf dem Mont-Saint-Michel eine neue Existenz aufbauen. Doch obwohl Amélie selbst auf der felsigen Insel vor der Küste der Normandie geboren wurde, wird sie auf dem Mont-Saint-Michel alles andere als herzlich empfangen. Linnea kann die abgeschiedene Gemeinde vom ersten Tag an nicht ausstehen und möchte nichts lieber als zurück nach Paris. Auch die Kirche ist wenig begeistert, als Amélie ihre Duftwerkstatt eröffnet.
Bald ereignen sich auf dem Mont-Saint-Michel seltsame Todesfälle. Als Amélie eines Tages vor der Tür ihrer Werkstatt eine bestimmte Essenz findet, weiß sie, dass es nicht mehr nur um ihre Existenz als Parfümherstellerin geht, sondern um Leben und Tod …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Epilog
Glossar
Danksagung
Le Mont-Saint-Michel
Prolog
Nach Mitternacht erfüllte ein betörender, süß-holziger Duft die Räume des herrschaftlichen Hauses in der Pariser Rue Dauphine. Warm und weich schmiegte sich der Geruch in ihre Nase. Eine neue und besonders verwegene Parfümkreation, weil diese verbotene Lüste wecken konnte …
Im Schein der Öllampe kniete sich Amélie in der Parfümwerkstatt nieder. Sie achtete darauf, mit dem Stoff ihres weißen Musselinkleides den leicht gekrümmt vor sich am Boden liegenden Männerkörper nicht zu berühren. Mit einer letzten zärtlichen Geste schloss sie ihrem toten Ehemann die Augen, strich ihm vorsichtig die dunkelrot verfärbten, klebrigen Haare von der aufgeplatzten linken Schläfe, dort, wo der Tod seine Krallen hineingehauen hatte. Hassliebe wallte in ihr auf.
Neben dem Kopf der Leiche hob Amélie die Reste des zerbrochenen Flakons auf, vorsichtig, um sich nicht an den scharfen Glaskanten zu schneiden. Blassgelbes zähflüssiges Öl tropfte aus dem schön geschliffenen Fläschchen und vermischte sich mit dem Blut an ihren Fingern.
Fassungslos starrte sie die rötliche Spur des Todes an. Warum hatte es so weit kommen müssen? War das wirklich alles geschehen? Panik durchflutete sie. Wie einen Fremdkörper streckte sie ihre Hand weit von sich und ließ das Flakon fallen. Sie sprang auf und suchte nach einer Möglichkeit, sich die Zeichen der Schuld abzuwischen.
Amélie hastete in der Parfümwerkstatt umher, dem Raum, von dem ihr Mann stets angenommen hatte, er sei ihr fremd. Doch sie kannte nahezu jede der über einhundert Essenzen in den Fläschchen: Orange, Sandelholz und Rose waren ihr längst vertraut, ebenso wie die schwierig zu bezähmenden animalischen Gerüche von Zibet, Moschus und Ambra. Schließlich war ihr Ehemann häufig und lange genug bei der Kundschaft und anderswo unterwegs … gewesen, fügte sie in Gedanken hinzu und glaubte, an dem ungesagten Wort zu ersticken.
Zitternd wanderten ihre Hände im Halbdunkel auf dem massiven Holztisch zwischen Flakons, Pipetten und Döschen hin und her, und endlich fand sie das klein zusammengefaltete Baumwolltuch zwischen den Bechergläsern, in das ihr Mann immer hineingeatmet hatte, um die vom Riechen angestrengte Nase zu beruhigen und wieder für neue Gerüche aufnahmefähig zu machen. Sie tränkte den Stoff mit reichlich Parfümalkohol und schrubbte ihre blutverschmierten Finger, bis das Brennen auf ihrer Haut in einem stechenden Schmerz gipfelte. Hektisch knüllte sie das mögliche Beweisstück zusammen, stopfte es in ihren Ausschnitt und griff nach der Öllampe.
Amélies Atem ging flach und stoßweise, und wie unter Zwang warf sie einen letzten Blick auf den Toten. Ihr stämmiger Ehemann lag halb auf dem Rücken, als sei er vor etwas zurückgewichen und dabei unglücklich gestolpert. Seine Beine waren leicht angewinkelt, der Kopf unnatürlich zur Seite gedreht. Dieses Bild verfolgte sie, als sie aus der Werkstatt lief.
Draußen, mitten im langen Flur blieb sie abrupt stehen und horchte in die vom flackernden Lichtschein erhellte Dunkelheit. Ihre Tochter, wo war sie hingerannt?
Amélie eilte ein paar Türen weiter zu ihrem Zimmer. Da die Bediensteten alle im Seitenflügel des Anwesens schliefen, musste sie nicht befürchten, durch ein unbedachtes Geräusch jemandes Aufmerksamkeit zu erwecken.
In dem großen, mit kostbaren Schnitzmöbeln ausgestatteten Mädchenzimmer spürte Amélie die Anwesenheit ihrer fünfzehnjährigen Tochter. Nach kurzer Überlegung riss sie die vergoldete Kleiderschranktür auf, und tatsächlich, Linnea kauerte in dem seit Kindertagen nicht mehr benutzten Versteck zwischen den bestickten Seidenkleidern, hielt die Knie mit den Armen umschlungen und sah ihr mit angstvoll geweiteten, tränennassen Augen entgegen.
»Es ist nichts passiert!«, herrschte Amélie ihre Tochter im Ausbruch der Verzweiflung an, fegte die bunten Stoffe achtlos beiseite, packte Linnea an der Schulter und schüttelte sie, was ihr zugleich leidtat. »Hast du verstanden?«, rief sie und leuchtete ihr mit der Lampe ins Gesicht.
»Mon père«, schluchzte Linnea, jegliche Farbe war von ihren sommersprossigen Wangen gewichen. »Papa!«
»Vergiss die Bilder in deinem Kopf! Es ist nichts passiert, Linnea, hörst du, nichts ist passiert! Komm heraus und such deine Sachen zusammen! Wir machen eine kleine Reise.«
Immer noch hemmungslos weinend, kletterte Linnea aus dem Schrank und blieb mit abgewandtem Kopf und leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper vor ihrer Mutter stehen.
»Sieh mich an!« Fordernd griff Amélie nach dem Kinn ihrer Tochter und erschrak selbst über die Härte ihrer Geste. Sie streichelte Linnea in wortloser Entschuldigung über die Wange und strich ein paar in Unordnung geratene rote Haare am Hinterkopf des Frisurenkunstwerks glatt, mit dem die Tochter ihren Vater an seinem heutigen, sechzigsten Geburtstag hatte beeindrucken wollen. Doch Alphonse du Maurier hatte es vorgezogen, der eigens für ihn arrangierten Feier mit über zweihundert geladenen Gästen von Beginn an fernzubleiben, und sein Erscheinen nach Mitternacht hatte er damit gerechtfertigt, dass er bei der Präsentation seiner neuen Parfümkreationen von der Kundin in deren Hause aufgehalten worden sei.
Eine Ausrede, dachte Amélie. Längst gab sich Alphonse keine große Mühe mehr, etwas nach außen hin vor ihr zu verbergen. Ein Jahr lang hatte sie ihren Ehemann beschworen, der Familie zuliebe die Sache zu beenden. Zum Jahreswechsel hatte er es ihr versprochen, und vier Monate später immer noch nicht Wort gehalten.
Linnea hielt dem Blickkontakt nicht mehr stand, sie drehte sich von ihrer Mutter weg, und ihre angespannte Körperhaltung zeugte davon, dass sie am liebsten weggerannt wäre. Amélie überging ihre Abwehr, umarmte Linnea und drückte ihren Kopf sanft an ihre Brust, wo ihr Herz wild hämmerte.
Doch Linnea entzog sich ihr. »Der Geruch, Maman, ich halte den Geruch nicht aus!«
Erschrocken presste Amélie die Faust auf ihren Ausschnitt, aus dem der Duft des blutroten Parfüms strömte.
»Maman?« Linnea entzog sich ihr. »Es war ein Unfall, es war doch ein Unfall, nicht wahr, Maman?«
»Natürlich, meine Kleine, natürlich. Es war sicher keine Absicht – und jetzt kein Wort mehr davon. Schwör mir das!«
»Ich schwöre«, wiederholte Linnea in hilfloser Verzweiflung. »Aber Maman, wir können ihn doch nicht einfach da liegen …«
»Kein Wort mehr!«, fuhr Amélie ihrer Tochter erneut über den Mund. Linnea tat die augenscheinliche mütterliche Härte sichtlich weh, doch Amélie fühlte sich nicht mehr als Herrin ihrer selbst, vielmehr war sie eine Gefangene des Geschehens. Was sollte sie jetzt tun? Ihre Gedanken kreisten wie von Windmühlenflügeln getrieben, und sie glaubte, jeden Moment den Verstand zu verlieren.
»Linnea, hör zu, du tust jetzt genau, was ich sage. Du packst sofort deine wichtigsten Habseligkeiten. Kleidung, Wäsche, ein paar Bücher! Aber wirklich nur das Notwendigste! Alles muss in eine Reisetruhe passen. Wenn dich jemand von den Bediensteten fragt, sagst du, wir werden zur Erholung wegfahren, während dein Vater auf eine längere Geschäftsreise nach England gehen musste. Ich kümmere mich um alles …«, auch wenn mein Plan alles andere als durchdacht ist, setzte sie im Stillen hinzu.
1
Das blutrote Parfüm
»Ein ewiger Duft, dessen Rezept ich dir vorgeben werde, Essenz für Essenz.«
Zwei kräftige, hintereinander angeschirrte Rösser zogen mit gesenkten Köpfen den offenen Karren über das Watt. Unablässig schnaubten sie den Sand aus den Nüstern, die Muskeln spannten sich unter dem schwarzen, perlnass glänzenden Fell. Tiefe Räderspuren gruben sich in den goldgelben Sand, auf einer unberührten und einsamen Ebene von mörderischer Schönheit.
Halb sitzend, halb liegend kauerte Amélie auf einem schmalen Brett auf der rechten Vorderseite des Karrens, der für Erntefuhren, nicht aber für Personenreisen gebaut war. Mit dem Zipfel einer steif gewordenen Leinendecke, die das geladene Gut notdürftig bedeckte, schützte sich Amélie vor dem angriffslustigen Aprilwind. Eingepfercht zwischen waghalsig gestapelten, eilig festgezurrten Kisten saß ihre Tochter zähneklappernd auf der gegenüberliegenden Seite und sorgte sich, dass sie die kostbare Ladung – das Einzige, was sie noch besaßen – nicht verloren.
Auf dem Festland, im Ort Genêts an der normannischen Küste, von wo aus Amélie zum ersten Mal wieder ihre Heimat draußen im Meer schemenhaft erblickt hatte, sangen bereits die Frühlingsboten ihr Lied, die Magnolienbäume öffneten ihre zartrosa-weißen Knospen und verströmten einen seelenvollen, süßen Duft. Auf dieser schutzlosen Weite aber waren die Böen noch schneidend kalt.
»Maman«, rief Linnea, »wann sind wir endlich da? Und wohin fahren wir überhaupt? Warum sagst du mir das nicht endlich?« Ihre Stimme verriet die Zerrissenheit zwischen Misstrauen und blindem Vertrauen ihrer Mutter gegenüber.
Amélie entschloss sich, ihre Tochter nicht länger im Ungewissen zu lassen. »Wir sind ganz weit im Norden des Landes, Linnea. Und wir erreichen bald unser Ziel, eine Insel vor der Normandieküste.«
»Wir fahren auf den Mont-Saint-Michel?«, schlussfolgerte Linnea sofort mit ungläubiger Stimme, obwohl sie den Namen der Heimat ihrer Mutter einzig von knappen Erwähnungen her kannte. »Werden wir dort wohnen? Wer lebt da noch? Gibt es dort wilde Tiere? Erzähl mir davon!«
Amélie richtete ihren Blick in die Ferne. Die Sonne schien vom wolkenlosen Himmel, das Meer hatte sich bis zum Horizont zurückgezogen, und doch spürte sie den herannahenden gluckernden Wellensaum. Sie roch das Salz in der Luft, trocken und stechend klebte es in ihren Nasenflügeln. Die Gefahr des auflaufenden Wassers lauerte in ihrem Rücken – man sagte, die Flut nähere sich mit der Geschwindigkeit eines galoppierenden Pferdes.
»Da gibt es auch nicht viel zu erzählen!«, erwiderte Amélie. »Es ist eine kleine vorgelagerte Insel, wie du weißt, und ich war seit rund zwanzig Jahren nicht mehr dort. Das ist alles.« Ihr stand jetzt nicht der Sinn nach vielen Worten, zu übermächtig war ihre nervöse Anspannung.
Die ungewöhnlich groß gebauten Kutschenräder drehten sich knirschend und unablässig im Sand mahlend wie Mühlsteine. Stillstand an der falschen Stelle bedeutete den Tod, das Versinken in einer Falle auf sicher geglaubtem Boden. Der Treibsand verschlang alles, was sein gieriges Maul fassen konnte, zog die Beine eines Menschen an den Knöcheln in die Tiefe, und je mehr sich derjenige wehrte, desto schneller sank sein Körper ein, bis nur noch Schultern und Kopf herausschauten. Gänzlich verschlungen wurde ein Mensch nur in sagenumwobenen Legenden; tatsächlich war es die aufkommende Flut, die die hilflosen Schreie der Todgeweihten erstickte und binnen eines Augenblicks das qualvoll begonnene Werk ihres Komplizen vollendete.
Der schwarz gekleidete Kutscher trieb die Pferde an. Gebeugt saß er unmittelbar vor ihnen auf dem behelfsmäßig wirkenden Kutschbock, die angewinkelten Füße auf der Deichsel abgestützt. Aus dem Handgelenk ließ er die Peitsche knallen und die Schnur dicht über den Rücken der Tiere hinwegsausen. Er hatte nach der Preisverhandlung in Genêts nicht einmal seinen Namen genannt, nur mit einem Nicken seine Zustimmung kundgetan und danach ohne ein Wort die schweren Kisten auf den Karren gehoben. Seiner sehnigen Gestalt war die in ihr steckende Kraft nicht anzusehen, und es fiel Amélie schwer, sein Alter zu bestimmen, er konnte erst knapp dreißig, aber auch schon über vierzig sein. Sein Äußeres jedenfalls, seine geflickte, nachlässige Kleidung, die zerzausten, schulterlangen schwarzen Locken, sein struppiger, bis auf die Brust reichender, salzverkrusteter Vollbart machten ihn zu einem von jenen Menschen, denen Amélie in Paris aus dem Weg zu gehen gelernt hatte.
»Wie ist Ihr Name?«, fragte Amélie im spontanen Bemühen, sich den Fremden ein wenig vertraut zu machen.
Der Kutscher drehte sich halb um, und im Ausdruck seiner wasserblauen Augen lag spöttische Belustigung. »Brauchen Sie unbedingt einen Namen für mich? Dann nennen Sie mich Montagnard.«
Bergbewohner? Amélie lag eine Nachfrage auf der Zunge, doch er hatte sich bereits wieder nach vorne gewandt, um jegliche Fortsetzung des Gesprächs im Keim zu ersticken. Ausgesprochen redselig, dieser Montagnard, dachte sie. Leider war er jedoch der einzige Kutscher auf dem Festland gewesen, der spät an diesem Vormittag noch auf Kundschaft gewartet hatte.
Die widrigen Wegbedingungen fochten den Kutscher nicht an, mit stoischem Gesichtsausdruck, die kräftigen Augenbrauen zusammengezogen, behielt er sein Ziel im Blick.
Die schemenhaften Umrisse des Mont-Saint-Michel traten allmählich klarer aus dem Dunst hervor, so als zöge jemand ein hauchdünnes Tuch über dem verwaschenen, graublauen Steinhaufen fort. Der mit jeder Minute deutlicher ins Goldbraune changierende Felsen erhob sich aus dem Wasser wie zum Gebet gefaltete, gichtgekrümmte Hände und schwoll zu majestätischer Größe an.
Unzählige kleine Steinhäuser knieten dicht gedrängt in starrer Anbetung vor der über ihnen thronenden Kirche. Die Fialen am Strebewerk der Kathedrale ragten wie Stacheln in den Himmel, umsäumt von einer unüberschaubaren Fülle an Verzierungen, Säulen, Bögen, Türmchen und Wasserspeiern. Ein unwirklicher und verwunschener Ort. So als habe Gott dieses unliebsame Gewächs einst mit spitzen Fingern am Kirchturm gepackt, samt den umliegenden Häusern mit dem Wurzelballen aus der Erde gerissen, in diesem Niemandsland hier fallen gelassen und dem Vergessen anheimgestellt.
Mit ehrfurchtsvollem Erstaunen und wachsender Neugierde betrachtete Amélie ihre Heimat, Erinnerungen flochten sich in ihre Gedanken, sie saugte die Fülle an Eindrücken in sich auf und konnte sich kaum sattsehen.
Wie viel hatte sich wohl verändert? Tief in ihrem Herzen kannte Amélie die Antwort: nichts. Auf dem Mont war die Lebensweise der Bewohner festgeschrieben wie die von Moses in Stein gemeißelten Gebote. Alles würde noch so sein wie damals. Ein beruhigender und zugleich auch ein wenig erschreckender Gedanke. Wie mochte das näher rückende Ende der Reise wohl auf Linnea wirken? Amélie warf einen Seitenblick auf ihre Tochter und schloss aus deren fahrigen Beinbewegungen auf eine zunehmende Unruhe des Mädchens.
»Wie geht es dir?«, schrie Amélie, um das Rädergeräusch zu übertönen.
»Gut, aber ich kann … ich kann die Kiste … sie rutscht!«, hörte Amélie gerade noch, dann folgte der schmatzende Aufprall auf dem Sandboden.
»Kutscher, anhalten!«, rief Linnea voller Entsetzen und machte sich zum Absprung bereit.
»Kind, um Gottes willen, nicht! Nicht springen!« Amélie rappelte sich auf.
Gerade noch rechtzeitig drehte sich Montagnard auf dem Kutschbock um, packte Linnea am Arm und bugsierte sie mit einer energischen Bewegung zurück. »Hier ist dein Platz, junges Fräulein!«
»Aber ich will …«
»Du willst dich umbringen, ja?«, schnitt der Kutscher ihr das Wort ab.
»Wir müssen die Sachen retten!«, rief Linnea.
Amélie versuchte ihre Tochter zu beruhigen und schaute dabei der Kiste nach. Da erkannte sie den roten Strich, mit dem sie den Deckel markiert hatte. Ihr wurde heiß und kalt. »Meine Tochter hat recht!«, redete sie auf den Kutscher ein. Amélie gelang es aufzustehen, schwankend suchte sie auf der engen Trittstelle das Gleichgewicht.
Die Peitsche knallte dicht neben ihr. »Solange ich auf dem Kutschbock sitze, verlässt niemand dieses Gefährt!«, brüllte Montagnard. »Kein verfluchtes Gepäckstück auf dieser Welt ist ein Menschenleben wert!«
Erschrocken über seinen Ausbruch setzte sich Amélie wieder hin, aber den Verlust konnte und wollte sie nicht hinnehmen. Die Augen gegen die Sonne abgeschirmt, schaute sie in Richtung der verlorenen Habe. Rund acht Pferdelängen weit lag diese nun schon entfernt, und der Abstand wurde immer größer. Sie rang mit sich, dachte daran, ihr eigenes Leben zu riskieren, um ihrer beider Zukunft zu retten.
Ruckartig stand sie wieder auf. Sie bahnte sich einen Weg an Montagnards Kutschbock vorbei und sprang.
Zuerst landete sie auf den Füßen, doch im Schwung fiel sie nach vorn, ihre Hände griffen in den nassen Sand, ihre Knie wurden feucht. Mühsam rappelte sie sich auf, zwei Schritte, noch zwei Schritte, dann sank sie bis über die Knöchel ein. Panik wallte in ihr auf, sie versuchte sie zu verdrängen und nicht zurückzuschauen. Weiter, weiter, dachte sie nur. Sie verlor einen Schuh, den anderen.
»Maman!«, schrie Linnea. »Komm zurück!«
Amélie drehte sich um. Die Kutsche hatte die Fahrt verlangsamt und schien doch bereits unerreichbar weit weg. Wohin jetzt? Die kalte Sandmasse umschloss schon ihre Waden, kroch weiter ihren Weg der drohenden Vernichtung.
»Nicht bewegen!« Montagnard warf ihr das Ende eines langen Seils zu, und es landete genau vor ihren Füßen, Wasser spritzte auf. »Halten Sie sich daran fest und dann langsam, langsam zu uns zurückgehen!«
Amélie hielt die Luft an, sie drehte sich noch ein letztes Mal nach der Kiste um, dann krallten sich ihre Finger um das Seil, sie redete sich ein, ihre Füße steckten nicht in einer tödlichen Falle, während sie sich zu retten versuchte, begleitet von den schluchzenden Schreien ihrer Tochter.
Ihr Herz raste, als sie endlich das große Kutschenrad zu fassen bekam. Mit zitternden Beinen und letzter Kraft kletterte sie in den sich weiter fortbewegenden Wagen, wobei ihr der Kutscher nun nicht mehr half. Mit verschlossener Miene rollte Montagnard das Seil auf, richtete den Blick nach vorn und nahm die Zügel wieder auf.
»Maman!«, rief Linnea erleichtert.
Mein Gott, dachte Amélie, wie schnell war das gegangen, wie leichtfertig hatte sie ihr Leben riskiert und ihre Tochter beinahe als Waisenkind zurückgelassen.
»Es ist alles gut, Linnea, alles gut. Wir sind bald da. Es ist nichts passiert …« Plötzlich beunruhigt, tastete sie in ihrer Rocktasche nach dem Münzbeutel und stellte erleichtert fest, dass er noch da war.
»Was war in der Kiste, Maman?«
»Nichts Wichtiges, mein Mädchen, nichts Wichtiges«, versuchte Amélie sie auf andere Gedanken zu bringen. Erschöpft nahm sie ihre unbequeme Position auf dem schmalen Brett wieder ein und atmete tief durch. Nichts Wichtiges, nur unersetzbar wertvolle Parfümessenzen, die Grundlage, auf der ich unser neues Leben aufbauen wollte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie schloss ihre Lider, damit niemand ihre Verzweiflung sehen konnte.
Die Zeit bis zur Ankunft verging ihr plötzlich viel zu schnell. Amélie öffnete die Augen, als der Kutscher das Ende der Fahrt ankündigte. Für ihr Gefühl waren kaum fünf Minuten vergangen, aber der Zwischenfall im Watt musste der zurückgelegten Strecke nach zu urteilen gut eine halbe Stunde her sein. Sie fuhren entlang der hohen Ringmauern des Berges, die sich im seichten Wasser spiegelten. Auf den beiden südlichen Wachtürmen seitlich des Haupttores schlugen die rot-gelben Fahnen sanft im böig auffrischenden Wind, es wirkte wie ein freudiges Zuwinken.
Amélie hörte die ersten Geräusche aus dem Dorf, Hufgeklapper, Kindergeschrei und Hundegebell hallten aus den engen Gassen, wo sich schindelgedeckte Steinhäuser aneinanderlehnten, krumm und gebeugt wie altersschwache Menschen. Amélie versuchte ihr Elternhaus weit oben auszumachen und war erleichtert, es noch stehen zu sehen. Doch aus dem verfallenen Kamin stieg kein Rauch auf. Das aufkommende flaue Gefühl im Magen verdrängte Amélie mit der einfachen Erklärung, dass das Feuer ausgegangen sein könnte und der Vater oder die Mutter gerade dabei waren, frisches Holz oder Kohlen nachzulegen.
Vor dem Haupttor sprang Amélie vom Karren und spürte festen Boden unter ihren Füßen. Eiskalt fühlte sich dieser an, und erst jetzt kamen ihr die im Watt verlorenen Schuhe wieder in den Sinn. In feuchten Strümpfen stand sie vor dem unscheinbaren Haupttor, dem ersten von insgesamt dreien, das den Zugang zu dieser abgeschiedenen Festung sicherte – wobei für sie immer die Frage war, ob sich die Bewohner vor Feinden schützen oder sich vielmehr vor der Welt verschließen wollten.
Verschämt schaute sie an sich hinunter. Das mantelartige, vorne offene Überkleid aus gerafftem, blauem Taftstoff war am Saum durchnässt, und der silberfarben glänzende Rock wies auf Kniehöhe dunkle, sandverkrustete Flecken auf. Sah so eine Dame von Welt aus? Wie peinlich, nach zwei Jahrzehnten in solch einem Zustand in ihrem Elternhaus anzukommen. Und wie saß überhaupt ihre Frisur? Lächerlich, sich jetzt mit solchen Sorgen zu befassen, aber es lenkte sie von ihren quälenden Ängsten ab, die mit jeder Minute des näher rückenden Wiedersehens mit den Eltern schlimmer wurden. Sie tastete über ihre hoch aufgesteckten Haare, unzählige Strähnchen hatten sich gelöst, wie sie mit Besorgnis feststellte.
»Du bist hübsch, Maman, sehr, sehr hübsch«, hörte sie die Stimme neben sich. Nach diesen Worten kehrte Amélie in die Wirklichkeit zurück. Aus Scham über ihre ertappte Eitelkeit fühlte sie Röte in die Wangen steigen.
»Und du bist die schönste und tapferste Tochter auf der ganzen Welt!« Sie half Linnea auszusteigen und schloss sie fest in die Arme. »Wir haben es geschafft, wir sind da.« Mit einem Kopfnicken deutete sie der durchs Tor fahrenden Kutsche hinterher.
»Komm, lass uns meine Heimat betreten.« Amélie nahm ihre Tochter an der Hand, doch Linnea entzog sich ihr wieder.
»Lass das, Maman. Ich bin alt genug.« Es widerstrebte ihrer Tochter sichtlich, dieses ihr fremde Dorf, diese Festung, zu betreten.
»Es wird bestimmt interessant, du wirst sehen. Ich war damals sechzehn, fast so alt wie du, als ich meine Heimat verlassen habe.«
»Um mit Papa wegzugehen?«
»Ja. Er war Parfümhändler, war aber als Pilger auf den Mont gekommen, und er hat mir den Kopf verdreht.«
»Papa war viel älter als du. Was haben deine Eltern dazu gesagt?«
Amélie atmete tief durch. »Wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen, das erzähle ich dir später! Mach dir keine Gedanken, meine Eltern werden mir im Lauf der Jahre meinen plötzlichen Weggang verziehen haben und mich mit Herzensfreude wieder in den Schoß der Familie aufnehmen. So sie noch leben …« Sie verstummte.
»Und wenn sie gestorben sind?«, wandte Linnea zaghaft ein.
»Das glaube ich nicht«, wiegte sie sich selbst und ihre Tochter in Sicherheit, obwohl ihr die Vernunft sagte, dass sie damit rechnen musste. »Außerdem habe ich noch Geschwister, und ich kenne viele Bewohner hier. Die Montois sind ein eigenes Volk, eine eingeschworene Gemeinschaft, aber ich bin eine von ihnen und bin mir sicher, sie werden uns mit offenen Armen empfangen.« Amélie schenkte ihrer Tochter ein aufmunterndes Lächeln und schob sie an den Schultern sanft vorwärts. Gemeinsam betraten sie den kleinen Vorhof hinter dem ersten Tor, der Porte de l'Avancée.
Zwei Offiziere der Bürgermiliz in dunklen Uniformen mit silbernen Knöpfen und weiß verzierten Hüten stellten sich ihnen mit Spießen bewaffnet entgegen.
»Was führen Sie in der Kutsche mit sich, und was ist Ihr Begehr?«, fragte der deutlich Ältere von beiden ohne Begrüßung, während er auf den Karren zeigte und sie von oben bis unten musterte. Sein geringschätziger Blick blieb bei ihren bestrumpften Füßen hängen.
Um Worte der Erklärung und Entschuldigung ringend, brachte Amélie nur einen halben Satz hervor, dann verstummte sie vor ihrem Respekt einflößenden Gegenüber: »Wir sind auf dem Weg zu …« In seinem schmalen Gesicht spannte sich eine dunkel verfärbte Narbe quer über die linke Hohlwange. Seine stechend blauen Augen suchten unerbittlich und schamlos in ihrem Gesicht nach irgendeiner Spur, die sich mit seiner offenkundigen Erinnerung verknüpfen ließ.
Schlagartig erkannte Amélie ihn wieder als den Wirt des Gasthauses La Coquille, das unterhalb ihres Elternhauses am Ende der großen Straße gelegen war, dort, wo die breite Treppe für die Pilger auf den Berg hinaufführte. La Coquille, die Muschel als Zeichen der Pilger … Raoul Pirou. Sofort sah sie die Bilder aus Kindertagen wieder vor sich. Schon damals war sie auf dem Heimweg vorzeitig abgebogen und hatte lieber den steilen Weg über die hohen, ausgetretenen Stufen und am Friedhof vorbei genommen, nur um eine Begegnung mit ihm zu vermeiden. Heute würde sie es wieder tun, das spürte sie. Seine Eltern waren Nachbarn von ihnen, aber in ihrem Haus hatte sich dieser unangenehme Mensch Gott sei Dank nur selten blicken lassen.
Um die offensichtliche Ungeduld des Wächters und Wirts Pirou zu besänftigen, gab sie schnell zur Antwort: »Mein gesamtes Hab und Gut befindet sich in den Kisten.«
»Auch Waren?«, fragte der zweite Wächter, ein jüngerer und weitaus sympathischer wirkender Mann. Er versuchte wie ein Schuljunge, ein strenges Gesicht zu machen, seine großen braunen Augen schauten dabei so freundlich und unschuldig drein, dass sich Amélie ein Lächeln verkneifen musste. Fünf, sechs Jahre jünger als sie schien er zu sein, die dreißig hatte er aber wohl schon erreicht, daher könnte sie ihn aus früheren Tagen kennen. Sie kramte in ihrem Gedächtnis, versuchte sich sein Aussehen als Kind vorzustellen, doch es kehrte keine Erinnerung wieder.
»Ja, auch Waren«, gab sie freiwillig zu, ehe den Männern einfallen konnte, ihr gesamtes Hab und Gut zu durchsuchen.
»Welcher Art?«, hakte Pirou sofort nach.
»Düfte.«
»Düfte?«, echoten die Männer gleichzeitig mit zur Schau gestelltem Erstaunen.
»Ja, drei Kisten mit Fläschchen. Mit Essenzen, aus denen sich Parfüms herstellen lassen«, präzisierte Amélie ihre Aussage.
»Eine davon haben wir auf dem Watt verloren«, korrigierte Linnea augenblicklich, und Amélie seufzte innerlich über die ausgeprägte Wahrheitsliebe ihrer Tochter. Aber vielleicht war es besser so.
»Wie ist Ihr Name?«, forschte der Wirt des Gasthauses weiter, der seiner Pflicht, sich wie alle gesunden Männer stundenweise der Bürgerwehr zur Verfügung stellen zu müssen, offenbar besonders Genüge tun wollte.
»Amélie Dupont«, stellte sie sich mit ihrem Mädchennamen vor.
Die beiden Männer warfen sich einen Blick zu, und Amélie vermutete dahinter endgültig herannahende Schwierigkeiten. Sie überlegte kurz, ob es doch von Vorteil gewesen wäre, sich mit ihrem angeheirateten Namen zu erkennen zu geben, als der Wortführer unvermittelt in haltloses Lachen ausbrach und der andere zögernd, aber pflichtschuldig darin einfiel.
»Bitte, Madame.« Mit einer linkischen Geste, der Verbeugung eines Spaßmachers auf dem Jahrmarkt würdig, trat Raoul Pirou beiseite und machte ihr den Weg frei.
Das Gelächter begleitete Mutter und Tochter über den Vorplatz und wurde noch lauter, als der Kutscher seine beiden Pferde vor dem zweiten Tor an der Seite, um die Durchfahrt nicht zu blockieren, zum Stehen brachte. Montagnard sprang vom Kutschbock, band sein Leitpferd an einer der Bombarden an, die noch von dem fehlgeschlagenen Angriff der Engländer vor über dreihundert Jahren stammten und nun mit warnendem Stolz seitlich des Eingangs präsentiert wurden. Der Kutscher klopfte den beiden Rappen den Hals und machte sich dann ohne weitere Umschweife daran, die Kisten abzuladen.
»Was erlauben Sie sich? Das können Sie doch nicht einfach tun!«, echauffierte sich Amélie und deutete durch das zweite Tor in die dahinterliegende Gasse, die zwar eng war, aber immer noch für eine Kutsche zugänglich gewesen wäre. Im Hintergrund sah man das steinern verzierte Königstor mit dem ein Stück weit heruntergelassenen Fallgitter.
»Mein Dienst ist hier zu Ende«, kommentierte Montagnard sein Tun.
»Sie müssen bis zum Ende der langen Straße weiterfahren und mir die Kisten über die Treppen zum Haus hinauftragen!«
»Mein Auftrag lautete, ein armes, junges Fräulein, eine lebensmüde Mutter sowie dieses Gepäck zum Mont zu bringen. Und nun sind wir da.«
Amélie blieb ob der Unverfrorenheit zunächst die Sprache weg. Fassungslos starrte sie den schwarzbärtigen Lumpenkerl an, und es blieb ihr kaum etwas anderes übrig, als mit ihm zu verhandeln, während er Kiste um Kiste vor ihr abstellte.
»In Ordnung«, rang sie sich schließlich durch. »Ich bezahle Ihnen mehr Geld.«
»Geld?«
»Ich werde Sie gut entlohnen. Ich biete Ihnen vierzig Sous.«
Montagnard schüttelte entrüstet den Kopf und hob das vorletzte Gepäckstück vom Wagen.
»Dann also sechzig.« So langsam begann die Summe zu schmerzen, nicht weil ihr das Geld fehlen würde, davon hatte sie in ihrem Beutel genug mitgenommen, sondern weil sie diesem impertinenten Menschen soeben rund drei Tagelöhne geboten hatte und er nicht darauf eingehen wollte.
»Ich habe meine Arbeit getan, wie es abgemacht war.«
»Einhundert Sous?« Als sich auch bei diesem Angebot kein Zeichen seiner Zustimmung regte, schob sie mit aufkeimender Wut hinterher: »Sie können das Geld doch gut gebrauchen!«
»Ach, so sehe ich wohl aus, ja? Ein Almosen für einen armen Bergbewohner? Erstens: Ich mache mir nichts aus Geld. Heute ist es da und morgen wieder weg. Und zweitens: Man kann im Leben nicht alles kaufen, merken Sie sich das.« Mit diesen Worten ließ er sie stehen und schlenderte durch das Tor.
»Warten Sie gefälligst!«, schrie Amélie, obwohl sie wusste, dass es vergeblich war. Er hielt es nicht einmal für nötig, sich nach ihr umzudrehen, sondern verschwand aus ihrem Blickfeld, offenkundig, um dort in eines der Gasthäuser zu gehen. Ein junges Mädchen ging mit mitleidigem Blick an ihnen vorüber, in blau-rotem Kleid und mit zwei Weinkrügen beladen. Insgesamt stapelten sich nun acht Kisten und vier große Säcke vor Amélie und ihrer Tochter.
»Linnea, bleib bitte einen Augenblick allein bei der Kutsche und achte auf unsere Sachen! Ich bin sofort zurück …« Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte Amélie durch das Königstor dem Kutscher hinterher.
Gasthaus an Gasthaus reihte sich auf beiden Seiten der Grande Rue, der großen Hauptstraße, wie die stolzen Einwohner die kutschenbreite Gasse zu nennen pflegten. Wie ehedem warben das Licorne und das Saint Michel um Kundschaft, die Messingschilder berührten sich fast über der Mitte der Gasse, wie lange Arme, die sich ausstreckten, um die Konkurrenz im Zaum zu halten.
Zornerfüllt stapfte Amélie in Strümpfen auf das nächstgelegene Gasthaus zu, die Hôtellerie Saint Michel, ein hübsch hergerichtetes, traditionsreiches Steinhäuschen mit weiß und blau blühenden Hyazinthen vor dem Doppelfenster. Ein süßer, schwerer, fast betäubend wirkender Duftschwall entströmte den sich wie reife Weintrauben um den Stiel drängenden Blüten, und Amélie spürte förmlich, wie der Duft sie umfing. Sie atmete tief durch, schmerzlich stieg die Erinnerung an die auf dem Meeresboden für immer verlorenen Essenzen in ihr auf, und zögerlich betrat sie den kleinen, aber freundlich eingerichteten Gastraum.
Sofort verstummten alle Gespräche. Irritiert blieb Amélie stehen. Hatte sie etwas falsch gemacht? Auf dem Mont war man Fremde, Heerscharen von Pilgern, doch seit alters her gewöhnt! Aber mit dem Anblick einer in Pariser Mode gekleideten Dame, noch dazu in Strümpfen, war man offensichtlich nicht vertraut. Die Gäste zeigten ungeniert mit den Fingern auf sie, wohl auch, weil sie die ausgeprägte Wölbung über ihrem Hintern fremdartig anmutete, doch für Amélie war es längst zur Gewohnheit geworden, die Formschönheit ihrer rückwärtigen weiblichen Rundung mit einem Cul de Paris, erzeugt durch ein kleines Kissen unter dem Kleid, zu betonen. Das Zischen und Tuscheln hinter vorgehaltener Hand mündete in ein lauter werdendes Gemurmel, und es gab kritische Blicke, besonders von den Frauen.
Soeben hatte Amélie sich noch namentlich vorstellen und ihre Herkunft benennen wollen, doch jetzt schnürten ihr die unverhohlen entgegengebrachten Ressentiments so sehr den Hals zu, dass sie fluchtartig den Raum verließ.
Draußen in der Gasse wuchs ihre Verstörung. Das stark geglaubte Gefühl der alten Verbundenheit mit ihrer Heimat erschien ihr mit einem Mal töricht, aber für heute gab es kein Zurück mehr, die Gezeiten des Meeres hielten sie auf der Insel gefangen.
In den nächsten drei Gasthäusern konnte Amélie Montagnard nicht entdecken, und die Wirte schüttelten auf ihre Nachfrage hin die Köpfe. Auch die Reaktion der Wirtshausbesucher auf ihre Person blieb auf erschreckende Weise dieselbe wie in der Hôtellerie Saint Michel, schwankend zwar manchmal zur Neugierde hin, aber immer in ablehnender Haltung verharrend.
Vor dem nächsten schmalen Steinhaus standen trotz der noch kühlen Frühjahrszeit kleine Tische draußen, doch auf keinem der Stühle saß Montagnard, nur ein paar Männer, ungefähr in ihrem Alter, die sich die Zeit mit Kartenspielen vertrieben – und damit, den vorübergehenden Frauen nachzuschauen.
Aus dem Wirtshausfenster roch es nach gebratenem Lamm mit Rosmarin, und Amélie hielt inne. Erfüllt von diesem Geruch musste sie daran denken, dass sie zuletzt am frühen Morgen einen Teller Milchsuppe mit Brot gegessen hatten … Jetzt war es später Nachmittag, aber noch viel dringender als Nahrung brauchte sie diesen gottverdammten Montagnard! Vor dem Tor durften ihre Sachen nicht liegen bleiben, und wenn dieser ungehobelte Bergmensch nicht sofort zur Stelle sein würde, konnte er etwas erleben!
Die drei Kartenspieler bemerkten ihr Näherkommen, das Spiel kam zum Erliegen. Stühle rückten, jedermann kämpfte um die beste Sicht auf ihre Person. Als sie zwei von den Männern wiedererkannte, klopfte ihr Herz vor Freude, doch sie ließ sich nichts anmerken: Es waren die beiden rothaarigen Zwillinge, damals nur die Brigands rouges genannt, die roten Räuber, und jetzt konnte sie auch den dritten, recht dicklich gewordenen Mann als ehemaligen Nachbarsjungen einordnen. Ob sie ihn heute noch mit Monsieur le Comte, mit Herr Graf, ansprachen? Das war in Kindertagen sein Spitzname gewesen. Sie dachte daran, sich zu erkennen zu geben, empfand jedoch das Versteckspiel als amüsant und wartete gespannt auf das Erkennen auf der anderen Seite.
»Verzeihung, die Herren, könnte mir wohl jemand von Ihnen bei meinem Gepäck behilflich sein? Es steht noch unten am Boulevardtor …«
»Aber natürlich!«
»Selbstverständlich!«
»Gewiss doch!«
Wie auf Kommando erhoben sich die drei, sodass die Stühle rumpelten. Irritiert über doch so viel unerwartete Hilfsbereitschaft machte Amélie einen Schritt rückwärts.
»Achtung!«, hörte sie dabei hinter ihrem Rücken eine Männerstimme rufen, als sie auch schon von einem heftigen Schlag an ihrer Schulter getroffen wurde, das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. Die Hände ihrer alten Freunde griffen nach ihr, erschrocken rappelte sie sich mit deren Unterstützung aus dem Straßenschmutz auf.
Den versehentlichen Angriff hatte ein Müllersbursche mit zwei geschulterten Mehlsäcken verursacht. Selbst noch schwankend von der Wucht des Aufpralls, warf ihr der junge Mann einen entrüsteten Blick zu, murmelte dann aber eine Entschuldigung und ging schlurfenden Schrittes weiter, um die Ware vom Festland in einem der nächsten Gasthäuser abzuladen.
Amélie sah auf ihr verschmutztes Kleid, das mittlerweile einer Zigeunertracht gleichkam, sie beschloss jedoch, kein weiteres Aufheben um die Sache zu machen, und drehte sich frohgemut wieder zu den Kartenspielern um.
»Nichts passiert«, erklärte sie den besorgt dreinschauenden Männern, die dicht hinter ihr stehen geblieben waren.
»Gott sei Dank. In welche Hôtellerie soll Ihr Gepäck denn gebracht werden?«, fragte Monsieur le Comte sogleich nach.
»In kein Gasthaus.« Lächelnd fügte Amélie hinzu: »Zum Haus meiner Eltern! Ich bin eine gebürtige Montoise, habe den Berg aber vor rund zwanzig Jahren verlassen. Erinnert ihr euch nicht an mich?« Kokett lächelnd wartete sie auf eine Reaktion und gedachte währenddessen der gemeinsamen, abenteuerlichen Streifzüge über den Mont, auf der Suche nach Höhlen, Geheimverstecken und verborgenen Schätzen. In der Gruppe hatte sie damals als einziges Mädchen Anerkennung gefunden, und darauf war sie mächtig stolz gewesen.
Doch jetzt machte ratloses Kopfschütteln die Runde. Belustigt über das schlechte Erinnerungsvermögen der Herren gab sie selbst die Antwort: »Mein Name ist Amélie, Amélie Dupont!«
»Amélie Dupont? Oh, das tut mir jetzt leid, aber ich habe doch keine Zeit zum Helfen«, entgegnete einer der Zwillinge wie verwandelt und wandte sich ab.
»Ich auch nicht«, schloss sich der Zweite an und folgte seinem Bruder eilig an den Tisch zurück.
»Zum Haus des spinnenden Weibsbilds? Ohne mich!«, erklärte Monsieur le Comte voll inbrünstiger Ablehnung.
»Aber was redet ihr denn da?«, fragte Amélie fassungslos nach. »Weshalb Haus des spinnenden Weibsbilds? Ihr verwechselt da etwas. Was ist denn los? Ihr kennt mich doch!«
Die Männer hatten ihre Karten wieder aufgenommen und gaben vor, in ihr Spiel vertieft zu sein, und Amélie wusste, sie würde keine Antwort mehr bekommen.
Nun gut, was auch immer diese eigensinnigen Montois zu ihrem Verhalten antrieb, ihr Sturkopf sollte ihnen aus früheren Tagen bekannt sein und wenn nicht, dann würden sie diesen erneut kennenlernen. Noch nie hatte sie bei irgendwem um einen Gefallen gebettelt – und wenn man ihr den Beistand versagte, dann musste sie sich eben selbst helfen.
»He, Müllersbursche!«, rief sie einer plötzlichen Eingebung folgend dem jungen Mann hinterher, der offensichtlich gerade den Inhalt seiner Mehlsäcke abgeliefert hatte und nun wieder an ihr vorbeigegangen war. Sie raffte ihre Röcke und hatte ihn schnell eingeholt. »Warte!«
Verwundert drehte sich der junge Mann um.
Linnea machte große Augen, als ihre Mutter noch schmutziger als zuvor und mit zwei leeren Mehlsäcken über dem Arm zurückkehrte. Und Amélie staunte ihrerseits, weil die Kutsche weg war.
»Montagnard war hier«, sprudelte ihre Tochter hervor. »Maman, warum hast du mich so lange allein gelassen? Was ist passiert? Ich dachte, du kommst nicht mehr wieder! Nur wenige Minuten nachdem du weg warst, kam der Kutscher wieder, stieg auf die Karre, um den Mont zu verlassen … Was hätte ich …« Ihre Stimme kippte. »Was hätte ich denn tun sollen?«
»Nichts, mein Kind, nichts. Du hast alles richtig gemacht.«
»Nein, nein, nein, das habe ich nicht!«, rief Linnea aufgebracht, und jeglicher mütterlicher Trost schien vergebens. »Es war gerade Wachwechsel, er hielt noch am Tor, hat mit den Wächtern geredet und gelacht – ich hätte hingehen sollen, irgendetwas sagen, vielleicht hätte er auf mich gehört, vielleicht wäre er geblieben!«
»Beruhige dich, meine Kleine. Es wird alles gut.«
»Ich bin nicht deine Kleine, Maman, hör endlich auf damit!«
Amélie stutzte. Dieses Verhalten war neu. »Entschuldige, Linnea«, lenkte sie schnell ein. »Manchmal vergesse ich wohl, wie erwachsen du schon geworden bist.« Versöhnlich wollte sie ihre Tochter umarmen, aber Linnea sperrte sich gegen diese liebevolle Geste.
»Ich will ehrlich zu dir sein«, sagte Amélie, ging einen Schritt zurück und sah ihr in die Augen. »Die nächste Zeit wird schwer für uns werden. Aber gemeinsam sind wir stark, und niemand auf der Welt wird uns etwas anhaben können, habe ich recht, meine Große?«
»Ja, Maman, natürlich. Wir werden zusammenhalten wie Pech und Schwefel.«
Amélie bemerkte zwar den seltsamen Unterton in Linneas Worten, doch angesichts ihres Lächelns maß sie diesem keine Bedeutung bei.
»Linnea, wir müssen uns jetzt allein um unsere Habe kümmern. Hilf mir bitte, wir laden immer so viel in die Säcke, wie wir an Gewicht den Berg hinaufschleppen können. Mit den Wächtern werde ich reden, damit sie wenigstens die Freundlichkeit besitzen mögen, währenddessen auf unser restliches Gepäck zu achten.«
Amélie griff in die eingenähte Tasche ihres Kleides nach dem Münzbeutel, um ihre Bitte an die Männer überzeugender klingen zu lassen. Sie fasste ins Leere. Panisch tastete sie ihren Rock ab und bekam Schweißausbrüche.
»Maman, was ist los? Hast du dein Geld verloren?«, riet ihre Tochter sofort richtig.
Amélie nickte und versuchte fieberhaft, sich an die Umstände zu erinnern. Der Münzbeutel war noch da gewesen, als sie auf dem Watt wieder in die Kutsche geklettert war, nach Ankunft am Mont bei der Geldverhandlung mit Montagnard müsste sie ihn auch noch gehabt haben, und hätte der Müllerbursche ihr die Säcke nicht als kleine Wiedergutmachung kostenlos überlassen, hätte sie den Verlust wohl schon früher bemerkt.
»Merde! Ich muss den Beutel irgendwann vorhin im Getümmel verloren haben!«
»Vielleicht hat ihn dir jemand gestohlen?«
»Das glaube ich nicht!«, gab Amélie im Brustton der Überzeugung zurück. »Er wird sich schon wieder finden. Es gibt auch noch ehrliche Menschen, besonders hier auf dem Mont.«
»War viel Geld darin?«
»Nein, nein, kaum der Rede wert … Lass uns jetzt anfangen, unser Gepäck umzuladen. Nimm den Sack, packe deine Kleider und noch ein paar schwerere Gegenstände hinein, aber nur so viel du tragen kannst.«
»Sollen wir nicht zuerst ohne die Sachen zu deinem Elternhaus gehen? Was machen wir, wenn niemand da ist?«
»Der Weg ist anstrengend genug, wir gehen ihn nicht mit leeren Händen, und – natürlich wird jemand da sein«, sagte sie und fing an, ihre Habe in dem Mehlsack zu verstauen.
Wie lange würde sie diese Fassade der Zuversicht ihrer Tochter gegenüber noch aufrechterhalten können? Die Antwort war so einfach wie erbarmungslos: Bis sie ihre Eltern eben nicht antreffen würden, und sie demzufolge eine Übernachtung im Gasthaus bezahlen musste. Sie besaß kein Geld mehr, keinen einzigen Sou. Nie im Leben hätte sie das für möglich gehalten, aber das Unvorstellbare war bittere Tatsache geworden. Wie konnte das nur passieren? Aber wo sonst als an ihrem Körper wäre das Geld sicherer aufgehoben gewesen? Wohin nur mit ihrer ohnmächtigen Wut? Es gab zu viele Verdächtige: Nicht nur Montagnard, einer der Kartenspieler oder der Müllersgeselle, auch ein Unbekannter im Gasthaus oder auf der belebten Gasse hätte es gewesen sein können. Oder musste sie sich selbst anprangern, weil sie in ihrer Unachtsamkeit den Beutel tatsächlich verloren hatte?
Amélie griff sich Schuhe aus einer Kiste, schlüpfte hinein und fühlte sich damit wenigstens nicht mehr wie eine Bettlerin. Sie setzte ihr Pariser Gesellschaftslächeln auf und machte sich betont fröhlich mit ihrer Tochter auf den Weg, ganz so, als brächen sie zu einer vergnüglichen Wanderung auf.
Dieses Mal ging Amélie nicht die Grande Rue entlang, sondern bog am Königstor scharf nach rechts in den überdachten Treppengang, der über das Königstor hinweg auf die Escalier des Monteux zuführte, eine steile Treppe mit unebenen Stufen, die, wie der Name besagte, nur von Bergbewohnern benutzt wurde, die ihrerseits das Gedränge und das Schaulaufen auf der Grande Rue vermeiden wollten.
Sechs oder sieben Montois kamen ihr dort entgegen, einer nach dem anderen drückte sich mit dem Rücken an die Felsmauer und verharrte in dieser Haltung, bis sie vorübergegangen waren. Ihre fragenden Blicke konnte Amélie noch im Rücken spüren: Was hatte eine lebendig gewordene Frau aus den Journalseiten des Cabinet des Modes in einem schmutzstarrenden Kleid hier auf dem Mont zu suchen? Dazu noch mit einem geschnürten Bündel wie ein Landstreicher bepackt, allein mit einem halb erwachsenen Kind?
Vergeblich hoffte Amélie darauf, einem vertrauten Gesicht zu begegnen, jemandem, der sich über ihre Anwesenheit freute. Die Rückkehr in ihr Dorf, in ihre alte Heimat, hatte sie sich weiß Gott anders vorgestellt.
Oben an der steilen Treppe angelangt, musste Amélie auf ihre erschöpfte Tochter warten. Obwohl der Weg nunmehr parallel zum Berg und damit, bis auf wenige Zwischentreppen, eben verlief, gelang es Linnea kaum zu verschnaufen, und Amélie schmerzte es zutiefst, ihre Tochter einer solchen Anstrengung auszusetzen.
Der Aufstieg war geschafft: Sie befanden sich hoch über den Dächern der Unterstadt, ein weiter Blick über das Wattenmeer tat sich vor ihnen auf. Eine letzte Kutsche war noch vor der auflaufenden Flut auf dem Weg zum Mont. Gleißend spiegelte sich die sinkende Sonne im seichten Wasser der Bucht, sodass sich Amélie geblendet abwandte. Die hohen Mauern und festungsähnlichen Gebäudefassaden, aus deren Mitte sich die Kathedrale erhob, waren in ein atemberaubend schönes Goldbraun getaucht, an dem sie sich schon früher kaum hatte sattsehen können.
Zu ihrer Linken hatten sich nur noch vereinzelt Häuser in die Nähe des Kirchenbaus gewagt, im Gegensatz zur Unterstadt konnten sich hier sonnenbeschienene Gärtchen ausbreiten, in denen die ersten Narzissen, Hyazinthen und Tulpen ausgehungert nach dem Frühling vorsichtig ihre Köpfe aus dem blassgelben Gras ins Licht streckten. Eine alte Frau lockerte mit einer Harke die entkräftete Erde und sammelte dabei ein paar schwarz verdorrte Blätter auf, die die letzten Herbststürme von den wenigen Bäumen in ihren Garten gefegt hatten.
Weiter vorne, vor dem dreistöckigen steinernen Haus mit dem hübschen Erker saßen drei Frauen unterschiedlichen Alters auf der Bank. Zu ihren Füßen lag ein Haufen Netze, die sie auf schadhafte Stellen prüften und flickten, damit nach dem Ende des Winters der Fischer wieder bei Ebbe seine Netze auf dem Watt mit Holzstangen befestigt wie Fallen auslegen konnte. Nach der Flut musste er mit dem ablaufenden Wasser seinen Fang nur noch bequem an Land ziehen. Hatte der Fischer nicht Leclerc geheißen?
Beim Geräusch der sich nähernden Schritte schauten die Frauen neugierig von ihrer Arbeit auf. Es waren die Mutter und die Ehefrau des schon damals reichsten Fischers, nur deshalb hatte sich Leclerc dieses Haus in der Oberstadt leisten können. Die Dritte auf der Bank, ein Mädchen im heiratsfähigen Alter, war augenscheinlich die Tochter von Leclerc.
Offenkundig begriffen die beiden älteren Frauen schnell, wen sie vor sich hatten, denn obwohl sie gerade noch für eine Plauderei zu haben schienen, senkten sie die Köpfe und gaben sich plötzlich wieder sehr beschäftigt.
Von dieser erneut ablehnenden Reaktion zutiefst verunsichert, blieb Amélie nicht stehen, sondern beschränkte sich darauf, im Vorbeigehen die Frauen höflich zu grüßen. Ihr ungutes Gefühl verstärkte sich, je mehr sie sich ihrem Elternhaus näherte.
Vor ihr tauchte die kleine Pfarrkirche auf, wie ein Untertan zu Füßen der Kathedrale, und Amélie folgte dem ausgetretenen Pfad, der schräg links am Friedhof vorbei noch einmal steil nach oben führte.
»Maman, ich brauche eine Pause«, bettelte Linnea heftig atmend.
»Wir sind gleich da!«, rief sie ihrer Tochter über die Schulter zu. »Nur noch dort vorne am Haus mit den grünen Fensterläden vorbei, siehst du, dort, wo gerade jemand auf der Dachterrasse Wäsche zum Trocknen aufhängt.«
Es kam keine Antwort.
»Hast du gehört, Linnea? Schaffst du das noch?«
»Ja!«, brüllte diese in gereiztem Tonfall zurück.
Wahrscheinlich habe ich sie vorher nicht gehört, dachte Amélie. Kein Wunder, da doch ihre gesamte Aufmerksamkeit nur noch auf ein Ziel gelenkt war. Trotz des nicht enden wollenden Anstiegs wurden ihre Schritte schneller, der Weg führte sie im engen Bogen um das letzte große Sichthindernis herum, und dann stand Amélie endlich davor: zwei aneinander angrenzende, einsam am Hang gelegene, zweistöckige Gebäude. Das linke davon war ihr Elternhaus.
Vertraut und doch verändert erschien es ihr, wie ein älter gewordenes Kind. Von hier oben hatte man eine wunderbare Aussicht auf Stadt und Meer. Im oberen Stockwerk rechts war ihr Zimmer gewesen. Tränen stiegen ihr in die Augen. Amélie stellte ihren Sack ab.
Vor dem Steinhaus gab es immer noch das schmale Gärtchen, in dem sie gespielt und beim Pflanzen geholfen hatte. Jetzt wucherten dort die Büsche. Offenbar fehlte ihren Eltern auf dem Steilhang die Kraft für die Gartenpflege, versuchte sie sich einzureden. Oder war doch ein anderer Umstand der Grund für die Verwilderung? Waren ihre Eltern …
»Komm!«, sagte Amélie, fasste nach der kraftlosen Hand ihrer Tochter und zog sie sanft mit sich weiter. Um das Haus herum gelangten sie zur Haupteingangsseite, wo es kühl und dunkel war. Zwischen der Hauswand und den hohen Stützmauern der Abtei fühlte sie sich wie in einen Felsspalt eingeklemmt, doch für ihren Vater, der Schreiber des Abts war, stellte dieses Haus ein Privileg dar. Es ersparte ihm den anstrengenden Weg aus der Unterstadt zur Arbeit, bedeutete aber auch, selbst zu Unzeiten sofort zur Stelle sein zu müssen.
Es gab zwei Eingänge am lang gestreckten Hausteil ihrer Eltern. Über die linke Tür kam man geradewegs über einen Flur zu den drei Schlafräumen, die sich aufgrund der Hanglage von der anderen Seite her gesehen im ersten Stock befanden. Über den rechten Zutritt führte eine Treppe hinunter in drei weitere Räume: Küche, Wohnraum und Gesindezimmer. Ein Baudetail, das aus den Besitzansprüchen zweier Familien auf dieses Haus vor hundert Jahren resultierte, aber spätestens mit dem Einzug der Familie Dupont hinfällig geworden und somit zu einem Relikt verkommen war. Ihr Vater hatte die Aufteilung oft genug verflucht, denn es zwang ihn bei Wind und Wetter aus dem Haus zu gehen, nur um im Obergeschoss nach seinen Kindern sehen oder sein Schlafgemach aufsuchen zu können. Umgekehrt hatten ihre Geschwister und sie diesen Umstand geliebt, erlaubte er ihnen doch, das eine oder andere verbotene Abenteuer zu erleben …
Ob ihre zwei Jahre jüngere Schwester Célestine wirklich auf dem Mont geblieben und den Wünschen der Eltern gemäß die Ehe mit einem einheimischen Gastwirt eingegangen war? Und was war aus ihrem damals zwölfjährigen Bruder geworden, aus Maurice, der unbedingt in den Mönchsorden auf dem Mont-Saint-Michel hatte eintreten wollen?
Amélie atmete tief durch, ging auf die rechte Haustür zu und griff entschlossen nach dem löwengesichtigen Klopfer, vor dem sie sich als Kind ein wenig gefürchtet hatte.
»Jetzt lernst du endlich deine Großeltern kennen«, sagte sie zu Linnea.
Sie warteten, aber drinnen rührte sich niemand.
»Da stimmt etwas nicht, Maman. Das habe ich doch gleich gesagt.«
»Unsinn. Wahrscheinlich haben sie uns nur nicht gehört.« Amélie klopfte noch einmal lauter an.
»Ach bitte, glaub mir doch, hier ist niemand! Lass uns wieder runter und in ein Gasthaus gehen. Ich bin so schrecklich müde, ich möchte nur schlafen.«
»Ich will …«, schnell verschluckte Amélie das Ende des Satzes, mit dem sie die schreckliche Wahrheit beinahe ausgesprochen hätte, und fügte stattdessen eine hoffnungsfrohe Botschaft an: »Ich will dich gleich ins Bett bringen, womöglich kannst du sogar mein altes Zimmer haben – du wirst sehen, der Ausblick ist großartig! Wir müssen nur einen Augenblick warten, bis meine Eltern wiederkommen. Sie machen bestimmt nur eine kurze Besorgung.« Der flehende Ausdruck in den Augen ihrer Tochter ließ sie ihren Vorschlag noch einmal überdenken, aber dennoch keinen Schritt von ihrem Elternhaus weichen. Einer inneren Eingebung folgend, drückte Amélie den breiten, geschwungenen Eisengriff nieder und fand die Tür zu ihrer Überraschung tatsächlich unverschlossen vor. Auch diese Sitte hatte sich also auf dem Mont nicht geändert. Zögernd blieb sie auf der Schwelle stehen. Sie zog ihren Sack in den Flur und bedeutete ihrer Tochter, es ihr gleichzutun.
»Ist jemand zu Hause?«, rief sie. »Ich bin es, Amélie! Mutter? Vater?«
Keine Antwort.
»Maman, was machst du? Du kannst hier nicht einbrechen!«
»Einbrechen? Das ist mein Elternhaus!«, rief sie laut, wie um ihre Scheu zu überwinden. Tatsächlich, es roch noch so wie früher. Begierig sog sie den Geruch ihres Zuhauses ein, eine Mischung aus unendlich vielen Düften, eine harmonische Melodie mit markanten Zwischentönen, warm und weich, es roch nach Liebe, Glück und Geborgenheit. Ein Duft, den es für sie nur einmal auf der Welt gab.
Amélies Augen mussten sich an das fahle Licht gewöhnen, doch sie hätte sich auch mit geschlossenen Lidern orientieren können.
»Hier könnten doch mittlerweile andere Leute wohnen …«, sagte Linnea und zog sich rückwärtsgehend, den Sack über den Dielenboden schleifend, Richtung Tür zurück. »Ich will hier nicht bleiben!«
»Gut, dann warte draußen auf mich. Ich spüre, dass keine Fremden hier wohnen, außerdem werde ich mich umsehen und es am Mobiliar und an den Gegenständen erkennen.«
Der Eingangsbereich verengte sich, und am Ende führte eine schmale Treppe hinunter in die große Küche. Amélie fand sich darin wieder wie vor zwanzig Jahren. Jeder Teller, jeder Becher, jede Schüssel stand am richtigen Platz im Holzregal neben dem gemauerten Herd. Die dort aufgehängten, getrockneten Kräutersträuße dufteten nach Lavendel, Salbei und Pfefferminze. Es roch nach Mutters Küche, und vor ihrem geistigen Auge sah Amélie sie am kleinen Küchentisch auf einem der einfach geschnitzten Holzstühle sitzen und Bohnen schälen.
»Mutter?«, rief sie noch einmal. »Mutter, Vater?«
Neben dem Küchentisch führte die nur angelehnte Tür zur Wohnstube, wo in ihren Gedanken ihr Vater Tabakspfeife rauchend im Lehnstuhl in der Ecke saß und lächelnd von seinem Buch aufschaute, weil er zum Essen gerufen wurde. Es dauerte nicht lange, und sie hörte im Geiste ihre beiden Geschwister die Holztreppe herunterstürmen, wobei sie aus der Küche stets gleich die Teller mitbrachten, während Amélie als älteste Schwester seelenruhig ihre Pflicht tat, indem sie den Tischwein für den Vater aus dem sogenannten Gesindezimmer holte. Dieses reihte sich an die Stube an und diente als Lagerraum – es hatte gedient, stutzte Amélie jetzt, denn es standen keine Fässer mehr in dem Raum, kein Wein, kein Kraut, und die eingepassten Vorratsregale für Brot, Butter, getrockneten Schinken, eingelegtes Gemüse und Obst waren geplündert und mit Spinnenweben behangen. Hier fand nicht einmal mehr eine Maus ihr Auskommen.
Amélie schloss sachte wieder die Tür, so als könne sie damit dieses unbegreifliche Bild, diesen Tagtraum, verdrängen. Zurück im Wohnraum rang sie um eine Erklärung für diese nicht zu vereinbarenden Indizien, denn das Fenster über der Eckbank mit dem wunderschönen Blick zum Meer war geputzt, der Tisch sauber gewischt, und die Sitzflächen – Amélie fuhr mit der Hand über das glatte, rotbraune Holz – waren staubfrei, so als wäre hier noch vor Kurzem zu Mittag gegessen worden.
Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend begab sie sich zurück nach draußen, wo Linnea fröstelnd und ungeduldig im Schatten stand.
»Linnea, warum wartest du nicht auf der anderen Seite in der Sonne?«
»Was hast du so lange drinnen gemacht?«
»Mir sind im Haus ein paar Dinge aufgefallen, auf die ich mir keinen Reim machen kann. Ich will noch schnell in das andere Stockwerk gehen.«
»Maman, lass das, die Tür ist bestimmt verschlossen!«
»Linnea, dir mag die Umgebung fremd erscheinen, ich aber bin hier zu Hause. Und früher stand die Tür stets jedem offen, das ist hier so üblich.«
Amélie ließ sich nicht abbringen und sollte recht behalten. Schon etwas mutiger betrat sie den zweiten Teil des Hauses und folgte dem Korridor zu den drei Zimmern.
Gleich hinter der ersten Tür war ihr ehemaliges Reich gewesen, das sie sich allerdings mit ihrer Schwester hatte teilen müssen, im Raum daneben war ihr zwölfjähriger Bruder untergekommen, und am Ende des Flurs befand sich die Schlafkammer der Eltern.
Voll innerer Anspannung und mit einem Lächeln auf den Lippen drückte Amélie die Türklinke ihres ehemaligen Zimmers herunter. Schon der erste Blick hinein ließ sie erstarren.
Hexenküche, schoss es ihr durch den Kopf.
Wenig Licht fiel durch das schmutzige, fast blinde Fenster. Totenköpfe lagen auf dem obersten Regalbrett an der Wand gegenüber, fünf weiße, nebeneinander aufgereihte Schädel, darunter schief stehende Folianten mit abgeplatzten Lederrücken, welligen Seiten und deutlich schimmligem Geruch. Das zweite Regal war voll mit Tiegeln und verschiedensten kleinen Gefäßen.
In der Mitte des Zimmers, genau unter der an drei schmiedeeisernen Ketten aufgehängten Lampe, stand ein runder Tisch, darauf ein Zinnbecher, eine Bibel und ein grünes, bauchiges Fläschchen, umschlungen von einem Strick, der fünf regelmäßig geknüpfte Knoten aufwies. Verstört betrachtete Amélie diesen unheimlichen Altar.
Zögerlich ging sie ein paar Schritte umher, irgendwann fiel ihr Blick auf den Kleiderschrank neben der Durchgangstür zum Zimmer ihres Bruders, den sie an der geschnitzten Zierleiste als ihr altes Möbelstück ausmachte. Es kostete sie Überwindung, die Tür zu öffnen und hineinzuschauen. Sie entdeckte in Glasbehältern verwahrte Salze, Mineralien und Erze in verschiedensten Farben, Aufschriften wie Bleiglanz, Kupfer, Schwefel, Zinnober und viele mehr waren darunter …
Amélie hatte genug gesehen, hastig schloss sie den Schrank und schaute in das mittlere Zimmer, das von zwei nahezu mannsgroßen Destilliergefäßen ausgefüllt wurde. Ein Alchemistenlabor. Und mit einem Schlag kam ihr noch eine Erkenntnis: Hatten ihre alten Freunde ihre Mutter gemeint, als sie vorhin vom spinnenden Weibsbild sprachen?