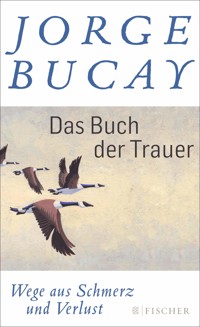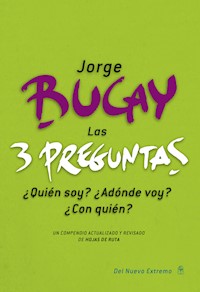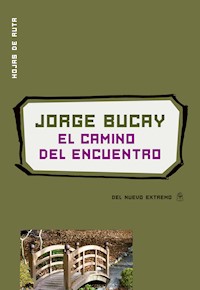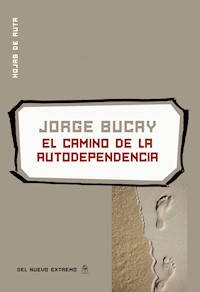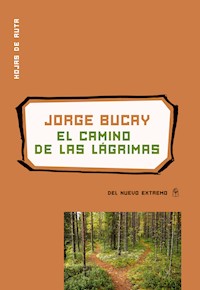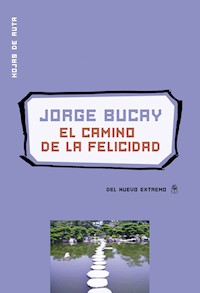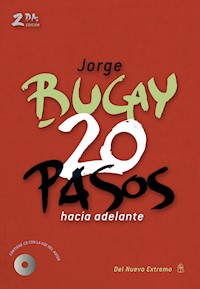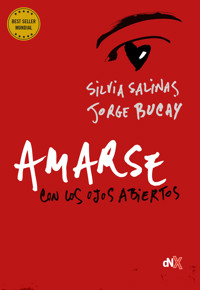9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Partnerschaften sind darauf ausgelegt, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Es ist diese Suche nach Tiefe, die ihnen Stabilität gibt, damit sie von Dauer sind.« Jorge Bucay Wir alle wünschen uns, den Partner fürs Leben zu finden. Wir sehnen uns nach der wahren, aufrichtigen Liebe. Doch der Weg zu einer erfüllten Zweisamkeit ist oft steinig, führt durch unwegsames Gelände. Jorge Bucay erzählt uns von der Entdeckung des anderen, der Liebe, und der Sexualität. Er will uns verstehen helfen, woran wir so oft scheitern, wenn wir von Liebe reden und alles Glück von ihr erwarten. Nur wer gelernt hat nicht abhängig zu sein, wird den Menschen finden, der sein Leben und seine Liebe mit ihm teilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jorge Bucay
Das Buch der Begegnung
Wege zur Liebe
Über dieses Buch
Ein Buch über die Liebe, das uns im Idealfall liebesfähig macht.
„Partnerschaften sind darauf ausgelegt, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Es ist diese Suche nach Tiefe, die ihnen Stabilität gibt, damit sie von Dauer sind.“ Jorge Bucay
Wir alle wünschen uns, den Partner fürs Leben zu finden. Wir sehnen uns nach der wahren, aufrichtigen Liebe. Doch der Weg zu einer erfüllten Zweisamkeit ist oft steinig, führt durch unwegsames Gelände. Jorge Bucay erzählt uns von der Entdeckung des anderen, der Liebe, und der Sexualität. Er will uns verstehen helfen, woran wir so oft scheitern, wenn wir von Liebe reden und alles Glück von ihr erwarten. Nur wer gelernt hat nicht abhängig zu sein, wird den Menschen finden, der sein Leben und seine Liebe mit ihm teilt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jorge Bucay, 1949 in Buenos Aires, Argentinien, geboren, stammt aus einer Familie mit arabisch-jüdischen Wurzeln. Aufgewachsen ist er in einem überwiegend christlichen Viertel von Buenos Aires. Er studierte Medizin und Psychoanalyse und wurde zu einem der einflussreichsten Gestalttherapeuten.
Jorge Bucay ist im wahrsten Sinn des Wortes ein geborener Geschichtenerzähler. Sein großer internationaler Erfolg verdankt sich der Erfahrung und Kenntnis unterschiedlichster kultureller Einflüsse und seinem stupenden Wissen über den Menschen. Seine Bücher reflektieren alle diese Einflüsse und seine jahrelange therapeutische Erfahrung.
Lisa Grüneisen, 1967 geboren, arbeitet seit ihrem Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte als Übersetzerin. Sie übersetzte unter anderem Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Alberto Manguel und Frida Kahlo.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die spanische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›El camino del encuentro‹
© 2001 Jorge Bucay
The translation follows the edition by Editorial Sudamericana, S.A., Buenos Aires 2001
Published by arrangement with UnderCover Literary Agents
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main 2016
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg/Simone Andlelkovic
Coverabbildung: Marcelino Truong
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402822-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Einleitung
Die Allegorie von der Kutsche II
Geschichte
Die Bedeutung der Begegnung in der heutigen Welt
Der Mensch: Einsamer Wolf oder soziales Wesen?
Vertikale Begegnungen
Über die Liebe
Bedeutung
Die Liebe ist man selbst
Unterschiedliche »Arten« von Liebe – ein Irrglaube
Enttäuschung
Der Glaube an die ewige Liebe
Anmerkungen über emotionale Bindungen
Liebe und Freundschaft
Intimität, eine große Herausforderung
Die Liebe zu den Kindern
Scheidung der Eltern
Die Kinder werden größer
Die Familie als Sprungbrett
Die erste Stütze ist die Liebe
Die zweite Stütze ist die Wertschätzung
Die dritte Stütze sind Regeln
Die letzte Stütze ist die Kommunikation
Meine Kinder als Geschwister
Die Liebe zu sich selbst
Horizontale Begegnungen
Sexualität – eine besondere Begegnung
Es miteinander treiben
Ficken/Vögeln
Liebe machen
Sex und Unterdrückung
Phantasie
Orte
Achte auf dich
Romantik
Neues entdecken
Die Sinne entdecken
Den Alltag außen vor lassen
Sei unvernünftig
Hab Spaß!
Lass dich gehen
Und der wichtigste Punkt: Vergiss den Orgasmus
Ein paar Worte zum Begehren
Die Liebe in der Partnerschaft
Das Geheimnis der romantischen Anziehung
Die Theorie von der Arterhaltung
Die Theorie vom Markt der Vorzüge und Mängel
Die Theorie der Anerkennung
Die Gesellschaftstheorie
Die Theorie von der spirituellen Bereicherung
Die Theorie vom 1+1=3
Die Theorie von den sich ergänzenden Rollen
Liebesbeweise: Liebesbeteuerungen, Treue, Zusammenleben
Ehevertrag
Ausblick
Für Héctor, Ioschúa,
Chrystian, Julia und Miguel
weil sie mir die Liebe gezeigt haben,
die Freundschaft mit sich bringt.
Einleitung
Mit Sicherheit gibt es einen Weg,
der vielleicht
auf vielerlei Weise
individuell und einzigartig ist.
Vielleicht gibt es einen Weg,
der mit Sicherheit
auf vielerlei Weise
für alle derselbe ist.
Mit Sicherheit gibt es
einen möglichen Weg.
Dieser Weg ist es, den man finden und gehen muss. Vielleicht bricht man allein auf und ist überrascht, unterwegs all jenen zu begegnen, die in dieselbe Richtung gehen.
Dabei sollten wir unser endgültiges einsames, persönliches, entscheidendes Ziel nicht vergessen. Es ist unsere Brücke zu den anderen, der einzige Berührungspunkt, der uns mit der Welt dessen verbindet, was ist.
Wie auch immer man dieses endgültige Ziel nennen mag: Glück, Selbstverwirklichung, Erfüllung, Erleuchtung, Erkenntnis, innerer Frieden, Erfolg, Vollendung oder einfach das endgültige Ziel … Es tut nichts zur Sache. Wir alle wissen, dass es darum geht, gut dort anzukommen.
Manche gehen unterwegs in die Irre und treffen ein wenig später ein, andere finden eine Abkürzung und werden zu kundigen Führern für die anderen.
Einige dieser Wegführer haben mich gelehrt, dass es viele Wege gibt, die ans Ziel führen, unendlich viele Ausgangspunkte, Tausende von Optionen und Dutzende von Routen, die in die richtige Richtung führen. Wege, die jeder für sich geht.
Aber es gibt einige Wege, die stets Teil des ganzen Weges sind.
Wege, denen man nicht ausweichen kann.
Wege, die man gehen muss, wenn man vorankommen will.
Wege, auf denen wir lernen, was man unbedingt wissen muss, um das letzte Wegstück in Angriff zu nehmen.
Für mich sind diese unerlässlichen Wege die folgenden vier:
Der Weg der endgültigen Begegnung mit sich selbst. Ich nenne ihn den Weg der Selbstabhängigkeit.
Der Weg der Begegnung mit dem anderen, mit der Liebe und der Sexualität. Ich nenne ihn den Weg der Begegnung.
Der Weg der Verluste und des Schmerzes. Ich nenne ihn den Weg der Tränen.
Und schließlich den Weg der Erfüllung und der Sinnfindung. Ich nenne ihn den Weg des Glücks.
Auf meiner eigenen Reise habe ich die Wegweiser studiert, die andere auf ihrer Reise hinterließen, und ich habe einige Zeit damit verbracht, meine eigenen Wegkarten zu zeichnen.
Meine Karten dieser vier Wege wurden mit den Jahren zu einer Art Leitfaden, der mir half, wieder auf den Weg zurückzufinden, wenn ich die Orientierung verlor.
Vielleicht können meine Bücher dem einen oder anderen eine Hilfe sein, der wie ich immer wieder vom Weg abkommt. Vielleicht helfen sie auch jenen, die in der Lage sind, Abkürzungen zu finden. Aber eine Karte ist immer etwas anderes als der Weg selbst; man muss die Route immer wieder korrigieren, wenn man aufgrund der eigenen Erfahrungen einen Fehler des Kartographen entdeckt. Nur so können wir den Gipfel erreichen.
Hoffentlich begegnen wir uns dort.
Das würde bedeuten, dass du es geschafft hast.
Und es würde bedeuten, dass auch ich es geschafft habe.
Jorge Bucay
Die Allegorie von der Kutsche II
Als ein Ganzes machten meine Kutsche, die Pferde, der Kutscher und ich als Passagier uns auf den ersten Teil des Weges. Die Landschaft veränderte sich: Manchmal war sie trocken und öde, dann wieder blühend und erheiternd. Auch die klimatischen Bedingungen und die Beschaffenheit des Weges änderten sich: Manchmal war er sanft und eben, andere Male holprig und steil, dann wieder abschüssig und rutschig. Und schließlich veränderte sich auch meine seelische Verfassung: Im einen Moment war ich heiter und optimistisch, im anderen traurig und müde, später gelangweilt und verdrossen.
Nun, am Ende dieses Wegstücks, spüre ich, dass die wirklich wichtigen Veränderungen diese letzten, inneren Veränderungen sind, so als hingen die äußeren Veränderungen von diesen ab oder als existierten sie gar nicht.
Wenn ich für einen Moment innehalte, um die zurückgelassenen Spuren auf meinem Weg zu betrachten, empfinde ich Zufriedenheit und Stolz. Im Guten wie im Schlechten, meine Siege und Enttäuschungen gehören zu mir.
Ich weiß, dass eine neue Etappe auf mich wartet, aber ich weiß auch, dass sie für alle Zeit auf mich warten könnte, ohne dass ich mich im Geringsten schuldig fühle. Nichts zwingt mich weiterzugehen, nichts außer meinem eigenen Wunsch, es zu tun.
Ich schaue nach vorn. Der Weg erscheint mir einladend. Ich sehe, dass er voller bunter Farben und neuer Formen ist, die meine Neugier wecken. Meine Intuition sagt mir, dass auch Gefahren und Schwierigkeiten dort lauern, doch das hält mich nicht auf. Ich weiß, dass ich auf all meine Ressourcen zurückgreifen kann; sie werden ausreichen, um jeder Gefahr zu begegnen und alle Schwierigkeiten zu meistern. Andererseits habe ich gelernt, dass ich zwar verletzlich bin, aber nicht zerbrechlich.
In den inneren Dialog vertieft, merke ich kaum, dass ich mich bereits auf den Weg gemacht habe.
Still genieße ich die Landschaft … und sie, könnte man meinen, genießt meine Anwesenheit, wird sie doch mit jedem Augenblick schöner.
Plötzlich nehme ich auf einem Parallelweg einen Schatten wahr, der sich hinter den Büschen bewegt.
Ich sehe genauer hin. Als ich nach einer Weile zu einer Lichtung komme, stelle ich fest, dass es eine weitere Kutsche ist, die in dieselbe Richtung unterwegs ist wie ich.
Ich bin überwältigt von ihrer Schönheit: das dunkle Holz, die glänzenden Beschläge, die riesigen Räder, die sanft geschwungenen, harmonischen Formen …
Ich bin wie geblendet.
Ich bitte den Kutscher, schneller zu fahren, um auf eine Höhe mit ihr zu kommen. Die Pferde schnauben und fallen in eine raschere Gangart. Ohne dass man es ihnen sagen muss, lenken sie ihre Schritte an den linken Wegesrand, als wollten sie den Abstand verringern.
Die Kutsche neben uns wird ebenfalls von zwei Pferden gezogen, und auch dort führt ein Kutscher die Zügel. Ihre Pferde und meine fallen spontan in die gleiche Gangart, als gehörten sie zusammen. Den Kutschern erscheint dies der geeignete Moment, um ein wenig auszuruhen, denn sie lehnen sich beide auf dem Kutschbock zurück und lassen mit entspanntem Blick die Zügel gleiten und die Kutsche ihren Weg nehmen.
Ich bin so gebannt von der Situation, dass ich erst nach einer ganzen Weile bemerke, dass auch in der anderen Kutsche ein Passagier sitzt.
Nicht, dass ich gedacht hätte, es gäbe keinen. Ich hatte ihn lediglich nicht gesehen.
Nun entdecke ich ihn und betrachte ihn. Ich sehe, dass er mich ebenfalls ansieht. Um ihm zu zeigen, dass ich mich freue, lächle ich ihm zu, und er winkt lebhaft aus dem Fenster zu mir herüber.
Ich erwidere den Gruß und traue mich, ihm ein leises »Hallo« zuzurufen. Geheimnisvollerweise (vielleicht ist es auch gar nicht so geheimnisvoll) hört er es und ruft zurück:
»Hallo. Fährst du auch in diese Richtung?«
»Ja«, antworte ich mit einer Freude, die mich selbst überrascht. »Sollen wir gemeinsam fahren?«
»Klar«, sagt er. »Auf geht’s.«
Ich atme tief durch und fühle mich glücklich.
Auf dem ganzen Weg bis hierher habe ich noch nie einen Reisegefährten gefunden.
Ich bin glücklich, ohne zu wissen warum, und interessanterweise will ich es auch gar nicht wissen.
Erster Teil
Geschichte
Die Bedeutung der Begegnung in der heutigen Welt
Wir leiden an einer Art emotionaler Verkümmerung, die uns zu bestimmten selbstzerstörerischen Verhaltensweisen treibt, im öffentlichen Leben genauso wie im privaten.
Wir müssen einen Weg finden, der uns die Möglichkeit gibt, seelisch intakter zu sein, und dieser Weg ist aufs engste mit der Liebe und der Spiritualität verbunden. Die Liebe ist der beste Ausdruck für die seelische Gesundheit des Menschen. Sie ist das genaue Gegenteil von Aggression, Angst und Paranoia, die ihrerseits der krankhafte Ausdruck dessen sind, was uns voneinander trennt.
Claudio Naranjo, Clan (1984)
Wenn in diesem Buch von Begegnung die Rede sein wird, meine ich damit die Entdeckung, die Erschaffung und das fortwährende Erleben eines Wir, das über die Struktur des Ich hinausgeht. Diese Erschaffung des Wir fügt der reinen Summe von Du und Ich einen überraschenden Wert hinzu.
Ohne Begegnung gibt es keine seelische Gesundheit. Ohne die Existenz eines Wir ist unser Leben leer, auch wenn unser Haus, unsere Schränke und unser Safe voller Kostbarkeiten sein mögen.
Und dennoch verführt uns das Bombardement der Medien dazu, unsere Häuser, unsere Schränke und unsere Safes mit Dingen zu füllen und daran zu glauben, dass alles andere altmodisch und sentimental sei.
Die intellektuellen Skeptiker, die angeblich die Weisheit für sich gepachtet haben, sind nur allzu gerne bereit, jene lächerlich zu machen und von oben herab zu betrachten, die aus dem Herzen, dem Bauch oder der Seele heraus sprechen, die das Fühlen über das Denken stellen, Spiritualität über den Ruhm und das Glück dem Erfolg vorziehen.
Wenn einer von Liebe spricht, ist er unreif. Sagt einer, er sei glücklich, ist er naiv oder oberflächlich. Ist er großzügig, macht er sich verdächtig. Hat er Vertrauen, ist er ein Dummkopf, und ist er optimistisch, schimpft man ihn einen Idioten. Und ist er eine Mischung aus all dem, dann behaupten die angeblichen Bewahrer des Wissens – unfreiwillige Steigbügelhalter des dilettantischen Konsums –, er sei ein Lügner, ein unreflektierter, unseriöser Heuchler (ein Scharlatan, würde man in Argentinien sagen).
Viele dieser in hierarchischen Strukturen verhafteten Denker sind Vertreter einer Hochnäsigkeit, die sich für zu bedeutend hält, als dass sie sich ihre eigene Verunsicherung oder ihr eigenes Unglück eingestehen würde.
Andere sind vollständig in ihrer Identität gefangen und nicht bereit, ihren Elfenbeinturm zu verlassen, aus Angst, man könnte entdecken, wie gleichgültig ihnen die anderen sind.
Fast allen jedoch, die sich hinter den Mauern ihrer Eitelkeit verschanzen, fällt es schwer, zu akzeptieren, dass andere, die aus anderen Richtungen kommen, völlig andere Lösungen vorschlagen.
Und doch lässt sich die mangelnde Wertschätzung des Beziehungs- und Gefühlslebens nicht länger aufrechterhalten. Die Wissenschaft liefert immer neue Belege dafür, wie wichtig der Zugang zu unseren Gefühlen für die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit ist und dass es eine Notwendigkeit ist, in lebendigem Kontakt mit anderen zu sein. Die Forschungen und Schriften von Carl Rogers, Abraham Maslow, Margaret Mead, Fritz Perls, David Viscott, Melanie Klein, Desmond Morris und in jüngerer Zeit Dethlefsen, Dahlke, Buscaglia, Goleman, Watzlawick, Bradshaw, Dyer und Satir zwingen uns, unser primitives Denkschema von Ursache und Wirkung zu revidieren, auf die Medizin und Psychologie traditionell zurückzugreifen, um Gesundheit und Krankheit zu erklären.
Doch wenn wir unsere Umgebung und unser eigenes Inneres betrachten, können wir die Beunruhigung, wenn nicht gar Angst spüren, die eine mögliche neue Begegnung in uns auslöst. Warum? Zum einen, weil jede Begegnung ein gewisses Maß an Zuwendung, Einfühlungsvermögen, Zusammengehörigkeit, gegenseitiger Verbindlichkeit und folglich Verantwortung voraussetzt.
Aber auch und vor allem, weil es bedeutet, sich mit einer unserer größten Ängste auseinanderzusetzen, vielleicht der einzigen, vor der wir uns noch mehr fürchten als vor der Einsamkeit: der Angst vor Zurückweisung und Verlassenwerden.
Ob nun aus Angst oder aus einer Konditionierung heraus, fest steht, dass es uns zunehmend schwerfällt, Bekannten wie Unbekannten zu begegnen.
Das Modell einer beständigen Partnerschaft oder Familie wird mehr und mehr zur Ausnahme von der Regel. Lebenslange Freundschaften oder Ehen sind »aus der Mode gekommen«.
Zufällige, zwanglose Begegnungen und unverbindliche sexuelle Beziehungen werden ohne weiteres akzeptiert und von Experten wie Laien sogar als Ausdruck eines vorgeblich freieren und fortschrittlicheren Lebens empfohlen.
Individualismus erscheint mit sozialem Denken unvereinbar, insbesondere bei jenen Kleingeistern, die gesellschaftliche Strukturen im Grunde verachten oder aber in einer Art solidarischem Fundamentalismus daran festhalten, der das regulieren soll, von dem man nicht weiß, wie man ansonsten damit umgehen soll.
Die Statistiken sind nicht vielversprechend. In Argentinien gab es zwischen 1993 und 1998 ebenso viele Scheidungen wie Eheschließungen. Fast die Hälfte aller Kinder in den großen Städten lebt in Haushalten, in denen einer der biologischen Elternteile abwesend ist, eine Zahl, die mit Sicherheit noch weiter ansteigen wird, wenn – so sind die Aussichten – zwei von drei Ehen geschieden werden.
Die Statistiken zur Individualpathologie sind nicht weniger beunruhigend: steigende Depressionsraten bei Jugendlichen und alten Menschen, zunehmende Vereinsamung, zu wenig Begegnungsmöglichkeiten und abnehmende Angebote für einsame Menschen jeden Alters.
Ob mit oder ohne Hilfsinitiativen: Paarbeziehungen sind immer konfliktbeladener, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern immer angespannter, Beziehungen zwischen Geschwistern immer weniger tragfähig und Beziehungen unter Arbeitskollegen zunehmend von Konkurrenz geprägt.
Um es mit Allan Fromme zu sagen: »Unsere Städte mit ihren Wolkenkratzern und ihrer enormen Überbevölkerung sind der größte Nährboden der Einsamkeit. Nirgendwo ist man einsamer als in New York City an einem Wochentag zur Rush Hour, umgeben von zwanzig Millionen Menschen, die genauso einsam sind.«
Es liegt in unserer Verantwortung, eine Lösung für diese Situation zu finden und etwas an ihr zu ändern, für uns selbst und für die, die nach uns kommen.
Worin liegt die Herausforderung dieses Wegs?
Sich immer wieder bewusst zu machen, wie komplex die Beziehung zwischen zwei oder mehr einzigartigen, unterschiedlichen und selbstabhängigen Individuen ist, die beschließen, eine ernsthafte Verbindung einzugehen.
Wer sich entschließt, diesen Weg zu gehen, sollte darauf vorbereitet sein, dass er die Vorwürfe jener aushalten muss, die ihn noch nicht gegangen sind und ihn niemals gehen werden und die in ihm bestenfalls einen sentimentalen Träumer sehen.
Zu lernen, in Beziehung zu anderen zu leben, ist eine schwierige Aufgabe, man könnte beinahe sagen, es sei eine Kunst, für die es spezielle, knifflige Techniken braucht. Diese müssen zunächst erlernt und eingeübt werden, ehe man sie adäquat beherrscht. So wie ein Chirurg nicht operieren kann, solange er keine Approbation hat. So wie ein Architekt zunächst Erfahrung sammeln muss, bevor er ein großes Gebäude baut, und ein Koch jahrelang in der Küche stehen muss, bis er weiß, wie er am besten kocht.
Und das ist so, weil jeder Mensch ein großes Rätsel ist. Und auch unsere Beziehungen sind ein Geheimnis – fröhlich oder dramatisch, aber immer unvorhersehbar.
Leo Buscaglia erzählt von einem jungen Mann, der unbedingt lernen will, wie er an die Mädchen aus seinem Unikurs herankommt, und deshalb in eine Buchhandlung geht, um einen entsprechenden Ratgeber zu suchen. Auf einem unscheinbaren Regal ganz hinten in der Buchhandlung entdeckt er ein Buch, dessen Titel ihn anspricht. Es heißt Leidenschaft – Liebe. Der junge Mann kauft den dicken Wälzer, um zu Hause festzustellen, dass er den einzelnen Band eines Lexikons gekauft hat.
Ich schrieb einmal, ein Buch zu lesen sei, wie einem Menschen zu begegnen. Es gibt überraschende Bücher und langweilige Bücher, Bücher, die man einmal liest, und Bücher, die man immer wieder zur Hand nimmt. Bücher schließlich, die tiefgründiger sind als andere.
Heute, zwanzig Jahre später, sage ich das immer noch, aber von einem anderen Standpunkt aus:
Einem Menschen zu begegnen ist, wie ein Buch zu lesen.
Ganz gleich, ob diese Begegnung gut, durchschnittlich oder schlecht ist: Sie gibt mir etwas, bringt mich weiter, lehrt mich etwas. Wenn eine Beziehung scheitert, liegt es nicht daran, dass der andere schlecht, untauglich oder unfähig wäre.
Scheitern, wenn wir es so nennen wollen, ist der Begriff, den wir verwenden, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Beziehung nicht länger tragbar für einen von beiden ist. (Wir sind nicht jederzeit für jeden geschaffen, und nicht jeder ist jederzeit für uns geschaffen.)
Jede einzelne Begegnung in meinem Leben ist wie ein Buch, das ich gelesen habe: Eine Lektion des Lebens, die mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin.
Der Mensch: Einsamer Wolf oder soziales Wesen?
Bekanntlich besteht die Philosophie vor allem aus Fragen und gelegentlich auch aus Antworten, die immer vorläufig, niemals endgültig sind.
Als die Philosophie der Neuzeit über den Sinn des Lebens in Gemeinschaft nachzudenken begann, war die Wahrheit nicht länger nur der Kirche und ihren Vertretern vorbehalten. Nachdem das Monopol gebrochen war und aufklärerisches Denken nicht länger verfolgt wurde, gab die Philosophie den Anstoß, sich eine eigene Meinung zu bilden, die neuen gesellschaftspolitischen Ideen weiterzudenken oder aber sich von ihnen abzugrenzen. So entstand ein Netz unterschiedlicher Positionen, die darüber verhandelten, in welcher Beziehung der Mensch zu der sozialen Gruppe steht, der er angehört.
In der Philosophie begann damit der Diskurs über das Wesen des Menschen.
Innerhalb der ersten zweihundert Jahre der Aufklärung scheint die Philosophie darin übereinzustimmen, dass Gesellschaft und Moral wider die menschliche Natur sind, da diese ungesellig, egoistisch und anarchisch ist.
Von diesem Standpunkt aus konnte sich die »offizielle« Überzeugung, dass Moral und gesellschaftliche Kontrolle zwar gut, aber keineswegs natürlich sind, durchsetzen. Das Natürliche, so argumentieren die meisten Philosophen, ist das Bestreben des Einzelnen, sich selbst zu genügen und von niemandem abhängig zu sein. Die menschliche Natur, so die gängige Meinung, hat nur das im Sinn, was sie selbst braucht und ihr für sich selbst erstrebenswert erscheint. Alle anderen Verhaltensweisen, insbesondere die »sozialen«, sind eine Erfindung des zivilisierten Menschen und folglich widernatürlich.
Bereits Ende des 16. Jahrhunderts behauptete Montaigne (1533–1592), dass der Mensch in Gesellschaft lebt, weil er auf sie angewiesen ist, nicht, weil es ihm gefällt. Ließe man dem Menschen seinen freien Willen, ziehe er das Alleinsein vor. Wenn er mit anderen zusammenlebt, so geschieht dies aus dem Bestreben heraus, Kräfte zu bündeln, um so seinen eigenen Vorteil zu suchen. Im Gegenzug für die Unterstützung, die Hilfe oder die Kraft der anderen ist der Einzelne bereit, den Preis zu zahlen und auf vielerlei persönliche Wünsche zu verzichten. Montaigne ist der Ansicht: Entwinden wir uns den leidenschaftlichen Verstrickungen, die uns anderweitig fesseln und von uns selbst entfernen! Diese so starken Bande muss man lösen; man mag dann noch dies oder jenes lieben, vermählen aber darf man sich nur mit sich selbst.
Die Vorstellung eines nach Unabhängigkeit strebenden Menschen bestimmte die Geschichte der Philosophie der Neuzeit auf ihrer Suche nach der Natur des Einzelnen: der Mensch als unabhängiges, an niemanden gebundenes Wesen. Montaigne war der erste Philosoph, der erklärte, dass Abhängigkeit untauglich ist, weil sie uns in ein schwieriges Verhältnis zu den anderen setzt.
Während Montaigne den Schwerpunkt darauf legt, uns von unseren Fesseln zu befreien und die Abhängigkeit abzuschaffen, analysiert Pascal: »Wir begnügen uns nicht mit dem Leben, das wir aus unserem eigenen Sein haben; wir wollen in der Vorstellung der anderen ein eingebildetes Leben führen und wir bemühen uns, so zu scheinen.«
Pascal (1623–1662) zufolge ist diese Abhängigkeit für unser Unglück mitverantwortlich, weshalb wir uns aus ihr befreien sollten. Er vertritt die Ansicht, dass wir uns an das Leben der anderen hängen, weil es uns nicht gelingt, die zu sein, die wir sein sollten.
La Bruyère (1645–1696) glaubt, dass der Mensch von Natur aus einsiedlerisch ist und gesellschaftliches Denken und der Herdentrieb Erfindungen des Menschen sind. Seine Ideen führen ihn zu folgendem Schluss:
Dem Menschen passt es nicht, die Beute, die er gejagt hat, zu teilen, aber er teilt sie, weil der Gemeinsinn für ihn zu einer Regel geworden ist, auf die wir uns aus dem einen oder anderen Grund verständigt haben. Der Mensch ist nicht nur von Natur aus egoistisch, sondern zudem unersättlich und ungesellig.
Aus dieser Vorstellung des Menschen als ungeselligem Wesen, die in der Epoche mehr oder weniger wohlwollend aufgenommen wurde, entwickelten sich zwei völlig unterschiedliche philosophische Richtungen: Die eine war der Ansicht, dass diese Neigung bekämpft werden müsse, da sie schädlich für die Gesellschaft sei, die andere fand, dass man sie anerkennen und stärken müsse. Für die einen muss sich das Ideal der Realität unterordnen, für die anderen soll sich die Realität dem Ideal beugen.
Der erste Philosoph, der die Ansicht vertrat, dass die ungesellige, barbarische Natur des Menschen bekämpft werden müsse, war Machiavelli.
Für Machiavelli (1469–1527) ist die Gesellschaft ein wesentlicher Kontrollmechanismus, um die individuellen, egoistischen Interessen der menschlichen Natur zu zügeln. Andernfalls würde das Leben ein ständiger Kampf auf Leben und Tod sein, in dem jeder versucht, den anderen zu töten, um das zu bekommen, was er will. Ihm zufolge besteht das große Vermögen des Menschen darin, persönliche Interessen zu unterdrücken und die Gesellschaft als Ganzes über den Einzelnen zu stellen. Gelinge dies einer Gesellschaft nicht, sei das Leben ein ständiger Kampf.
Dieser Gedanke wurde von Hobbes (1588–1679) in dem berühmten Satz aufgegriffen, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Das heißt, angesichts einer begehrten Beute werden zwei Menschen wie wilde Tiere auf Leben und Tod miteinander kämpfen. Es sei denn, sie hätten zuvor eine Abmachung getroffen, die sie in die Lage versetzt, nicht zu Rivalen zu werden.
Was Hobbes sagte und Machiavelli oder Montaigne weiter ausführten, ist, dass wir im Grunde ungesellige Wesen sind und unsere Abhängigkeit von anderen aus unserem eigenen Schutzbedürfnis heraus entsteht. Wir Menschen schließen uns mit anderen Menschen zusammen, weil wir irgendeinen Vorteil daraus ziehen. Wäre dies nicht der Fall, würden wir unsere Unabhängigkeit wahren und lernen, alleine glücklich zu sein und uns mit unserem eigenen Leben zu begnügen.
Wir befinden uns im 15., 16. Jahrhundert, einer Zeit gewaltiger gesellschaftlicher Umbrüche, in der die herrschende Ordnung in Frage gestellt wurde. Machiavelli vertritt die Ansicht, dass der Mensch, unterwürfe er sich nicht Regeln und Verboten, in einem ständigen Machtkampf leben würde. Denn Macht sei es, wodurch der Einzelne das erlangt, was er im Grunde erstrebe.
Auch La Rochefoucauld (1613–1680) ist der Überzeugung, dass ein Überleben nur in Gesellschaft möglich ist. Folge der Mensch allein seiner Natur, würden die Ereignisse ständig Hobbes’ Ausspruch bestätigen, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Rochefoucauld zufolge können wir es nicht zulassen, dass sich die menschliche Natur ungehemmt äußert. Er schlägt vor, sie durch Erziehung und Vorschriften moralisch zu zügeln. Das Leben in Gesellschaft, so Rochefoucauld, mäßigt den unbändigen Appetit des Menschen und führt ihn zum gesellschaftlichen Ideal:
Wer sich zum Mittelpunkt von allem erhebt, möchte alles beherrschen; deshalb muss der Versuch unternommen werden, diesem Beherrscher gesellschaftliche Vorschriften entgegenzusetzen, die strikt genug sind, um ihm Einhalt zu gebieten. Im andern Fall werden sein unmäßiges Streben nach Macht, dieser Durst nach Herrschaft, die Geschichte bestimmen.
An dieser Stelle kommen die Überlegungen eines der bekanntesten Philosophen ins Spiel: Immanuel Kant (1724–1804), demzufolge der Mensch in einer ungeselligen Gesellschaft lebt. Das heißt, die Gesellschaft ist nichts, wofür der Mensch sich freiwillig entscheidet, sondern ein Kompromiss, den er eingeht, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Kant zufolge ist der Mensch, wie schon für La Bruyère, seinem Wesen nach ein Einzelgänger; allerdings wird dieses sozial unfähige, egoistische und ungesellige Wesen von drei grundlegenden Bedürfnissen angetrieben: dem Hunger nach Macht, dem Hunger nach materiellem Besitz und dem Hunger nach Ruhm.
Kant eröffnet eine neue Perspektive. Mit Machiavelli teilt er die Vorstellung, dass es dem Menschen darum geht, zu herrschen, und mit Hobbes den Gedanken, dass der Mensch nach Besitz strebt. Neu bei Kant ist der Gedanke, dass der Mensch von dem Bedürfnis angetrieben wird, geachtet zu werden (im Sinne von gefeiert, verherrlicht, bewundert). Der Mensch kann Besitz anhäufen. Er kann über seinen Besitz, über das Land und die Tiere herrschen. Aber wie könnte er in der Einsamkeit, ohne dass es einen anderen gibt, Anerkennung finden? Um anerkannt zu werden, braucht es den anderen.
Kant zufolge brauchen wir die Gesellschaft, damit sie uns die Anerkennung verschafft, nach der wir streben und die wir alleine nicht erreichen können.
In gewisser Weise halten wir bis heute an Kants Grundidee fest, dass die ungesellige Natur des Menschen unterdrückt werden muss, weil die Menschheit sonst keinen Bestand hätte.
Wie bereits gesagt, gibt es auch Denker, die das ungesellige Wesen des Menschen nicht verurteilen, sondern im Gegenteil der Ansicht sind, dass es hoch zu bewerten ist.
Von Cicero (106–43 v.C.) (Folge deinem eigenen Weg und lasse dich nicht von der Meinung der anderen leiten) bis Diderot (1713–1784) (Das menschliche Tun wird vom Nutzen beherrscht, doch ist zu verhindern, dass sich das Ideal dem Gegebenen beugt) haben viele Philosophen Denkmodelle aufgestellt, um ihre Zeitgenossen davon zu überzeugen, dass die Natur des Menschen der Konditionierung vorzuziehen ist. An diesem Punkt möchte ich vor allem auf zwei sehr bekannte und bedeutende, wenngleich, wie ich finde, nicht immer richtig verstandene Denker Bezug nehmen: de Sade und Nietzsche.
Mit de Sade (1740–1814) könnten wir uns fragen: Weshalb sollten meine persönlichen Interessen und Neigungen von dem abhängig sein, was die Gesellschaft mir gestattet oder untersagt? Weshalb sollte ich nicht die Freiheit haben, mir Zugang zu dem zu verschaffen, was mir gefällt? Weshalb sollte ich auf die Erlaubnis des anderen angewiesen sein? Weshalb sollte ich dem anderen zugestehen, mir zu sagen, was ich haben kann und was nicht? Weshalb sollte ich nicht so sein, wie ich wirklich bin, und mich lediglich mit jenen zusammentun, die meine Art und Weise, mir jene Dinge zu beschaffen, nach denen ich strebe, mit mir teilen, und warum sollte ich sie nicht gemeinsam mit ihnen genießen, ohne uns von der Zustimmung der anderen abhängig zu machen?
Wenn ich wirklich frei und aus ganzem Wesen Mensch bin, so de Sade, bin ich nicht von der Erlaubnis des anderen abhängig. Als erwachsener Mensch kann ich selbst entscheiden, was gut oder schlecht für mich ist, und mich auf die Suche danach machen.
Nietzsche (1844–1900) prägte den Begriff vom »Übermenschen«. (Gelänge es dem Menschen, über sich hinauszuwachsen, wäre er nicht länger von anderen abhängig.) Er behauptet, dass die höherstehenden Wesen nicht auf andere angewiesen sind, um den Hunger zu stillen, von dem bei Kant die Rede ist. Für Nietzsche werden Besitz, Anerkennung und Macht nicht durch den wohlwollenden Blick des anderen oder durch adäquate gesellschaftliche Anpassung erreicht, sondern schlicht und einfach, indem man darum kämpft und diesen Kampf gewinnt.
Nietzsche sagt sinngemäß: Meine Artgenossen sind stets Rivalen oder Vasallen. Wenn ich ein Interesse, einen Wunsch, eine Sehnsucht verfolge und dabei einem anderen begegne, der denselben Wunsch hegt, dann hat dieser zwei Möglichkeiten: Schließt er sich mit mir zusammen, ist er ein Vasall; möchte er das nicht, wird er zum Feind. Wenn ich unter Vasallen und Rivalen lebe, verändere und manipuliere ich entweder die Umwelt, damit sie zu meinem Vasallen wird (Machiavelli), oder aber ich trete in direkte Rivalität zum anderen und kämpfe, bis ich ihn besiegt habe.
Doch Nietzsche geht fehl, wenn er jedes Miteinander ausschließt. Er hält den Kampf um Besitz für unvermeidlich und schließt daraus, dass die Welt den Starken gehört, jenen, die sich dem Kampf stellen und als Sieger aus ihm hervorgehen. Im Einklang damit etabliert er eine Herrenmoral und eine Sklavenmoral. Die Herrenmoral ist die Moral dessen, der seiner eigenen Natur, seinen eigenen Wünschen treu bleibt. Die Sklavenmoral hingegen ist die Moral jener, die um ihre Schwäche wissen und sich deshalb mit anderen zusammenschließen, um des reinen Überlebens willen.
Für Nietzsche entwickeln die Sklaven »minderwertige« Empfindungen wie Mitleid und Erbarmen aus der Angst heraus, eines Tages selbst in der Rolle des Leidtragenden zu sein. Für ihn funktioniert Barmherzigkeit aus dieser Sklavenmoral heraus. Die Moral des Übermenschen hingegen, wie er sie nennt, ist eine Moral, die sich nicht von der Zustimmung oder Ablehnung des anderen abhängig macht, wie dies schon de Sade darlegte, sondern unabhängig von der Zustimmung oder Erlaubnis der übrigen ihren eigenen Prinzipien treu bleibt.
Wenn Nietzsche von der Moral des Übermenschen spricht, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder in Einsamkeit herrschen oder den unterwerfen, der sich dem entgegenstellt. In die erste Person gesetzt, hieße das: Ich bin ganz bei mir; ich weiß, was ich will, ich weiß, wohin ich will, und behellige niemanden; aber wenn du dich mir entgegenstellst, unterwerfe oder vernichte ich dich.
Folgen wir Nietzsche, gab sich die Gesellschaft seiner Zeit, die er bürgerliche Gesellschaft nennt, mit der Sklavenmoral zufrieden, also damit, die Schwachen zu schützen, die bequemste Haltung einzunehmen und sich mit den anderen zusammenzutun, um stark zu sein.
Es liegt auf der Hand, dass Nietzsche hier im Widerspruch zu Hobbes steht. Ein Anhänger von Hobbes, der den Zarathustra läse, würde sagen, wenn der Übermensch seiner Natur freien Lauf lasse, vernichte er die anderen.
Nietzsche sagt:
Das Individuum ist etwas Absolutes, alle Handlungen ganz sein eigen. Die Werthe für seine Handlungen entnimmt er zuletzt doch sich selber; weil er auch die überlieferten Worte sich ganz individuell deuten muss.[*]
Alle diese Philosophen vertreten die Überzeugung, dass das Leben in Gesellschaft ein anerzogenes und folglich unnatürliches Verhalten ist, unabhängig davon, ob man nun seine ungesellige Natur bekämpft, in der Annahme, dass der Mensch in völliger Freiheit seinen Nächsten am Ende töten würde, oder ob man sie eher glorifiziert, weil man der Ansicht ist, dass der freie Mensch sein Leben lebt, ohne einen anderen zu stören.
Gegenüber dieser scheinbar unanfechtbaren Position ergeben sich die folgenden Alternativen:
Entweder ich akzeptiere das Streben des Menschen nach Vereinzelung, seiner unerträglichen Verletzlichkeit zum Trotz, und finde mich mit dem Gedanken ab, dass ich aus Vernunftgründen auf meine egoistischen Bedürfnisse verzichte, um mit den anderen zusammenleben zu können, von denen ich auf die eine oder andere Weise abhängig bin.
Oder ich komme zu dem Schluss, dass ich davon absehe, mich mit den anderen zusammenzutun, weil ich mir selbst genüge, und verzichte auf das Bedürfnis, mich an jemanden zu binden, der sich um mich kümmert. Wenn ich meine Unsicherheiten beherrsche, so meine Einstellung, besteht keinerlei Notwendigkeit, in Gesellschaft zu leben.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Anfang des 18. Jahrhunderts kam Rousseau (1712–1778) und revolutionierte alle bisherigen Denkweisen. Denn Rousseau ist der Erste seiner Zeit, der sagt: Es stimmt, dass sich der Mensch mit anderen zusammentut, um zu jagen, um stärker zu sein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Doch manchmal geht er auch Verbindungen ein, ohne einen besonderen Grund. Rousseau stellt sich die Frage, was den Menschen noch dazu bringt, sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Und er kommt zu dem Schluss, dass es in der Natur des Menschen liegt.
Im Unterschied zu den anderen Philosophen kommt Rousseau zu dem Ergebnis, dass der Mensch von Natur aus keineswegs Einzelgänger, sondern vielmehr ein soziales Herdenwesen ist. Für ihn ist das, was zuvor für die ungesellige, barbarische Natur des Menschen gehalten wurde, Ausdruck seiner Entfremdung von der Gesellschaft. Sie scheint ihm als Resultat nachgeordnet, nicht als gegebene Verfassung.
Andererseits sagt Rousseau, dass das Individuum zwei Formen der Liebe kennt: Das, was wir heute Eitelkeit nennen würden, nennt er Eigenliebe, und, was wir heute Selbstwertgefühl nennen würden, Selbstliebe. Die Eitelkeit treibt mich dazu, mir das zu beschaffen, was ich benötige, indem ich den anderen benutze. Ich benutze den anderen, um in den Genuss von etwas zu gelangen. Ich strebe nach Ruhm (Kant), um mich gut zu fühlen, und wende mich dann dem anderen zu, damit er mir Ehre erweist. Aber ich trete auch in Beziehung zum anderen, weil ich das Bedürfnis habe, von ihm geachtet zu werden und so mein Selbstwertgefühl zu steigern.
Rousseau setzt seine Gedanken in Bezug zu der aristotelischen Auffassung, dass ein Mensch, der nicht erkennt, dass er zum Leben die Gesellschaft braucht (oder der nicht in Gesellschaft lebt), entweder ein Tier oder aber ein Gott ist. Schon Nietzsche hatte diesen Satz des Aristoteles (384–322 v.C.) bejaht: So lasst uns Götter sein, die der anderen nicht bedürfen. Rousseau hingegen sagt: Wir sind weder Tiere noch Götter, wir sind Menschen, und deshalb sind wir notwendigerweise auf die Anerkennung durch andere angewiesen. Er bezieht sich dabei auf die Figur des Aristophanes in Platons (428–348 v.C.) Gastmahl. Dieser fühlt sich unvollkommen und strebt nach Besitz, militärischen Erfolgen und Liebespartnern. Er hat Kinder und fühlt sich doch nie zufrieden, bis er sich eines Tages zu Tisch setzt und jemand zu ihm sagt: »Du bist Aristophanes, ich kenne dich.« Als der andere das sagt, fühlt sich Aristophanes endlich als ein Ganzes.
Aristophanes versinnbildlicht hier einen Mangel, der nur verschwindet, wenn dich jemand erkennt. Rousseau ist der Ansicht, dass der Mensch sich mit anderen zusammentut, weil er sich ohne die anderen verstümmelt fühlt. Der große Unterschied zu Kant und La Bruyère ist, dass für Rousseau diese Unvollkommenheit Teil der menschlichen Natur ist.
Rousseau ist der Erste, der sagt:
Es liegt in der Natur des Menschen, sich alleine unvollkommen zu fühlen.
Rousseau schreibt: Der wilde Mensch lebt in sich, der gesellige hingegen ist immer außer sich und lebt nur in der Meinung, die andere von ihm haben.
Dieser Gedanke ist so machtvoll und so revolutionär in der Philosophiegeschichte, dass er das politische Denken veränderte.
Ich bin unvollständig ohne den anderen; ich kann meinem Leben keinen Sinn geben, wenn ich allein bin – das ist es, was Rousseau sagt.
Rousseaus Ideen finden Eingang in zwei wichtige Strömungen der Moralphilosophie. Da sind zum einen die Theorien von Adam Smith (1723–1790), Moralphilosoph und Nationalökonom, der sich maßgeblich mit der Evolution der Menschheit und gesellschaftlichen Prozessen beschäftigte. Er entwickelt den Gedanken von der Notwendigkeit der Billigung: Smith zufolge genügt es nicht, dass der andere da ist und uns anerkennt; wir sind auch darauf angewiesen, dass er unser Handeln billigt. Sein gesamtes ökonomisches Modell beruht auf der Annahme, dass der Mensch nicht nach Besitz strebt, um Reichtum zu erwerben, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass man sich durch Besitz Wohlwollen und Billigung der anderen verdient. Anstatt im Besitz ein Grundbedürfnis des Menschen zu sehen, hält er es für ein Mittel, sich zu vervollkommnen.