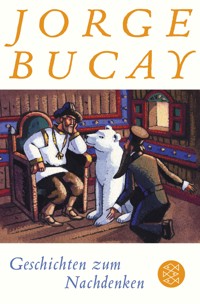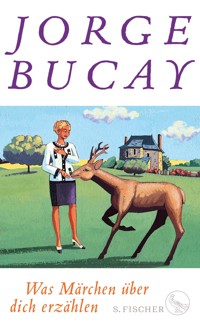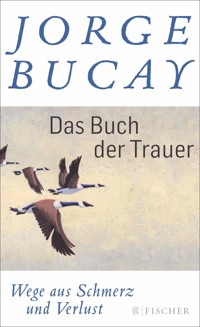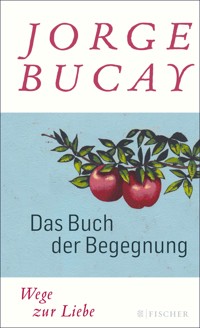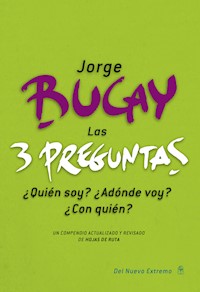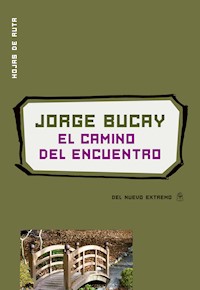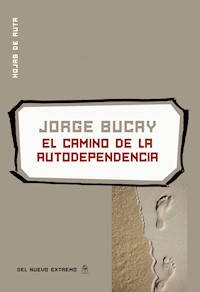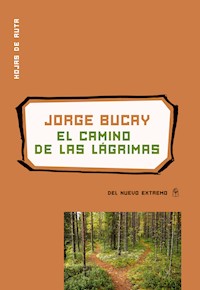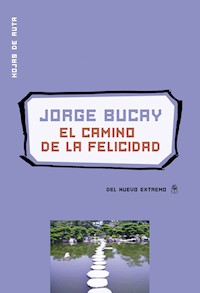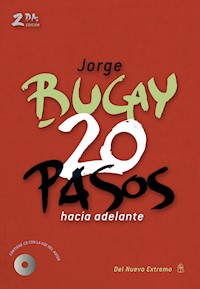9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie begegnet man den Wirrnissen des Lebens? Mit Geschichten, sagt Jorge Bucay. Der angesehene Psychiater und Gestalttherapeut hat die Gabe, das Komplizierte einfach werden zu lassen. Seine zauberhaften Geschichten sind eine Anleitung für alle, die sich selbst helfen wollen, das Leben und sich selbst besser zu verstehen. »Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen – Erwachsenen, damit sie aufwachen.« Das Leben ist eine komplizierte Angelegenheit. Es stellt uns Fragen, auf die wir alleine keine Antworten finden, es ruft Ängste, Probleme, Sorgen und Unsicherheiten hervor. Nicht so sehr jedoch für Jorge Bucay, der als Psychotherapeut das Schwierige erklären muss. Er weiß, wie er denen helfen kann, die ihm gegenüber sitzen – mit handverlesenen Geschichten: Zen-Weisheiten aus Japan und China, Sagen der klassischen Antike, Märchen aus aller Welt, sephardische Legenden, Sufi-Gleichnisse, selbst Erfundenes. Die packenden und lehrreichen Erzählungen von Jorge Bucay geben Denkanstöße und vermitteln wertvolle Lebensweisheiten für alle, die dem Leben noch einmal und immer wieder neu begegnen wollen. »Jorge Bucays Bücher machen Menschen glücklich, die kleine Prinzen suchen, die ihnen neue Wege durchs unübersichtliche Leben weisen« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jorge Bucay
Komm, ich erzähl dir eine Geschichte
Aus dem Spanischen von Stephanie von Harrach
Fischer e-books
Für meine Tochter Claudia
Der angekettete Elefant
Ich kann nicht«, sagte ich. »Ich kann es einfach nicht.«
»Bist du sicher?« fragte er mich.
»Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzustellen und ihr zu sagen, was ich fühle … Aber ich weiß, daß ich es nicht kann.«
Der Dicke setzte sich im Schneidersitz in einen dieser fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzimmer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme wie immer, wenn er wollte, daß man ihm aufmerksam zuhörte, und sagte:
»Komm, ich erzähl dir eine Geschichte.«
Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwarten, begann er zu erzählen.
Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert, und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet.
Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, daß ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte.
Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute.
Was hält ihn zurück?
Warum macht er sich nicht auf und davon?
Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei.
Meine nächste Frage lag auf der Hand: »Und wenn er dressiert ist, warum muß er dann noch angekettet werden?«
Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten.
Vor einigen Jahren fand ich heraus, daß zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden:
Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist.
Ich schloß die Augen und stellte mir den wehrlosen neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, daß er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt.
Ich stellte mir vor, daß er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert, und am nächsten Tag wieder, und am nächsten … Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt.
Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, daß er es nicht kann.
Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt.
Und das Schlimme dabei ist, daß er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat.
Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen.
»So ist es, Demian. Uns allen geht es ein bißchen so wie diesem Zirkuselefanten: Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an Hunderte von Pflöcken gekettet.
Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal, vor sehr langer Zeit, damals, als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind.
Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant, und auch in unser Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt: Ich kann das nicht, und ich werde es niemals können.
Mit dieser Botschaft, der Botschaft, daß wir machtlos sind, sind wir groß geworden, und seitdem haben wir niemals mehr versucht, uns von unserem Pflock loszureißen.
Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns der Pflock in den Blick, und wir denken: Ich kann nicht, und werde es niemals können.«
Jorge machte eine lange Pause. Dann rückte er ein Stück heran, setzte sich mir gegenüber auf den Boden und sprach weiter:
»Genau dasselbe hast auch du erlebt, Demian. Dein Leben ist von der Erinnerung an einen Demian geprägt, den es gar nicht mehr gibt und der nicht konnte.
Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas kannst oder nicht, ist, es auszuprobieren, und zwar mit vollem Einsatz. Aus ganzem Herzen!«
Verallgemeinerungsfaktor
Als ich zum ersten Mal in Jorges Sprechstunde ging, wußte ich, daß ich es nicht mit einem gewöhnlichen Psychotherapeuten zu tun haben würde. Claudia, die ihn mir empfohlen hatte, hatte mich gewarnt, daß »der Dicke«, wie sie ihn nannte, »etwas speziell« sei.
Ich hatte die Nase bereits voll von den konventionellen Therapien, besonders davon, mich monatelang auf der Couch eines Psychoanalytikers herumzulangweilen. Also rief ich Jorge an und bat um einen Termin.
Mein erster Eindruck übertraf all meine Erwartungen. Es war ein warmer Frühlingstag. Ich war fünf Minuten zu früh und wartete noch ein Weilchen vor der Haustür.
Punkt halb vier klingelte ich. Der Türöffner summte, ich trat ein und fuhr hinauf in den neunten Stock.
Oben im Gang wartete ich.
Ich wartete.
Und wartete.
Als ich das Warten leid war, klingelte ich an der Praxistür.
Die Tür wurde von einem Kerl geöffnet, der aussah, als wollte er gerade zu einem Picknick gehen: Er trug Jeans, Tennisschuhe und ein knallrotes Freizeithemd.
»Hallo«, sagte er. Ich muß zugeben, sein Lächeln beruhigte mich einigermaßen.
»Hallo«, antwortete ich. »Ich bin Demian.«
»Ja, das weiß ich. Was ist passiert? Warum bist du so spät? Hast du dich verlaufen?«
»Nein, ich war pünktlich da. Ich wollte nur nicht klingeln, um nicht zu stören, ich dachte, du hättest vielleicht noch einen Patienten.«
»Um nicht zu stören«, äffte er mich nach und schüttelte besorgt den Kopf. Und wie um mich aus der Reserve zu locken, sagte er: »Also müssen die Dinge zu dir kommen.«
Ich ging nicht weiter darauf ein.
Es war sein zweiter Satz, und sicher war etwas dran an dem, was er sagte, aber … So ein verdammter Hurensohn!
Der Raum, in dem Jorge seine Patienten empfing und den ich nicht unbedingt Sprechzimmer nennen würde, war genau wie er: informell, unordentlich, chaotisch, warm, kunterbunt, unberechenbar und, warum es leugnen, ein bißchen schmuddelig. Wir setzten uns auf zwei Sessel einander gegenüber, und während ich ihm dies und das erzählte, trank Jorge Mate. Ja, mitten in der Sitzung trank er seinen Matetee.
Er bot mir welchen an.
»Gut«, sagte ich.
»Was ist gut?«
»Der Mate … «
»Ich verstehe nicht.«
»Gut, ich nehme einen Mate.«
Jorge machte eine übertriebene Verbeugung und sagte:
»Vielen Dank, Majestät, daß Ihr meinen Mate annehmt … Warum sagst du nicht frei heraus, ob du einen Mate willst oder nicht, anstatt so zu tun, als tätest du mir einen Gefallen?«
Dieser Mann würde mich schnurstracks in den Wahnsinn treiben.
»Ja!« sagte ich.
Und da überreichte mir der Dicke tatsächlich einen Mate.
Ich beschloß also, noch ein Weilchen zu bleiben.
Neben tausend anderen Dingen erzählte ich ihm, daß irgend etwas mit mir wohl nicht ganz stimme, denn ich hätte Schwierigkeiten in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen.
Jorge fragte mich, wie ich denn darauf käme, daß das Problem bei mir liege.
Ich erzählte ihm, zu Hause hätte ich Schwierigkeiten mit meinem Vater, meiner Mutter, auch mit meinem Bruder und mit meiner Freundin … Und daß das Problem daher ja wohl ganz offensichtlich bei mir liege. Das war das erste Mal, daß mir Jorge eine Geschichte erzählte.
Mit der Zeit erfuhr ich, daß der Dicke Fabeln liebte, Parabeln, Märchen, kluge Sätze und gelungene Metaphern. Seiner Meinung nach war der einzige Weg, etwas zu begreifen, ohne die Erfahrung am eigenen Leib machen zu müssen, der, ein konkretes symbolisches Abbild für das Ereignis zu haben.
»Eine Fabel, ein Märchen oder eine Anekdote«, bekräftigte Jorge, »kann man sich hundertmal besser merken als tausend theoretische Erklärungen, psychoanalytische Interpretationen oder formale Lösungsvorschläge.«
An diesem Tag sagte mir Jorge, es könne da womöglich etwas in mir leicht aus dem Takt geraten sein, aber er fügte hinzu, daß meine Schlußfolgerung, mich selbst für alles verantwortlich zu machen, gefährlich sei, denn es spreche nichts dafür. Und dann erzählte er mir eine dieser Geschichten, von denen man nie weiß, ob er sie tatsächlich selbst erlebt hat oder ob sie einfach seiner Phantasie entsprungen sind:
Mein Grossvater war ein ziemlicher Säufer.
Am liebsten trank er türkischen Anisschnaps.
Er trank Anis und fügte Wasser hinzu, um ihn zu verdünnen, aber trotzdem wurde er betrunken.
Also trank er Whisky mit Wasser und wurde betrunken.
Er trank Wein mit Wasser und wurde betrunken.
Bis er eines Tages beschloß, es seinzulassen.
Und er verzichtete … auf das Wasser.
Brust oder Milch
Nicht in jeder Sitzung erzählte Jorge eine Geschichte, aber aus irgendeinem Grund erinnere ich mich an fast jede einzelne der Geschichten, die er mir in den anderthalb Jahren meiner Therapie erzählt hat. Vielleicht hatte er recht, wenn er behauptete, dies sei die beste Methode, etwas zu kapieren.
Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem ich ihm sagte, daß ich mich sehr abhängig von ihm fühle. Ich erzählte ihm, wie sehr mich das störe und wie ich gleichzeitig nicht auf das verzichten könne, was er mir in jeder Sitzung mit auf den Weg gab. Nach meinem Eindruck hatten meine Bewunderung und Zuneigung für Jorge bewirkt, daß ich extrem von seinem Blick abhängig war und mich viel zu stark an die Therapie gebunden sah.
Du hast Hunger zu lernen
Hunger zu wachsen
Hunger zu wissen
Hunger zu fliegen …
Vielleicht bin ich heute
die Brust
die jene Milch gibt
die deinen Hunger stillt …
Es scheint mir wunderbar, daß du nun
nach dieser Brust verlangst.
Aber vergiß eins nicht:
Es ist nicht die Brust, die nährt,
es ist die Milch!
Der Bumerangziegel
An diesem Tag war ich sehr aufgebracht. Ich hatte schlechte Laune, und alles ging mir auf die Nerven. Mein Verhalten im Sprechzimmer war gereizt und wenig produktiv. Alles, was ich tat, und alles, was ich besaß, war mir verhaßt. Vor allem aber war ich wütend auf mich selbst. Wie in der Geschichte von Papini, die Jorge an diesem Tag für mich bereithielt, hatte ich das Gefühl, mich selbst nicht ertragen zu können.
»Ich bin ein Idiot«, sagte ich, mehr zu mir selbst. »Ein Riesenesel … Ich hasse mich.«
»Na schön, Demian, die Hälfte der Anwesenden in diesem Sprechzimmer haßt dich. Die andere wird dir eine Geschichte erzählen.«
Es war einmal ein Mann, der ging mit einem Ziegelstein in der Hand durch die Welt. Er hatte beschlossen, jedem, der ihm quer kam und ihn zur Weißglut brachte, einen Schlag mit dem Ziegelstein zu verpassen. Etwas barbarisch, diese Methode, aber wirkungsvoll, nicht wahr?
Eines Tages lief ihm ein ziemlich arroganter Freund über den Weg, der ihm etwas unmanierlich daherkam. Seiner Maßregel getreu, griff der Mann nach seinem Ziegel und warf ihn.
Ich weiß nicht, ob er getroffen hat, Tatsache ist, daß er anschließend den Ziegelstein wieder holen gehen mußte, und das war ihm lästig. Also setzte er alles daran, das »System zur Wiedererlangung des Ziegelsteins«, wie er es nannte, zu verbessern. Er band den Ziegelstein an eine Schnur von einem Meter Länge und trat damit auf die Straße. Das System hatte den Vorteil, daß sich der Ziegelstein nie allzu weit entfernte, aber bald stellte sich heraus, daß die neue Methode auch ihre Mängel hatte: Einerseits durfte sich die feindliche Zielperson nicht weiter als einen Meter von ihm entfernt aufhalten, andererseits mußte er, nachdem er den Ziegelstein geworfen hatte, die Schnur wieder aufwickeln, weil sie sich oft verwirrte und verknotete, was noch zusätzliche Mühen mit sich brachte.
Also machte sich der Mann an die Entwicklung des »Systems Ziegel III«. Im Mittelpunkt stand weiterhin besagter Ziegelstein, aber dieses System war, statt mit einer Schnur, mit einer Sprungfeder ausgestattet. Der Ziegelstein konnte also unendlich oft abgeworfen werden und kam jedesmal von selbst zurück. So war es zumindest geplant.
Als der Mann mit dem neuen Modell auf die Straße trat und sich der ersten Anfechtung ausgesetzt sah, warf er den Ziegel. Er hatte sich verkalkuliert, der Stein verfehlte sein Ziel, und nachdem sich die Feder ausgelöst hatte, kam der Ziegel zurück und traf unseren Mann genau am Kopf.
Er versuchte es noch einmal und verpaßte sich einen zweiten Ziegelschlag – er hatte die Entfernung falsch berechnet.
Einen dritten, weil er den Stein zu zeitig losgeschleudert hatte.
Ein vierter Versuch war von besonderer Natur, denn nachdem der Mann sich einmal für ein Opfer entschieden hatte, wollte er es zugleich vor seinem eigenen Angriff schützen, und so traf der Stein wiederum ihn selbst am Kopf.
Wo er eine riesige Beule verursachte.
Er fand nie heraus, warum es ihm nicht gelingen wollte, jemandem einen Ziegelstein an den Kopf zu werfen: lag es an den vielen Schlägen, die er selbst hatte einstecken müssen, oder an irgendeiner seelischen Deformation?
Alle ausgeteilten Schläge trafen stets ihn selbst.
»Einen solchen Mechanismus nennt man Retroflexion. Dabei handelt es sich im großen und ganzen darum, andere vor unserer eigenen Aggression zu bewahren. In solchen Fällen hält unsere aggressive feindliche Energie, bevor sie den anderen erreicht, vor einer Barriere inne, die wir uns selbst auferlegt haben. Diese Barriere fängt den Aufprall nicht ab, sondern schickt die Energie einfach retour. Und all die Wut, der Mißmut, all die Aggressionen fallen auf uns selbst zurück in Form von echtem autoaggressivem Verhalten, wie Selbstverstümmelung, Freßanfällen, Drogenkonsum oder übertriebener Risikofreude, und in anderen Fällen über unterdrückte Gefühle oder Emotionen, wie Depressionen, Schuldgefühle oder psychosomatische Erkrankungen.
Sehr wahrscheinlich würde ein aufgeklärtes menschliches Phantasiewesen, das ein bißchen auf Draht ist und fest im Leben steht, nie wütend werden. Es wäre natürlich wunderbar, wenn man sich gar nicht erst aufregen müßte, und trotzdem, wenn Wut, Haß oder Überdruß einen überkommen, ist der einzige Weg, sie wieder loszuwerden, der, sie in Handlung umzusetzen. Das Gegenteil bewirkt früher oder später nur, daß man wütend auf sich selbst wird.«
Der wahre Wert des Rings
Wir hatten darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Anerkennung und Wertschätzung von außen zu bekommen. Jorge hatte mir Maslows Theorie der hierarchisch angeordneten Bedürfnisse erklärt.
Wir alle gründen unsere Selbsteinschätzung darauf, wie sehr wir von anderen gemocht und respektiert werden. An diesem Tag hatte ich mich darüber beklagt, weder von meinen Eltern richtig für voll genommen zu werden, noch als der beste Kumpel meiner Freunde zu gelten und auch auf der Arbeit nicht die rechte Anerkennung zu bekommen.
»Es gibt da eine alte Geschichte«, sagte der Dicke und reichte mir den Mate, damit ich ihn aufgoß, »die handelt von einem jungen Mann, der einen Weisen um Hilfe ersucht. Dein Problem scheint mir dem seinen zu ähneln.«
»Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, daß ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz, was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben?«
Ohne ihn anzusehen, sagte der Meister: »Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muß. Vielleicht danach … «
Er machte eine Pause und fügte dann hinzu: »Wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluß eventuell deines Problems annehmen.«
»S … sehr gerne, Meister«, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hintangestellt wurden.
»Also gut«, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte: »Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muß diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du mußt unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen, und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück.«
Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte.
Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab, und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, daß ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu einen Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren, und lehnte das Angebot ab.
Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte – und das waren nicht weniger als hundert –, stieg er, von seinem Mißerfolg vollkommen niedergeschlagen, auf sein Pferd und kehrte zurück.
Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte.
Er betrat das Zimmer.
»Meister«, sagte er, »es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen.«
»Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund«, antwortete der Meister mit einem Lächeln. »Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Rings besser einschätzen als er? Sag ihm, daß du den Ring verkaufen möchtest, und frag ihn, wieviel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet: Du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück.«
Und erneut machte sich der Junge auf den Weg.
Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe, er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte:
»Mein Junge, richte dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als achtundfünfzig Goldstücke für seinen Ring geben.«
»Achtundfünfzig Goldstücke?« rief der Junge aus.
»Ja«, antwortete der Schmuckhändler. »Ich weiß, daß man mit etwas Geduld sicherlich bis zu siebzig Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist … «
Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war.
»Setz dich«, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. »Du bist wie dieser Ring: ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, daß jeder x-beliebige um deinen Wert weiß?«
Und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand.
Der launenhafte König
Als ich den Mund aufmachte, fiel mir auf, wie hastig ich sprach. Ich war euphorisiert. Während meines Gesprächs mit Jorge wurden mir allmählich bewußt, was ich während der Woche alles getan hatte.
Wie so manches Mal fühlte ich mich wie ein unschlagbarer Supermann, ein wahres Glückskind. Voll motiviert und strotzend vor Energie erzählte ich dem Dicken von meinen Plänen für die nächsten Tage.
Der Dicke lächelte fröhlich und komplizenhaft.
Ich hatte wie immer den Eindruck, daß dieser Mann mich in all meinen Seelenzuständen begleitete, mochten sie sein, wie sie wollten. Daß ich meine Freude mit Jorge teilen konnte, war ein weiterer Grund für mein Glück. Alles lief bestens, und ich schmiedete weiter Pläne. Für all das, was ich mir vorgenommen hatte, würden zwei Leben kaum ausreichen.
»Soll ich dir eine Geschichte erzählen?« fragte Jorge.
Obwohl ich mich kaum konzentrieren konnte, hörte ich zu.
Es war einmal ein sehr mächtiger König, der regierte in einem fernen Land. Er war ein guter König, aber es gab da ein Problem: Er besaß zwei Persönlichkeiten.
Es gab Tage, da erwachte er voller Überschwang, euphorisch und glücklich.
Solche Tage waren vom ersten Glockenschlag an wunderbar. Die Gärten seines Palastes waren schön wie nie. Seine Dienerschaft schien wie ausgewechselt, so ausgesucht höflich und tüchtig war sie.
Beim Frühstück fand er bestätigt, daß in seinem Königreich das beste Mehl verarbeitet und die besten Früchte geerntet wurden.
An solchen Tagen senkte der König die Steuern, teilte den Staatsschatz neu auf, gab Anträgen statt und sorgte für einen friedlichen Lebensabend der Alten. An solchen Tagen gewährte der König seinen Freunden und Untertanen jede Bitte.
Aber es gab auch ganz andere Tage.
Das waren schwarze Tage. Schon am Morgen hatte er dann das Gefühl, daß er lieber noch ein bißchen länger im Bett geblieben wäre. Wenn ihm das klar wurde, war es allerdings schon zu spät und die Träume bereits verflogen.
Sosehr er sich auch bemühte, er konnte einfach nicht verstehen, warum seine Bediensteten so übellaunig und unaufmerksam ihm gegenüber waren. Die Sonne störte ihn noch mehr als der Regen. Das Essen war lauwarm und der Kaffee zu kalt. Und schon allein die Vorstellung, Besucher zu empfangen, verschlimmerte seine Kopfschmerzen.
An solchen Tagen erinnerte sich der König der Versprechungen, die er zu anderen Zeiten gemacht hatte, und erschrak beim Gedanken daran, wie er sie einlösen solle. Dies waren die Tage, an denen der König Steuererhöhungen anordnete, Ländereien beschlagnahmte und seine Widersacher verhaften ließ …
Aus Angst vor Gegenwart und Zukunft und heimgesucht von den Irrtümern der Vergangenheit, regierte er an solchen Tagen gegen sein Volk, und das meistgebrauchte Wort an diesen Tagen war »nein«.
Als ihm bewußt wurde, in welch mißliche Lage ihn seine Stimmungsschwankungen brachten, rief der König die Weisen, Magier und Zauberer aus dem gesamten Königreich zusammen.
»Herrschaften«, sagte er, »Sie alle kennen meine Launen. Sie alle haben von meinem Überschwang profitiert und unter meinen Ausfällen gelitten. Derjenige, der am meisten darunter leidet, bin allerdings ich selbst, denn Tag um Tag bin ich damit beschäftigt, den Schaden wettzumachen, den ich angerichtet habe, wenn ich die Dinge mal wieder mit anderen Augen sah.
Ich möchte, daß Sie zusammenarbeiten, um eine Kur zu finden, sei es nun ein Heiltrunk oder eine Zauberformel, die verhindert, daß ich einmal so überaus optimistisch bin und jedes Risiko auf mich nehme und dann wieder so kleinlich schwarzseherisch werde und beginne, diejenigen zu quälen und zu unterdrücken, die mir lieb sind.«
Die Weisen nahmen die Herausforderung an und befaßten sich wochenlang intensiv mit dem Problem des Königs. Dennoch, keine Alchemie, keine Zauberkraft und kein Kraut konnte eine Lösung für die gestellte Aufgabe erbringen.
Also traten die Weisen vor den König und gestanden ein, daß sie gescheitert waren.
In dieser Nacht weinte der König bitterlich.
Am nächsten Morgen bat ein fremder Besucher, beim König vorsprechen zu dürfen. Es war ein seltsamer, dunkelhäutiger Mann, gehüllt in eine zerschlissene Tunika, die vielleicht einst weiß gewesen war.
»Majestät«, sagte der Mann und verbeugte sich. »Dort, wo ich herkomme, spricht man von Eurer Unbill und davon, wie sehr sie Euch quält. Ich bin gekommen, Euch das Gegenmittel zu bringen.«
Er neigte den Kopf und reichte dem König ein kleines Lederkästchen.
Der König öffnete es überrascht und erwartungsvoll und sah hinein. Darinnen fand er nichts als einen einfachen Silberring.
»Danke«, sagte der König begeistert. »Ist das ein Zauberring?«
»Gewiß ist er das«, antwortete der Reisende, »aber seine Wirkung tritt erst in Kraft, wenn man ihn am Finger trägt.
Jeden Morgen, gleich beim Aufstehen, müßt Ihr die Inschrift lesen und Euch jedesmal, wenn Ihr den Ring anschaut, an sie erinnern.«
Der König nahm den Ring aus dem Kästchen und las laut vor:
Sei dir bewußt, daß auch dies vergänglich ist.
Die Fröschlein in der Sahne
Ich steckte mitten in den Prüfungen. Ich hatte mich für zwei im Nebenfach und eine im Hauptfach angemeldet. Der nächste Termin stand mir in einer Woche bevor, und dafür blieb noch viel zu tun.
»Ich schaff das nicht«, sagte ich zu Jorge. »Es ist reine Energieverschwendung, sich mit etwas aufzuhalten, das sowieso aussichtslos ist. Am besten gehe ich einfach mit dem Wissen in die Prüfung, das ich jetzt habe. Dann habe ich wenigstens nicht die ganze Woche mit Lernen vergeudet, wenn sie mich schließlich doch nur durchfallen lassen.«
»Kennst du die Geschichte von den zwei Fröschlein?« fragte mich da der Dicke.
Es waren einmal zwei Frösche, die fielen in den Sahnetopf.
Sofort dämmerte ihnen, daß sie ertrinken würden: Schwimmen oder sich einfach treiben lassen war in dieser zähen Masse unmöglich. Am Anfang strampelten die Frösche wie wild in der Sahne herum, um an den Topfrand zu gelangen. Aber vergebens, sie kamen nicht vom Fleck und gingen unter. Sie spürten, wie es immer schwieriger wurde, an der Oberfläche zu bleiben und Atem zu schöpfen.
Einer von ihnen sprach es aus: »Ich kann nicht mehr. Hier kommen wir nicht raus. In dieser Brühe kann man nicht schwimmen. Und wenn ich sowieso sterben muß, wüßte ich nicht, warum ich mich noch länger abstrampeln sollte. Welchen Sinn kann es schon haben, aus Erschöpfung im Kampf für eine aussichtslose Sache zu sterben?«
Sagte es, ließ das Paddeln sein und ging schneller unter, als man gucken konnte, buchstäblich verschluckt vom dickflüssigen Weiß.
Der andere Frosch, von hartnäckigerer Natur, vielleicht auch nur ein Dickkopf, sagte sich: »Keine Chance. Aussichtslos. Aus diesem Bottich führt kein Weg heraus. Trotzdem werde ich mich dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern kämpfen, bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes Stündlein nicht geschlagen hat, werde ich keine Sekunde herschenken.«
Es strampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde auf derselben Stelle, ohne vorwärtszukommen.
Und von all dem Strampeln und die Beinchen Schwingen, Paddeln und Treten verwandelte sich die Sahne allmählich in Butter.
Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte zappelnd an den Rand des Topfes. Von dort aus konnte er fröhlich quakend nach Hause hüpfen.
Der Mann, der glaubte, er sei tot
Ich weiß, daß ich noch über die Geschichte mit den Fröschen nachdachte.
»Das ist wie in dem Gedicht von Almafuerte«, sagte ich. »Gib dich nicht verloren, selbst wenn du verloren bist.«
»Kann sein«, sagte der Dicke. »Ich glaube allerdings, hier geht es eher um so etwas wie ›Gib dich nicht verloren, bevor du verloren bist‹. Oder aber: ›Erklär dich nicht zum Verlierer, bevor der Moment der letzten Abrechnung gekommen ist.‹ Weil … «
Und da war sie schon, die nächste Geschichte.
Es war einmal ein Mann, der enorme Angst vor Krankheiten hatte, und vor allem fürchtete er sich sehr vor dem Tod. Eines Tages kam ihm die verrückte Idee, daß er eventuell schon tot sei. Also fragte er seine Frau: »Sag mal, Frau. Bin ich etwa schon tot?«
Die Frau lachte und riet ihm, zur Probe seine Hände und Füße anzufassen.
»Siehst du? Sie sind warm. Das bedeutet, daß du lebendig bist. Wenn du tot wärst, wären deine Hände und Füße kalt.«
Dem Mann schien die Antwort plausibel, und er beruhigte sich.
Wenige Wochen später, an einem verschneiten Wintertag, ging der Mann zum Brennholzhacken in den Wald. Dort angekommen, zog er die Handschuhe aus und machte sich mit der Axt an den Stämmen zu schaffen.
Gedankenlos wischte er sich mit der Hand über die Stirn und bemerkte, daß sie kalt war. Er erinnerte sich an die Worte seiner Frau, zog Schuhe und Socken aus und fand zu seinem Entsetzen bestätigt, daß auch sie kalt waren.
Da zweifelte er nicht eine Sekunde mehr: Er gestand sich ein, daß er tot war.
»Es ist sehr unvernünftig für einen Toten, hier draußen Holz zu hacken«, sagte er sich. Also ließ er die Axt neben seinem Maultier liegen, streckte sich stumm auf dem gefrorenen Boden aus, faltete die Hände auf der Brust und schloß die Augen.
Kaum lag er da, näherte sich eine Hundemeute seinem Proviantbeutel. Als die Tiere bemerkten, daß nichts und niemand sie daran hinderte, zerfetzten sie den Beutel und verschlangen alles Eßbare darin. Der Mann dachte: ›Glück haben sie, daß ich tot bin. Wäre dem nicht so, würde ich sie höchstpersönlich mit Fußtritten davonjagen.‹
Die Meute schnüffelte weiter herum und entdeckte das an einem Baum festgebundene Maultier. Leichte Beute für die scharfen Zähne der Hunde. Das Maultier brüllte und schlug mit den Hufen aus, der Mann aber dachte nur daran, wie gern er dem Tier geholfen hätte, wenn er bloß nicht tot gewesen wäre.
Innerhalb weniger Minuten war das Maultier mit Haut und Haaren verspeist, und nur ein paar einzelne Hunde nagten noch an dem ein oder anderen Knochen.
Die Meute, deren Hunger nicht zu stillen war, streunte weiter an jenem Ort umher.
Es dauerte nicht lange, da hatte einer der Hunde Menschengeruch gewittert. Er blickte sich suchend um und bemerkte den Holzfäller, der unbeweglich auf dem Boden lag. Der Hund näherte sich behutsam, sehr behutsam, denn er hielt die Menschen für sehr hinterlistig und gefährlich.
Kurz darauf hatte die gesamte Meute mit sabbernden Lefzen den Mann umstellt.
›Jetzt fressen sie mich‹, dachte der Mann. ›Wenn ich nicht tot wäre, würde die Geschichte ganz anders ausgehen.‹
Die Hunde kamen näher …
Und da er sich nicht rührte, fraßen sie ihn auf.
Der Portier des Freudenhauses
Die Hälfte meines Studiums lag hinter mir, und wie viele andere Studenten begann ich plötzlich, meine Entscheidung fürs Studieren zu hinterfragen.
Als ich mit meinem Therapeuten darüber sprach, begriff ich, daß ich selbst derjenige war, der sich unter Druck setzte und sich dazu zwang, das Studium fortzusetzen.
»Das ist das Problem«, sagte der Dicke. »Wenn du weiter glaubst, daß du studieren und den Abschluß machen mußt, besteht keine Aussicht darauf, daß du je Freude daran haben wirst. Und wenn es dir nicht die geringste Freude bereitet, werden dir gewisse Teile deiner Persönlichkeit irgendwann einen Streich spielen.« Bis zum Überdruß wiederholte Jorge, daß er nicht an die Anstrengung glaube. Seiner Meinung nach gab es nichts Nützliches, das man mit Anstrengung erreichen konnte. Meiner Meinung nach täuschte er sich hierbei. Zumindest handelte es sich in meinem Fall um die Ausnahme zur Bestätigung der Regel.
»Aber Jorge, ich kann doch mein Studium nicht so einfach an den Nagel hängen«, sagte ich. »Ich wüßte nicht, wie ich in den Kreisen, in denen ich nun einmal leben werde, ohne Titel jemals etwas darstellen sollte. Ein Studium ist da zumindest so etwas wie eine Garantie.«
»Kann sein«, sagte der Dicke. »Kennst du den Talmud?«
»Ja.«
»Im Talmud gibt es eine Geschichte, in der geht es um einen ganz gewöhnlichen Mann. Er ist Portier in einem Freudenhaus.«
Im gesamten Dorf gab es keinen Beruf, der schlechter bezahlt und angesehen war als der des Freudenhausportiers … Aber was hätte dieser Mann denn sonst tun sollen?
Fakt war, daß er nie schreiben oder lesen gelernt und auch nie eine andere Tätigkeit oder einen anderen Beruf ausgeübt hatte. Er war zu dem Posten gekommen, weil auch schon sein Vater Portier dieses Freudenhauses gewesen war, und vor ihm dessen Vater.