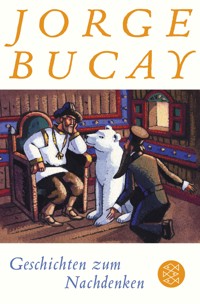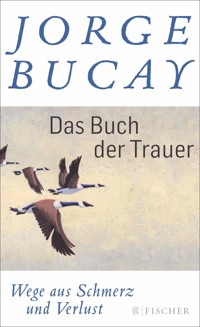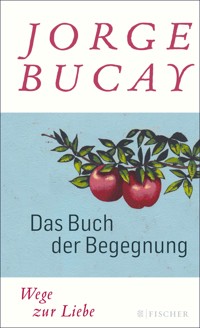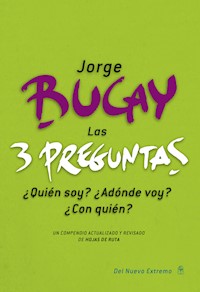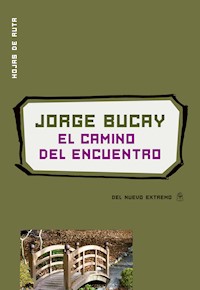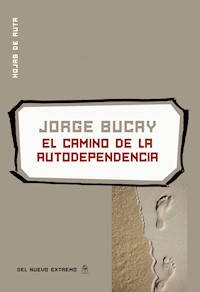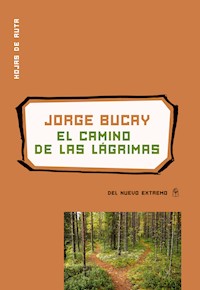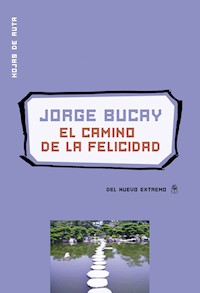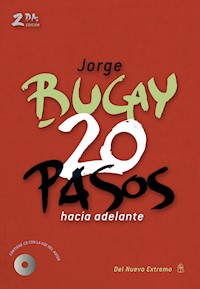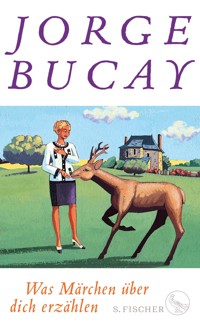
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der große Geschichtenerzähler Jorge Bucay schenkt uns die Märchen unserer Kindheit zurück und eröffnet uns den Zugang zu einem magischen Universum: dem Universum unserer Emotionen. "Emotionen sind das wertvollste und nützlichste Rüstzeug auf unserem Weg zu einem besseren, innerlich reicheren Menschen." Bucay schenkt uns mit seinem neuen Buch die magische Erfahrung, für einen einzigartigen, geschützten Moment wieder das Kind zu sein, das wir einmal waren. Das Kind von damals, das es genoss, wenn sich jemand zu ihm setzte und ihm eine Geschichte erzählte. Von Rotkäppchen über Dornröschen bis zum tapferen Schneiderlein erzählt uns Jorge Bucay die Märchen unserer Kindheit und wagt es, in ihrer Deutung einen Schritt über die althergebrachte 'Moral von der Geschicht' hinauszugehen. Er zeigt uns, wie viel uns Märchen über uns selbst erzählen und schenkt uns wunderbare Lesestunden voller Entschleunigung und Magie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jorge Bucay
Was Märchen über dich erzählen
Geschichten
Über dieses Buch
»Der berühmte Satz ›Es war einmal‹, mit dem die meisten Märchen beginnen, erinnert mich an ein anderes berühmtes Wort: ›Abrakadabra‹. Beides eröffnet uns, jedes auf seine Art, den Zugang zu einem magischen Universum: Es ist das Universum der Emotionen. Emotionen sind das wertvollste und nützlichste Rüstzeug auf unserem Weg zu einem besseren, innerlich reicheren Menschen.«
Jorge Bucay
In »Was Märchen über dich erzählen« erzählt uns Jorge Bucay 15 altbekannte Märchen und Legenden ganz neu und zeigt, wie wir mit jedem Mal nicht nur die Geschichte anders lesen, sondern uns selbst auch besser verstehen lernen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jorge Bucay, 1949 in Buenos Aires, Argentinien, geboren, stammt aus einer Familie mit arabisch-jüdischen Wurzeln und wuchs in einem überwiegend christlichen Viertel von Buenos Aires auf. Er studierte Medizin und Psychoanalyse und ist heute einer der einflussreichsten Gestalttherapeuten des Landes. Mit ›Komm, ich erzähl dir eine Geschichte‹ gelang ihm der internationale Durchbruch. Bucays Bücher wurden in mehr als dreißig Sprachen übersetzt und haben sich weltweit über zehn Millionen Mal verkauft.
Lisa Grüneisen, 1967 geboren, arbeitet seit ihrem Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte als Übersetzerin. Sie übersetzte unter anderem Bücher von Carlos Ruiz Zafón, Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Alberto Manguel und Frida Kahlo.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Motto
Vorwort
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Das Verfahren der Neuinterpretation
Schöpferisches Lesen
1 Das hässliche Entlein
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
2 Aschenputtel
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
3 Dumbo, der fliegende Elefant
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
4 Rotkäppchen
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
5 Amor und Psyche
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
6 Der Rattenfänger von Hameln
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
7 Dornröschen
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
8 Die Geschichte von Adam und Eva
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
9 Das tapfere Schneiderlein
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
10 Die Abenteuer des Pinocchio
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
11 Hänsel und Gretel
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
12 Die kleine Meerjungfrau
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
13 Des Kaisers neue Kleider
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
14 Schneewittchen und die sieben Zwerge
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
15 Die Legende von Odysseus
Einleitung
Die Geschichte
Die Moral
Die andere Tür
Nachwort
Notizen zu einer Recherche
Das hässliche Entlein
Aschenputtel
Dumbo, der fliegende Elefant
Rotkäppchen
Amor und Psyche
Der Rattenfänger von Hameln
Dornröschen
Die Geschichte von Adam und Eva
Das tapfere Schneiderlein
Pinocchios Abenteuer
Hänsel und Gretel
Die kleine Meerjungfrau
Des Kaisers neue Kleider
Schneewittchen und die sieben Zwerge
Odysseus
Ausblick
Der Ursprung der Geschichten
Märchen als Heilmittel
Das Märchen und die Kultur
Bibliographie
Für Benicio,
Lucía, Manuel
und Pedro
Und Rotkäppchen fragte den Wolf, den es für seine Großmutter hielt:
»Warum liest du diese Märchen, wenn du sie schon auswendig kennst?«
Der Wolf erhob sich und antwortete mit heller Stimme:
»Um mich besser kennenzulernen!«
Jorge Bucay, 2017
Vorwort
Als der Verlag mir den Vorschlag machte, klassische Märchen neu zu interpretieren, war ich sofort von der Idee angetan. Das Projekt vereint zwei meiner großen Leidenschaften: Geschichten und Legenden auf ihrem Weg durch Raum und Zeit und mein Bestreben, das menschliche Verhalten zu ergründen und weiterzugeben, was ich auf diesem Weg lerne.
Nach intensivem Gedankenaustausch darüber, welche Märchen ich einer Neubetrachtung unterziehen sollte, fand ich es eine gute Idee und eine spannende Herausforderung, die bekanntesten Märchen und Legenden auszuwählen, bei denen wir so unterschiedlichen Figuren wie Rotkäppchen und Odysseus begegnen.
Als ich dann Informationen über diese Geschichten suchte, entschied ich mich, zunächst von den bekanntesten Versionen auszugehen, um dann weiter in der Zeit zurückzugehen und herauszufinden, wie viel von den jeweiligen Urtexten in jeder Geschichte steckte, und die komplexe Symbolik herauszuarbeiten, die sich in ihnen verbarg und immer noch verbirgt.
Die Idee dieses Projekts ist es, den Blick auf ein knappes Dutzend Märchen zu richten, die jeweilige Geschichte in wenigen Worten nachzuerzählen und dabei auf die Veränderungen einzugehen, die sie seit den ersten Versionen erfahren hat, um sie dann einer neuen Betrachtungsweise zu unterziehen, die es uns ermöglicht, Botschaften in ihr zu entdecken, die über die offensichtlichen, traditionellen Lesarten hinausgehen und uns dazu anregen, auch heute noch unsere Lehren daraus zu ziehen, denn jeder Text besitzt immer mehr als eine Botschaft … Oder wie ein altes Sprichwort so schön sagt: Ganz gleich, wie oft du einen alten Mehlsack schüttelst, es kommt immer noch ein bisschen Mehl heraus.
Und selbst wenn das Lesen dieser Märchen dir keine neuen Erkenntnisse bringen sollte, wirst du die magische Erfahrung machen, für einen einzigartigen, geschützten Moment wieder das Kind zu sein, das du einmal warst. Das Kind von damals, das es genoss, wenn sich jemand zu ihm setzte und ihm einfach eine Geschichte erzählte.
Genau wie meine Enkel heute und meine Kinder vor einigen Jahren weigerten mein Bruder und ich uns vor vielen, vielen Jahren, abends die Augen zuzumachen, bevor jemand von unseren Eltern oder Großeltern uns eine Geschichte erzählt hatte. Wie sollte man einschlafen, ohne zuvor in diese wundersamen Welten eingetaucht zu sein, insbesondere, wenn sie von furchtbaren Drachen und bösen Hexen bewohnt waren, von Riesen und Ungeheuern, die, bevor sich der Tag verabschiedete, von unserem Lieblingshelden oder unserer Lieblingsheldin vertrieben oder besiegt wurden?
Weil mein Vater ein begeisterter Leser war, gab es in meinem Elternhaus Märchen für jeden Geschmack. Kurze und lange, Geschichten voller Abenteuer, Magie oder Zauberei, Tiergeschichten, Heldengeschichten, solche zum Lachen, solche fürs Herz und andere zum Fürchten. Manchmal suchten wir Kinder uns eines aus, andere Male derjenige, der es erzählte, aber das Ergebnis war immer bezaubernd, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genauso gibt es für die Auswahl der Märchen in diesem Buch eine subjektive Begründung, die in den meisten Fällen zu Beginn des Kapitels erklärt wird (Rotkäppchen zum Beispiel ist das wohl bekannteste Märchen der Weltliteratur). Gleichzeitig wurden sie ausgewählt, weil ihnen eines gemeinsam ist: Sie alle haben im Laufe der Zeit unzählige Debatten und Interpretationen über ihre Symbolik und ihren tieferen Sinn verursacht und so ihre Wirkung und ihre Bedeutung unter Beweis gestellt.
In meiner Zeit als Psychotherapeut sagte ich meinen Patienten immer, dass wir, wenn wir uns verloren fühlen, nicht unbedingt einen Therapeuten brauchen, der uns heilt, oder eine Mama, die sich um uns kümmert. Manchmal brauchen wir nur ein Zeichen oder einen Lehrmeister, die uns darauf hinweisen, wo wir vom Weg abgekommen sind.
Die meisten dieser Märchen sind vor Jahrhunderten entstanden, um davor zu warnen, an welchem Punkt man die falsche Richtung einschlägt, und uns dazu zu ermuntern, etwas aus dem zu machen, was wir sind, und nicht aus dem, was wir gerne wären. Schon Bruno Bettelheim vertrat die Ansicht, dass Märchen viel mehr seien als eine Einschlafhilfe für Kinder.
Wenn der schiefe Turm von Pisa irgendwann umfiele, bliebe ein Schutthaufen aus Tausenden von Steinen zurück. Die Steine wären immer noch dieselben, die sich noch Wochen zuvor als Turm in den Himmel erhoben, und doch wäre das Bauwerk verschwunden. Das Werk liegt nicht im einzelnen Stein, sondern in der Schöpfung des Baumeisters und der Arbeit der Handwerker, die den Turm bauten. Sie sind es, die die Granitquader in einer bestimmten Art und Weise anordneten. Ohne diese Ordnung hätten wir kein stabiles Dach über dem Kopf, würden diese Worte keinen Text formen, wäre aus den Farben auf Da Vincis Palette nicht die Mona Lisa entstanden.
Mein Freund und Lehrmeister Jaime Barylko sagte einmal: »Frei zu sein heißt nicht, sich von Dingen loszusagen, so wie es heute oft verstanden wird – als würde man seine Kleidung ablegen, bis man völlig nackt ist. Nackt zu sein kann eine Weile ganz schön sein, aber man muss sich klarmachen, dass Erziehung nicht bedeutet, jemandem beizubringen, wie man sich auszieht. Es bedeutet vor allem, begreiflich zu machen, dass man selbst entscheiden kann und soll, welche Kleidung man trägt, und diese Erfahrung weiterzugeben.« Ein neues ideologisches, religiöses, ethisches oder berufliches Gewand, das unserem Wesen entspricht und das die Gesellschaft, die wir schaffen wollen, von uns benötigt.
Eine Erziehung, die hilft, Wichtiges von Nebensächlichem zu unterscheiden, Rache von Gerechtigkeit und das Beste zum Wohle vieler von den Interessen einiger weniger. Eine Gesellschaft, in der jeder genau weiß, welche Werte er verteidigt.
Eine Werteskala sollte deutlich zum Ausdruck bringen, was für jeden Einzelnen wirklich wichtig ist. Eine Gewichtung der Prioritäten, die jedes Mal eine innere Warnlampe aufleuchten lässt, wenn die Umstände unsere Prinzipien zu verletzen drohen. Eine Lebenseinstellung, die so fundamental ist, wenn es darum geht, mich für ein bestimmtes Verhalten zu entscheiden, dass ich sie nicht verletzen kann, ohne Abscheu vor dem Bild zu empfinden, das ich von mir selbst habe.
Die Hierarchisierung unserer Prinzipien, die, wie ihr Name besagt, immer vor unserer Zielsetzung stehen sollten.
Persönlichkeitsentwicklung beginnt mit dem Lernen und geht mit der Verinnerlichung des Gelernten weiter. Sie setzt sich fort, wenn wir uns der Angst vor dem Scheitern stellen und in der Lage sind, aus Fehlern zu lernen. Schließlich ist der Erfolg nicht zuletzt davon abhängig, ob wir Vertrauen in uns selbst haben und unabhängig vom Erfolg begreifen, dass es immer eine andere Möglichkeit gibt. Beharrlichkeit, Lernfähigkeit und Einsatz sind sicherlich das beste Rüstzeug für jeden, der gelegentlich Fehler macht, also für uns alle.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
In jedem Kapitel widme ich mich einer Geschichte und folge dabei demselben Schema:
Zuerst gebe ich eine kurze Einleitung, um dich mit dem Kontext der Geschichte, ihren Ursprüngen und gegebenenfalls den Verfassern vertraut zu machen.
Danach folgt die Geschichte selbst, in meinen Worten nacherzählt, aber mehr oder weniger der Originalversion folgend, die ich bei meinen Recherchen gefunden habe.
Im Anschluss fasse ich kurz die Moral der Geschichte zusammen, die mehr oder weniger deutlich aus dem Erzählten hervorgeht und üblicherweise als die zentrale Botschaft angesehen wird.
Und schließlich folgt eine mehr oder weniger gewagte Neuinterpretation nach meinen eigenen Ideen und Vorstellungen. Dieser Abschnitt trägt den Titel »Die andere Tür«, denn meine Absicht und mein Wunsch ist es, dass du mich auf meinem Weg in die Magie dieser Märchen begleitest.
Im Verlauf der Recherchen zu diesem Buch stieß ich auf viele interessante und kuriose Fakten, die mir reizvoll oder überraschend erschienen. Fakten und »Gerüchte«, die keinen Eingang in meine Analyse der Geschichte fanden, die ich aber unbedingt mit dir teilen will, ganz besonders, wenn du, wie ich annehme, ebenfalls ein (großes?) Interesse an Märchen hast. Um das »Klima« des Buches zu wahren, beschloss ich, all diese Fakten zu sammeln, nach Märchen zu ordnen und sie in einem Anhang zusammenzufassen, dem ich den Titel »Notizen zu einer Recherche« gab. Hoffentlich erliegst du der Versuchung, dich mit ihnen zu beschäftigen.
Das Verfahren der Neuinterpretation
Die meisten Geschichten in diesem Buch stammen aus der Bibel oder der Mythologie oder sind aus Sagen und Legenden entstanden, die man sich in alten Zeiten erzählte oder vorsang. Und obwohl Personen und Schauplätze wechseln und sie aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen stammen, erzählen die populärsten Märchen immer dieselben Geschichten.
In den Anfängen war der Geschichtenerzähler der wahre Träger der Kultur und Geschichte seines Volkes. Er trug die Werte der Gemeinschaft von Generation zu Generation weiter und hielt das Gedächtnis an die Geschichte derer lebendig, die keine Stimme besaßen. Die unter Hunger, Kälte und dem Unrecht der Mächtigen litten, ohne auch nur das Recht zu besitzen, darüber zu klagen. Eine authentische, schmerzliche Geschichte, die dank der volkstümlichen Erzählungen nicht von den Chronisten unterschlagen werden konnte.
Diese Geschichten, die Allgemeingut waren, gehören heute auch uns und geben uns die Möglichkeit, in der Tiefe zu begreifen, woher wir kommen, um so mit größerer Umsicht unseren eigenen Weg zu gehen.
Bei meinen Recherchen ist mir natürlich nicht entgangen, was für ein Segen es ist, mich beim Schreiben dieses Textes auf Hunderte von Büchern stützen zu können, die Psychologen, Psychoanalytiker, Literaten und Philosophen zu dem Thema verfasst haben, wahre Experten auf dem Gebiet der Mythen, Symbolik und verborgenen Bedeutungen der Märchen. Angefangen natürlich mit Bruno Bettelheims unvergleichlichem Kinder brauchen Märchen, gefolgt von weiteren genialen Köpfen aus Literatur, Psychologie und Philosophie, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die ich bewundere und denen ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Und nicht zuletzt wäre dieses ganze Projekt viel schwieriger gewesen, gäbe es nicht Hunderte und Tausende Internetseiten, die mir während meiner jahrelangen Arbeit dabei geholfen haben, den Weg nachzuzeichnen, den die einzelnen Geschichten im Laufe der Zeit genommen haben, von den vorzeitlichen Höhlen bis in unsere Tage.
Schöpferisches Lesen
Die Arbeit der argentinischen Autorin und Lehrerin María Hortensia Lacau, die den Begriff des schöpferischen Lesens prägte, hätte ein eigenes Kapitel in diesem Buch verdient.
Als die Pädagogin und Schulleiterin, die persönlich zu hören ich das Privileg hatte, im Januar 2006 starb, hinterließ sie Dutzende wundervolle Artikel und Bücher, die sich mit ihrer pädagogischen Arbeit beschäftigen. Eine Aufgabe, der sie ihr Leben widmete, wobei sie stets die Bedeutung des Lesens insbesondere für junge Menschen betonte. Ihr Buch Didáctica de la lectura creadora (Didaktik des schöpferischen Lesens) ist eine Fundgrube für alle, die sich für Literatur und Pädagogik gleichermaßen begeistern.
Der Akt des Lesens ist ein interaktiver Prozess zwischen Text und Leser, dem die Aufgabe zukommt, das geschriebene Wort zu übertragen, zu entschlüsseln und ihm eine Bedeutung zuzuweisen. Unter diesem Gesichtspunkt ist Literatur ein Prozess der Teilhabe, bei welchem dem Lesenden eine zentrale Aufgabe zukommt. Oder um es mit José Martí zu sagen: »Beim Lesen muss man sich durchbeißen.«
María Hortensia Lacau erzählt, wie sie irgendwann feststellte, dass die Auswahl der Texte, die laut Lehrplan des Ministeriums im Unterricht gelesen werden sollten, zwar den Interessen und Möglichkeiten der Jugendlichen entsprach, die Inhaltsangaben und Interpretationen der Schüler zu ihrem Erstaunen jedoch zu wünschen übrigließen. Schnell wurde ihr klar, dass der Fehler nicht bei den Schülern und den ausgewählten Büchern lag.
Sie schreibt:
»Man muss in den Jugendlichen die Liebe zum Lesen wecken und eine liebgewonnene Gewohnheit daraus machen, die nach und nach zu einem Teil des Lebens wird. Der jugendliche Leser muss zum Mitwirkenden werden, der eigene Projekte schafft, die mit dem Werk zu tun haben, zum begeisterten Kritiker, Augenzeugen und Berichterstatter. Das heißt, zwischen dem Jugendlichen, der im Mittelpunkt seiner Welt steht, und dem Buch, das er liest, muss eine emotionale Bindung entstehen.«
Dieses tiefere Durchdringen und Adaptieren der Lektüre kann nur stattfinden, wenn die Lesenden die Verantwortung dafür übernehmen, den Text auf der Grundlage ihrer eigenen Lebenserfahrung, ihres Wissensstandes und ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit zu interpretieren, zu dechiffrieren und ihm eine Bedeutung zuzuweisen.
Eine solche konstruktive Lektüre ließe sich folglich als ein vertrauter, inniger Kontakt mit dem geschriebenen Wort definieren, der es dem Lesenden ermöglicht, zum Coautor des Gelesenen zu werden. Zwischen Lesendem und Autor entsteht eine persönliche Bezugsebene, die neue Interpretationen, Ansätze und Ideen ermöglicht, so dass aus dem Werk ein neues Werk entsteht, das sich wiederum auf schöpferische Weise lesen lässt … Und immer so weiter.
Die Methoden, um diese Form des Lesens zu unterstützen, wurden nicht nur von María Hortensia Lacau beschrieben, sondern auch von der spanischen Pädagogin Morote Magán, und sie sind ebenso spannend wie unterhaltsam. Man könnte zum Beispiel:
das Ende und den Anfang ändern
neue Figuren einführen
die Eigenschaften der Protagonisten ausarbeiten
Charaktere aus unterschiedlichen Geschichten zusammenbringen
sich Dialoge zwischen ihnen ausdenken
ein Kapitel hinzufügen
die Textart ändern und aus der Geschichte ein Theaterstück, eine Komödie, ein Drehbuch oder ein Musical machen
die Geschichte mit eigenen Zeichnungen illustrieren oder einen Comic daraus machen
die Handlung in eine frühere oder spätere Epoche verlegen
imaginäre Interviews mit dem Autor oder den Figuren führen.
Und der Vorschlag, der mir am besten gefiel:
die Geschichte zu einem Zeitungsartikel umschreiben und ihn mit einer reißerischen Schlagzeile versehen.
Schon bei dem Gedanken an das eine oder andere Beispiel musste ich lachen. Hier ist eines davon:
Die näheren Umstände des Vorfalls werden noch untersucht. Unter Verdacht stehen ein Mann, bei dem es sich dem Aussehen nach um einen Jäger handeln könnte, und ein rotgekleidetes Mädchen, die dabei beobachtet wurden, wie sie um das Haus einer älteren Dame schlichen. Diese könnte ihre Komplizin gewesen sein und ihnen geholfen haben, das grausame Verbrechen zu begehen.
Eine solche teilnehmende, aktive Form des Lesevorgangs bietet die Chance, kritische, kreative und mental offene Leser zu formen, die bereit sind, alles aus jedem Text herauszuholen und das auf ihrem Weg Gelernte mit anderen »Weggefährten«, wie ich sie gerne nenne, zu teilen.
1Das hässliche Entlein
Einleitung
Es ist nicht nötig, diese kleine Anthologie in einer bestimmten Reihenfolge zu lesen, aber aus persönlichen Gründen habe ich mich dafür entschieden, mit diesem Märchen zu beginnen.
Zum einen ist Das hässliche Entlein das wohl bekannteste und am häufigsten erzählte Märchen in Südamerika. Ich wage zu behaupten, dass es kein Kind gibt, das die Geschichte nicht irgendwann einmal gehört hat.
Zum anderen haben auch die meisten Erwachsenen die Geschichte präsent und wären in der Lage, sie mehr oder weniger detailgetreu einem Kind zu erzählen oder sich in einer Unterhaltung darauf zu beziehen.
Der dritte und vielleicht wichtigste Grund ist, dass ich niemanden kenne, der sich nicht irgendwann einmal mit der Hauptfigur dieses Märchens von Hans Christian Andersen identifiziert hätte, das 1845 zum ersten Mal erschien.
Und der letzte, wenn auch nur für mich maßgebliche Grund ist, dass es nach meiner Erinnerung die erste Geschichte in meinem Leben war, die man mir erzählte, und diejenige, die ich am häufigsten hörte. Ich weiß noch genau, wie der Einband des Buchs aussah, aus dem meine Eltern mir immer vorlasen.
Es war meine absolute Lieblingsgeschichte, und obwohl ich sie auswendig konnte, entschied ich mich jedes Mal für Das hässliche Entlein, wenn meine Eltern mir die Wahl ließen, welche Geschichte ich zum Einschlafen hören wollte (so wie ich auch nun entschieden habe, sie an den Anfang dieses Buchs zu stellen).
Die Geschichte
Wie schön war doch der Sommer! Wie wunderbar war es, durch die Felder zu streifen und das goldgelbe Korn, den grünen Hafer und die Heustadel in der weiten Landschaft zu betrachten!
Flamingos staksten auf ihren langen Beinen umher und machten die Landschaft perfekt. Ach, es war herrlich, auf dem Land zu sein.
Im Sonnenlicht stand ein altes Gutshaus. Es war von einem tiefen Wassergraben umgeben, an dessen Ufer Pflanzen mit riesigen Blättern wuchsen, so groß, dass ein Kind sich darunter verstecken konnte.
Im Schutz dieser wilden, überwucherten Böschung hatte eine Hausente ihr Gelege, weit genug vom Hühnerhof entfernt, um nicht beim Brüten gestört zu werden, und nah genug, um dorthin zurückkehren zu können, sobald die Jungen geschlüpft waren.
Nach einem Monat wurde die Ente unruhig, denn sie spürte, dass es Zeit für ihre Küken war, auf die Welt zu kommen. Ungeduldig betrachtete die Entenmutter das Gelege und wartete auf Neuigkeiten.
Schließlich zersprangen die Eier eins nach dem anderen. »Piep, piep!«, schnatterten die kleinen gelben Daunenbällchen, als sie die Köpfchen aus den Eierschalen streckten.
»Quack, quack«, antwortete die Entenmutter, um die Kleinen zu ermuntern, so schnell wie möglich aus ihren Schalen zu schlüpfen und ihre ersten Schrittchen zu machen, sich an das Tageslicht zu gewöhnen, das sie ein wenig blendete, und das satte Grün zu genießen, das sie umgab.
»Oh, wie groß doch die Welt ist!«, staunten die Entlein, die auf einmal so viel mehr Platz hatten als eben noch in ihrem Ei.
»Quack, quack«, lachte die Entenmutter. »Ihr glaubt, das sei schon die ganze Welt? O nein! Die Welt reicht bis zu der Wiese auf der anderen Seite des Wassergrabens, aber so weit bin ich noch nie gewesen … Nun, ich hoffe, ihr seid vollzählig. Wir müssen ins Wasser, bevor es dunkel wird«, drängte sie und erhob sich vom Nest.
In diesem Moment kam eine betagte Entendame vorbei.
»Was stehst du da herum?«, sagte sie, und es klang ein wenig vorwurfsvoll. »Da liegt noch ein Ei im Nest.«
Die Entenmutter sah sich um und stellte fest, dass das größte Ei tatsächlich noch intakt war. »Wie lange dauert das denn noch?«, fragte sie sich. »Ich kann doch nicht ewig hier hocken bleiben.« Dennoch setzte sie sich wieder auf ihr Gelege, wie es ihr der Instinkt befahl.
»Das Kleine macht keine Anstalten, zu schlüpfen«, jammerte sie. »Aber sieh dir die anderen an: Sind es nicht die hübschesten Entlein der Welt? Sehen aus wie ihr Vater in jungen Jahren. Warum lässt sich dieser Nichtsnutz nicht mal blicken?«
»Du weißt doch, wie die Männer sind«, sagte die alte Entendame, um etwas zu sagen. »Lassen einen mit der Arbeit allein.«
»Ich denke, ich bleibe noch ein Weilchen sitzen«, sagte die Entenmutter. »Aber wenn sich nicht bald etwas tut, gehe ich. Ich hocke schon so lange hier, mir tut alles weh.«
»Na dann, alles Gute«, sagte die alte Entendame und watschelte davon.
Schließlich zerbrach das Ei.
»Piep! Piep!«, rief das Kleine und purzelte aus dem Ei. Seine Stimme klang merkwürdig für ein frisch geschlüpftes Entenküken. Der Entenmutter gefiel das ganz und gar nicht. Sie betrachtete das Küken eingehend und stellte fest, wie groß und hässlich es war.
»Meine Güte, was für ein riesiges Küken!«, entfuhr es ihr. »Es sieht überhaupt nicht aus wie die anderen.«
Und das stimmte: Sein graues, struppiges Gefieder war ganz anders als der weiche gelbe Flaum seiner Geschwister.
Das letzte Tageslicht fiel durch die grünen Blätter, und der Himmel färbte sich orangerot.
Die Entenmutter watschelte mit der gesamten Familie zum Wassergraben und sprang, platsch!, hinein.
»Quack, quack«, lockte sie. »Kommt, kommt, habt keine Angst!«
Eins nach dem anderen sprangen die Kleinen hinterher. Das Wasser schlug über ihren Köpfchen zusammen, doch als sie wieder auftauchten, schwammen sie völlig mühelos. Im Handumdrehen waren alle im Wasser, und auch das hässliche graue Entlein folgte den anderen guten Mutes. Die kleine Schar paddelte mit den Füßchen und schwamm der Entenmutter hinterher.
»Quack, quack!«, rief die Mutter nach einer Weile. »Kommt, folgt mir, ich will euch den anderen im Hühnerhof vorstellen. Aber bleibt ganz dicht bei mir, nicht, dass ihr zertrampelt werdet. Und gebt auf die Katze acht!«
Sie hielt kurz inne, um sich zu vergewissern, dass alle ihr folgten.
»Los, los, sputet euch! Und macht einen artigen Knicks vor der alten Entendame dort drüben. Sie ist die vornehmste von uns, angeblich fließt spanisches Blut in ihren Adern. Seht nur, sie trägt einen roten Ring um ihr Bein; das ist die höchste Auszeichnung, die man erringen kann.«
Stolz und zufrieden gab sie ihrer Schar weitere Anweisungen:
»Kommt, Kinderchen«, lockte sie. »Seid artig und grüßt höflich. Senkt den Schnabel, schaut zu Boden und sagt ›Quack‹! Und dreht nicht die Füße nach innen, das gehört sich nicht.«
Alle gehorchten, doch als die Küken heranwatschelten, um die anderen Enten zu grüßen, musterten diese angewidert das ungewöhnliche Entlein und riefen schließlich:
»Uh, was für ein garstiges Ding! Nehmt es, und verschwindet von hier, wir können seinen Anblick nicht ertragen.«
Ein junger Enterich kam näher und drohte, es in den Hals zu hacken.
»Lasst es in Ruhe! Es hat niemandem etwas zuleide getan«, schritt die Entenmutter ein. »Es war zu lange in seinem Ei, deshalb ist es nicht so hübsch wie die anderen.«
»Mag sein«, sagte die alte Ente mit dem roten Ring. »Ich hoffe, das Hässliche wächst sich aus, wenn es älter wird, und es bleibt nicht so riesig, sonst reicht das Futter nicht. Aber du solltest dir gut überlegen, was du mit ihm machst. Wenn du es draußen auf dem Teich zurückließest, wärst du deine Sorgen los. Es wirkt stark und wird seinen Weg machen. Was deine übrigen Jungen betrifft, so sind sie wirklich reizend«, setzte die alte Ente hinzu. »Sie sind im Hühnerhof herzlich willkommen. Es würde mich freuen, wenn sie sich hier wie zu Hause fühlten.«
Sie nahmen die Einladung an und blieben im Hühnerhof. Die Küken fühlten sich sehr wohl dort – alle, bis auf das arme Entlein, das zuletzt geschlüpft war. Die anderen Enten und Hühner und sogar der Truthahn, der sich immer schon für etwas Besonderes gehalten hatte, hackten nach ihm, knufften es und lachten es aus.
Eines schönen Tages plusterte der Truthahn sein Gefieder auf wie ein Schiff unter vollen Segeln und stürzte sich ohne jeden Grund, nur weil ihm der Sinn danach stand, mit lautem Gegacker auf das arme hässliche Entlein, bis sein Kopf tiefrot anlief. Das arme Entlein lief erschreckt und aufgescheucht durch den Hühnerhof. Es hatte inzwischen gemerkt, dass es anders war als die anderen, doch es verstand nicht, warum man es deswegen abwies und angriff.
Die Tage vergingen, und es wurde immer schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen drangsaliert. Selbst seine Geschwister triezten es zuweilen und sagten:
»Hoffentlich holt dich die Katze, du garstiges Ding!«
Eines Tages scheuchte die Magd, die immer das Futter brachte, das kleine Entlein vor sich her und wäre dabei beinahe über es gestolpert. In seiner Wut verpasste das Mädchen dem armen Entlein einen Tritt, dass es bis in den Schweinetrog flog.
»Geh mir aus den Augen, du hässlicher Vogel!«, schrie sie.
Nachdem das Entlein den ganzen restlichen Tag geweint hatte, traf es eine Entscheidung. Es war nicht wie die anderen und würde niemals sein wie sie … Auch wenn es nicht zu verstehen war, machte dieses Anderssein es ihm unmöglich, noch länger mit den anderen im Hühnerhof zusammenzuleben.
Falls es noch irgendeinen Zweifel gehabt hatte, so schwand dieser, als es seiner Mutter von seinen Plänen erzählte und diese nach langem Schweigen mit gesenktem Kopf murmelte, vielleicht sei es besser so.
Noch am selben Abend verließ das arme, verachtete Entlein den Hühnerhof.
Mit einem Satz hüpfte es über den Zaun und scheuchte mehrere Spatzen auf, die erschreckt aus den Büschen aufflatterten.
Das kleine Entlein lief immer weiter, bis es erschöpft den großen See erreichte, wo, so hatte es die Mutter erzählt, die Wildenten lebten. Es kauerte sich ins Schilf und schlief entkräftet und traurig ein.
Als die Wildenten am nächsten Morgen losfliegen wollten, entdeckten sie den sonderbaren Gast.
»Was bist du für ein seltsames Ding?«, fragten sie.
Das Entlein wusste nicht, was es antworten sollte. Stattdessen verbeugte es sich ein ums andere Mal, um artig und wohlerzogen zu erscheinen.
»Du bist hässlicher als eine Vogelscheuche!«, sagten die Wildenten.
»Ich glaube, gerade deshalb gefällst du mir«, sagte eine von ihnen, die die Anführerin zu sein schien. »Du kannst mit uns kommen, wenn du willst.«
»Solange du nicht eine von unseren Schwestern heiraten willst …«, setzte eine weitere hinzu.
»Genau, genau«, pflichteten die anderen bei.
Das arme Entlein dachte nicht im Traum ans Heiraten oder gar ans Fliegen. Es wollte nur in Ruhe im Schilf hocken und ein bisschen Wasser aus dem See trinken.
»Paff! Peng!«, knallte es plötzlich, und die Wildenten flogen aufgescheucht davon. Zwei von ihnen jedoch waren von den Kugeln der Jäger getroffen und fielen tot ins Schilf. Ihr Blut färbte das Wasser rot.
Als weitere Schüsse ertönten, flogen immer mehr Wildenten und Gänse vom See auf, um den Kugeln zu entkommen. Halbtot vor Angst, steckte das Entlein den Kopf unter den Flügel und duckte sich in eine Mulde hinter zwei Steinen, die es im Uferschilf entdeckt hatte.
Blaue Pulverschwaden waberten durch das dunkle Blattwerk, um sich dann draußen über dem See aufzulösen. Das Entlein musste von dort fort, doch in diesem Moment näherte sich ein riesiger Jagdhund und durchstöberte jeden Zentimeter des morastigen Geländes, die gewaltige Zunge hing ihm von Geifer triefend aus dem Maul.
Mit seinen Pfoten scharrte der Jagdhund die Steine beiseite, hinter denen das Entlein saß, so dass es auf einmal schutzlos dasaß. Das arme Tier schloss die Augen, als es erkannte, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte.
Der Hund kam ganz nah, die Schnauze nur noch Zentimeter von dem zitternden Entlein entfernt, schnüffelte einige endlose Sekunden lang, fletschte seine scharfen Zähne … und trottete davon, ohne ihm auch nur eine Feder zu krümmen.
Das kleine Entlein löste sich aus seiner Erstarrung und atmete erleichtert auf.
»Ich bin so hässlich, dass nicht mal die Hunde mich als Beute erkennen«, sagte es sich und blieb ganz still sitzen, während die Schrotkugeln über seinen Kopf hinwegpfiffen und dichter Pulverdampf in der Luft lag.
Schließlich vertrieb ein aufziehendes Unwetter die Wildenten und die Jäger. Das kleine Entlein wartete noch eine Weile, bis es sicher war, dass alles ruhig blieb; dann verließ es, so schnell es konnte, den See, ohne zu wissen, wohin.
Nach einer Weile erreichte es eine alte Hütte, die war so krumm und windschief, dass es wie ein Wunder anmutete, dass sie noch aufrecht stand. Aber sie bot doch wenigstens Schutz vor Regen und Wind.
Das Entlein kroch durch eine Ritze hinein und schüttelte sich die Nässe aus dem Gefieder. Zum ersten Mal nach langer Zeit würde es ohne Angst schlafen können.
Am nächsten Morgen stellte das Entlein fest, dass die Hütte einer alten Frau gehörte, die dort mit einem Kater und einem Huhn zusammenlebte.
Die beiden Tiere entdeckten den sonderbaren Besucher als Erste. Der Kater begrüßte den Fremden mit einem Schnurren, das Huhn gackerte dazu.
»Wen haben wir denn da?«, fragte die alte Frau, als sie hinzukam und unseren kleinen Helden in einer Ecke entdeckte. Sie freute sich, dass sie nun Enteneier haben würde, um ihren kargen Speiseplan zu bereichern.
»Falls es kein Enterich ist«, überlegte die Alte laut. »Das werden wir in den nächsten Tagen herausfinden müssen.«
Sie ließen dem kleinen Entlein drei Wochen Zeit, um mit dem Eierlegen zu beginnen, aber natürlich warteten sie vergeblich. Schließlich fragte das Huhn:
»Sag mal, kannst du überhaupt Eier legen?«
»Nein.«
»Und einen Buckel machen? Oder schnurren?«, fragte der Kater.
»Nein.«
»Dann bist du zu nichts nutze. Verzieh dich in deine Ecke und sei still.«
»Aber ich kann schwimmen«, erklärte das Entlein.
»Schwimmen?«, sagten die Tiere. »Wozu soll das gut sein? So ein Blödsinn!«
»Es ist herrlich, übers Wasser dahinzugleiten«, sagte das hässliche Entlein. »Den Kopf unter die Oberfläche zu stecken und bis zum Grund zu tauchen!«
»Herrlich!«, spottete das Huhn. »Mir scheint, du bist verrückt geworden. Frag den Kater, keiner ist so klug wie er! Frag unsere alte Herrin, die weiseste Frau der Welt! Glaubst du, sie machen sich etwas daraus, zu schwimmen oder zu tauchen?«
»Du verstehst mich nicht«, sagte das Entlein.
»Nun, wenn ich dich nicht verstehe, dann weiß ich nicht, wer dich sonst verstehen soll. Du hältst dich wohl für klüger als den Kater oder meine Herrin, von mir gar nicht zu sprechen! Du hast Glück gehabt, ein warmes, angenehmes Zuhause zu finden, und alles, was dir einfällt, ist … Schwimmen!«
Das Huhn schüttelte das Gefieder und setzte überheblich hinzu:
»Du bist ein Nichtsnutz. Du solltest lernen, Eier zu legen oder zu schnurren, wenn du nicht willst, dass wir dich vor die Tür setzen. Ich meine es nur gut mit dir; nur gute Freunde sagen einem die Wahrheit.«
Also fragte das kleine Entlein, in welche Richtung der See lag, und ging seiner Wege.
Dort schwamm und tauchte es nach Herzenslust; doch nicht einmal die Krähen, die in den Bäumen ringsum hockten, schenkten ihm ein Krächzen.
Dann kam der Herbst. Die Blätter färbten sich gelb und braun und wurden vom Wind davongetragen, der sie in Wirbeln vor sich herjagte, der Himmel war düster und grau. Die Wolken hingen tief, schwer beladen mit Eis und Schnee.
Eines Abends, die Sonne ging herbstlich leuchtend am Horizont unter, da erschien eine Gruppe wunderschöner großer Vögel am Ufer. Noch nie zuvor hatte das Entlein so schöne Tiere gesehen. Sie waren schneeweiß und hatten lange, schlanke Hälse.
Die Schwäne stießen durchdringende Rufe aus, dann breiteten sie ihre mächtigen Schwingen aus und erhoben sich hoch in den Himmel, immer höher, und flogen in Richtung Süden davon.
Das hässliche Entlein überkam eine merkwürdige Unruhe, eine Mischung aus Bewunderung und Neid. Niemals wieder würde es diese herrlichen Vögel vergessen können! Wie schön wäre es doch, an andere Orte zu fliegen, statt unentwegt umherschwimmen zu müssen, um nicht auf dem Eis festzufrieren. Jede Nacht wurde die Fläche, auf der es schwimmen konnte, kleiner und kleiner.
In jenen Tagen wurde es so kalt, dass das Entlein am Ende tatsächlich festgefroren wäre, hätten es nicht ein paar Bauernkinder zitternd am Ufer gefunden und mit nach Hause genommen, wo ihre Mutter es wärmte und fütterte, bis es wieder zu Kräften kam.
Das Entlein blieb bei der mitleidigen Familie, die ihm eine Kiste im Werkzeugschuppen herrichtete. Manchmal wollten die Kinder mit ihm spielen, doch diese Spiele endeten fast immer damit, dass etwas im Haus zu Bruch ging oder Gefahr für Leib und Leben des armen Entleins bestand, wie einmal, als es beim Indianerspielen beinahe am Marterpfahl verbrannte …
Irgendwann fürchtete sich das hässliche Entlein vor ihren Einfällen; wenn die Kleinen nach ihm riefen, um zu spielen, hüpfte es schnell aus seiner Kiste und versteckte sich.
Eines Morgens, als es sich vor den kleinen Rackern ins Schilf floh, stellte es fest, dass die Sonne wieder wärmte und die Lerchen sangen. Es war Frühling geworden.
Vielleicht aus Instinkt breitete es die Flügel aus, um sich in der Sonne zu wärmen. Wie sehr sie gewachsen waren! Das Entlein öffnete sie noch mehr und schlug damit auf und ab, damit sie vollständig trockneten. Das Rauschen, das sie verursachten, war viel lauter als sonst, und für einen kurzen Moment hob das Entlein vom Boden ab.
Halb laufend, halb fliegend erreichte es einen großen Garten mit blühenden Apfelbäumen und üppigem Flieder, dessen Zweige sich über einen plätschernden Bach neigten. Oh, wie schön war es dort im frischen Frühlingsgrün!
In diesem Moment erschienen drei herrliche weiße Schwäne, ganz ähnlich jenen, die das Entlein damals hatte davonfliegen sehen, und es überraschte sich dabei, wie es dachte:
»Ich werde mich ihnen anschließen! Sie werden mich hässliches Ding für meine Dreistigkeit mit ihren Schnäbeln tothacken, aber was soll’s! Besser, von ihnen totgehackt zu werden, als noch länger die Knüffe der anderen Enten, das Gehacke der Hühner, die Tritte der Gänsemagd und den strengen Winter zu ertragen.«
Das hässliche Entlein ließ sich ins Wasser gleiten, um zu den schönen Schwänen zu gelangen, die ihm mit aufgeplustertem Gefieder entgegenschwammen, als sie es entdeckten.
Als das Entlein sie kommen sah, fürchtete es, sie könnten es angreifen, und wollte seine übliche Verbeugung machen. Doch als es den Kopf neigte, erblickte es im klaren Wasser sein eigenes Spiegelbild. Und was es sah, war nicht länger ein abstoßend hässlicher grauer Vogel, sondern … ein wunderschöner Schwan!
Die anderen Schwäne schwammen um es herum und liebkosten es mit ihren Schnäbeln, als wollten sie ihm sagen, dass alles in Ordnung sei und sie es als einen der Ihren willkommen hießen.
Einige Kinder kamen ans Ufer und begannen Brotkrumen ins Wasser zu werfen. Eines von ihnen, das kleinste, rief:
»Seht nur, da ist ein neuer Schwan!«
Und die anderen Kinder stimmten fröhlich ein:
»O ja, ein neuer Schwan! Schaut nur, wie hübsch er ist!«
»Nein, er ist nicht hübsch. Er ist der Allerschönste!«
Unser Held war sehr, sehr glücklich, und auch wenn er sich an die Verachtung und die Demütigungen der Vergangenheit erinnerte, verspürte er keinen Groll.
Der Flieder neigte seine Zweige vor ihm, bis sie das Wasser berührten, und die sanften, warmen Sonnenstrahlen ließen sein zartes weißes Gefieder noch heller leuchten … Der Neuankömmling reckte seinen schönen Hals und er- hob sich in die Lüfte, gefolgt von den übrigen Schwänen, die sich nicht von ihm trennen wollten, wie das bei Schwänen so ist.
Aus der Luft schaute der Schwan, der vor kurzem noch ein hässliches Entlein gewesen war, auf den Hühnerhof hinab, in dem er die ersten Tage seines Lebens verbracht hatte, und freute sich aus tiefstem Herzen … Noch nie zuvor war er so glücklich gewesen.
Die Moral
Gemeinhin wird die Geschichte vom hässlichen Entlein als Metapher für die Erfahrung von Zurückweisung und Ablehnung in der schwierigen Zeit des Heranwachsens gelesen. Es ist eine Situation, auf die sich ohne weiteres der Begriff Mobbing anwenden lässt. Ich bin sicher, dass sich jeder, der diese Geschichte liest, in irgendeiner Form mit dem hässlichen Entlein identifizieren kann. In irgendeiner Phase unseres Lebens oder in einer bestimmten Situation haben wir uns doch alle irgendwie zurückgewiesen oder ausgegrenzt gefühlt – wegen unserer Größe oder unseres Gewichts, der Hautfarbe, zu großer Füße oder einer ungewöhnlich großen Nase. Die Geschichte vom hässlichen Entlein ermuntert dazu, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und das Schöne und Besondere zu sehen, das in jedem von uns steckt – sozusagen »den Schwan in uns«.
Die andere Tür
Die Geschichte vom hässlichen Entlein endet damit, dass es feststellt, sein Glück gefunden zu haben.
Und genau an diesem Punkt möchte ich dich mitnehmen und dazu ermuntern, genauer hinzuschauen, damit wir gemeinsam noch mehr aus dieser wunderbaren Geschichte ziehen.
Das Glück ist ein ebenso bedenkenswertes Thema wie Liebe und Hass, unser Unvermögen, uns mitzuteilen, unsere Einstellung zum Tod oder die merkwürdige Überzeugung, dass wir die Wahrheit für uns gepachtet haben und genau zu wissen glauben, was gut ist und was schlecht, was schön und was hässlich.
Was sind solche Probleme anderes als Hindernisse auf unserem Weg zu uns selbst? Was könnte uns mehr beschäftigen, auch wenn es vielen, auch mir, schwerfällt, das Ziel mit einem einzigen Wort zu benennen?
Nennen wir es, wie wir wollen:
Selbstverwirklichung
Erleuchtung
Erfolg
Erkenntnis
spiritueller Gipfel
Bewusstwerdung
innerer Friede
oder einfach: Glück.
Wir alle streben nach diesem Zustand; für manche, auch für mich, ist es eine Verpflichtung.
Manche verirren sich unterwegs und kommen ein bisschen später ans Ziel, andere entdecken eine Abkürzung und werden zu Wegbereitern für die Übrigen. Da sind jene Glücklichen, die den Weg von Anfang an klar und deutlich vor sich sehen; andere, wie das hässliche Entlein, haben zunächst zu kämpfen.
Andere Wegbereiter und viele andere Geschichten haben mich gelehrt, dass viele Wege zum erwünschten Ziel führen, unendlich viele Routen, die uns in die richtige Richtung lenken; doch all diesen Wegen ist gemeinsam, dass man Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen finden muss, die jeder Mensch sich stellt, sobald er denken kann.
Es sind drei Fragen, die sich der Protagonist des Märchens, wenn auch unausgesprochen, stellt und durch konkretes Handeln und mutige Entscheidungen beantwortet.
An diesem Punkt kann man das Märchen neu lesen und erkennen, dass es keinen Weg gibt, auf dem es nicht darum geht, Antworten auf diese drei Fragen zu finden: Wer bin ich?
Wohin gehe ich?
Und … mit wem?
Fragen, die sich allenfalls für kurze Augenblicke ausblenden lassen, denn wer keine Antworten darauf findet, dem werden sie unterwegs immer wieder begegnen.
Fragen, die man beantworten muss, wenn man vorankommen will, denn bei der Suche nach Antworten lernt man, was man unbedingt wissen muss, um weiterzukommen.
Fragen, die wir nacheinander und in genau dieser Reihenfolge für uns beantworten müssen.
Was wäre aus dem hässlichen Entlein geworden, wenn es den Weg eingeschlagen hätte, den die anderen Bewohner des Hühnerhofs ihm vorzeichneten?
Was würde aus dir, wenn du der Überzeugung wärst, dein Wert hinge nur davon ab, mit wem du zusammen bist? Was würde aus uns allen, wenn unsere Mitmenschen darüber entschieden, wer wir zu sein haben? Was wäre aus unserem armen Protagonisten geworden, hätte er versucht, so zu sein wie die anderen? Er hätte sich lediglich damit abfinden können, hässlich, ungeliebt und nutzlos zu sein, und wäre zwangsläufig gescheitert.
Das hässliche Entlein macht einen Bewusstwerdungsprozess durch: Nein, es ist nicht so, wie die anderen behaupten. Ja, ich bin anders, aber das macht mich nicht unbedingt verachtenswert. Und dann macht es sich auf den Weg zu sich selbst.
Es ist keine Ente, keine Gans, keine Katze und auch kein Huhn, und es muss zunächst lernen, all das nicht länger sein zu wollen, bevor es herausfindet, wer es wirklich ist. Der Preis für diesen Eigensinn ist hoch und die Aufgabe nicht leicht.
Eine Lebenslektion, die wir eigentlich aus dem Mund von spirituellen Führern erwarten, beschäftigt uns auch heute, doch nun kommt sie von Ökonomen, Finanzministern oder Staatschefs. Das unmittelbare Ziel des Wachstums ist nicht länger an finanzielle Sicherheit, Reichtum oder Besitz gekoppelt, sondern liegt in der Freiheit, und das setzt Verzicht voraus.
Die Tugend des Verzichts wurde in fast allen Religionen und von nahezu allen spirituellen Führern als Schlüssel zu einem besseren Selbst gepriesen. Und sie alle hatten recht.
Vom heiligen Franziskus von Assisi bis hin zu Buddha gibt es viele Lebenswege, die als Vorbild für ein entsagungsreiches Leben taugen, doch wenn man ihre Geschichte liest, zeigt sich, dass die kulturellen Paradigmen ihrer Zeit in der Welt, in der wir leben, oft keine Gültigkeit mehr besitzen.
Von klein auf haben wir gelernt, unsere Schulsachen, unsere Kleidung und all unsere kleinen Besitztümer wertzuschätzen. Man hat uns beigebracht, sie pfleglich zu behandeln, nichts kaputtzumachen und alles daranzusetzen, immer mehr zu bekommen … Nicht einfach, dieses Muster in Frage zu stellen! Und doch gibt es etwas, das wir vielleicht tun können: Wir können dieses Muster um vier Punkte ergänzen, die es uns ermöglichen, auf unserem Weg zum Verzicht weiterzukommen, ohne den kulturellen Background komplett außen vor zu lassen:
genau hinsehen
teilen
nichts horten
nichts anhäufen.
Wer einen Ort hat, den er als seinen erachtet, wird ihn logischerweise wertschätzen. Das klingt gut und richtig, doch Wertschätzen ist etwas anderes als Sich-Festklammern. »Ich genieße, was ich habe« ist etwas ganz anderes als »Ich brauche das, um ich selbst zu sein«. Sich dafür zu entscheiden, an einem bestimmten Ort zu sein, ist etwas anderes, als dort gefangen zu sein.
Es klingt wie eine Binsenweisheit, dass der Mensch nicht ist, was er hat, und dass es nicht glücklich macht, Dinge anzuhäufen. Aber was man oft beobachten kann, legt die Vermutung nahe, dass gar nicht wenige Mitmenschen das glauben.
Und dann ist da dieses hässliche Entlein, das über den Zaun des Hühnerhofs flattert und allen Schutz zurücklässt, um sich völlig allein und auf sich gestellt auf seine Suche zu machen.
Auch davon erzählt dieses Märchen: Wie das Verlassen des schützenden Umfelds (oder der »Komfortzone«, wie es heute heißt) eine entscheidende Rolle in unserem Leben spielen kann. Wenn wir etwas von diesem hässlichen Entlein lernen können, dann, dass es Mut braucht, sich aus vorgegebenen Bahnen zu befreien und das Wagnis einzugehen, dem eigenen Herzen, seinen Gefühlen, Empfindungen und Idealen zu folgen.
Aber wir werden diese Entscheidung treffen, du und ich, und das nicht nur einmal. Glaubst du nicht?
Die zweite Frage ist die schwierigste für das hässliche Entlein: Wohin soll es gehen?
Auf unsere Menschenwelt übertragen: Was gibt unserem Leben Sinn?
Das hässliche Entlein weiß nicht so viel über seine Ziele wie du oder ich, aber es hat eine klare Vorstellung davon, dass es etwas Besseres sucht als das, was das Schicksal für es bereithält. Es will das Beste für sich und die schönen Dinge des Lebens genießen. Das ist nicht schlecht, wenn man im falschen Nest gelandet ist, findest du nicht?
Auch für uns ist diese zweite Frage nicht leicht zu beantworten. Vor allem, wenn du feststellst, dass dir die Ratschläge der anderen nicht weiterhelfen, du aber eine Antwort darauf finden musst, bevor du dich der dritten Frage widmest.
Neuesten Studien zufolge sucht ein Drittel aller Patienten einen Therapeuten auf, weil sie keinen Sinn im Leben sehen. Um den Sinn des Lebens zu finden, muss man sich den Unterschied zwischen Wunsch und Ziel, zwischen Sinn und Zweck deutlich machen. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, war der Erste, der betonte, wie wichtig es ist, einen Sinn im Leben zu finden.
Frankl wurde während des Zweiten Weltkriegs wegen seiner jüdischen Herkunft von den Nazis in ein Konzentrationslager deportiert. In den Vernichtungslagern beobachtete der Wiener Arzt, dass fast ausschließlich solche Gefangenen überlebten, denen es gelang, ihrem furchtbaren Leben im Lager irgendeinen Sinn abzugewinnen.
Inmitten des Horrors, so stellte Frankl fest, brauchten die Menschen ein Ziel, und sei es noch so klein, um sich ihren Überlebenswillen zu wahren. Noch während der Gefangenschaft beschloss er, dieser Beobachtung weiter auf den Grund zu gehen und darüber zu schreiben. Diese Erkenntnis und das Vorhaben, darüber zu schreiben, boten dem Autor selbst einen tieferen Sinn, der ihn am Leben hielt.
Man kann immer einen Sinn im Leben finden, in jeder Situation und in allen Lebensumständen, auch wenn dies in unserer angenehmen Lebenswirklichkeit sicherlich einfacher ist, als es in den Konzentrationslagern der Nazis war. Doch man sollte immer damit beginnen, zwischen den Begriffen Wunsch und Ziel zu unterscheiden, denn allzu oft wird übersehen, wie grundlegend sich beides voneinander unterscheidet.
Ziele sind Häfen, die man im Leben ansteuert; den Weg dorthin zeigt uns die Erfahrung.
Erfolge sind Anreize, weiterzumachen, aber wir wissen nur dann, wohin die Reise geht, wenn wir für uns erkennen, was die Bestimmung unseres Lebens ist.
Mit der Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, kommen auch die Antworten auf die dritte Frage. Es sind die Begegnungen mit anderen, die in dieselbe Richtung unterwegs sind und die, genau wie man selbst, den Mut hatten, zurückzulassen, was nicht mehr ist. Es sind die Liebe und die Begegnung mit Reisegefährten in Zeit und Raum.
So wie das hässliche Entlein, bevor es sich auf den Weg macht, neigen auch wir dazu, zu glauben, unser Alltag, unsere Familie, unser Partner, der Job, Wissenschaft und Politik seien unumstößlich und unwiderruflich – so war es schon immer, und so wird es immer sein. Die Geschichte vom hässlichen Entlein ist eine Einladung, sich die Realität zu eigen zu machen, in der man lebt, und zu begreifen, dass die Welt das ist, was wir gemeinsam daraus machen.
Wenn ich weiß, wer ich bin und wohin mein Weg führt, und ich mir das Recht herausnehme, mir bewusst auszusuchen, wer mich auf meinem Weg begleitet, werde ich nicht nur eine angenehme, entspannte Reise haben; ich kann auch eine positivere Sicht auf die Dinge entwickeln und dafür sorgen, dass die Welt mehr und mehr zu dem Ort wird, den ich mir für mich und andere ersehne.
2Aschenputtel
Einleitung
Die Version von Aschenputtel, die wir alle aus Kindertagen kennen, ist in Wirklichkeit eine entschärfte, überzuckerte Adaption der Geschichte, wie sie die Gebrüder Grimm niederschrieben. Diese wiederum hat, wie wir später sehen werden, ihren Ursprung in uralten Erzählungen aus unterschiedlichen Kulturen, in denen die bekanntesten Elemente des Märchens, etwa die Figur der Fee, überhaupt nicht auftauchen.
Wie bei jeder Geschichte in diesem Buch erzähle ich dir zunächst meine eigene Version von Aschenputtel. Dabei richte ich den Blick vor allem auf jene wiederkehrenden Motive, die in den meisten Versionen dieses Märchens auftauchen, das so oder so ähnlich in verschiedenen Ländern und Kulturen überall auf der Welt erzählt wird.
Die Geschichte
Die schöne Ella ist die einzige Tochter eines wohlhabenden Mannes, der auf tragische Weise seine Frau verliert, als das Mädchen zehn Jahre alt ist.
Der Mann kommt nur schwer über den Verlust seiner geliebten Frau hinweg, doch nach einigen Monaten der Trauer beschließt er aus Angst vor Einsamkeit und aus Sorge um die Erziehung seiner Tochter, so schnell wie möglich wieder zu heiraten.
Das Märchen beginnt mit der Wahl der zukünftigen Ehefrau: eine gleichfalls verwitwete Gräfin, die, so raten ihm alle, die notwendigen Eigenschaften habe, ihn über seinen Verlust hinwegzutrösten, ihm eine treue Gefährtin zu sein und ihm und seiner Tochter eine richtige Familie zu bieten, so wie vor dem Tod seiner ersten Frau.
Die Ehevereinbarungen werden schnell getroffen, und am Tag nach der Hochzeit ziehen der Mann und seine Tochter in das Haus der neuen Ehefrau, die dort mit ihren beiden Töchtern Dracina und Renarda lebt.
Die beiden Mädchen, die ein wenig älter sind als Ella, sind nicht besonders glücklich über die Neuankömmlinge. Sie sind abweisend und neidisch und machen vom ersten Tag an klar, dass sie nicht bereit sind, ihnen das Leben leichtzumachen, insbesondere ihrer neuen Schwester.
Trotz der Zwistigkeiten zwischen den Mädchen verläuft das Zusammenleben in den ersten Wochen normal; die täglichen Reibereien werden dank der schlichtenden Worte und der Autorität des Hausherrn rasch beigelegt, der den Streitereien mit Geduld und Nachsicht begegnet.
Als der Vater jedoch nach einem Monat seine Geschäftsreisen wiederaufnimmt und manchmal wochenlang unterwegs ist, wird das Zusammenleben schwieriger …
Kaum ist der Vater aus dem Haus, fangen die Töchter der Gräfin an, Ella zu piesacken. Die Stiefmutter sieht dem Streit entweder amüsiert zu, oder sie gibt Ella die Schuld und behauptet, das Mädchen habe ihre Töchter provoziert.
Natürlich bekommt der Vater das alles brühwarm erzählt, sobald er nach Hause kommt. Nachdem er sich die Klagen der Gräfin über das Benehmen seiner Tochter angehört hat, stellt er sich auf die Seite seiner Frau und ermahnt seine Tochter, nicht mit den Schwestern zu streiten und ihrer Stiefmutter zu gehorchen.
»Aber ich …«, versucht sich das Mädchen zu verteidigen.
»Kein Aber!«, fällt der Vater ihr ins Wort. »Gehorch einfach, und tu, was man dir sagt!«
Vielleicht hätte der Vater mit der Zeit gemerkt, wie ungerecht er war. Vielleicht hätte er gesehen, dass seine Tochter weder ungehorsam noch streitlustig war. Vielleicht hätte er irgendwann herausgefunden, was wirklich passierte, wenn er nicht da war.
Hätte, könnte, wäre …
Doch es kommt anders.
Einige Monate darauf bricht der Mann zu einer langen Reise in den Orient auf. Eine Reise, von der er nicht zurückkehren wird …
Die schreckliche Nachricht trifft schon bald nach seiner Abreise ein. Das Schiff, auf dem Ellas Vater unterwegs war, ist vor der indischen Küste gesunken, es gibt keine Überlebenden.
Als sie das erfährt, wird die Gräfin, nun zum zweiten Mal verwitwet, noch hartherziger und strenger gegenüber der Tochter ihres verstorbenen Mannes, die sie für alles verantwortlich zu machen scheint, was passiert ist.
Ella bekommt die ganze Missgunst ihrer Stiefmutter zu spüren. Das Mädchen muss von nun an in einer Dachkammer schlafen und sämtliche niederen Arbeiten im Haus verrichten.
Die mittellose Waise wird von ihrer »Adoptivfamilie« wie eine Dienstmagd behandelt. Sie muss bis tief in die Nacht arbeiten und im Morgengrauen aufstehen, um die Hausarbeit zu erledigen. Vor allem muss sie auf Anweisung der Stiefmutter zweimal am Tag den Herd ausfegen.
Aus diesem Grund geben Dracina und Renarda ihr den Namen »Aschenputtel«, weil ihre Kleider und ihr Gesicht immer mit Ruß und Asche bedeckt sind.
Aschenputtel ist förmlich im Haus eingesperrt und darf mit niemandem ein Wort wechseln. Ihre einzige Gesellschaft sind vier Täubchen, die in dem Baum nisten, den ihr Vater beim Einzug mitgebracht hatte, und zwei Mäuse, die aus ihrem Loch kommen, um die Brotkrumen und Käsestückchen zu fressen, die Aschenputtel ihnen hinlegt.
Eines schönen Tages geschieht etwas Unerwartetes: Der König sendet Boten aus, die den Untertanen mitteilen, dass im königlichen Palast ein großer Ball gefeiert werde. Man suche eine Frau für seinen Sohn, den Prinzen, und alle unverheirateten Mädchen des Landes seien zu dem großen Ereignis eingeladen.
Die Nachricht macht unter den Untertanen des Königs die Runde und führt in der Stadt zu heller Aufregung. Das Haus der Gräfin ist da keine Ausnahme.
Für einen kurzen Augenblick träumt auch Aschenputtel wie ihre Stiefschwestern davon, dass vielleicht sie die Auserwählte sein könnte. Die zukünftige Königin! Warum nicht?
Warum nicht …?
Weil zwischen diesem Traum und der Realität ihre böse, grausame Stiefmutter steht.
»Ich weiß nicht, was es für dich zu feiern gibt, Aschenputtel«, macht sie sich über sie lustig. »Du wirst nicht zum Ball des Prinzen gehen. Was fällt dir ein? Schau dich im Spiegel an: Du bist schmutzig, und du hast weder ein Kleid noch Schuhe … Und du willst zum Tanz? Dass ich nicht lache! Du, so wie du aussiehst, im Ballsaal des Palasts? Meine Güte, was für eine Vorstellung! Du wärst eine Schande für die Familie … Kommt nicht in Frage! Du bleibst hier, fegst den Boden und kehrst die Asche aus dem Herd. Und sorge dafür, dass das Haus blitzt, wenn wir zurückkommen.«
»Aber ich …«, wagt Aschenputtel einzuwenden.
»Sei still!«, herrscht die Stiefmutter sie an, die auf keinen Fall will, dass ihre Töchter noch mehr Konkurrenz bei der Bewerbung um den Thron bekommen.
»Du sei nur still!«, wiederholen die Stiefschwestern im Chor.
An diesem Abend setzt sich Aschenputtel aufs Bett und weint bitterlich, bis am nächsten Morgen die Sonne aufgeht. Sie ist sehr traurig. Tief in ihrem Inneren findet sie, dass auch eine einfache Dienstmagd zum Ball gehen können sollte, um den Prinzen kennenzulernen oder ihn zumindest von ferne zu sehen.
Schließlich, nach vielen Tränen, ist der große Tag des Balls gekommen.
Im Haus herrscht große Aufregung, nur Aschenputtel bleibt nichts zu tun, als ihren Stiefschwestern bei ihren vergeblichen Bemühungen um Eleganz und Schönheit zu helfen.
»Aschenputtel, schnür mein Korsett enger!«
»Aschenputtel, steck mir das Haar auf!«
»Aschenputtel, bring mir das Rouge!«
»Aschenputtel, putz meine Schuhe!«
Aschenputtel hier, Aschenputtel da …
Obwohl sie sich redlich bemüht, ihre Stiefschwestern herauszuputzen, sind ihre Anstrengungen zum Scheitern verurteilt. Die beiden Mädchen sind zutiefst hässlich, von einer Hässlichkeit, die nur noch von ihrer Boshaftigkeit übertroffen wird …
Am Abend brechen die Gräfin und ihre beiden Töchter in ihren feinsten Kleidern zum königlichen Palast auf. Aschenputtel bleibt allein und tieftraurig im Haus zurück.
»Warum bin ich so unglücklich?«, klagt sie unter Tränen. »Mutter, ich vermisse dich so sehr! Wenn du hier wärst, wäre alles anders … Ach, wenn du mir nur helfen könntest!«
Da geschieht etwas Unglaubliches: Aus dem Garten fällt ein strahlend weißes Licht durchs Fenster und erhellt das Haus. Überrascht tritt Aschenputtel ans Fenster und sieht, dass das Licht aus der Eiche zu kommen scheint, die sie und ihr Vater aus ihrem früheren Zuhause mitgebracht und im Garten gepflanzt hatten.
Seltsamerweise hat Aschenputtel keine Angst. Unbekümmert und hoffnungsvoll läuft sie in den Garten hinaus und tritt unter den Baum.
Dort stellt sie fest, dass das Strahlen von der nebelhaften Erscheinung einer alten Frau ausgeht. Die Frau hat das gütigste Gesicht, das Aschenputtel je gesehen hat, und streckt die Arme aus, als wollte sie das Mädchen auffordern, doch näher zu kommen …
»Weine nicht länger«, sagt die Frau. Sie hat eine sanfte, zarte Stimme, die das Mädchen an seine Mutter erinnert.
»Wer bist du?«, wagt Aschenputtel zu fragen.
»Ich bin deine gute Fee«, sagt die Frau mit einem milden Lächeln. »Und ich bin hier, um dir zu helfen, deinen Traum zu erfüllen. Wenn du möchtest, werde ich dafür sorgen, dass du zu dem Ball im Palast gehen kannst.«
»Das wäre herrlich!«, sagt Aschenputtel. Dann lässt sie den Kopf hängen. »Aber wie soll das gehen? Schau dir meine Lumpen an … Ich habe weder ein Kleid noch Schuhe. Und wie soll ich zum Palast kommen?«
Die Fee zückt wortlos ihren Zauberstab und berührt Aschenputtel an den Schultern. Augenblicklich verwandeln sich ihre Lumpen in ein wunderschönes himmelblaues Kleid.
Bevor Aschenputtel sich lange darüber wundern kann, schwebt die Fee ins Haus und holt einen Kürbis aus der Vorratskammer. Dann ruft sie in einer fremden Sprache die vier Täubchen aus dem Baum und die zwei freundlichen Mäuse herbei.
Eine Berührung des Zauberstabs verwandelt die Tauben in herrliche, schneeweiße Pferde, der Kürbis wird zu einer Kutsche, und die Mäuse sind plötzlich ein Kutscher und ein Page in vornehmen Livreen, bereit, das Mädchen wie eine Königin zum Ball zu geleiten.
»Los, los, beeil dich«, sagt die Fee.
»Warte.« Aschenputtel zögert. »Schau dir meine Füße an. So kann ich nicht gehen, ohne Schuhe!«
Erneut schwingt die Fee lächelnd den Zauberstab, und wie aus dem Nichts erscheint ein Paar funkelnder gläserner Schuhe, die dem Mädchen wie angegossen passen.
»Eines noch, Aschenputtel«, mahnt die Fee. »Bedenke, dass der Zauber nicht ewig anhält …«
Die Fee senkt die Stimme.
»Um Punkt Mitternacht, mit dem letzten Glockenschlag, wird der Zauber enden. Die Kutsche wird sich wieder in einen Kürbis verwandeln und dein Kleid in die Lumpen, die du zuvor getragen hast. Du musst vorher zurück sein.«
»Verstanden«, sagt Aschenputtel. »Ich werde daran denken und vor Mitternacht zurück sein. Ich bin so glücklich, dass ich überhaupt zum Ball kann …«
Aschenputtel besteigt mit Hilfe ihrer Begleiter die Kutsche. Als sich das Gefährt in Bewegung setzt, schaut sie aus dem Fenster, winkt und haucht ein leises »Danke« in Richtung der Fee.
Am Schloss helfen ihr die beiden Diener aus der Kutsche und geleiten sie zur Freitreppe.
Als sie den Saal betritt, macht sich ein erstauntes Schweigen breit. Niemand hat je zuvor dieses Mädchen gesehen, und alle sind wie geblendet von seiner Schönheit.
»Sie ist eine Prinzessin aus einem fernen Land«, macht das Gerücht die Runde.
Nicht einmal die drei Frauen, mit denen Aschenputtel zusammenlebt, erkennen sie, so sehr sind sie daran gewöhnt, sie in Lumpen und rußverschmiert zu sehen.
Auch der Königssohn ist wie geblendet von so viel Schönheit, doch eingedenk seiner Position als Thronfolger atmet er tief durch, um seine schlotternden Knie unter Kontrolle zu bringen, und geht dann der unbekannten Schönen entgegen, heißt sie mit einer tiefen Verbeugung willkommen und bietet ihr seinen Arm, um sie zur Tanzfläche zu führen. Die Musik ist verstummt, die Gäste sehen die Fremde verwundert an.
Der Prinz bedeutet dem Orchester mit einer Handbewegung, weiterzuspielen, dann reicht er Aschenputtel die Hand und fordert sie zum Tanz auf.
Für den Rest des Abends tanzt der Gastgeber nur noch mit Aschenputtel und weist alle anderen Kavaliere ab, die mit ihr tanzen wollen.
»Sie ist meine Tanzpartnerin«, sagt er jedem, der sich dem Mädchen nähert.
In den Armen des stattlichen Prinzen vergeht die Zeit wie im Fluge, bis Aschenputtel bei einer Drehung einen Blick auf eine der Uhren im Ballsaal erhascht und sieht, dass es nur noch wenige Minuten bis Mitternacht sind.
»O mein Gott! Ich muss nach Hause!«, sagt sie, reißt sich von dem Prinzen los und wendet sich zum Gehen, während sie daran denkt, dass sich ihr Kleid in wenigen Minuten in schmutzige Lumpen und ihre Kutsche in einen Kürbis zurückverwandeln werden.
»Ich werde dich zu deinem Schloss begleiten, wo auch immer es sein mag«, sagt der Prinz, der wissen will, wer dieses junge Mädchen ist, das er unbedingt wiedersehen möchte.
»Nein, nein«, wehrt Aschenputtel ab. »Ich muss gehen …«
Und ohne weitere Erklärungen lässt sie den Prinzen mitten im Ballsaal stehen und eilt zum Ausgang.
Als sie die Schlosstreppe hinunterläuft und hastig ihre Kutsche besteigt, verliert sie einen ihrer gläsernen Schuhe.
Nachdem der Prinz die Überraschung über den überstürzten Aufbruch der Unbekannten überwunden hat, läuft er ihr hinterher, doch als er den Park erreicht, verschwindet die Kutsche bereits in der Dunkelheit. Auf dem Boden ist lediglich ein zierlicher gläserner Schuh zurückgeblieben, die einzige Spur des schönen Gastes.
Von diesem Augenblick an ist dem Prinzen klar, wer die zukünftige Königin sein soll, auch wenn er nicht weiß, wer die Unbekannte war und wie er sie wiederfinden soll. Er wird dieses Mädchen heiraten, das heute Nacht seinen Schuh verloren hat, und er wird nicht ruhen, bis er es gefunden hat.
Am nächsten Morgen verlässt der Prinz sein Schloss und reist durchs ganze Land.
Alle jungen Mädchen müssen den gläsernen Schuh anprobieren; diejenige, der er passt, soll die künftige Königin sein.
Der Schuh jedoch ist so zierlich, dass kein Mädchen hineinpasst.
Nach einigen Tagen trifft der Prinz mit seinem Gefolge vor dem Haus der Gräfin ein, in dem auch Aschenputtel lebt.
»Wir sind auf der Suche nach der Besitzerin dieses gläsernen Schuhs«, sagen sie. »Der Königssohn hat verkündet, dass er das Mädchen zur Frau nehmen wird, dem dieser Schuh passt.«
Aufgeregt macht sich die Stiefmutter auf die Suche nach ihren hässlichen Töchtern, damit sie den Schuh anprobieren, während sie lauthals beteuert:
»Der Schuh gehört einer meiner Töchter … Ich erkenne ihn wieder!«, lügt sie. »Ich laufe und hole sie.«
Den gläsernen Schuh in der Hand, stürzt sie ins Haus und ruft:
»Mädchen! Der Prinz hat euren Schuh gefunden!«
Die Ältere hat sehr große Füße, und es ist sonnenklar, dass sie niemals in den winzigen Schuh hineinpassen wird. Die Gräfin ruft aus dem Fenster, dass ihre Tochter gleich nach unten komme; dann nimmt sie ein Küchenmesser und befiehlt:
»Los, hack dir die Zehen ab, Dracina. Du brauchst sie nicht mehr. Wenn du erst Königin bist, wirst du nie wieder zu Fuß gehen müssen.«