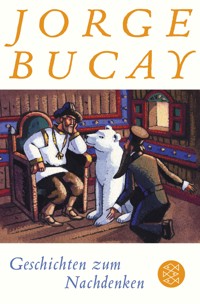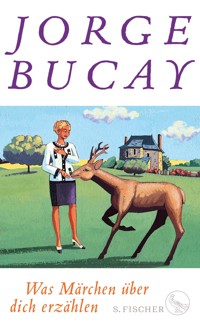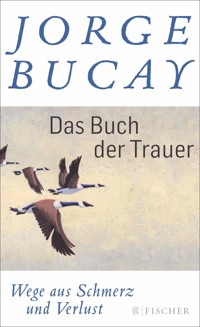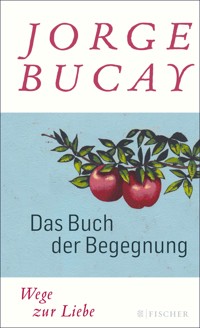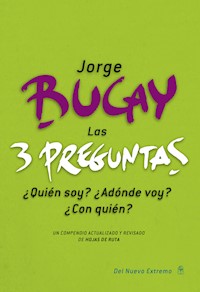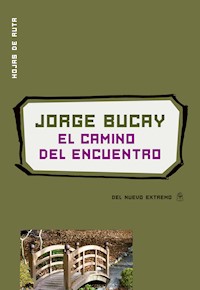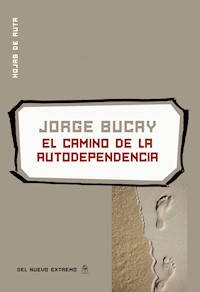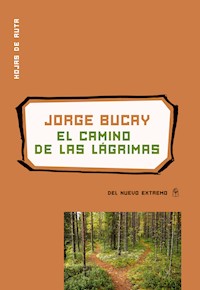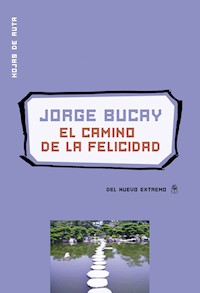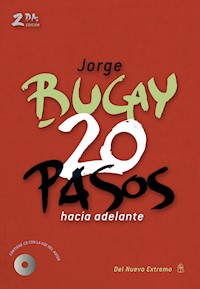9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Niemand kann für dich tun, was du für dich selbst tun kannst.« Jorge Bucay Die Autonomie des Einzelnen, seine Begegnung mit der Liebe, seine Auseinandersetzung mit Schmerz und Verlust und die Suche nach Glück, das sind die vier entscheidenden Wege, die zur Erfüllung unseres Daseins führen. ›Selbstbestimmt leben‹ ist der erste Weg, den ein jeder für sich erobern muss, der eine unabhängige Persönlichkeit entwickeln will. Wie kann ich mich selber wahrnehmen? Wie schaffe ich es, mich von den Wünschen und Projektionen anderer, mit denen ich mein Leben verbringe, frei zu machen. Jorge Bucay erzählt, wie Abhängigkeiten entstehen und wie wir uns von anderen unterscheiden und abgrenzen können. Nur wenn wir uns selbst genug lieben, können wir Autonomie im Zusammenleben mit anderen erlangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jorge Bucay
Selbstbestimmt leben
Wege zum Ich
Aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Ursprungsfamilie
Chela, Elías und Cacho,
durch die ich bin, der ich bin.
Einleitung
Mit Sicherheit gibt es einen Weg,
der vielleicht
auf vielerlei Weise
individuell und einzigartig ist.
Vielleicht gibt es einen Weg,
der mit Sicherheit
auf vielerlei Weise
für alle derselbe ist.
Mit Sicherheit gibt es
einen möglichen Weg.
Dieser Weg ist es, den man finden und gehen muss. Vielleicht macht man sich allein auf und ist überrascht, auf dem weiteren Weg all jenen zu begegnen, die in dieselbe Richtung unterwegs sind.
Dieses endgültige, einsame, persönliche, entscheidende Ziel sollte man nicht vergessen. Denn es ist unsere Brücke zu den anderen, der einzige Verbindungspunkt, der uns unweigerlich mit der Welt dessen verbindet, was ist.
Wie auch immer man das endgültige Ziel nennen mag: Glück, Selbstverwirklichung, Erfüllung, Erleuchtung, Erkenntnis, innerer Frieden, Erfolg, Vollendung oder einfach das endgültige Ziel … Es tut nichts zur Sache. Wir alle wissen, dass es darum geht, gut dort anzukommen.
Manche gehen unterwegs in die Irre und treffen ein wenig später ein, andere finden eine Abkürzung und werden zu kundigen Führern für die anderen.
Einige dieser Wegführer haben mich gelehrt, dass es viele Wege gibt, die ans Ziel führen, unendlich viele Ausgangspunkte, Tausende von Optionen und Dutzende von Routen, die in die richtige Richtung führen. Wege, die jeder für sich geht.
Doch es gibt einige Wege, die stets Teil des ganzen Weges sind.
Wege, denen man nicht ausweichen kann.
Wege, die man gehen muss, wenn man weiterkommen will.
Wege, auf denen wir lernen, was man unbedingt wissen muss, um das letzte Wegstück in Angriff zu nehmen.
Für mich sind diese unerlässlichen Wege die folgenden vier:
Der Weg der endgültigen Begegnung mit sich selbst. Ich nenne ihn den Weg der Selbstabhängigkeit.
Der Weg der Begegnung mit dem Anderen, mit der Liebe und der Sexualität. Ich nenne ihn den Weg der Begegnung.
Der Weg der Verluste und des Schmerzes. Ich nenne ihn den Weg der Tränen.
Und schließlich den Weg der Erfüllung und der Sinnsuche. Ich nenne ihn den Weg des Glücks.
Auf meiner eigenen Reise habe ich die Hinweise studiert, die andere auf ihrer Reise hinterließen, und ich verwendete einige Zeit darauf, meine eigenen Wegkarten zu zeichnen.
Meine Karten dieser vier Wege wurden in jenen Jahren zu einer Art Leitfaden, der mir dabei half, wieder auf den Weg zurückzufinden, wenn ich die Orientierung verlor.
Vielleicht können meine Bücher dem einen oder anderen eine Hilfe sein, der wie ich immer wieder vom Weg abkommt, und vielleicht auch jenen, die in der Lage sind, Abkürzungen zu finden. Aber eine Karte ist immer etwas anderes als die Landschaft selbst, und wir müssen die Route immer wieder korrigieren, wenn wir aufgrund unserer eigenen Erfahrungen einen Fehler des Kartographen entdecken. Nur so können wir den Gipfel erreichen.
Hoffentlich begegnen wir uns dort.
Das würde bedeuten, dass du es geschafft hast.
Und es würde bedeuten, dass auch ich es geschafft habe.
Jorge Bucay
Statt eines Vorworts
Die Allegorie von der Kutsche
Eines Tages im Oktober sagt eine vertraute Stimme am Telefon zu mir:
»Komm mal vor die Tür. Da ist ein Geschenk für dich.«
Begeistert renne ich auf die Straße, und da steht sie: eine prächtige Kutsche, die genau vor meiner Tür hält. Sie ist aus glänzendem Nussbaumholz, mit Bronzebeschlägen und Lampen aus weißem Porzellan, sehr vornehm, sehr elegant, sehr »chic«. Ich öffne den Wagenschlag und steige ein. Eine breite, dick gepolsterte Bank aus bordeauxrotem Samt sowie weiße Spitzenvorhänge verleihen dem Innenraum ein herrschaftliches Gepränge. Ich nehme Platz und stelle fest, dass alles wie für mich gemacht ist: Beinfreiheit, Sitztiefe, Deckenhöhe … Alles ist sehr bequem, da ist kein Platz für jemand anderen. Ich schaue aus dem Fenster: Auf der einen Seite ist die Fassade meines Hauses zu sehen, auf der anderen das Nachbarhaus … Und ich sage mir: »Was für ein wunderbares Geschenk! Einfach phantastisch …«, und ich genieße eine ganze Weile dieses Gefühl.
Doch nach einiger Zeit beginne ich mich zu langweilen. Die Aussicht aus dem Fenster ist immer dieselbe. Ich frage mich, wie lange man immer dasselbe ansehen kann. Und ich komme zu dem Schluss, dass dieses Geschenk, das man mir gemacht hat, völlig nutzlos ist.
Gerade, als ich meinem Unmut lautstark Ausdruck verleihen will, kommt mein Nachbar vorbei und sagt, als könne er meine Gedanken lesen:
»Merkst du nicht, dass dieser Kutsche etwas fehlt?«
Ich mache ein ratloses Gesicht, während ich die Polster und Wandbespannungen betrachte.
»Die Pferde fehlen«, setzt er hinzu, bevor ich fragen kann.
Ach, deshalb verändert sich die Aussicht nicht, denke ich. Deshalb ist es so eintönig …
»Stimmt«, sage ich.
Ich gehe zur Poststation und spanne zwei Pferde vor den Wagen. Dann steige ich wieder ein und rufe von drinnen:
»Hüh!!!«
Die Landschaft, die an mir vorüberzieht, ist wunderbar, einzigartig, sie verändert sich fortwährend und versetzt mich in Staunen.
Doch nach einiger Zeit spüre ich, wie die Kutsche zu vibrieren beginnt, und ich bemerke einen Riss in einer der Seitenwände.
Es sind die Pferde, die mich auf schreckliche Wege führen; sie jagen durch sämtliche Schlaglöcher, galoppieren über Randsteine, bringen mich in gefährliche Viertel.
Mir wird bewusst, dass ich keinerlei Kontrolle habe. Die Pferde machen mit mir, was sie wollen.
Am Anfang war die Fahrt wirklich schön, aber irgendwann merke ich, dass es sehr gefährlich ist.
Ich bekomme Angst und stelle fest, dass auch das mir nichts nützt.
In diesem Moment sehe ich meinen Nachbarn in seinem Auto vorbeifahren. Ich brülle ihn an:
»Was hast du mir angetan?«
Er schreit zurück:
»Du hast den Kutscher vergessen!«
»Oh …«, sage ich.
Unter großer Mühe bringe ich mit seiner Hilfe die Pferde zum Stehen und beschließe, einen Kutscher einzustellen. Ein paar Tage später tritt er seinen Dienst an. Er ist ein zuverlässiger, umsichtiger, erfahrener, stets schlecht gelaunter Mann.
Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin, das Geschenk, das man mir gemacht hat, wirklich zu genießen.
Ich steige ein und mache es mir bequem, dann sehe ich aus dem Fenster und sage dem Kutscher, wo es hingehen soll.
Er lenkt, er hat die Lage unter Kontrolle, er entscheidet über die angemessene Geschwindigkeit und wählt die beste Route.
Und ich genieße die Fahrt.
Diese kleine Geschichte soll dazu dienen, das ganzheitliche Konzept des Seins zu veranschaulichen.
Bei der Geburt verlassen wir unser »Haus« und erhalten ein Geschenk: unseren Körper. Eine Kutsche, nur gemacht für uns. Ein Fortbewegungsmittel, das sich im Laufe der Zeit allen Veränderungen anpassen kann und doch während der gesamten Reise ein- und dasselbe bleibt.
Nicht lange nach der Geburt wird unser Körper von einem inneren Drang nach Bewegung erfasst, von einer tiefen Notwendigkeit, dem unstillbaren Bedürfnis, sich in Bewegung zu setzen. Doch ohne Pferde ist die Kutsche – unser Körper – nutzlos. Diese Pferde sind unsere Impulse, unsere Triebe und Gefühle.
Eine Zeitlang geht alles gut, doch irgendwann stellen wir fest, dass diese Impulse uns auf riskante und bisweilen gefährliche Wege führen. Dann müssen wir sie zügeln. Hier kommt nun der Kutscher ins Spiel: unser Kopf, unser Intellekt, unsere Fähigkeit zu rationalem Denken. Dieser Kutscher wird uns der beste Wegführer sein.
Man muss sich bewusst machen, dass jeder von uns mindestens drei dieser Komponenten, von denen hier die Rede ist, in sich trägt.
Auf der Reise deines Lebens bist du die Kutsche, du bist die Pferde, und du bist der Kutscher.
Du musst ein Gleichgewicht zwischen all diesen Teilen herstellen und darauf achten, keines der drei zu vernachlässigen.
Wenn du zulässt, dass dein Körper nur von deinen Impulsen, deinen Gefühlen oder Leidenschaften geleitet wird, kann das sehr gefährlich werden. Du brauchst deinen Kopf, um eine gewisse Ordnung in dein Leben zu bringen.
Die Aufgabe des Kutschers ist es, sich Gedanken über den Weg zu machen. Aber letztendlich sind es die Pferde, die die Kutsche ziehen. Lass nicht zu, dass der Kutscher sie vernachlässigt. Sie müssen genährt und gepflegt werden, denn was würdest du ohne die Pferde machen? Was würde aus dir, wenn du nur aus Körper und Gehirn bestehen würdest? Wie sähe das Leben aus, wenn du keine Wünsche und Sehnsüchte hättest? Es wäre wie bei diesen Menschen, die ohne Kontakt zu ihren Emotionen durchs Leben gehen und deren Kutsche einzig und allein von ihrem Verstand angetrieben wird.
Natürlich darfst du auch die Kutsche nicht vernachlässigen, schließlich muss sie die ganze Reise hindurch halten. Und das bedeutet, sie zu reparieren, sie zu pflegen und alles Notwendige zu tun, um sie in einem guten Zustand zu erhalten. Wenn sich keiner um sie kümmert, geht die Kutsche kaputt, und wenn die Kutsche kaputtgeht, ist die Reise zu Ende.
Erst in dem Moment, in dem ich das verinnerlicht habe, in dem ich mir darüber im Klaren bin, dass ich mein Körper, mein Kopfschmerz und mein Appetit bin, mein Verlangen, meine Wünsche und Instinkte; dass ich meine Gedanken bin, mein Verstand und meine Erfahrungen … Erst dann bin ich in der Lage, mich gut gerüstet auf den Weg zu machen. Den Weg, für den ich mich heute entscheide.
1Die Ausgangssituation
Unterschiedliche Formen der Abhängigkeit
Hamlet Lima Quintana schreibt[1]:
Alles ist eine Frage des Lichts,
das auf die Dinge fällt …
Alles ist eine Frage der Form,
der Konturen,
der Auslassungen und
Unwägbarkeiten.
Alles ist auch eine Frage dessen,
wie die Zeit uns prägt,
wie, was uns umgibt, zu dem macht, was wir sind.
Im Grunde geht es darum, zu wählen,
ob man den Schatten folgt
oder sich damit abfindet, der Verfolgte zu sein.
Ein merkwürdiges »To be or not to be«
in diesem Beinahe-Sein,
in diesem Beinahe-Nichtsein.
Aus den Schatten herausfinden
oder die Schatten beständig werden lassen.
Und sich auf der letzten Etappe des Abgrunds,
wenn wir die anderen befreit haben,
all jene anderen,
daran erinnern,
dass man selbst der Gefangene ist.
Und von nun an …
frei werden.
Um den Begriff der Abhängigkeit zu begreifen, lohnt es sich, uns vorzustellen, dass wir auf manche Weise frei und auf vielerlei Weise Gefangene sind. In diesem »Beinahe-Sein und Beinahe-Nichtsein«, von dem der Dichter spricht, von der Frage auszugehen: Welchen Sinn und welche Bedeutung messen wir der Tatsache bei, dass wir von anderen abhängig sind?
Ich greife hier einen Gedanken wieder auf, für den ich seinerzeit einen eigenen Begriff formte: die Selbstabhängigkeit (= Autodependenz).
Gibt es nicht schon genügend Wörter, die auf dieselbe Wurzel zurückgehen?
Braucht es da noch ein weiteres?
Ich glaube ja.
Das Wort abhängig – dependiente – leitet sich im Spanischen von pendiente – hängend – ab, bezeichnet also etwas, das sich ohne Kontakt zu einem Untergrund in der Luft befindet.
Gleichzeitig bezeichnet es etwas, das unvollständig ist, ohne Abschluss, etwas Unerledigtes. In der maskulinen Form bezeichnet es zudem ein Schmuckstück, einen Anhänger oder Ohrring nämlich. Ist es weiblich, bezeichnet es eine abschüssige Fläche, einen Abhang, der durchaus schwierig zu erklimmen und gefährlich sein kann.
Bei all diesen Bedeutungen und Ableitungen ist es nicht verwunderlich, dass das Wort Abhängigkeit in uns Bilder hervorruft, die wir zu seiner Erklärung verwenden:
Abhängig ist jemand, der sich an einen anderen hängt, der quasi ohne Bodenhaftung in der Luft schwebt, wie ein Schmuckstück, ein Anhänger oder Anhängsel dieses anderen. Jemand, der am Abhang, am Abgrund steht, ewig unvollkommen, ewig unvollständig.
Es war einmal ein Mann, der litt an der absurden Angst, sich in der Menge zu verlieren. Alles begann an einem Abend, als er noch sehr jung war. Es war auf einem Maskenball. Jemand hatte ein Foto gemacht, auf dem alle Gäste in einer Reihe standen. Aber als er es betrachtete, konnte er sich nicht finden. Er hatte sich für ein Piratenkostüm mit Augenklappe und Kopftuch entschieden, aber viele andere waren in einer ähnlichen Verkleidung gekommen. Er hatte die Wangen rot angemalt und sich ein Schnurrbärtchen aufgemalt, aber es gab noch mehr Kostümierte mit roten Bäckchen und Schnurrbärten. Er hatte sich prächtig amüsiert auf dem Fest, aber auf dem Foto sahen alle sehr vergnügt aus. Schließlich fiel ihm wieder ein, dass er den Arm um ein blondes Mädchen gelegt hatte, als das Foto gemacht wurde; also versuchte er diesen Anhaltspunkt auf dem Foto auszumachen. Jedoch vergeblich: Mehr als die Hälfte der Frauen war blond, und nicht wenige zeigten sich Arm in Arm mit einem Piraten.
Dem Mann machte dieses Erlebnis sehr zu schaffen. In der Folge ging er jahrelang nirgendwo mehr hin, aus Angst, sich erneut zu verlieren.
Aber eines Tages fand er eine Lösung: Ganz gleich zu welchem Anlass, von nun an würde er stets braune Kleidung tragen. Braunes Hemd, braune Hose, braunes Sakko, braune Strümpfe, braune Schuhe. »Wenn dann jemand ein Foto macht, weiß ich immer, dass ich der Mann in Braun bin«, sagte er sich.
Im Laufe der Zeit hatte unser Protagonist Hunderte von Gelegenheiten, seine Schläue bestätigt zu sehen: Wenn er sich neben anderen Passanten in den Schaufenstern der großen Geschäfte spiegelte, beruhigte er sich immer wieder mit dem Satz: »Ich bin der Mann in Braun.«
Im darauffolgenden Winter schenkten ihm Freunde einen Wellnesstag. Der Mann war begeistert; er war noch nie in einem solchen Bad gewesen und hatte von Freunden schon viel über die Vorzüge von Wechselbädern, finnischer Sauna und Dampfbad gehört.
Im Bad angekommen, reichte man ihm zwei Handtücher und forderte ihn auf, in einer Kabine die Kleider abzulegen. Der Mann zog die Jacke aus, die Hose, den Pullover, das Hemd, Schuhe und Strümpfe … Als er auch die Unterhose ablegen wollte, fiel sein Blick in den Spiegel, und er erstarrte. »Wenn ich das letzte Kleidungsstück ausziehe, bin ich ein Nackter unter Nackten«, dachte er. »Und wenn ich mich verliere? Wie soll ich mich wiederfinden ohne diesen Hinweis, der mir so gute Dienste geleistet hat?«
Eine gute Viertelstunde saß er in Unterhosen in der Kabine und überlegte, ob er wieder gehen sollte … Dann fiel ihm ein, dass er vielleicht ein Identitätsmerkmal bei sich behalten konnte, wenn er schon nicht angezogen bleiben konnte. Ganz vorsichtig zupfte er einen Faden aus seinem Pullover und band ihn sich um den rechten großen Zeh. »Falls ich mich verliere, weiß ich: Der mit dem braunen Faden um den Zeh bin ich«, sagte er sich.
Nun beruhigt, genoss er den heißen Dampf in der Sauna und schwamm ein paar Bahnen. Dabei bemerkte er nicht, dass sich der Wollfaden im Wasser von seinem Zeh löste und auf der Oberfläche trieb. Als ein anderer Schwimmer den Faden im Wasser entdeckte, sagte er zu seinem Freund: »So ein Zufall! Das ist genau die Farbe, die ich meiner Frau immer beschreibe, damit sie mir einen Schal strickt. Ich nehme den Faden mit, dann kann sie Wolle in der gleichen Farbe kaufen.« Damit fischte er den Faden aus dem Wasser, und als er merkte, dass er nichts hatte, worin er ihn aufbewahren konnte, kam er auf die Idee, ihn sich um den rechten großen Zeh zu binden.
Inzwischen hatte der Held dieser Geschichte alle Angebote genutzt und begab sich wieder in die Kabine, um sich anzuziehen. Er ging guter Dinge hinein, aber als er sich abgetrocknet hatte und einen Blick in den Spiegel warf, stellte er entsetzt fest, dass er völlig nackt und der Faden an seinem Zeh nicht mehr da war. »Ich habe mich verloren«, sagte er zitternd und stürzte hinaus, um den braunen Faden zu suchen, der ihm seine Identität gab. Nachdem er eine Weile aufmerksam den Boden abgesucht hatte, fiel sein Blick auf den Fuß des anderen Mannes, der den Wollfaden um seinen Zeh gebunden hatte. Schüchtern ging er zu ihm und fragte: »Entschuldigen Sie. Ich weiß, wer Sie sind. Können Sie mir sagen, wer ich bin?«
Es muss nicht so weit gehen, dass wir auf andere angewiesen sind, damit sie uns sagen, wer wir sind. Aber wenn wir unseren eigenen Augen nicht trauen und uns nur durch die Augen der anderen sehen, sind wir nahe dran. Abhängig zu sein bedeutet, mich freiwillig einem anderen auszuliefern, damit er mich führt und leitet und mein Verhalten nach seinem Willen lenkt, nicht nach meinem. Abhängigkeit ist für mich immer etwas Dunkles und Krankhaftes, eine Haltung, die, und mag sie durch noch so viele Argumente gerechtfertigt sein, letztendlich zwangsläufig Trottel hervorbringt.
Das spanische imbécil=Trottel haben wir von den Griechen entlehnt (im: mit, báculo: Stock), die damit jene bezeichneten, die sich stets auf andere stützen, die auf andere angewiesen sind, damit sie gehen können.
Ich spreche hier nicht von Menschen, die sich in einer vorübergehenden Krise befinden, von Versehrten und Kranken, Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, unreifen Kindern und Jugendlichen. Sie sind mit Sicherheit von anderen abhängig, und daran ist nichts Schlechtes oder Schlimmeres, denn sie haben einfach nicht die Fähigkeit und die Möglichkeiten, es nicht zu sein.
Gesunde Erwachsene jedoch, die sich weiterhin dafür entscheiden, von anderen abhängig zu sein, werden mit der Zeit zu Trotteln. Viele von ihnen wurden schon zur Abhängigkeit erzogen, denn es gibt Eltern, die ihre Kinder zur Freiheit erziehen, und es gibt Eltern, die ihre Kinder dumm halten.
Es gibt Eltern, die ihre Kinder dazu ermuntern, eigene Entscheidungen zu treffen, und ihnen mit zunehmendem Alter die Verantwortung für ihr Leben übertragen, und es gibt Eltern, die am liebsten immer in der Nähe sind, »um zu helfen«, »für alle Fälle«, »weil er oder sie (mit zweiundvierzig Jahren!) so gutgläubig ist«, und »wozu haben wir das ganze Geld verdient, wenn nicht, um unseren Kindern unter die Arme zu greifen?«
Diese Eltern werden irgendwann sterben, und dann werden diese Kinder versuchen, uns als Krückstock zu benutzen.
Ich kann Abhängigkeit nicht gutheißen, weil ich die Dummheit nicht gutheißen möchte.
Fernando Savater[2] zufolge gibt es verschiedene Klassen von Trotteln.
Der rational gehemmte Trottel glaubt, dass er nichts im Kopf hat (oder er hat Angst, dass irgendwann nichts mehr drin ist, wenn er ihn benutzt). Deshalb fragt er die anderen: »Wie bin ich? Was soll ich machen? Wohin soll ich gehen?« Wenn er eine Entscheidung treffen muss, läuft er durch die Gegend und fragt: »Was würdest du an meiner Stelle tun?« Vor jeder Aktion schart er einen ganzen Beraterstab um sich, damit dieser für ihn denkt. Da er tatsächlich glaubt, dass er nicht in der Lage ist zu denken, lässt er andere für sich denken, und das ist wirklich beunruhigend. Die große Gefahr ist, dass er oft bedächtig und freundlich wirkt und wegen seiner verbindlichen Art sehr beliebt ist. (Ein Ratschlag: Wähl so einen bloß nicht!)
Der Gefühlstrottel ist immerzu darauf angewiesen, dass man ihm versichert, wie sehr man ihn liebt und schätzt und was für ein netter, liebenswerter Mensch er ist.
Er führt solche irrwitzigen Dialoge wie:
»Liebst du mich?«
»Ja, ich liebe dich …«
»Nerve ich dich?«
»Was?«
»Ich meine nur …«
»Nein, warum solltest du mich nerven?«
»Ah. Gut. Liebst du mich noch?«
(Zum Davonlaufen!)
Ein Gefühlstrottel ist ständig auf der Suche nach jemandem, der ihm immer und immer wieder beteuert, dass er niemals aufhören wird, ihn zu lieben. Wir alle haben den völlig normalen Wunsch, von dem geliebten Menschen wiedergeliebt zu werden. Aber etwas ganz anderes ist es, dies ständig bestätigt haben zu wollen.
Wir Männer haben eine stärkere Tendenz zum Gefühlstrottel als Frauen. Bei letzteren betrifft die Unfähigkeit eher praktische Dinge, weniger ihre Gefühlswelt[3].
Wenn wir tausend Paare nehmen, die sich getrennt haben, und ihren weiteren Lebensweg verfolgen, stellen wir fest, dass 95 Prozent der Männer nach drei Monaten bereits wieder mit einer anderen Frau zusammenleben (oder kurz davor stehen). Darauf angesprochen, werden sie sagen: »Ich habe es nicht ertragen, in eine dunkle Wohnung zu kommen, wo niemand auf mich wartet. Ich habe es nicht ausgehalten, die Wochenenden allein zu verbringen.«
99 Prozent der Frauen hingegen leben nach wie vor allein oder gemeinsam mit ihren Kindern. Unterhalten wir uns mit ihnen, sagen sie: »Nachdem ich erst mal raus hatte, wie der Abfluss funktioniert, und die finanziellen Fragen geklärt waren, sehe ich keinen Grund, mir einen Mann ins Haus zu holen. Wozu? Damit er zu mir sagt: ›Bring mir mal die Pantoffeln, Liebling?‹ Kommt nicht in Frage.«
Kann sein, dass sie wieder einen Partner finden, mag sein, dass sie sich nach jemandem sehnen und sich wünschen, bestimmte Dinge mit einem anderen Menschen zu teilen. Aber sie werden ziemlich sicher nicht den Erstbesten nehmen, nur um beim Nachhausekommen keine dunkle Wohnung vorzufinden. Das ist ein typisches Männerding.
Und dann gibt es noch …
die moralischen Trottel, zweifellos die gefährlichsten von allen. Das sind diejenigen, die unentwegt Bestätigung von außen brauchen, um ihre Entscheidungen zu treffen.
Der moralische Trottel braucht jemanden, der ihm sagt, ob