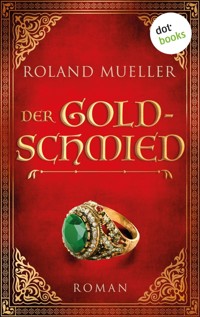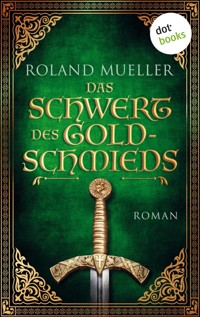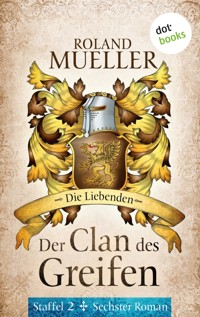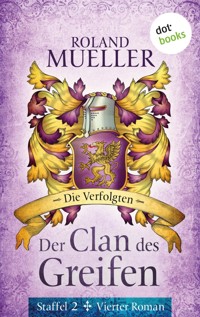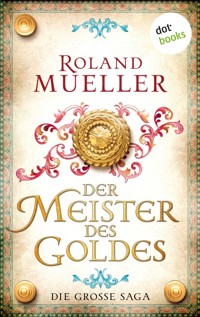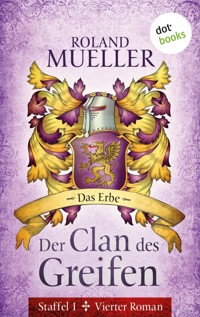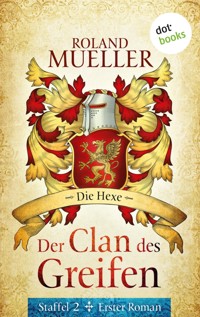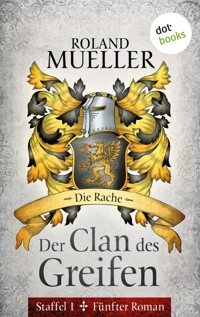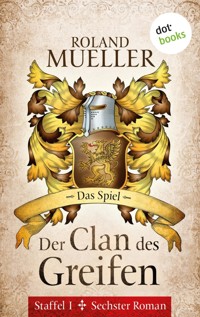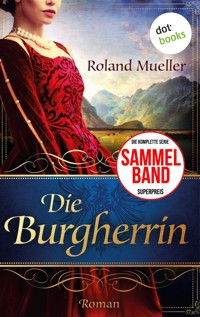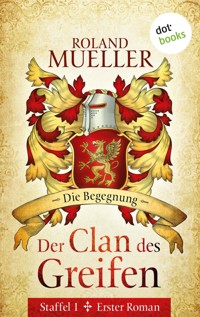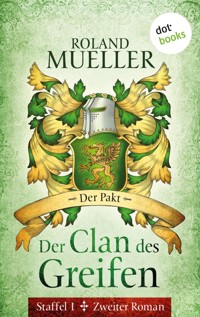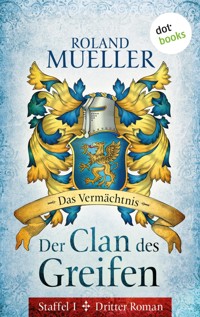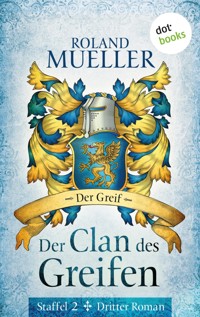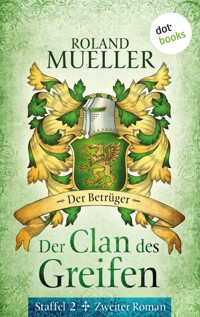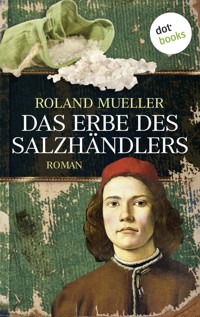
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, Treue und der Kampf um das "weiße Gold" des Mittelalters – entdecken Sie jetzt "Das Erbe des Salzhändlers" von Roland Mueller als eBook. Im Sommer 1158 reißt ein Feuer den Salzhändler Anselm Zierl samt Familie in den Tod. Nur sein Sohn Kai wird in letzter Sekunde von Junker Gottfried gerettet. Gottfried nimmt sich des Jungen an, der sich außer an seinen Namen an nichts erinnern kann. Erst nach vielen Jahren lüftet sich der Schleier um Kais Identität. Endlich ist er imstande, sein Erbe einzufordern. Doch seine Verwandten in Innsbruck erwarten ihn nicht mit offenen Armen. Trotz Intrigen, Habgier und Verrat wird Kai Salzhändler wie sein Vater – und kommt hinter das Geheimnis, das Gottfried so lange vor ihm verborgen hat … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Das Erbe des Salzhändlers" von Roland Mueller. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks - der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Sommer 1158 reißt ein Feuer den Salzhändler Anselm Zierl samt Familie in den Tod. Nur sein Sohn Kai wird in letzter Sekunde von Junker Gottfried gerettet. Gottfried nimmt sich des Jungen an, der sich außer an seinen Namen an nichts erinnern kann. Erst nach vielen Jahren lüftet sich der Schleier um Kais Identität. Endlich ist er imstande, sein Erbe einzufordern. Doch seine Verwandten in Innsbruck erwarten ihn nicht mit offenen Armen. Trotz Intrigen, Habgier und Verrat wird Kai Salzhändler wie sein Vater – und kommt hinter das Geheimnis, das Gottfried so lange vor ihm verborgen hat …
Über den Autor:
Roland Mueller, geboren 1959 in Würzburg, lebt heute in der Nähe von München. Der studierte Sozialwissenschaftler arbeitete in der Erwachsenenbildung, als Rhetorik- und Bewerbungstrainer und unterrichtet heute an der Hochschule der Bayerischen Polizei. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher.
Bei dotbooks veröffentlicht sind bereits Roland Muellers historische Romane:»Der Goldschmied«»Das Schwert des Goldschmieds«»Im Land der Orchideenblüten«»Der Fluch des Goldes«Die beiden historischen Romane »Der Goldschmied« und »Das Schwert des Goldschmieds« sind ebenso als Sammelband unter dem Titel »Der Meister des Goldes« verfügbar.
Außerdem hat Roland Mueller bei dotbooks die historische Serie »Der Clan des Greifen« veröffentlicht, die folgende Bände umfasst:»Die Begegnung. Staffel I – Erster Roman«»Der Pakt. Staffel I – Zweiter Roman«»Das Vermächtnis. Staffel I – Dritter Roman«»Das Erbe. Staffel I – Vierter Roman«»Die Rache. Staffel I – Fünfter Roman«»Das Spiel. Staffel I – Sechster Roman«»Die Hexe. Staffel II – Erster Roman«»Der Betrüger. Staffel II – Zweiter Roman«»Der Greif. Staffel II – Dritter Roman«»Die Verfolgten. Staffel II – Vierter Roman«»Die Braut. Staffel II – Fünfter Roman«»Die Liebenden. Staffel II – Sechster Roman«Die komplette Serie ist außerdem in den drei Sammelbänden »Die Burgherrin«, »Die Kinder der Burgherrin« und »Das Vermächtnis der Burgherrin« enthalten.
Daneben hat Roland Mueller die beiden historischen Kinderbücher »Die abenteuerliche Reise des Marco Polo« und »Der Kundschafter des Königs« bei dotbooks veröffentlicht.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2014
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de, unter Verwendung von Bildmotiven von Thinkstockphoto, istockphoto und Maria Seidel
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-621-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Erbe des Salzhändlers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Roland Mueller
Das Erbe des Salzhändlers
Roman
dotbooks.
PROLOG
Im November des Jahres 1157
1
Seit zwei Tagen folgten die vier Mönche dem Waldweg zu Fuß. Nur der älteste von ihnen, Bruder Wernhardt ritt auf einem Maultier. Nebelnässe durchfeuchtete ihre Wollkutten.
»Wir sind da«, sagte Bertholdus.
Es roch nach Rauch, und sie hörten Hundegebell. Wernhardt verzog sein Gesicht vor Schmerz, und Bruder Bertholdus wusste, warum. Der Abgesandte des Bischofs von Freisingen hatte Nierenschmerzen.
Vor ihnen lag ein Jagdlager, groß genug, um einem guten Dutzend Zelten Platz zu geben. Hier schien es weniger neblig zu sein, denn als sie näher kamen, erkannten sie den dunklen Wald hinter den Zeltreihen. Dort schimmerten noch Reste bunt gefärbten Laubes. Wenn die Sonne herauskam, würde das Farbenspiel sicher prächtig werden. Aber darauf hoffte niemand mehr. Die Gegend war sumpfig, und die dichten Wälder hielten den zähen Nebel fest.
»Wir sind da«, sagte Bertholdus noch einmal und hoffte, dass Wernhardt etwas darauf antworten würde.
Aber der Bruder war müde. Die tagelange Reise durch die Kälte hatte sein Leiden nur verstärkt. Lieber wäre er im Kloster geblieben, in seiner Kammer oder im Hospiz bei Bruder Engelhardt. Aber diese Reise war ja wichtig und duldete keinen Aufschub.
»Herr, hab Erbarmen«, stöhnte er und schloss die Augen, als er eine neue Schmerzwelle herannahen spürte.
»Noch nicht besser?«, fragte Bertholdus.
Wernhardt schüttelte den Kopf und stöhnte, ohne die Augen zu öffnen.
«Manchmal glaube ich, es zerreißt mir den Leib.«
Das Maultier stand still und ließ den Kopf hängen. Bertholdus ahnte, dass Wernhardt das Ende ihrer Reise möglichst lange hinauszögern wollte.
»Nun sind wir ja da«, sagte Bertholdus bereits zum dritten Mal.
»Ja«, antwortete Wernhardt mühsam, »schick Bruder Markus voraus. Er soll uns ankündigen.«
Der Mönch blickte sich um. Aber Bruder Markus hatte längst verstanden und folgte bereits mit schnellem Schritt dem Weg, der direkt in das Lager führte.
Wernhardt blieb sitzen und atmete schwer. Dann, als der Schmerz allmählich nachließ, öffnete er die Augen. Bertholdus stand neben dem Tier und wartete darauf, dass er abstieg. Wernhardt versuchte, dem Schmerz, der immer noch in leisen Wellen durch seinen Leib fuhr, keine Beachtung mehr zu schenken. Er kletterte umständlich aus dem Sattel. Bertholdus und ein weiterer Mönch halfen ihm. Wernhardt richtete sich vorsichtig auf und atmete tief ein. Es war kalt. Er fror und zog seine Kutte um seine Schultern zusammen. So gingen sie das letzte Stück, und auf der Hälfte des Weges kam ihnen Bruder Markus entgegen. Er blieb vor der kleinen Gruppe stehen. Sein Gesicht war von der Kälte gerötet, und er räusperte sich vernehmlich.
»Was ist los?«
»Der Herzog ist nicht da«, hauchte Markus.
»Was? Aber wir waren angekündigt«, entgegnete Wernhardt.
Der Mönch vor ihm zuckte nur die Schultern.
Wernhardt knirschte mit den Zähnen. »Wenn das stimmt, ist es eine Unverschämtheit.«
Tatsächlich war bislang kein Vertreter des Welfen gekommen, um sie zu begrüßen. Dennoch hatte Wernhardt das Gefühl, man beobachtete ihn und seine Begleiter. Fast meinte er, die höhnischen Bemerkungen zu hören. Seht nur die Mönche, Heinrich lässt sie den ganzen weiten Weg aus Freisingen kommen, quer durch die Wälder, bis hierher in das Jagdlager. Aber der Herzog ist gar nicht da.
»Lasst uns die Glieder aufwärmen«, befand Wernhardt und presste seine Hand gegen seine schmerzende Seite.
Sie betraten das Lager. Knechte tränkten die Pferde der Herren, ein Mann schlug Holz, trotz der Kälte mit nacktem Oberkörper. Niemand nahm besondere Notiz von ihnen.
Das Zelt des jungen Herzogs stand im Zentrum des Lagers. Ringsum gruppierten sich die übrigen Zelte seiner Ritter. Heinrichs Domizil war groß, fast quadratisch, aus schwerem, dunkelgrauem Tuch. Als sein Vater gestorben war, so erzählte man, hatte er dessen Zelt zerschneiden und sich vom Tuchner ein neues, größeres fertigen lassen. So wie Friedrich eines besaß. Sein Freund und Vetter Friedrich Barbarossa, der Kaiser.
Ein Mann trat aus dem Zelt. Er war schlank, beinahe blond, mit einem auffallend hübschen Gesicht. Eine pelzverbrämte Weste in Heinrichs Farben trug er über seinem knielangen Wams. Statt eines Schwerts hing an seinem Gürtel ein Hirschfänger. Amüsiert blickte er auf die durchfrorene Gruppe der Mönche.
»Gott schütze euch auf euren Wegen, ihr frommen Männer«, begann er.
»Deus hic!«, murmelten die Mönche.
Bertholdus trat an seinem Mitbruder vorbei auf den Mann zu.
"Deus hic! Wahrlich, Gott sei hier, Junker. Das hier ist Bruder Wernhardt aus Freisingen, Gesandter des Bischofs. Wir wollen zu Heinrich.«
«Unser Herr ist nicht da.«
«Aber es hieß, er erwarte uns. Wo ist er?
«Auf der Jagd.«
Bertholdus vergaß, den Mund wieder zu schließen. Er blickte sich nach seinem Mitbruder um und erkannte in dessen Gesicht neben dem ständigen Schmerz unverhohlenen Ärger. Wernhardt trat näher.
»Dank dir, Bertholdus«, sagte er mit einem Blick auf seinen Begleiter und sah dann den Mann vor sich streng an. »Wenn dies stimmt, empfinde ich es als Beleidigung, dass Heinrich ...«
»Lieber Bruder, niemand wollte euch beleidigen. Aber es ist Jagd und ...«
»Der Herzog weiß«, unterbrach Wernhardt ungehalten, »dass wir von weit her kommen, nur um ...«
»Verzeiht«, unterbrach ihn der Mann, »aber wir haben nicht damit gerechnet, dass ihr vor heute Abend hier seid. Außerdem hat unser Herr immer gehofft, dass der Bischof in jener Angelegenheit selbst ins Winterquartier des Herzogs reist.«
»Bis nach Braunschweig?«
»Warum nicht?«
»Aber wir haben bereits vor Wochen Heinrichs Einverständnis zu diesem Treffen hier im Bayerischen erhalten.«
Wernhardt blickte auf Bertholdus, der eilig ein Pergamentblatt entgegennahm, das der vierte Mönch aus einem Sack gekramt hatte. Er hielt dem Mann das Dokument entgegen.
»Ich weiß von der Vereinbarung«, wehrte der freundlich ab, »aber wie ich gerade sagte: Heinrich ist auf der Jagd. Doch nun kommt, und wärmt euch erst einmal auf.«
Wernhardt schnaufte und nickte dann.
»Endlich ein vernünftiges Wort«, murmelte er und trat als Erster in das Zeltinnere.
Dort erst stellte der Mann sich vor. Er nannte sich Gottfried und war Sekretär und persönlicher Diener des Herzogs. Er bot ihnen warme Ziegenmilch und frisches Brot an und versicherte dabei, dass Heinrich bis zum Abend von seinem Jagdausflug zurückkehren werde. Dann würde sich alles aufklären. Die Gespräche am warmen Feuer konnten beginnen, und alles würde sich zum Guten wenden.
Damit gaben sich die Mönche zufrieden. Gottfried war höflich, und seine Erklärungen brachte er mit ruhiger Stimme vor. Dennoch hatten Wernhardt und auch Bertholdus des Öfteren den Eindruck, dass er sich eines Lachens kaum erwehren konnte. Das konnte aber doch nur an ihren völlig durchweichten Kutten und ihrem damit verbundenen trostlosen Anblick liegen.
Im Inneren des großen Zelts war es warm und trocken. Gottfried ließ durch einen Pagen Wein reichen. Bald saßen sie alle um das Feuer und wärmten sich. Es dauerte jedoch noch Stunden, bis man ihnen mitteilte, dass Heinrich nun zurück sei. Gespannt warteten sie darauf, dass er sie begrüßen würde. Doch nichts dergleichen geschah.
Wernhardt wurde allmählich ungeduldig, und mit seiner Ungeduld steigerte sich auch sein Groll. Zuletzt bat Gottfried sie in ein weiteres Zelt, wo man ihnen Decken und Felle für die Nacht bereitlegte. Hier sollten sie bleiben, bis sich Heinrich am nächsten Morgen zu einem Gespräch bereit erklärte.
Wernhardt schäumte beinahe vor Wut. Volle vier Tage von Freisingen hierher unterwegs, in eisiger Novemberkälte und ständigem Nebel. Und dann hieß es, es sei bereits spät und der Herzog wolle erst am nächsten Tag mit ihnen sprechen. Dieser Welfe war ein bornierter, eingebildeter Grobian und schien alle Zeit der Welt zu haben, obwohl alle Beteiligten wussten, wie sehr ihm und nicht dem Bischof die Angelegenheit auf den Nägeln brannte.
2
Am nächsten Morgen lag erneut dichter, nasskalter Nebel über dem Lager. Jeder Schritt, die Rufe der Knechte, das Schnauben der Pferde – alles klang verhalten. Gottfried steckte den Kopf durch den Zelteingang.
»Gott zum frühen Gruße, ehrwürdige Brüder. Seid ihr schon auf?«
Er fragte, obwohl er sah, wie Wernhardt auf der Erde kniete und betete. Nun küsste der Mönch das kleine Holzkreuz in seinen Händen und erhob sich umständlich. Dann erst wandte er sich um.
»Wir sind es gewohnt, jeden Morgen ein Gebet an unseren Herrn Jesus Christus zu richten. Eine Sitte, die man hier wohl nicht kennt.«
»Heinrich wünscht auf der Jagd keine Strenge, Bruder.«
Wernhardt seufzte.
»Werden wir den Herzog sprechen können?«
»Er lädt euch sogar ein, mit ihm gemeinsam zu speisen.«
Der Mönch nickte zufrieden. Na endlich, schien er mit einem Seitenblick auf seinen getreuen Bertholdus zu sagen, endlich kommen die Dinge in Bewegung. Heinrich schien sich doch noch seiner Pflichten als Gastgeber zu erinnern.
»Richte dem Herzog aus, dass wir kommen werden.«
»Besser, ihr kommt gleich mit mir.«
Es entstand eine Pause.
«Jetzt gleich«, setzte Gottfried mit Nachdruck hinzu.
Im Zelt des Welfen waren neben dem Kochfeuer eine Reihe kleinerer Kohlefeuer entzündet worden, und es war wohlig warm. Heinrich saß auf einem Sessel, vor sich eine reich gedeckte Tafel, um ihn herum eine Reihe Männer. Die meisten schienen Lehnsmänner der Gegend zu sein. Beim Anblick der Mönche winkte er.
«Ihr frommen Herren aus Freisingen, ich grüße euch. Kommt, setzt euch zu uns. Wärmt euch, und füllt euch den Bauch!«
Er wartete, bis sie alle einen Platz gefunden hatten.
»Gott sei hier, Herzog Heinrich«, begann Wernhardt. »Wir entbieten dir den Gruß des ehrwürdigen Bischofs. Lass uns den Grund unseres Kommens erklären.«
»Später«, wehrte Heinrich kauend ab, »erst lasst uns essen.«
Wernhardt nickte. Zögernd griffen er und seine Begleiter zu. Heinrich kaute mit vollen Backen und grinste. Ab und an stieß er einen seiner Ritter in die Seite. Die lachten dann leise, und erneut konnte sich Wernhardt des Verdachts nicht erwehren, dass diese Heiterkeit ihnen galt. Der Mönch fühlte sich nicht sonderlich wohl, und so verlief das Essen mit leisem Geplänkel ringsum. Wenigstens waren seine Schmerzen verschwunden.
In dem Zelt herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Einmal kamen Falkner herein und zeigten zwei Jungvögel in einem Korb. Heinrich beobachtete interessiert, wie die beiden Tiere heiser rufend mit den Flügeln schlugen. Er nickte zufrieden, und die Gelegenheit nutzte ein Knecht, um ihm eine Garnitur Sauspieße zu präsentieren. Heinrich erhob sich, beugte sich über die Tafel und wählte dann etliche Waffen aus. Er schien Zeit zu haben, und Wernhardt fragte sich, ob der Augenblick nicht günstig wäre, um erneut mit seinem Anliegen zu beginnen.
Viel gegessen hatte er nicht. Er trank auch nicht besonders viel, fürchtete er doch, was ihm blühte, wenn er die Kutte heben musste, um sich zu erleichtern.
»Verehrter Herzog«, begann er in dem Stimmengewirr und räusperte sich.
Zahlreiche Augen blickten ihn an. Der Löwe rülpste wohlig und gähnte dann. Wernhardt ließ sich nicht beirren. »Worum es uns geht ...«
»Aber ich weiß, warum ihr hier seid«, antwortete Heinrich, »aber hier bin ich nicht in meiner Eigenschaft als Fürst dieses Landes.«
Er schwieg einen Augenblick.
»Heute werde ich Glück haben. Und wisst ihr auch, warum?"
Wernhardt schüttelte den Kopf.
»Weil ich nun christlichen Beistand habe«, meinte Heinrich.
Wernhardt und Bertholdus blickten einander an, die beiden anderen Mönche hörten mit dem Essen auf.
»Ich verstehe nicht«, begann Wernhardt, aber Heinrich lachte laut, und die Ritter neben ihm grinsten oder lachten ebenfalls. Diese Mönche waren wirklich ein wenig begriffsstutzig.
»Christlichen Beistand«, wiederholte Heinrich langsam und zeigte mit dem Finger auf Wernhardt und Bertholdus, »weil ihr, liebe Brüder, heute Morgen mit mir kommen werdet. Begleitet mich und betet für mein Jagdglück. Ich bin sicher, bis zum Mittag haben wir ein feines Stück erlegt. Mit eurer Hilfe im Gebet.«
Wernhardt spürte, wie ihm schwindlig wurde. Auf die Jagd mitreiten? Augenblicklich meldeten sich seine Schmerzen zurück. Er versuchte, ruhig zu atmen.
»Es ehrt mich sehr, was du vorschlägst, Heinrich, aber in meinem Zustand ...«
Wernhardt schüttelte den Kopf, und seine Miene zeigte Bedauern.
»Du musst wissen, ich bin zurzeit ein wenig leidend.«
»Dann wird dir die Jagd nur gut tun. Begleitet mich, und wir können dabei alles bereden. Wenn ihr hier bleibt, weiß ich nicht, wann und ob ich überhaupt dazu kommen werde. Ich will natürlich nicht, dass eure ganze Reise umsonst war.«
Bei den letzten Worten beugte er sich ein wenig über die Tafel; dabei lächelte er. In diesem Moment hatte Wernhardt einen bösen Gedanken, und im gleichen Augenblick wusste er, dass dieser Gedanke Sünde war. Er würde ihn beichten müssen.
»Lass mir einen Moment des Nachdenkens, Heinrich«, antwortete er mühsam.
»Denk nicht zu lange nach, Bruder. Die Meute wartet.«
Und als ob dies ein Stichwort gewesen wäre, begannen draußen vor dem Zelt die Hunde zu lärmen.
Für Wernhardt waren die letzten Stunden wie ein schlechter Traum gewesen. Er und Bertholdus hatten je ein Pferd erhalten. Beide waren sie keine geübten Reiter, und Wernhardt hatte Mühe, sich im Sattel zu halten. Seine Schmerzen wurden durch die Bewegung zu Pferd wieder schlimmer.
Der Herzog aber schien in seinem Element.
Obwohl der dichte Nebel kaum etwas erkennen ließ, stürmten er und seine Männer den voraushetzenden Hunden hinterher, wobei ihnen das schwierige Gelände nicht das Geringste auszumachen schien. Einige Male scheuten die Pferde vor einem vom morgendlichen Reif verharschten Hang. Die Ritter, das Reiten von Jugend an gewohnt, stürzten sich samt ihren Tieren wie im Rausch hinunter. Wernhardt und Bertholdus folgten, beide darauf bedacht, sich irgendwo am Pferd festzuhalten und der Erfahrung und dem Instinkt der Tiere zu vertrauen.
So ging das stundenlang.
Nur einige Male hielten sie an, um zu verschnaufen. Das nutzten die übrigen Reiter, um zu trinken, die Pagen, die ihnen auf Maultieren folgten, beeilten sich, aus dem Sattel zu springen und die Herren zu bedienen. Heinrich schwitzte, aber er lachte und streichelte seinem Pferd den Hals. Dann sog er die feuchtkalte Nebelluft ein.
Sie folgten seit dem frühen Morgen einer Spur.
Es hieß, ein großer Hirsch, den Heinrich am Abend zuvor in der Dämmerung verloren hatte, flüchte vor ihnen. Die Jagdknechte waren umso stolzer, diese Spur am Morgen wieder gefunden zu haben, um sie ihrem Herrn zu präsentieren. Jetzt wendete er sein Pferd, Speichel troff in langen Schlieren vom Maul des Tieres.
»Kennt ihr die Gegend hier?«, wollte er wissen.
»Nein«, beeilte sich Wernhardt zu antworten.
»Hinter dem Wald dort liegt ein Dorf. Dort machen wir Halt. Meine Männer glauben, es gibt Schnee.«
Tatsächlich war es im Lauf des Vormittags immer kälter geworden. Wernhardt hatte es bei dem schweißtreibenden Ritt kaum bemerkt, aber jetzt blies ein eisiger Hauch zwischen den Bäumen hindurch. Der Himmel war dunkelgrau, und ohne Zweifel roch es nach Schnee. Wernhardt schloss die Augen. Er spürte seinen Hintern nicht mehr, und seine Hände und Füße waren völlig taub von der Kälte. Wenn sie es bis in dieses Dorf schafften, würde er Bertholdus bitten müssen, ihm beim Halt aus dem Sattel zu helfen. Wenn er allein abstieg, würde er stürzen, und diese Blöße wollte er sich vor Heinrich nicht geben.
Der Herzog gab den Befehl zum Weiterritt. Erneut mühten sich die Pferde einen kleinen, steilen Hügel hinauf. Die übrigen Reiter sprengten an ihnen vorbei. Wernhardts und Bertholdus' Pferde zögerten, und so gerieten sie an den Schluss der Gruppe. Aber Gottfried, der Getreue des Herzogs, schien seine Augen überall zu haben. Er parierte seinen Braunen und wandte sich im Sattel um. Als er sah, wie die beiden Pferde mit den Mönchen im Sattel sich den Hang hinauf quälten, dabei links und rechts von Jagdknechten zu Fuß überholt wurden, wendete er sein Pferd und ritt beiden entgegen. Als er neben ihnen war, schlug er mit der Hand auf die Kruppe von Wernhardts Pferd.
»Auf, du hässliche Mähre, auf! Oder die Hunde soll'n dich fressen!«
Da stob das Tier mit langen Sätzen den Hang hinauf. Wernhardt hörte, wie es unter ihm vor Anstrengung ächzte, und er selbst wäre bei dem rasanten Spurt beinahe heruntergefallen. Der Herzog, inzwischen auf dem Hügelkamm angekommen, wandte sich im Sattel um, sah dies und lachte schallend.
»Bruder Wernhardt, du wirst tatsächlich noch ein großer Reiter!«, rief er.
»Zu gütig, Exzellenz«, knirschte Wernhardt mühsam, als sein Pferd mit dem Tier des Herzogs gleichgezogen hatte. Kurz darauf erreichten sie den Ort.
Es war eine der zahlreichen Ansiedlungen, die es hier bereits seit der Zeit der Merowinger gab. Obwohl die Gründung bereits mehr als zweihundert Jahre her war, hatte sich der Ort kaum verändert. Die Zahl der Einwohner war über Jahrzehnte hinweg fast gleich geblieben. Neuankömmlinge gründeten eher neue kleine Weiler, statt die Einwohnerzahl eines Ortes zu vergrößern.
Die einzige Straße war breit genug, um zwei Karren nebeneinander passieren zu lassen. Braunschwarze Schweine ließen sich auch durch die Kälte nicht davon abbringen, in den dunklen Pfützen zu wühlen. Dünnes Eis zerbrach unter ihren schmutzigen Zehen.
»Wir bleiben hier!«, befahl Heinrich laut.
Die Reiter hielten auf einer Wiese voller kahler Bäume, neben einem halb fertigen Haus am Wegesrand, an dem ein Berg grober Steine von Bautätigkeit zeugte. Die Bewohner der kleinen Ansiedlung versammelten sich neugierig und blickten auf das Treiben der Jäger. Es waren ärmliche Gestalten, die meisten schmutzig und durchfroren. Die Kinder waren barfuß, so wie die meisten Frauen. Nur die Männer trugen Lumpen um die Füße gewickelt, und aus allen Gesichtern blickte der Hunger. Aus ihrer Mitte trat ein Mönch, beugte den Kopf und begrüßte die Ankommenden.
»Gott sei hier und segne euch, edle Herren.«
»Beug die Knie, frommer Mann. Du hast hohen Besuch. Das ist Herzog Heinrich, Herr von Bayern und Sachsen. Unser Fürst und euer Herr.«
Der Mönch beeilte sich tatsächlich, so etwas wie eine Verbeugung zu zeigen.
»Ehre und Frieden sei mit dir, Heinrich, und allen Herren in deiner Begleitung.«
Heinrich lachte und sprang aus dem Sattel. Er reckte und streckte sich und schlug sich dann mit beiden Fäusten auf die Brust.
»Ah, was für ein Tag!«
Er wandte sich um. Knechte waren bereits dabei, zwischen den Bäumen ein Feuer zu entzünden. Kaum züngelten die ersten Flammen, drängten sich alle um die Wärme. Bald kreisten Weinkannen. Wernhardt, endlich aus dem Sattel, hielt seine Hände so nahe wie möglich an die lodernden Flammen. Allmählich fragte er sich, wie lange er dem Treiben des Herzogs noch folgen sollte, und beschloss, nicht länger zu warten.
»Heinrich!«
Die Ritter blickten alle auf den Mönch und schwiegen.
»Ja, was ist?«, fragte der Herzog ungehalten.
»Hör mich an! Bischof Otto ist rechtmäßiger Betreiber der Zollbrücke von Vöhringen. Dein Ansinnen, diese Einkünfte für dich zu behalten, ist damit ohne Belang.«
Bis auf das Knacken des feuchten Holzes war nichts zu hören. Wie kleine Schauer aus leuchtenden Punkten sprühten Funken aus dem Feuer. Alle schwiegen und blickten auf die beiden frierenden Mönche, die sich ihre Hände rieben und immer wieder hineinhauchten.
»Deshalb seid ihr also gekommen?«, wollte Heinrich wissen, obwohl er es längst genau wusste.
»Bischof Otto macht dir ein Angebot.«
»Was redest du da?«, fragte Heinrich mit gefährlich leiser Stimme.
Wernhardt ließ sich durch den Ton nicht verunsichern. Er war müde, und ihm war kalt. Und er spürte erneut den Beginn grässlicher Leibschmerzen. Es war höchste Zeit, dieser Farce ein Ende zu setzen.
»Unser Herr lässt dir ausrichten, dass ein letztes Wort beileibe nicht gesprochen ist. Es müsste möglich sein, eine Lösung zu finden, ohne dass es Streit gibt.«
»Streit?«, fragte Heinrich. Noch immer war sein Stimme leise, klang aber nach wie vor gefährlich.
Bertholdus fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, zog seinen Mitbruder fast unmerklich an dessen Kutte, in der Hoffnung, er würde sich für diese Unterredung einen besseren Zeitpunkt suchen. Aber Wernhardt ließ sich nicht beirren. Er sah sich im Recht. Hatte sie der Herzog nicht unter beschämenden Umständen warten lassen? Dann zwang er sie, viele Stunden einer Spur zu folgen, die der erste Schnee dieses Jahres mit einem dünnen Hauch bedeckte. Tatsächlich hatte es kaum merklich zu schneien begonnen. Während das Feuer noch immer wohlige Wärme verbreitete, Holzscheite im Funkenregen barsten, schwiegen alle. Nur Heinrich blickte unverwandt auf den Abgesandten des Bischofs.
»Hör zu, was ich dir sage ...«, begann er grimmig.
Da ertönten Hornsignale aus dem angrenzenden Wald.
»Der Hirsch!«, rief jemand.
Das Signal ertönte erneut.
»Sie haben ihn!«
Heinrich wandte den Kopf und lauschte.
»Endlich.«
Heinrich schien Wernhardt auf einmal vergessen zu haben und verlangte nach seinem Pferd.
»Auf, los auf, Männer!«, rief er, und alles lief durcheinander.
Wernhardt schloss die Augen. Erneut wich ihm Heinrich aus. In diesem Moment verwünschte er den vermaledeiten Hirsch. Da zupfte ihn jemand am Ärmel, und als er aufblickte, sah er in Bertholdus' Gesicht.
»Bruder Wernhardt, wollen wir hier solange warten?«
»Nein, natürlich nicht. Das käme Heinrich nur recht.«
Wernhardt ließ zu, dass ihm Bertholdus half. Seine Füße waren noch immer wie Eisklumpen, aber wenigstens waren seine Hände wärmer geworden, und er konnte seine Finger wieder spüren. Bertholdus half ihm aufs Pferd.
»Kommt, ihr frommen Herren«, lachte Gottfried, um gleich darauf mit ernster Miene anzufügen: »Heinrich liebt es nicht zu warten.«
Aber er liebt es, andere warten zu lassen, hätte Wernhardt beinahe geantwortet, doch unterließ er es. Es war einfach zu kalt, um zu streiten, selbst wenn es dabei um die Manieren zwischen den Herren des Adels und des Klerus ging.
Kaum saßen er und Bertholdus im Sattel, folgten sie der breiten Spur der übrigen Reiter. Ein kurzer, aber scharfer Ritt durch den jetzt weiß bestäubten Wald folgte. Dabei ritten sie so schnell, dass sie Heinrichs nicht eben langsame Meute sogar noch einholten. Wernhardt lief unter seiner Kutte der Schweiß in Strömen vom Leib, und das erste Mal seit Tagen fror er nicht. Doch mehr als einmal wäre er vom Pferd gefallen, hätte ihn Gottfried, der neben ihnen ritt, nicht rasch gepackt und im Sattel aufgerichtet.
Endlich hielten sie an.
Die wartenden Reiter umstanden in einem Halbkreis einen Windbruch im Wald. Inmitten des schlammzerwühlten Bodens lag der Hirsch. Oder eher das, was von ihm übrig war. Das noch im Tod stattliche Tier war von einem Speer am Hals getroffen worden. Aber der hatte das Wild nicht getötet. Jemand hatte ihm den Rest gegeben, indem er große Steine auf den Schädel des Tieres warf, so lange, bis es verendet war. Diese brutale Tat schien aus blanker Verzweiflung heraus geschehen zu sein.
Die Hunde saßen ruhig an der Seite der Knechte, nur manchmal winselte eines der Tiere leise. Gottfried saß ab, trat an den Kadaver und begutachtete ihn. Das Tier war aufgebrochen worden, und jemand hatte begonnen, hastig das noch warme Fleisch zu zerteilen. Dabei hatten ihn die Hunde gestellt.
Ein noch junger Mann, die schäbige Kleidung fast schwarz vor Schmutz und Nässe, kauerte wie ein Häufchen Elend auf dem Boden. Ein Jagdknecht hielt ihn grob an den Haaren fest.
»Er hat ihm die fettesten Stücke rausgeschnitten«, erklärte Gottfried und blickte auf den Herzog, der stumm im Sattel saß.
Ganz langsam glitt Heinrich vom Pferd. Er zog sich einen Handschuh aus und trat zu dem toten Hirsch, bückte sich und berührte das verunstaltete Wild. Stumm betrachtete er seine vom Blut nass glänzende Hand. Langsam ballte er sie zur Faust, sog dabei die kalte Luft ein und trat dann zu dem Mann. Der senkte den Kopf.
»Du hast mich um mein Vergnügen gebracht, Bursche. Und um einen Hirsch.«
Der Mann vor ihm auf dem Boden zitterte.
»Vergib mir, hoher Herr, ich ...«
Heinrich schlug ihm seinen Handschuh ins Gesicht.
»Halt's Maul, du Missgeburt!«, schrie er. »Seit drei Tagen bin ich ihm gefolgt, und du schlachtest ihn ab wie einen tollen Hund!«
»Mein ist der Zorn, spricht der Herr«, begann Wernhardt.
Heinrich wandte den Kopf.
»... und mein ist die Rache. Auch das spricht der Herr. Ich kenne das Heilige Buch, Bruder Wernhardt.«
Heinrich trat von dem Mann weg, rieb sich mit Schnee das Blut des Hirsches von der Hand und trat zurück in den Kreis seiner wartenden Männer.
»Jochen!«
»Herr?«
»Zerwirk das Wild, schneid raus, was zu gebrauchen ist! Den Rest gibst du den Hunden.«
»Jawohl, Herr.«
Heinrich streifte den Handschuh über, stieg wieder auf sein Pferd und ordnete die Zügel.
»Und was wird mit dem da?«, wollte Gottfried wissen und deutete auf den am ganzen Körper zitternden Mann.
»Gottfried? Was geschieht mit einem Mann, der auf dem Grund und Boden seines Herrn wildert?«
Die Männer ringsum nickten, einige lachten verhalten, während Heinrich sich umblickte.
»Erbarmen, Herr!«, begann da der Mann zu flehen. »Ich hab ein Weib und vier kleine Kinder.«
Er begann kläglich zu weinen.«Wir brauchten das Fleisch, die Ernte war so schlecht, und dem Ulrich ist schon der Jüngste gestorben. So lang wollt ich doch nicht warten und ...«
Heinrich blickte nicht mehr auf, sondern fasste die Zügel kürzer. Wernhardt drängte sein Pferd nahe an das Reittier des Herzogs.
»Hab Erbarmen um Christi willen. Ja, der Mann hat sich versündigt, aber ist nicht genug Blut geflossen? Erweise dich als großmütiger Herr und sei gnädig.«
Heinrich blickte zu dem Mann, der wimmernd und zitternd auf dem Boden kauerte, dann wieder auf den Mönch.
»Das hier berührt das Recht eines Lehnsherrn. So wie die Brücke zu Vöhringen. Ein Recht, das mir zusteht. Dies, Bruder Wernhardt, genau dies berichte Bischof Otto.«
Er wendete sein Pferd, drängte dabei das Tier des Mönchs zur Seite.
»Ihr beide solltet uns zurück ins Lager folgen. Es wird noch kälter werden«, sagte er.
Dann beugte er sich vom Rücken seines Pferdes herab zwei Knechten zu und deutete mit der Hand auf den noch immer leise wimmernden Mann.
»Hängt ihn auf!«, befahl er.
Heinrich schnalzte mit der Zunge, und sein Pferd setzte sich in Bewegung. Seine Getreuen folgten ihm.
Die zwei Knechte zerrten den Mann zu einer großen Buche. Der eine hielt den um sein Leben Bettelnden fest. Der andere warf ein Seil über einen Ast, knüpfte schnell eine Schlinge und legte sie dem Mann um den Hals. Er zog sie straff, schnell und geübt. Dann griffen beide Knechte nach dem Seilende.
Gemeinsam zogen sie an und zerrten den Mann dabei in die Höhe. Der röchelte, zappelte wild mit den Beinen und griff mit beiden Händen nach dem Hanf um seinem Hals. Während ihm Zunge und Augen herausquollen, schlangen beide Knechte das Ende des Seils um den Baumstamm und banden es fest.
Der Todeskampf des Mannes dauerte an. Dann, während beide Knechte ihre Waffen und ihre Ausrüstung aufhoben, streckten sich die Glieder des Gehenkten ein letztes Mal, und es war vorbei. Ohne die Mönche noch einmal eines Blickes zu würdigen, verschwanden die Knechte in der winterlichen Dämmerung des Waldes. Wernhardt glitt aus dem Sattel, fiel neben seinem Pferd auf die Knie und betete.
Erst als ihm Bertholdus aufhalf, merkte er, dass er wieder fror.
TEIL EINS
Die Brücke am Salzsteig
Wie glückselig ist die Kammer,
wo die Hochzeit stattfand,
wo der Bräutigam der Braut
heute einen Kuss gab;
doch herrschte dort keine Gefahr
für ihre Unschuld,
nur die Gewalt des Heiligen Geistes.
AUGUSTINUS
3
«Er kommt!«, riefen aufgeregte Stimmen.
Die Kinderschar in der Nähe des großen Burgtores lugte neugierig um die Ecke. Tatsächlich waren auf der breiten Straße, die zur Burg heraufführte, Reiter zu sehen. Sie waren in vornehme Gewänder gehüllt, manche trugen das Kettenhemd sichtbar, ohne ein Wams darüber. An der Spitze ritten Pagen; einer von ihnen führte eine Lanze mit einem Wimpel in den Farben der Staufer. Friedrichs Farben.
Der Kaiser aller Deutschen erreichte am frühen Mittag die Burg Badenweiler. Als er in den Burghof einritt, wichen die Kinder am Eingang angesichts der dichten Folge von Reitern, Lehnsmännern und Knechten zurück, die sowohl zu Pferd als auch zu Fuß Teil der Begleitung des Kaisers waren.
Friedrichs mächtige Statur war unverkennbar.
Er lachte oft, und immer wenn er das tat, vibrierte seine Stimme und schien alles zu durchdringen. Sein helles, sommersprossiges Gesicht umrahmte ein kurzer, roter Vollbart.
An der Treppe zur Burgfeste hielt er an. Knappen eilten herbei und wollten ihm vom Pferd helfen. Doch Friedrich schwang ein Bein über die Kruppe des Hengstes und stand auf eigenen Füßen, ehe sich eine Hand bemühen konnte. Als er den Hausherrn und dessen Frau auf der Treppe erkannte, breitete er beide Arme aus.
»Heinrich!«
»Friedrich! Sei gegrüßt, Kaiser der Deutschen«, begann der Herzog.
»Sei auch du gegrüßt, teurer Vetter.«
Heinrich lächelte, und als Friedrich stehen blieb, trat er seinem Cousin und Herrn zwei Stufen die Treppe hinunter entgegen. Dann umarmten sie einander.
»Heinrich, mein Freund. Mir ist, als würde ich nach Hause kommen.«
»Aber du bist hier zu Hause«, bestätigte Heinrich. »Komm, du wirst müde sein.«
»Wie kommst du denn darauf?«, lachte Friedrich dröhnend. »Ein kleiner Ritt am Vormittag macht mir höchstens Appetit.«
»Und Durst, nicht wahr?«, wollte Heinrich wissen, obwohl er die Antwort bereits kannte.
»Und was für einen Durst!«, dröhnte Friedrich, legte seinen Arm um die Schultern des Herzogs und zog ihn erneut lachend an sich.
So schritten sie beide die wenigen Stufen zum Eingangsportal hinauf. Clementia von Zähringen, Heinrichs Frau, knickste tief vor dem Kaiser.
»Friedrich, unser Kaiser. Sei allerherzlichst gegrüßt ...«
»Clementia, lass doch die Förmlichkeiten!«
Er zog sie an sich und drückte sie stürmisch. Die zierliche Gestalt der Fürstin verschwand beinahe unter den breiten Armen des Kaisers.
»Und, gibt es bald einen Prinzen?«, dröhnte er und fuhr mit der Hand über ihren Bauch, da, wo er vermutete, dass sich bald Veränderungen im herzoglichen Haushalt anzeigen mussten. Clementia errötete und schob den Arm des Kaisers behutsam von sich.
»Mein Fürst, nicht vor dem Gesinde«, hauchte sie, und Friedrich lachte erneut sein unbeschwertes, lautes Lachen.
Gemeinsam führten der Herzog und seine Gemahlin den Kaiser in die Burg. Friedrichs Gefolgschaft schloss sich ihnen an. Im großen Saal hatte Heinrich eine festliche Tafel aufbauen lassen mit langen Bankreihen davor. Nur am Stirnende der Tafel stand ein Lehnstuhl. Zahlreiche Schalen und Platten mit kaltem und warmem Wildbret warteten. Diener trugen große Weidenkörbe voller Brotfladen herein, gefolgt von Pagen mit Weinkannen in jeder Hand. Auf Einladung seines Haushofmeisters nahmen die zahlreichen Begleiter des Kaisers ihre Plätze ein. Friedrich blickte sich suchend um, und so, als ob er diesen Blick erwartet hätte, zog sein Vetter ihn sanft am Ärmel.
»Clementia wird deine Männer bewirten und an meiner statt als Gastgeber auf alles achten. Für uns beide hab ich einen eigenen Tisch richten lassen.«
»Warum das, lieber Freund?«, fragte Friedrich.
Er war von jeher misstrauisch gegen allzu große Freundlichkeit, und er blieb es auch bei denjenigen, die sich Freund nannten.
»Wenn der Kaiser der Deutschen mich in meinem Haus besucht, teile ich ihn nicht mit seinen Lehnsherren«, begann Heinrich und lächelte. »Dafür ist später noch Zeit. Lass uns miteinander sprechen. Allein.«
»Ein Gespräch zwischen zwei Blutsverwandten?
»Nein, viel mehr. Ein Gespräch zwischen zwei Freunden.«
Friedrich nickte kaum merklich und ließ zu, dass man sie beide in ein Gemach führte, wo tatsächlich eine kleine Tafel aufgebaut worden war. Ein Diener schloss leise die Tür hinter ihnen und ließ sie allein. Der Herzog kam Friedrichs fragendem Blick zuvor.
»Erlaube mir, dass ich dich bediene.«
Der Kaiser nickte. Heinrich bot ihm einen Platz an.
»Probier diesen Roten aus Venetien.«
Friedrich schüttelte den Kopf.
»Keinen Wein aus Italien. Nicht heute.«
Heinrich goss Weißwein aus einem Krug in zwei goldene Pokale und reichte einen davon seinem Vetter.
»Auf dich, unseren Kaiser.«
»Und auf dich und dein Glück, mein Freund«, antwortete Friedrich. Sie tranken beide; dann schwiegen sie und blickten einander lange an.
»Sag mir, warum bist du hier, Friedrich?«, fragte der Herzog sanft.
Der Kaiser zögerte mit der Antwort, dann nahm er einen tiefen Schluck aus seinem Becher.
»Die Lombarden müssen einmal mehr daran erinnert werden, wer ihr Fürst ist. Notfalls mit dem Schwert.«
Heinrich lachte, griff nach einem Stück Fleisch und biss hinein. Bratensaft lief ihm das Kinn hinunter. Er kaute vergnügt, während er sich mit dem Handrücken über die fettglänzenden Lippen fuhr. »Was ich immer schon sagte: Diese Krämerseelen sind ausgemachte Dummköpfe.«
»Du sagst es«, grunzte Friedrich verächtlich, griff nach einem Stück Brot und biss hinein.
»Stimmt es, dass sie dich nur noch Rotbart nennen?«, fragte Heinrich mit vollem Mund, obwohl er es genau wusste.
Friedrich grinste breit und ließ dabei seine Zähne sehen.
»Ja, stimmt«, antwortete er grimmig und zupfte Brotkrümel von seinem Bart, »aber sie erschrecken nicht nur Kinder mit meinem Namen.«
Wieder musste Heinrich lachen, und während er das tat, griff er nach einem weiteren Stück Fleisch und biss herzhaft hinein.
»Dieses lateinische Gesindel«, sagte Friedrich. »Erst haben sie gespottet, jetzt zittern sie nur noch.«
Heinrich kaute noch immer. Dann, kaum dass er den letzten Bissen geschluckt hatte, blickte er seinem Vetter erneut unverwandt ins Gesicht.
»Warum bist du hier, Friedrich?«, fragte er erneut.
Barbarossas Miene wurde ernst.
»Wie ich schon sagte: Es geht um die Lombardei. Im Rat der Stadt Mailand haben sie einen neuen Wortführer. Auf einmal glauben diese Tuchhändler, nur weil sie Geld gescheffelt haben, können sie ihrem Fürsten die Treue verweigern. Sie wollen die städtischen Beamten, die Podestas, selbst ernennen! Wiederholt habe ich sie aufgefordert, dies zu unterlassen und die kaiserlichen Rechte zu achten.«
Heinrich blickte den Staufer an und ließ ihn weiterreden. Er wusste, dass jene »Podestas« Männer des Kaisers waren, von ihm bestimmt und ausgewählt. Sie dienten vornehmlich Friedrich und nicht den Städten.
»Statt zu gehorchen, rebellieren sie. Und wenn Piacenza und Brescia endlich stillhalten, erhebt sich Cremona. Hab ich die Cremoneser geschlagen, rebelliert Mailand. Dazu der Papst, der sich auf ihre Seite schlagen wird, sollte ich nur einen Hauch von Schwäche zeigen!«
Der Kaiser hatte sich in Rage geredet, und der Zorn ließ ihm die Adern an Hals und Schläfen anschwellen.
»Das ist der Grund für deinen Besuch?«
Statt darauf zu antworten, erhob sich Friedrich, trat ans Fenster und blickte hinaus. Das Treiben in der Burg Badenweiler wirkte beinahe beruhigend. Doch die Zeiten waren alles andere als friedlich.
»Ich besuche alle Lehnsherren meines Reiches«, erklärte der Kaiser.
»Du verbringst viel Zeit in Italien.«
»Aber ich bin Kaiser aller Deutschen, damit gut genug für Italien, genauso wie für das Reich der Franken. Die lombardischen Städte sind Teil davon. Muss ich dir das etwa erklären?«
Heinrich schüttelte lächelnd den Kopf und kaute am Rest seines Fleisches.
»Erinnerst du dich an Rom?«, wollte Friedrich wissen.
»Natürlich. Trotzdem, viele Lehnsherrn sehen dich mehr im Lateinischen als zu Hause.«
»Na und? Verdammt, die Lombardei ist mein, so wie Sachsen und Bayern deine Lehen sind.«
Heinrich lachte amüsiert über den erneuten Zornesausbruch seines Vetters. Er sah zu, wie Friedrich erneut aus dem Fenster in den belebten Burghof hinuntersah. Dort führten man eine Reihe prächtiger Pferde zu einer gemauerten Tränke, und das Sonnenlicht ließ das Fell der Tiere glänzen.
»Sie nennen dich Rotbart und fürchten dich als Fürst. Trotzdem führen sie Krieg gegen dich«, bemerkte der Herzog.
Friedrich wandte sich um und sah seinen Vetter unverwandt an.
»Fürchtest du mich denn, Heinrich?«
»Warum sollte ich das tun? Du bist mein Freund, mein Vetter. Wir sind von gleichem Blut. Dich fürchte ich nicht, sondern dich liebe ich. Und auf deinen Namen habe ich einen Eid geschworen. Das ist mehr, als dir die Lateiner je geben werden.«
Beide Männer blickten einander eine Weile lang an. Friedrich wusste um die rücksichtslose Art, die der mächtige Herzog an den Tag legte, wenn es darum ging, Einfluss und Besitz seines Hauses zu mehren. Nein, er hieß nicht alles gut, was Heinrich tat, aber bislang war der Herzog sein verlässlichster Verbündeter gewesen.
»Du warst immer ein Teufelsbraten, Heinrich«, sagte Barbarossa leise.
»Ich hatte in dir ein Vorbild, lieber Vetter«, entgegnete der Herzog ruhig.
Da mussten sie beide plötzlich lachen.
»König Konrad selig war dein Onkel, aber indem er dir die Krone übergab, traf er eine gute Wahl«, schmeichelte Heinrich. »Noch einmal: Was willst du von mir?«
»Ich brauche Truppen. Noch vor diesem Winter will ich die Lombarden schlagen. Unterstütze mich dabei.«
Heinrich nickte nachdenklich, stocherte mit einem Finger in seinem Mund herum und kratzte sich dann den Haarflaum an seinem Kinn.
»Ich glaube, ich werde ihn abrasieren«, begann er auf einmal. »Ja genau, gleich nachher lass ich den Bader kommen. Er soll ihn wegmachen.«
»Was sagst du?«, fragte Friedrich ein wenig verwirrt.
»Mein Bart. Clementia findet mich ohne ihn anziehender.«
Heinrich lächelte, und Barbarossa sog tief die Luft ein, bevor er antwortete. »Wenn du an ihrem Busen liegst, werden die Härchen auf ihrer weißen Haut kratzen. Manche Weiber mögen das nicht.«
Sie blickten einander an.
»Hilf mir gegen Mailand«, begann Friedrich erneut.
Heinrich zögerte, bevor er antwortete.
»Wie soll ich das anstellen? Ich kann niemand entbehren.«
»Heinrich, noch einmal: Ich bitte dich um deine Hilfe. Als Kaiser, als Freund und als Blutsverwandter.«
Im Burghof waren Rufe und lautes Gelächter zu hören.
»Wenn ich dir helfe«, begann Heinrich, »möchte ich dafür das Wort meines Kaisers in einer anderen Sache.«
»Von welcher Sache sprichst du?«
»Bischof Otto droht mir mit der Schied in Augsburg.«
»Otto«, begann Barbarossa vorsichtig, »ein frommer Mann, in Würden alt und weise geworden und im Geist sehr rege. Ich schätze ihn.«
»Der Mann ist eine Krämerseele, genau wie deine Lombarden.«
Barbarossa trat an die Tafel zurück, griff nach dem Weinkrug und goss ein. Dann trank er einen Schluck.
»Geht es immer noch um diesen Zoll?«
»Genau«, bestätigte Friedrich, »die Salzsäumer kommen über seine Brücke, und der Pfaffe verdient sich eine goldene Nase.«
»Wird bei der Brücke hübsche Mädchen haben.«
»Die können nicht hübscher sein als an einer herzoglich bayerischen Brücke«, antwortete Heinrich grimmig.
Er legte den Kopf ein wenig schief, blickte seinen Vetter an und wartete.
»Und, was willst du, dass ich tun soll?«, fragte Barbarossa ruhig.
Statt einer Antwort nahm Heinrich einen Schluck aus seinem Becher und fuhr sich mit dem Ärmel über den Mund.
»Was du mit den Lateinern machst, muss ich hier im Reich tun. Für Ordnung sorgen unter den Fürsten und dem Klerus.«
Friedrich lachte. »Vetter, mach dir die Kirche zum Feind, und du hast im Nu Krieg hier im Bayerischen. Das kostet dich Geld. Viel Geld. Warum regelst du die Sache nicht als Landesfürst?«
»Genau das will ich tun. Aber dazu brauch ich dein Wohlwollen.«
»Das hast du.«
»Und mein Recht als Landesfürst! Verbrieft! Setz deinen Namen und dein Siegel unter einen Erlass, der mir, dem Fürsten von Bayern und Sachsen, allein das Recht am Salzzoll gibt.«
»Zollrecht ist von jeher Lehnsrecht gewesen.«
»So ist es, ja«, entgegnete Heinrich unwillig, »aber Otto erkennt mein Lehen nicht an. Hab ich aber dein Siegel, hat er keine andere Wahl mehr und muss sich meinem Wort fügen.«
»Wenn ich tue, was du wünschst, was ändert das?«, begann Friedrich. »Glaubst du, der Freisinger sieht zu, wie das Salz über seine Brücke fährt, aber du kassierst?«
»Aber es ist mein Lehen und damit mein Recht, Zoll zu erheben!«
Wütend hieb Heinrich bei diesen Worten mit der Faust auf den Tisch.
»Aber es ist Kirchengrund«, entgegnete Friedrich ruhig.
Heinrich schloss die Augen. Er lehnte sich auf seinem Platz zurück und bemühte sich, seinen Zorn zu verbergen.
»Was die Stadt Bremen an Abgaben in diesem Jahr an mich entrichtet, sollst du für deinen Feldzug haben«, erklärte er schließlich. »Darauf mein Wort, Friedrich.«
Heinrich faltete seine Hände unter dem Kinn, hob dann den Kopf und blickte Barbarossa an. Der wusste, mit diesem Angebot war der Feldzug gegen Mailand gesichert.
»Also gut, ich werde deinem Wunsch entsprechen«, sagte Barbarossa feierlich.
Gibst du mir darauf dein Wort, Vetter?
»Ja, das Wort des Kaisers.«
Heinrich nickte zufrieden und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Sehr gut. Du, lieber Vetter, hast hiermit mein Wort für die lateinische Sache. Wenn ich auch nicht selbst dafür an deiner Seite reiten kann ...«
Er zögerte einen Moment, gerade lang genug, um Barbarossas zustimmendes Kopfnicken zu bemerken.
»... bleibe ich dein treuer Lehnsherr. Möge Gott der Allmächtige die aufmüpfigen Lombarden samt ihrem Geld ersäufen.«
Er griff nach seinem Weinkelch. »Und die Freisinger gleich dazu!«
Jetzt trank er, und Friedrich tat dasselbe.
4
Seit mehr als einer Woche war Anselm Zierl mit seiner Frau und den beiden Kindern unterwegs. Der wohlhabende Salzhändler stammte aus Innsbruck, und von dort waren sie auch aufgebrochen. Ihre Fracht, bestehend aus Steinsalz, wollten sie bis Augsburg schaffen. Dort würde der Lechner die ganze Ladung kaufen, um damit Fleisch zu pökeln.
Anselm ging bei dieser Reise nur Frieder, sein treuer Knecht, zur Hand. Aber nach dieser Fahrt würde er noch wenigstens einen Mann mehr brauchen, auch wenn das die Kosten erhöhte. Vielleicht gab es ja in Augsburg einen guten, Fuhrknecht, den es reizen konnte, mit ihm nach Innsbruck zu kommen, um dort sein Auskommen zu haben?
Ein greller Blitz zuckte durch den Wald und unterbrach seine Gedanken. Gleich darauf folgte krachend ein Donnerschlag. Die Ochsen blieben auf der Stelle stehen.
Anselm Zierl zog sich den Hut tiefer ins Gesicht und sah zum Himmel hinauf. Gewitterwolken türmten sich über ihnen. Erneut rollte Donnergrollen durch den Wald, und plötzlich ging ein heftiger Wolkenbruch auf sie nieder. Drei große Ochsengespanne mit jeweils vier Tieren vor einem Frachtwagen standen im strömenden Sommerregen und warteten auf das Ende der Sturzflut.
Der Himmel war kaum zu sehen, dichte Laubbäume verdeckten selbst das schmale Band durch den Wald, das die Straße sein musste. Schwere Tropfen bahnten sich ihren Weg durch das dichte Laubdach. Anselm hoffte nur, das Sommergewitter möge bald vorbei sein. Er bekreuzigte sich und murmelte zur Bekräftigung ein Gebet für den heiligen Christopherus. Das konnte nie schaden.
Es dauerte eine Weile, bis der Regen allmählich nachließ, um bald darauf ganz aufzuhören. Zuletzt ließ sich nur noch ein stetes Tropfen von den Zweigen und Blättern der Bäume hören. Bald erklang Vogelgezwitscher.
Anselm trat vor den Zug, zog ein Tuch aus seinem Wams und fuhr sich damit über das nasse Gesicht. Obwohl die Frachtwagen sich seit Stunden durch den schattigen Wald quälten und es nicht zu heiß gewesen war, nach diesem Regenguss noch dazu, schwitzte er. Jetzt aber frischte der Wind auf.
»Komm Jockel, komm weiter!«
Er stieß den Ochsen sanft mit dem Stock an. Das Fell war dunkel vom Regen. Im fahlen Sonnenlicht sah Anselm, wie der Dampf vom Leib des Tieres aufstieg.
»Zieh, Jockel! Komm, zieh an!«
Der Zugochse hob unwillig seinen massigen Schädel.
»Anselm, wie weit ist es noch?«
Die Frage kam von seiner Frau. Sie fragte ihn dies heute schon das dritte Mal. Anselm, wie weit ist es noch? Was, allmächtiger Herr im Himmel, sollte er denn noch darauf antworten? Dass es bis zur Brücke nicht mehr weit sein konnte? Das hatte er jedes Mal gesagt, wenn sie ihn gefragt hatte, und jedes Mal hatte sie so getan, als glaube sie ihm kein Wort. Dass ihm dieser Weg nicht so genau bekannt war, sagte er ihr lieber nicht. Denn er kannte seine Frau. Sie hätte mit dem Lamentieren nicht mehr aufgehört.
Aber ganz sicher war er sich über diesen eingeschlagenen Weg tatsächlich nicht. In Telfs hatte ihm ein Fuhrknecht dazu geraten. Aber auf den hätte er besser nicht gehört. Nur dessen Einladung zu einem guten Roten hatte er nicht ablehnen wollen, und später war es dann sehr fröhlich geworden. Josefa, Anselms Frau, war in der Kammer verschwunden und hatte Maria, die kleine Tochter, mitgenommen.
Dann war die hübsche Frau des Wirtes dazugekommen. Daran erinnerte sich Anselm noch. Trotzdem, er hätte nie auf den Mann hören dürfen. Verflucht, dreimal verflucht. Ja, es war Sünde, so zu fluchen, aber er musste es tun, sonst wäre er geplatzt. Anselm spuckte auf den Boden und murmelte zur Sicherheit hastig einige Worte an die Heilige Gottesmutter.
Dieser Weg war nie und nimmer richtig. Der Kerl in Telfs hatte sich nur großtun wollen. Wäre der Bursche in der Nähe gewesen, hätte er ihn an den Ohren gepackt und ihm sein Fell gegerbt. Hundsfott, elender!
»Anselm, ich hab dich was gefragt.«
»Bei allen Heiligen, Josefa, ich weiß es doch nicht. Der Welsche hat gesagt ...«
»Der Welsche, schnaubte sie verächtlich. »Hast du diesem Kerl tatsächlich geglaubt?«
»Er hat gesagt, dass er die Gegend kennt ...«
»Anselm ...!«
»Wenn wir die Brücke finden, dann ...«
»Anselm, schweig!«
»Josefa, an der Isar lässt sich immer eine Furt finden. Zumal jetzt im Sommer.«
»Anselm, schweig endlich! Sag nichts mehr!«
Ihr Kopf verschwand wieder im Inneren des Wagens. Dummes Weib, dachte er, was fragt sie mich erst, wenn sie dann doch wieder alles besser weiß? Jetzt war sie wieder eingeschnappt. Er musste an den heftigen Streit denken, den sie in Telfs gehabt hatten. Dabei war gar nichts passiert.
Das Gewitter war vorbei, und es wimmelte wieder von Mücken. Noch schlimmer waren die grauen Bremsen, deren Stich so schmerzte. Die Ochsen warfen ihre Schädel hin und her. Von den Mäulern troff Speichel, während sie versuchten, mit ihren langen Zungen die ärgsten Plagegeister von den Schnauzen zu vertreiben.
Anselm stapfte zurück an die Spitze des Wagenzuges. Frieder, sein Knecht, mühte sich mit dem Gespann.
»Was ist los?« wollte Anselm wissen und erschlug eine Bremse an seinem schwitzenden Hals.
»Er will nicht weiter«, sagte der Fuhrknecht und wies mit seinem Stock auf den Leitochsen.
Anselm seufzte und blickte auf das Tier. Mit ihm hatte er vor acht Jahren seinen Broterwerb begründet. Der Ochse war für ihn beinahe so etwas wie ein Partner. Er trat an das Joch, scheuchte einen Schwarm Mücken und Fliegen auf, die sich erneut wie eine Wolke auf das Fell des Ochsen setzten. »Was ist, alter Freund? Was hast du?«
Das Tier schnaufte.
Der Weg vor ihnen senkte sich langsam abwärts. Noch ein paar Schritte, und sie kamen an den Rand eines kurzen, aber steilen Hangs. Da führte der Weg hinunter. Anselm verstand. Immer wieder erstaunlich, aber dieser Ochse schien ein besonderes Gespür für einen guten oder weniger guten Weg zu haben.
Die Straße war verschlammt, und ablaufendes Regenwasser bahnte sich in selbstgeschaffenen Rinnen einen Weg. Die schweren Gespanne hier heil runterzubringen würde schwierig werden. Frieder war neben ihn getreten. Sein Wams tropfte am Saum noch vor Nässe. Stumm sah er den steilen Hang hinunter. Anselm erschlug eine weitere Bremse, die sich gerade auf seiner Hand niedergelassen hatte.
»Der Ochs meint Nein«, sagte Frieder plötzlich.
»Aha«, antwortete Anselm spöttisch und sah seinen Knecht von der Seite her an. »Tun wir jetzt schon, was der Ochs meint?«
Frieder kaute auf einem Grashalm herum.
»Der Weg ist steil«, meinte Frieder.
»Weiß ich, hab ja selber Augen im Kopf«, entgegnete Anselm.
Frieder starrte weiter durch den dämmrigen Wald den Hohlweg hinunter, in den das Wasser und längst gegangene Füße tiefe Rinnen gegraben hatten, starrte auf die kopfgroßen Findlinge im Schlamm. Da, wo keine Erde mehr war, blinkte der Schotter hervor. Er schwieg.
»Vater!«
Die Stimme gehörte Kajetan, den alle nur Kai nannten. Der knapp zehnjährige, ein wenig schmächtige Junge schob sich neben den beiden Männern vorbei, blieb dann am Rand des Abhangs stehen und blickte hinunter.
»Verflucht steil, Vater, aber zur Hölle, keiner wird uns helfen.«
»Red keinen Unsinn, Kai. Und fluch nicht, wenn deine Mutter dich hören kann.«
Anselm bedachte seinen Jungen mit einem strengen Blick, obwohl er es gar nicht so meinte. Die für sein Alter hoch aufgeschossene Gestalt, das halblange, braune Haar, sein Gesicht. Wenn er nur nicht so schmal wäre! Es ging ihnen doch gut, und am Essen brauchten sie nicht zu sparen.
»Wir müssen da runter«, beschied er.
Frieder spuckte aus.
»Weil wir nicht umkehren können«, erklärte Anselm, und Frieder nickte nur.
Das brauchte man ihm nicht zu sagen. Er stapfte zu den übrigen Gespannen. Anselm blickte ihm nach. Ja, sie mussten hier runter. Mit allen drei Frachtwagen. Und den Ochsen. Und der Frau und dem Mädchen und dem Jungen. Und dem Salz. Vor allem mit dem Salz. Ihr Auskommen für das nächste Jahr. Mit etwas Geschick würde auch ein hübscher Gewinn dabei zu erzielen sein. Er wandte sich zu seinem Sohn.
»Der Frieder und ich gehen mit dem Jockel und seiner Fuhre runter. Dann kommen wir wieder rauf und holen den nächsten Wagen. Du bleibst bei deiner Mutter und deiner Schwester und passt auf.«
»Aber Vater ...«
»Kein Wort mehr, du tust, was ich dir sage.«
Anselm seufzte. Ihm war nicht wohl dabei. Die Aussicht, mit jedem der Gespanne hinunterzugehen und dann den steilen Hang wieder hinaufzusteigen, um den nächsten Wagen zu holen, ließ ihn sogleich schwitzen. Das würde schwer werden. Und gefährlich. Vor allem gefährlich. Außer Jockel hatte keiner der Ochsen so ein stoisches Gemüt, um auf so steilem, rutschigem Boden zu gehen, mindestens eine Tonne Salz im Rücken. Am liebsten hätte er losfluchen wollen, aber das hätte seine Frau gehört. Kai stand noch immer vor ihm und blickte ihn an. »Vater ...«
»Geh und sorg dafür, dass Mutter sich nicht ängstigt.«
Der Junge nickte gehorsam und eilte durch das Gestrüpp am Wegesrand zurück. Anselm blickte ihm nach. Sein Junge. Auf ihn war er stolz.
Der Fluss hieß Isar. Isara, die Reißende, wurde sie einst von den Kelten genannt. In einem dicht bewaldeten Tal mitten im Karwendelgebirge trat das Wasser aus dem Fels, sammelte weitere Rinnsale und folgte, breiter und schneller werdend, seinem Weg durch das Tal. Wo der Bach das erste Mal aus dem Wald trat, war er bereits kräftig angeschwollen. Schnell wuchs er zu einem breiten Fluss, ungebändigt und genährt von zahlreichen weiteren Wassern. Auch dieses Jahr waren eine lange Schneeschmelze und die letzten verregneten Wochen schuld am heftigen Anstieg des jungen Wildflusses. Die Wassermassen waren stark genug, um Geschiebe aus Fels und Geröll mit sich zu nehmen und so das Flussbett ständig zu verändern. Bis Vöhringen führte die Isar bereits so viel Wasser, dass sie in großen Flächen links und rechts über die Ufer trat. Und noch immer schwoll die »Reißende« an.
Bereits seit römischer Zeit führte eine Straße, von jedermann nur Salzsteig genannt, an der Ansiedlung vorbei. Die einzige feste Brücke auf die Entfernung eines ganzen Tagesmarsches lag hier unweit der kleinen Ansiedlung Vöhringen, der einzig sichere Übergang über den Fluss zu allen Jahreszeiten. Zusätzlich sparte man wenigstens zwei Tage, wollte man nach Augsburg und von dort weiter nach Norden. Der Grund gehörte der Kirche und damit zu einem Lehen des Klosters in Freisingen. Deren Mönche waren es, die vor langer Zeit diese Brücke gebaut hatten. Sie hatten dabei alte Steinfundamente, die wohl schon römische Legionäre errichtet hatten, als Untergrund für die Pfeiler aus schweren Holzbalken genutzt. Der Bau dieser Brücke und der Straße hatte fast zwei Jahre gedauert und in dieser Zeit den Menschen aus den umliegenden Weilern Auskommen und Brot gegeben.
Bischof Otto kassierte den Zollgroschen, und das Geld trieben eine Hand voll Knechte ein. Ihr Anführer, Dankred, schrieb jedes Fuhrwerk, jede Viehherde und jeden Handelszug auf. Er rechnete die Groschen ab, die der Bischof viermal im Jahr abholen ließ. Dazu kam immer ein Mann zu Pferd, überprüfte alles und wollte über jede Partie genau Bescheid wissen.
Nun lag die Brücke in der Sommerhitze.
Weiter im Süden gingen über den Wäldern erneut schwere Gewitter nieder. Hier aber lag feuchtwarme Sommerluft schwül über ihnen. Dankred döste, bis er auf einmal eingenickt war.
Irgendetwas kitzelte ihn an der Nase. Sicher eine Fliege. Nur die waren so hartnäckig. Elende Biester. »Verflucht!«, entfuhr es ihm, als er aus seinem Halbschlaf aufschreckte. Er sah auf einmal Gerunchs lachendes Gesicht vor sich. In seiner Hand hielt er eine Vogelfeder.
»Blödmann«, entfuhr es Dankred.
Der andere lachte.
»Dauert, bis man dich wachkriegt. Dabei kann ein Welfenknecht kommen und dir den Hals durchschneiden.«
Zwei weitere, neben ihm kauernde Männer lachten.
»Einen Welfen erkenne ich schneller als deinen blöden Scherz«, grunzte Dankred.
»Wie das?«
»Welfen stinken.«
»Staufer auch«, warf ein Wachposten neben ihm ein, und wieder musste Gerunch grinsen.
»Ihr seid ein blöder Haufen«, antwortete Dankred gut gelaunt.
»Richtig, und der beste blöde Haufen noch dazu«, entgegnete Gerunch stolz.
Jetzt konnte auch Dankred ein Lachen nur schwer unterdrücken.
»Betet alle, dass euch der heilige Christopherus euren Hochmut austreibt.«
Wieder lachten die Männer.
Dankred blickte sich um. Sie waren zu viert, die hier an der Brücke Dienst taten, Zollgroschen kassierten und jeden Reisenden kontrollierten. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Alle drei Monate kam ein Junker im Auftrag des Bischofs und zahlte ihnen ihr Handgeld. Keine Frage, es gab schwerere Arbeiten.
»Schafe!«, rief einer der Wächter und deutete auf die andere Seite der Brücke hinüber.
»Nicht so laut, du Dummkopf«, wies ihn Gerunch zurecht.
Bis auf Dankred griffen sie nach ihren Spießen. Die schmale Straße führte in einer sanften Kurve bis zum Beginn der Brücke. Dort näherte sich eine Gruppe singender Menschen.
»Mönche«, murmelte einer der Brückenwächter enttäuscht, »da ist nichts zu holen.«
»Keine Mönche, Pilger«, verbesserte ihn Dankred. »Weiß der Teufel, wo die hinwollen ...«
Rasch bekreuzigten sich die Knechte bei der Nennung des Leibhaftigen. Man konnte ja nie wissen.
»Was machen wir mit ihnen?«
Dankred gähnte ausgiebig und befahl dann: »Lasst sie in Ruhe.«
Er lehnte sich wieder in den Schatten neben der Hütte, gähnte erneut und schloss die Augen. Gerunch kniete neben seinem Anführer.
»Dankred?
»Mmmh.«
»Wir sollten uns die Pilger vorknöpfen. Denk daran, jeder Groschen zählt.«
»Wozu die Mühe, die haben doch nichts, brummte Dankred.
«Trotzdem«, begann Gerunch wieder, »die Männer kommen noch aus der Übung, und es ist unsere Aufgabe, Brückenzoll einzutreiben.«
»Gerunch, du bist ein Heuchler. Sicher haben die Pilger ein junges Weibsbild dabei, und dein kleiner Freund hofft auf ein paar heiße Schenkel.«
Der Mann grunzte, und Dankred wusste, dass er dessen geheime Gedanken erraten hatte.
»Na, und wenn schon.«
»Wir warten, ob was Besseres kommt. Und jetzt lass mich in Ruhe.«
Gerunch legte sich seufzend auf den Rücken und starrte in die grünen Baumkronen über sich. Dankred aber schlummerte wieder ein.
5
Anselm lief der Schweiß an Hals und Rücken hinunter.
Die warme Luft und die feuchte Schwüle des Waldes waren der Grund dafür. Genauso wie die Anstrengung und die Angst, ob alles gut gehen würde. Die Tiere zogen an und gingen langsam und gleichmäßig, aber erst, nachdem er dem Leitochsen ein paar besonders derbe Schläge auf den massigen Kopf gegeben hatte. Das Tier hatte ihn angesehen, und Anselm war, als habe er einen ungläubigen, ja fast tadelnden Ausdruck entdeckt. So als frage sich die Kreatur in diesem Moment, ob sein Herr noch alle Sinne beieinander habe. Sollte er, der Leitochse dieses ersten Gespanns, tatsächlich mit einer Tonne Salz im Rücken diesen Weg hinuntergehen?
Anselm führte den Ochsen an einem Seil. Immer dann, wenn das Tier Anstalten machte, stehen zu bleiben, zog er erneut, begleitet vom pfeifenden Geräusch des Stockes. Anselm schämte sich dafür, aber diese Sprache verstand das Tier. So trottete es langsam, Schritt für Schritt den Hang hinunter.
»Pass auf, Frieder!«, rief Anselm nervös.
»Jaja«, tönte es von der anderen Seite.
Frieder schwitzte genauso. Er ging neben dem Fuhrwerk und versuchte, mit einem armdicken, langen Prügel das Gefährt zu bremsen. Dabei galt es, besonders Acht zu geben. Geriet das Holz zwischen die Speichen, war das Rad hin. Dann würde alles in einer Katastrophe enden. Genauso, falls der Wagen umkippen sollte, weil er nicht auf dem Weg blieb.
»Langsamer!«, rief Anselm, und Frieder stemmte sich mit dem Holz und seiner ganzen Kraft dagegen »Nicht so schnell! Frieder, nicht so schnell!«
»Hör dich doch, Herr«, keuchte der Knecht zurück und lauschte auf das knackende Geräusch des Holzes, das die schneller werdenden Räder bremsen sollte.
Der Frachtwagen rutschte mehr über den verschlammten Boden, als dass er rollte. Doch allmählich wurde der Wagen tatsächlich langsamer. Gott im Himmel, musste Frieder denken. Der Leitochse war ein sehr erfahrenes Tier und spürte die Kräfte, die auf dem Joch lasteten. Etwas, das man nicht von allen Ochsen sagen konnte. Die anderen waren so steile Strecken weniger gewohnt. Wie mochte diese Tour erst mit ihnen werden?
»Frieder!«, schrie Anselm plötzlich.
»Was ...?«
»Hinten, Frieder! Pass mir ja hinten auf!«
»Pass schon auf, Herr.«
Er wandte sich um und trat zwei Schritte höher. Bis zu den Hüften war er voll nassem Schlamm. Die Nässe sickerte durch seine Beinkleider und ließ die Haut jucken. Das Ende des schweren Frachtwagens schlingerte hin und her, und unter der gewaltigen Ladung knarrte das ganze Gefährt bedrohlich. Die mächtigen Wagenräder mahlten bis zur Achse durch den Schlamm, schoben Schotter und kopfgroße Steine mühelos zur Seite. Allmählich senkte sich der Weg und wurde sanfter. Sie hatten es beinahe geschafft. Als ob der Leitochse dies spürte, verfiel er sogar in einen schnelleren Schritt. Anselm musste am Seil ziehen, um ihn im Zaum zu halten.