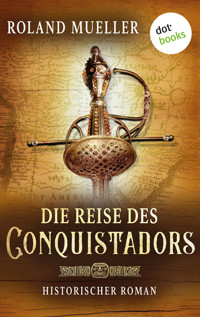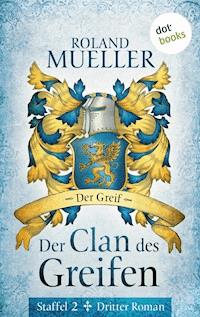0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Clan des Greifen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mitreißend und spannend: Die sechsteilige historische Serie „Der Clan des Greifen“ von Roland Mueller jetzt als eBook bei dotbooks. Südtirol im 15. Jahrhundert: Gräfin Eleonore von Greifenberg sieht ihren Mann Wolfram in den Krieg gegen die Engländer ziehen. Sie ist allein mit vier kleinen Kindern, der Burg, den Bauern und Fischern, den Schafhirten und den Holzknechten – dem Lehen. Aber Eleonore zeigt sich dieser Aufgabe durchaus gewachsen. Als Wolfram aus dem Krieg zurückkehrt, scheint ihr einst so frohsinniger Mann wie verwandelt. Doch nicht nur das – auch eine seltsame Krankheit quält ihn und fesselt ihn schließlich ans Bett. Eleonore ist nicht bereit, ihren Mann aufzugeben – denn sie könnte es nicht ertragen, ihn zu verlieren … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die sechsteilige historische Serie „Der Clan des Greifen“ von Roland Mueller. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südtirol im 15. Jahrhundert: Gräfin Eleonore von Greifenberg sieht ihren Mann Wolfram in den Krieg gegen die Engländer ziehen – nur fünf Jahre nach ihrer Eheschließung. Sie ist allein mit vier kleinen Kindern, der Burg, den Bauern und Fischern, den Schafhirten und den Holzknechten. Dem Lehen. Aber Eleonore zeigt sich dieser Aufgabe durchaus gewachsen. Als Wolfram aus dem Krieg zurückkehrt, scheint ihr einst so frohsinniger Mann wie verwandelt. Doch nicht nur das – auch eine seltsame Krankheit quält ihn und fesselt ihn schließlich ans Bett. Eleonore hat große Angst, ihren Mann nun gänzlich zu verlieren …
Über den Autor:
Roland Mueller, geboren 1959 in Würzburg, lebt heute in der Nähe von München. Der studierte Sozialwissenschaftler arbeitete in der Erwachsenenbildung, als Rhetorik- und Bewerbungstrainer und unterrichtet heute an der Hochschule der Bayerischen Polizei. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher.
Bei dotbooks erschienen bereits Roland Muellers historische Kinderbücher Die abenteuerliche Reise des Marco Polo und Der Kundschafter des Königs und seine historischen Romane Der Goldschmied, Das Schwert des Goldschmieds, Das Erbe des Salzhändlers und Der Fluch des Goldes.
Die erste Staffel der historischen Serie Der Clan des Greifen umfasst folgende Bände:
Erster Roman: Die Begegnung.
Zweiter Roman: Der Pakt.
Dritter Roman: Das Vermächtnis.
Vierter Roman: Das Erbe.
Fünfter Roman: Die Rache.
Sechster Roman: Das Spiel.
***
Originalausgabe Januar 2015
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung und Titelbildabbildung: Nele Schütz unter Verwendung von shutterstock/Olga Rutko
ISBN 978-3- 95520-588-1
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Clan des Greifen an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Roland Mueller
Der Clan des Greifen
Die Begegnung
Staffel I – ErsterRoman
dotbooks.
Über Jahrhunderte hinweg bestimmten Ritter die Geschicke Europas. Überall im Abendland bauten sie ihre Burgen, führten gewaltige Kreuzzüge, dienten Kaisern und Königen, waren selbst Herzöge oder Grafen. Ritter waren die Herren der damaligen Welt.
Als das Mittelalter mit der Jahrhundertwende um 1400 allmählich zu Ende ging, bestieg mit Sigmund ein neuer König den Thron. Zu dieser Zeit war der Niedergang des Ritterstandes bereits nicht mehr aufzuhalten. Einer der Gründe dafür war sicherlich die Entdeckung des Schießpulvers. Kanonen und Musketen machten Schwert und Schild, Lanze und Eisenpanzer allmählich überflüssig. In ebendiesen Zeiten wollte König Sigmund diplomatisches Geschick zeigen und versuchen, den ramponierten Ruf der abendländischen Kirche wiederherzustellen. Die ständig drohende Spaltung der Christenheit lähmte das Denken und Handeln der Menschen. Zeitweilig gab es drei Päpste gleichzeitig, und nicht etwa Rom, sondern Avignon war seit siebzig Jahren der Sitz des Kirchenfürsten. Doch Sigmund gelang tatsächlich, was niemand mehr für möglich gehalten hatte: In Konstanz trat ein Konzil mit dem Ziel zusammen, sich auf einen einzigen Papst zu einigen. Vier Jahre sollte es dauern, bis am Ende doch ein neues Oberhaupt aller Christen gewählt wurde. Nur ein Atemzug in der Geschichte des Abendlandes, in der sich eine neue Zeit erahnen ließ. Doch weder Sigmund noch der Papst, erst recht nicht die Ritter haben die Tür dieser neuen Epoche aufgetan. Dies gelang einem böhmischen Gelehrten mit dem Namen Johannes Hus. Seine kühnen Gedanken über Gott und die Welt überlebten sogar das Feuer, das ihn in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Nach seinem Tod wurden seine Ideen für die Menschen zur Sehnsucht. Selbst als die Pest erneut in Europa wütete, selbst als sich immer wieder schreckliche Hungersnöte mit blutigen Kriegen die Hand gaben und Despoten neue Despoten ablösten, schufen die Menschen mit diesem Denken den weiteren Lauf der Welt. Alles sollte sich verändern. Schneller als je zuvor. Städte wie Florenz, Pisa, Brescia, Verona, aber auch Nürnberg und Augsburg wuchsen sich hinter ihren sicheren Mauern reich. Venedig wurde zur neuen Großmacht jener Tage, und das zu einer Zeit, als es in Paris nur ein paar wenige gepflasterte Straßen gab und man in London die Themse über gerade mal zwei intakte Brücken überqueren konnte. Das Jahrhundert endete mit der Entdeckung der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus. Auch er war kein Ritter mehr, obwohl er es gerne gewesen wäre.
Diese aufregende Zeit ist der Rahmen der Geschichte über die Familie von und zu Greifenberg. Der Clan eines uralten Rittergeschlechts aus dem Niederadel lebt in einem malerischen Tal irgendwo in Tirol. Natürlich kann heute niemand mit Bestimmtheit sagen, ob sich tatsächlich alles genauso zugetragen hat, wie es hier erzählt wird. Aber im Rahmen der tatsächlichen Ereignisse in der damaligen Welt wäre diese Geschichte um den Ritter und seine Nachkommen sicher möglich gewesen.
***
»Großmutter, sieh nur!«
Der Junge deutete aufgeregt auf das Fohlen und strahlte dabei übers ganze Gesicht. Seltsam, dachte sie, immer öfter waren es Momente wie diese, die Erinnerungen wachriefen. Er nannte sie Großmutter, und sie sah sich als blutjunge Braut oder als Mutter von vier Kindern. Oder als Herrin der Burg. Nun war sie auch noch die Großmutter, die dabei zusah, wie ihr Enkelsohn sehnsüchtig einem Fohlen nachblickte, das der Pferdeknecht mit einem Schlag auf die Kruppe in Richtung Weide gelassen hatte. Das Tier trabte ein paar Schritte und wirkte auf seinen dünnen Läufen noch etwas steif und ungelenkig. Erste Schritte – und sie war in diesem Frühjahr 38 Jahre alt geworden.
Sie dachte an ihre morgendliche Begegnung mit Hagen, den sie bereits ihr halbes Leben lang kannte. Wieder einmal hatte sie festgestellt, dass der Ritter ein Mann war, den sie außerordentlich schätzte. Weil er sich zu benehmen wusste, wie es der Anstand verlangte, wie man es eben von einem Ritter erwartete und es in diesen Zeiten kaum noch erlebte. Hagen vom Wald ließ sie in seiner Gegenwart spüren, dass sie eine Frau war und nicht nur die Witwe des seligen Grafen von Greifenberg oder die Herrin der Burg. Eine Frau aus Fleisch und Blut, der man Aufmerksamkeit schenkte, der man schmeichelte, Komplimente machte. Gerade jetzt, nachdem wieder einmal ein Krieg zu Ende gegangen war und das Leben wieder besser wurde, durfte sie da nicht auch etwas Zeit für sich und ein paar Träume haben?
»Großmutter, wann werde ich ihn reiten können?«
»Bald, mein Liebling, bald ...«, antwortete sie.
Seine Wangen glühten in der Vorfreude, und er beobachtete erneut aufmerksam, wie das Fohlen auf dem frischen Wiesengrund hin und her trabte. Ob es ihr noch einmal gegeben war, neu anzufangen? Sie schloss für einen Moment die Augen. Ja, damals, als an einem warmen Sonntag im Mai alles begann ...
***
Der Gottesdienst war gerade zu Ende gegangen und sie, Eleonore vom Stein, jung, hübsch anzuschauen und neugierig auf das Leben, trat aus der Kapelle hinaus in das warme Sonnenlicht. Sie blieb neben dem Eingang stehen, denn sie hatte ihn bereits erkannt. Obwohl vor der Kirche, inmitten der Edlen und Ritter, deren Knechte und Pagen, ein geschäftiges Durcheinander herrschte, stand er unter den Bäumen bei den Pferden. Allein, niemand sonst nahm Notiz von ihm. So jung war er nicht mehr, fand sie, wenn auch längst nicht alt, etwa wie der Leiner, der Verwalter in ihrem Elternhaus, oder gar der Abt des Klosters, beides steinalte Männer in ihren Augen. Schlank von Gestalt, fast hager, sein Haar dunkel und glatt, an den Schläfen ausrasiert. Diese ein wenig altmodische Haartracht trug kaum ein Mann mehr, doch zu ihm passte sie irgendwie. Besonders gefiel ihr sein schmales, gut geschnittenes Gesicht. Er trägt sein Schwert nicht am Gürtel, dachte sie, sondern am Sattel, wo auch sein Schild hing. Schwarz, mit dem blutroten Greifen darauf. Wolfram von und zu Greifenberg, ein einfacher Ritter aus dem Wengertal, eine knappe Tagesreise entfernt. Viel mehr wusste sie nicht über ihn. Nur dass er hier bei seinem Oheim zu Gast war. Offenbar merkte er, dass sie ihn betrachtete, denn er hob den Kopf und lächelte ihr zu. Noch etwas, was ihr gefiel. Sein Lächeln.
Verlegen wandte sie den Blick ab. Ein Reitknecht trat zu ihr und führte ihren Zelter. Der Knecht hob beide Hände, um ihr in den Sattel zu helfen, und sie musste insgeheim darüber lachen, wie umständlich er das anstellte. Das rührte daher, dass es nicht üblich war, dies einem einfachen Mann aus dem Volk zu überlassen. Aber ihr Vater war mit dem Gefolge bereits auf und davon, um rasch der Schwüle dieses Sonntags im Schatten der nahen Schenke zu entgehen. Sie war mit Absicht zurückgeblieben, denn sie wollte auf den Berg, allein, so wie die letzten Sonntage auch. In die kleine Hütte, ihren Lieblingsplatz, den niemand sonst kannte.
Als sie im Sattel saß, ihr Kleid geordnet und die Zügel zurechtgelegt, blickte sie sich noch einmal um. Der Graf war verschwunden wie die beiden Sonntage zuvor. Sie seufzte. Also würde sie ihn erst nächste Woche wiedersehen, wie immer in der Kirche – wo sie ihn während der Messe verstohlen in seiner Bank kniend betrachten konnte. Dabei wünschte sie sich so sehr, dass er sie ansprach! Einmal nur, dachte sie, während das Pferd munter durch den Wald trabte. Sie musste ihm ja nicht gestehen, dass sie seit ihrer allerersten Begegnung ständig an ihn denken musste. Ein paar Worte mit ihm würden ihr schon genügen. Für den Anfang wenigstens ... Genau, und sollte er nächsten Sonntag wieder kein einziges Wort sprechen, werde ich es tun. Obwohl sich das nicht schickte. Sie schüttelte unwillig den Kopf. Warum eigentlich? Es schickt sich nicht! Aber was hieß das schon? Den Kopf energisch gehoben, schnalzte sie mit der Zunge, und der Zelter ging ein wenig schneller. Nein, ihr Entschluss stand hiermit fest: Wenn er sie nächsten Sonntag wieder nur ansah und lächelte, dann würde sie ihn fragen. Eine Frage zu stellen war ja wohl erlaubt. Warum er sie immer so anblickte, würde sie lauten, denn den Grund dafür wüsste sie zu gerne!
Der Weg führte jetzt auf die mächtige graue Felswand zu. Ein paarmal war sie so weit geritten, dass sie den glatten Fels mit den Händen berühren konnte. Unten, am Fuß der fast senkrechten Wand entlang, führte der Weg noch weiter und verschwand schließlich hinter einer Biegung. Ob man dort noch weiterreiten konnte, wusste sie nicht. So weit war sie noch nie gekommen. Man erzählte sich, dass dort das Reich der Berggeister begann. Und die mochten es nicht, wenn man sie störte.
Hier oben war es einsam. Kaum jemand verirrte sich hierher. Weiter unten, am Waldrand, hüteten manchmal Kinder Ziegen und Schafe. Der Leiner zahlte jetzt sogar zwei Sommerknechte, die schon lange vor dem Fest Johanni auf die Weiden kamen und erst spät im Herbst wieder ins Tal hinabstiegen, um fein gesponnene Wolle aus Ziegenhaar und würzigen Käse mitzubringen.
An der Hütte angekommen, stieg sie vom Pferd. Nachher erst würde sie es absatteln. Über sich hörte sie den vertrauten Ruf des Steinadlers, der immer auftauchte, wenn sie die Hütte besuchte. Wie bereits im letzten Sommer flog er dabei ganz niedrig, so als wolle er sie besonders eingehend betrachten. Eleonore sah ihn nie kommen. Erst wenn er rief, so wie jetzt, oder sein Schatten auf sie fiel, wusste sie, dass er da war. Seine Schwingen breit, die Klauen scharf und ein Schnabel, aus dem er seinen Ruf weit hören ließ. Wieder und wieder. Doch da war noch ein Geräusch.
Hufschläge. Als sie dann sein Pferd sah, ihn im Sattel, klopfte ihr Herz so laut, dass sie glaubte, er müsste es hören. Wenige Schritte vor ihr zügelte er das Tier und lächelte sie an. Er trug ein Hemd, die Ärmel aufgerollt, seine nackten Arme gebräunt, dazu lange enge Beinkleider. Die Füße ohne Strümpfe in den leichten Schuhen. Sein Kopf war unbedeckt, was ungewöhnlich für die Zeiten war und nicht der Mode entsprach.
»Ich wollte Euch nicht erschrecken, edles Fräulein«, sagte er statt einer Begrüßung.
Sie hörte seine angenehme Stimme. Er lächelte sie freundlich an.
»Erlaubt Ihr mir, einen Schluck Wasser zu trinken?«
Als sie nickte, stieg er vom Pferd und führte das Tier neben die Hütte, wo das Wasser den steilen Fels hinunter über grobe Steine plätscherte und neben der Hütte ein schmales Rinnsal bildete. Das Pferd senkte den Kopf und begann zu trinken. Er kniete daneben nieder, tauchte beide Hände in das klare Wasser und benetzte sich die Arme, den Hals, seine Stirn. Dann streichelte er das Tier am Kopf und am Hals und verjagte die lästigen Fliegen. Das Pferd dankte es ihm, indem es den schönen Kopf an seiner Schulter rieb.
Da musste sie lachen, und er wandte sich um und lachte auch. Er schöpfte Wasser mit der hohlen Hand, um zu trinken, und wie er das tat, gefiel er ihr mit jedem Augenblick besser. Als er sie fragte, ob er bleiben dürfe, zögerte sie kurz. Kein Zweifel, er war ihr gefolgt, und das verwirrte sie. Was wollte er von ihr? Während er die Frage stellte, blickte er an ihr vorbei auf die andere Talseite hinüber, und sie folgte seinem Blick. Dort hingen schwere Wolken in den steilen Felswänden. Der Wetterwechsel war ihr bei ihrem Ritt durch den Wald gar nicht aufgefallen. Ein Gewitter kam hier schnell. Und galt die Gastfreundschaft einem Reisenden gegenüber nicht wie ein ehernes Gesetz? Er blickte sie, auf Antwort wartend, an, und erneut nickte sie stumm zum Einverständnis. Jetzt lächelte er wieder und begann erst sein eigenes Pferd, dann das ihre zu versorgen. Dies tat er wie selbstverständlich, und sie betrat derweil die Hütte, legte ihren dünnen Schleier ab und zog dann Schuhe und Strümpfe aus. Sie mochte es, barfuß zu laufen. Dann öffnete sie die Fensterläden, ließ Licht und die frische Luft herein und blickte sich um. Alles war so wie immer: der große, aber gemütliche Raum mit der niedrigen Decke aus massiven Holzbalken, der steinerne Kamin an der Wand, die hölzerne Tenne an der Rückseite, der kleine Tisch und die beiden hölzernen Schemel. Ihr Reich. Zufrieden trat sie an die Tür und blieb dort stehen. Er führte die Pferde in das kleine Gehege neben der Hütte, und auf einmal war sie unsagbar froh, dass er blieb.
Später dann saß er am Tisch und sah ihr zu, wie sie Eier in einer schwarzen Eisenpfanne aufschlug, Speck in Streifen schnitt und Kräuter und eine Prise Salz dazugab. Bald erfüllte ein köstlicher Duft den niedrigen Raum. Dann blitzte es, grollend laut die Donnerschläge, gefolgt vom Regen, der wie ein dichter Schleier vom Himmel fiel. Er stand auf und schloss die hölzernen Läden.
»Ein schönes Fräulein in einer einsamen Hütte.«
Es waren die ersten Worte, die er sprach, seit er mit ihr zusammensaß, und sie spürte, wie ihr auf einmal das Blut in die Wangen stieg.
»Sie gehört meinem Vater«, sagte sie. »Dem Ritter vom Stein.«
Er nickte nur, und als sie dann gemeinsam aus der Pfanne aßen, fiel zwischen ihnen kein weiteres Wort. Nachdem sie gegessen hatten, trank er noch klares Felswasser, und sie stand auf und goss etwas Wasser in einen eisernen Kessel über dem Feuer. Sie rieb die Pfanne mit Sand sauber und hängte sie wieder an die Wand. Er blieb sitzen und sah ihr dabei zu. Als das Wasser zu kochen begann, hob sie den Kessel vom Feuer und stellte ihn auf einen Schemel. Dann nahm sie ein Stück Leinen und stellte einen tönernen Krug mit frischem Wasser dazu. Sie lächelte ihn an, und er lächelte zurück. Anschließend löste sie das samtene Band in ihrem Nacken, und ihr langes Haar fiel ihr über die Schultern. Als sie nach dem Krug greifen wollte, trat er neben sie. Mit einer Hand berührte er ganz behutsam ihr Haar, dann nahm er die Kelle, schöpfte heißes Wasser in den Krug und prüfte es mit den Fingerspitzen. Sie blickte ihn an, und da deutete er auf die Schleife um ihre Brust, mit der ihr Kleid zugebunden war.
»Es wird nur nass werden«, flüsterte er.
Sie schluckte stumm. Er hatte recht, und sie ließ zu, dass er die Schleife behutsam aufband. Das Kleid glitt über ihre Schultern und blieb zu ihren Füßen liegen. Sie trug nur noch ein dünnes ärmelloses Hemd, und als sie sich ein wenig nach vorn beugte, schöpfte er behutsam so lange warmes Wasser über ihr Haar, bis es ganz und gar nass war. Dann rieb er weiße Asche und anschließend ein wenig Honig hinein. Sie spürte seine Fingerspitzen, die sanft massierend ihre Kopfhaut berührten. Er griff erneut nach dem Krug und goss behutsam noch einmal warmes Wasser über ihr Haar, bevor er es mit dem Leinen zu trocknen begann. Sie ließ ihn einfach gewähren, und als er damit fertig war, kniete er neben ihr nieder und blickte sie nur an, wieder mit diesem Blick aus seinen dunklen Augen, der ihr vom ersten Moment an so gefallen hatte. Sie beugte sich zu ihm, und als er sie küsste und dabei fest in die Arme nahm, überließ sie sich ganz dem, was geschehen würde.
Er hob sie hoch und trug sie zu der breiten Tenne mit dem großen Heubett. Erneut küsste er sie, während er die Schnüre ihres dünnen Hemds öffnete. Dann war sie nackt, und sie half ihm bei seinen Kleidern, bis auch er nackt war. Sie schmiegten sich eng aneinander, berührten sich. Plötzlich waren sein Mund und seine Hände überall, und während sie sich liebten, hatte Eleonore das Gefühl, als würde alles um sie herum stillstehen, geduldig wartend, bis sie beide diese grenzenlose Nähe gänzlich ausgekostet hatten.
Später dann lagen sie still nebeneinander, ihrem Atem lauschend. Einmal wollte sie etwas sagen, unterließ es jedoch aus Sorge, diesen besonderen Augenblick zu zerstören. Der Regen hatte längst aufgehört, aber von irgendwoher tropfte Wasser auf den Boden der Hütte. Sie roch den Duft nach Heu und den Pferden. Und seinen Geruch, der ihr bereits vertraut erschien. Er lachte leise für sich, und jetzt wollte sie ihn doch fragen, was all das bedeutete, als er bereits anfing zu sprechen.
»Eleonore ...«
»Ja?«
»Weißt du, was ich mir mehr als alles andere wünsche?«
»Nein, sag ...«
»Ich möchte dich zur Frau haben.«
Seine Worte schienen, kaum verklungen, eine Antwort zu ersehnen. Sie wandte sich zu ihm und sah ihn an. Im Dämmerlicht erkannte sie die Konturen seines Gesichts, seine kräftigen Schultern, die sehnigen Arme. In diesem Moment war sie glücklich. Weil ihr bewusst geworden war, wie sehr sie gehofft hatte, dass er genau dies sagte. Und weil sie spürte, wie sehr sie ihn mochte. War das Liebe? Sie hätte nicht sagen können, ob dieses Wort für all das stand, was sie empfand, aber ein Gefühl grenzenloser Zufriedenheit ließ sie fast zerspringen.
»Liebster ...«, flüsterte sie.
»Ja ...?«
»Ich will dich auch. Zu meinem Mann.«
Er zog sie zu sich, küsste sie erst auf die Stirn, dann sanft auf den Mund, streichelte sie dabei, und sie spürte seine warme Hand an ihren Schenkeln, spürte, wie er mit den Fingerspitzen der Rundung ihres Hinterteils folgte, und als sie sich beide wieder und wieder küssten, begannen plötzlich die Pferde zu schnauben. Sie lauschten. Die Tiere schnaubten erneut, und man konnte ihre Unruhe nebenan förmlich spüren.
»Da ist irgendwas«, flüsterte sie.
»Ja ... ja vielleicht.« Er sprang behände auf und griff nach seinem Schwert. Das Feuer war gerade hell genug, dass sie ihn in seiner Nacktheit noch erkannte. Wieder wollte sie etwas sagen, aber er schlich bereits an die Tür, öffnete sie und lauschte hinaus. Seltsam, dachte sie, eben noch war alles warm, heiter, schön. Kein Anzeichen für eine Gefahr. Aber in diesen Zeiten war es oft nur ein Augenblick, der das Glück von Tod und Verderben trennte. Sie suchte tastend nach ihrer Decke, fand sie aber nicht.
Als er wie ein Schatten in der Dunkelheit verschwunden war, stand sie auf, so wie sie war, und huschte zur Tür. Er stand draußen, sein Schwert mit beiden Händen haltend, und sah sich aufmerksam um. Es war Vollmond, aber die Wolken verdunkelten ihn. Dennoch war zu erkennen, dass die Pferde nicht mehr grasten, sondern, die Nüstern weit, bewegungslos dastanden und die Köpfe stillhielten. Er glitt an den Tieren vorbei und verschwand zwischen den Bäumen. Jetzt erst fiel ihr die Stille auf. Kein Vogel, kein Geräusch aus dem nahen Wald. Sie schlich zu den Pferden und streichelte erst ihre Stute, dann seinen Wallach. Die Tiere ließen es sich gefallen, blieben aber unruhig. An ihrem linken Fuß spürte sie einen großen Stein, und sie bückte sich danach. Er passte gerade so in ihre Hand und würde eine gute Waffe sein. Splitternackt und barfuß, das lange goldblonde Haar wie ein Schleier um ihre Schultern, schlich sie bis an die Stelle, wo der Ritter im Wald verschwunden war. Da hörte sie auf einmal ein langgezogenes unheilvolles Heulen. Wölfe! Sie wunderte sich mehr, als dass sie erschrak. Jetzt, im Sommer? Eher scheu, verließ Isegrim die schützenden Wälder in der Regel erst im Winter, um sich den Ansiedlungen der Menschen zu nähern. Das Geheul ertönte erneut, und dieses Mal klang es bereits so, als entfernte es sich von ihr.
Ein leises Knurren ließ sie herumfahren.
Der Wolf stand keine zehn Schritte entfernt. Zuerst nur ein dunkler Schatten, erkannte sie ihn nach und nach deutlicher. Der »Graue« ging es ihr durch den Kopf. Das musste er sein, jener sagenhafte große Wolf, Anführer eines Rudels, das mehr Schaden anrichtete als jedes Raubzeug sonst weit und breit. Als nun die Wolken vor dem Mond verschwanden, fiel Eleonore der durchdringende Blick des Tieres auf.
Schlaues Biest, musste sie denken, dein Rudel lockt den Mann mit der Waffe fort, damit du mit mir allein bist. Sie zitterte. Trotz der milden Luft war ihr auf einmal kalt. Sie sah die gefletschten Zähne, hörte sein leises drohendes Knurren. Wie jeder in dieser Gegend hatte sie davon gehört, dass Wölfe einen Mann mühelos niederreißen und mit einem Biss in die Kehle töten konnten.
»Bleib, wo du bist.«
Sie flüsterte nur, aber der große graue Wolf stellte die Ohren auf. Er schien es nicht gewohnt zu sein, dass ein Opfer noch einen Laut von sich gab, bevor er es tötete. Aber dieses Wesen tat es. Und es schien keine Angst vor ihm zu haben, was ihn verwunderte. Denn alle hatten Angst vor ihm.
»Los, verschwinde! Geh deiner Wege!«
Der Wolf knurrte erneut und trat näher.
»Hörst du nicht, was ich sage? Ich, die zukünftige Herrin von Greifenberg, sagte, geh!«