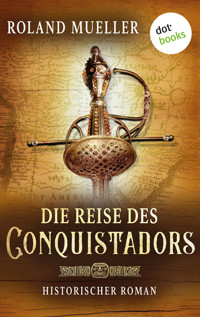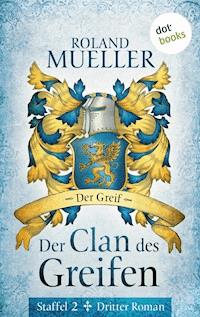7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Burgherrin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wird sie alles verlieren? Das historische Epos „Das Vermächtnis der Burgherrin“ von Bestsellerautor Roland Mueller jetzt als eBook bei dotbooks. Südtirol im 15. Jahrhundert: Die Familie von Greifenberg ist zutiefst gespalten – Gräfin Eleonore ist es nicht gelungen, zwischen ihren Söhnen Frieden zu stiften. Als sich dann auch die umliegenden Städte gegen Wolfs tyrannische Herrschaft wenden und den Greifenbergs den Krieg erklären, versinkt das Lehen in Chaos und Zerstörung. Noch gibt Eleonore die Hoffnung nicht auf, ihr Vermächtnis zu retten, doch dann betritt Frieder das Schlachtfeld – und der Kampf droht zu einem blutigen Bruderkrieg zu werden … Sechs Romane in einem Band! Die gesamte dritte Staffel der Erfolgsserie „Der Clan des Greifen“ von Roland Mueller jetzt erstmals unter dem Titel „Das Vermächtnis der Burgherrin“ als eBook kaufen und genießen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südtirol im 15. Jahrhundert: Die Familie von Greifenberg ist zutiefst gespalten – Gräfin Eleonore ist es nicht gelungen, zwischen ihren Söhnen Frieden zu stiften. Als sich dann auch die umliegenden Städte gegen Wolfs tyrannische Herrschaft wenden und den Greifenbergs den Krieg erklären, versinkt das Lehen in Chaos und Zerstörung.
Noch gibt Eleonore die Hoffnung nicht auf, ihr Vermächtnis zu retten, doch dann betritt Frieder das Schlachtfeld – und der Kampf droht zu einem blutigen Bruderkrieg zu werden …
Sechs Romane in einem Band! Die gesamte dritte Staffel der Erfolgsserie »Der Clan des Greifen« von Roland Mueller jetzt erstmals unter dem Titel »Das Vermächtnis der Burgherrin«.
Über den Autor:
Roland Mueller, geboren 1959 in Würzburg, lebt heute in der Nähe von München. Der studierte Sozialwissenschaftler arbeitete in der Erwachsenenbildung, als Rhetorik- und Bewerbungstrainer und unterrichtet heute an der Hochschule der Bayerischen Polizei. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher.
Bei dotbooks veröffentlicht sind bereits Roland Muellers historische Romane:»Der Goldschmied«»Das Schwert des Goldschmieds«»Im Land der Orchideenblüten«»Das Erbe des Salzhändlers«»Der Fluch des Goldes«Die beiden historischen Romane »Der Goldschmied« und »Das Schwert des Goldschmieds« sind ebenso als Sammelband unter dem Titel »Der Meister des Goldes« verfügbar.
Außerdem hat Roland Mueller bei dotbooks die historische Serie »Der Clan des Greifen« veröffentlicht, die folgende Bände umfasst:»Die Begegnung. Staffel I – Erster Roman«»Der Pakt. Staffel I – Zweiter Roman«»Das Vermächtnis. Staffel I – Dritter Roman«»Das Erbe. Staffel I – Vierter Roman«»Die Rache. Staffel I – Fünfter Roman«»Das Spiel. Staffel I – Sechster Roman«»Die Hexe. Staffel II – Erster Roman«»Der Betrüger. Staffel II – Zweiter Roman«»Der Greif. Staffel II – Dritter Roman«»Die Verfolgten. Staffel II – Vierter Roman«»Die Braut. Staffel II – Fünfter Roman«»Die Liebenden. Staffel II – Sechster Roman«Die komplette Serie ist außerdem in den drei Sammelbänden »Die Burgherrin«, »Die Kinder der Burgherrin« und »Das Vermächtnis der Burgherrin« enthalten.
Daneben hat Roland Mueller die beiden historischen Kinderbücher »Die abenteuerliche Reise des Marco Polo« und »Der Kundschafter des Königs« bei dotbooks veröffentlicht.
***
Originalausgabe Februar 2017
Copyright © 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Anja Rüdiger
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Kateryna Upit und eines Gemäldes von Jan van Huchtenberg »De Slag oon de Boyne« und Franz Barbarin »Alpine landscape with a castle«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-862-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Vermächtnis der Burgherrin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Roland Mueller
Das Vermächtnis der Burgherrin
Roman
Der Clan des Greifen - die komplette dritte Staffel in einem eBook
dotbooks.
Buch 1Der Aufbruch
Noch einmal sah sich Frieder in der kleinen Schlafkammer um. Von frühester Kindheit an war dies sein Reich gewesen. Doch nun, mit knapp zwanzig Jahren, war er im Begriff, nicht nur diese Kammer mit all den Erinnerungen, sondern auch die elterliche Burg zu verlassen. Möglicherweise für immer. Dass es dazu kommen würde, war ihm bereits klar gewesen, als die Hochzeit seiner Geschwister mit den tragischen Ereignissen noch andauerte. Natürlich hatte er mit Wolf, seinem Bruder, über alles sprechen wollen, aber der hatte sich in seinem Turmzimmer eingeschlossen. Das Einzige, was er verlangte, waren Krüge voll Wein, die ihm die Diener vor die Kammertür stellen mussten.
Frieder schloss die Tür hinter sich und stieg die Treppe zu den Frauengemächern hinunter. Als er den Gang betrat, blieb er stehen und lauschte. Irgendwo murmelten ein paar Stimmen. Er trat an die erste Kammertür, hinter der das Schlafgemach seiner jüngeren Schwester lag. Zaghaft klopfte er an, und kurz darauf öffnete Ramiro Esteban, der dunkelhäutige Diener Lorenzo Moratinis, die Tür.
»Gott schütze Euch, Herr Graf«, sagte der Mann höflich.
»Ich möchte mit meiner Schwester reden«, sagte Frieder.
Der Mann betrachtete ihn kurz, dann nickte er. »Bitte geduldet Euch einen Augenblick!«
Es dauerte nicht lange, und Ramiro bat Frieder einzutreten. Im Raum standen zwei offene Weidenkörbe voller Wäsche und zwei kleinere Holzkisten. Frieder musste seine Schwester beim Packen unterbrochen haben. Sie stand am Fenster, mit dem Rücken zu ihm, und erst als Ramiro die Kammertür wieder geschlossen und sich, mit verschränkten Armen wartend, danebengestellt hatte, wandte sie sich um. Frieder fand, dass seine kleine Schwester lieblicher denn je aussah, und für einen Moment wünschte er sich, Francesca möge an ihrer Stelle dort stehen. Johanna lächelte, und Frieder lächelte zaghaft zurück. Suchend blickte er sich um.
»Du bist allein?«
Sie nickte. »Lorenzo und mein Schwiegervater bereiten den Aufbruch vor. Gleich drei Packpferde lahmen. Sie müssen sie hier lassen und dafür andere Tiere nehmen. Nur gibt es wegen der vielen Gäste nicht genug Pferde auf der Burg. Sie hoffen, trotzdem welche kaufen zu können.«
Frieder nickte nur stumm und sah kurz auf den in schwarzes Leder gekleideten Mann neben der Tür.
»Ramiro ist mein Leibwächter. Mein Schwiegervater hat das so verfügt«, erklärte Johanna.
Frieder nickte verstehend. Dennoch wandte sich Johanna an den Dienstboten und sagte: »Bitte, lasst uns allein!«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Verzeiht mir, liebe Frau, aber das darf ich nicht. Ich musste Messer Moratini versprechen ...«
»Nur keine Sorge«, antwortete Johanna schnell, »es ist alles in bester Ordnung. Ich will nur mit meinem Bruder sprechen. Also geht jetzt bitte.«
Ramiro zögerte, doch dann verbeugte er sich und verließ das Zimmer. Frieder trat auf Johanna zu, und die beiden Geschwister umarmten sich innig. Dann machte sich Johanna sanft von ihm los und sah ihn an.
»Mein kleiner Bruder«, flüsterte sie zärtlich und streichelte ihm die Wange.
»Kleine Schwester.«
Sie lachte kurz und küsste ihn. »Wie geht es dir?«
Frieder seufzte tief. »Lass mich mit dir kommen.«
»Nein, Frieder.«
»Ich werde immer in deiner Nähe sein und auf dich aufpassen. Genau wie früher. Du brauchst diesen Ramiro nicht und ...«
»Nein, Frieder.«
Sie schüttelte traurig den Kopf. »Nein. Geh nach Weil, zu Friederike. Sie braucht dich viel mehr als ich.«
Johanna hob beide Hände, und erst beim zweiten Ansatz gelang es ihr weiterzusprechen. »Sie muss sich an ihre Stellung als Ehefrau des großen Barons von Weil gewöhnen. Das fällt ihr schwer genug.«
»Urs will seinen Schwager bestimmt nicht in seinem Hause haben.«
»Nach allem, was geschehen ist ...« Johanna schüttelte energisch den Kopf. »Er hat sicher nichts dagegen, wenn du in Friederikes Nähe bist.«
Frieder blieb nach den Worten seiner Schwester regungslos, und Johanna legte kurz den Kopf in den Nacken. »Ja, deshalb ist es besser, wenn du dort bei Hof bist anstatt hier.«
Frieder ahnte, dass seine beiden Schwestern, vielleicht auch seine Mutter, bereits alles in die Wege geleitet hatten. Er wollte etwas sagen, doch Johanna strich ihm erneut über die Wange. »Urs hat großen Einfluss, und er kann dir sicher helfen.«
»Mir kann niemand helfen«, entgegnete Frieder düster.
»Sag doch nicht so was.«
»Es ist aber die Wahrheit. Und du weißt das auch.«
Johanna stellte sich auf die Zehenspitzen und hauchte ihm einen Kuss auf den Mund.
»Der ist von Francesca«, flüsterte sie.
Er berührte seine Lippen mit den Fingerspitzen. »Wirklich?«
»Ja, wirklich. Es ist alles, was sie dir mit auf den Weg geben kann. Und du weißt auch, warum.«
Frieder schloss kurz die Augen.
»Der Himmel ist ungerecht«, murmelte er dann.
»Ja, mag sein. Aber vielleicht kommt es uns auch nur so vor. Geh nach Weil, Frieder. Dann bist du nicht ganz so weit weg von ihr.«
»Wessen Idee war das?«, fragte er jetzt.
»Meine, Frieder. Mutter hätte lieber zwischen euch vermittelt. Es hat sie schon genug getroffen, dass Hagen fortgegangen ist. Sie möchte nun nicht auch noch auf dich verzichten. Aber es ist das Beste.«
Johanna lächelte traurig, und Frieder musste erneut an den Moment denken, da der Ritter Hagen aller Welt von der Liebe zwischen ihm, Frieder von Greifenberg, und der anmutigen Francesca erzählt hatte. Ausgerechnet als diese im Begriff gewesen war, seinen älteren Bruder Wolf zu heiraten. Anschließend hatte der Ritter die Burg und Eleonore verlassen, weil er das Leid sah, das er mit diesem Geständnis angerichtet hatte. Die Erinnerung daran verursachte Frieder einen stechenden Schmerz in der Brust, und er drückte Johanna fest an sich.
»Danke, kleine Schwester.«
Er küsste sie auf die Stirn. »Werde glücklich mit Lorenzo.«
Sie nickte stumm, während Frieder ohne ein weiteres Wort den Raum verließ. Draußen auf dem Gang, direkt an einem der hohen schmalen Fenster, saß Ramiro Esteban. Respektvoll erhob er sich.
»Hab immer ein Auge auf sie«, sagte Frieder.
»Jawohl, Herr Graf.«
»Und, Ramiro ...«
»Herr Graf?«
»Wenn ihr etwas zustößt und du hast es nicht verhindern können, dann töte ich dich. Hast du verstanden?«
Der Diener sah Frieder unverwandt an, dann nickte er langsam.
»Sie ist die Frau meines Herrn und damit meine Herrin. Ihr wird nichts geschehen, Herr Graf.«
»Gebe Gott, dass du recht behältst.«
Entschlossen wandte Frieder sich um und schritt davon.
Eleonore kam allein.
Denn das, was sie ihrem Sohn Frieder sagen wollte, wollte sie ihm mitteilen, wenn niemand dabei war. Francesca wäre gern mitgekommen, aber Eleonore hatte der jungen Frau geraten, Wolfs Zorn auf Frieder lieber nicht noch weiter anzufachen. Sie befahl dem jungen Mädchen, sich ihrem Ehemann zu fügen, auch wenn sie sah, dass es Francesca schier das Herz brach. Großer Gott, dachte Eleonore zum wiederholten Mal, diese Hochzeit hatte wirklich unter keinem guten Stern gestanden! Einzig Johanna und Lorenzo schienen glücklich zu sein. Ihre jüngste Tochter wollte an diesem Tag noch die Burg verlassen. Genau wie die meisten Gäste, die nun keinen Grund mehr sahen, ihren Aufenthalt länger auszudehnen.
Und immer wieder musste Eleonore an Hagen denken. Wo, um alles in der Welt, war er abgeblieben? Seit der grotesken Zeremonie in der Burgkapelle war er fortgeritten und nicht wieder heimgekehrt. Sie war ihm ja gar nicht böse, denn sie wusste, wie stark er sich an sein Ehrgefühl als Ritter gebunden fühlte. Er hatte sich der Wahrheit verpflichtet, und zu lügen kam für ihn nicht infrage. Sie hatte durchaus Verständnis für ihn und wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder Ordnung in ihre Gedanken und ihr Leben zu bringen. Und dafür wäre ein Gespräch mit Hagen ein guter Anfang gewesen. Ihm zu sagen, dass sie ihm für seine Worte in der Kirche nicht böse war. Und dass sie ihn liebte. Sie hob den Kopf und straffte ihre Schultern. Sie fand Frieder im Stall, wo er mithilfe zweier Knechte ein paar seiner Habseligkeiten auf ein Packpferd lud und am Sattel festband. Als die Knechte die Burgherrin erblickten, beugten sie höflich die Köpfe, blieben dann aber unschlüssig stehen. Sollten sie bleiben und warten oder besser gehen? Das Drama in der Burgkapelle hatten alle mitbekommen. Es würde nicht lange dauern, und zwischen Bozen und Meran, ja, bis zu den lombardischen Städten, würde man sich die tragische Liebesgeschichte des jungen Grafen und der reizenden Contessa erzählen, die nicht den Mann ihres Herzens, sondern seinen Bruder Wolf, den Greifen, geheiratet hatte.
»Lasst uns allein«, sagte Eleonore.
Die Knechte verbeugten sich eilig noch einmal, bevor sie verschwanden. Frieder tat so, als wäre seine Mutter gar nicht da, und bemühte sich, den Packsattel auf dem Pferderücken nicht zu fest zu schnüren. Er würde etwas länger als gewöhnlich unterwegs sein und musste dabei auf sein Reitpferd genauso achten wie auf das Packtier, das neben seinen Kleidern und einer warmen Decke auch noch genügend Verpflegung, zwei prall gefüllte Wassersäcke und seine Waffen samt der Rüstung trug.
»Nimmst du auch die Lanze mit?«, fragte Eleonore zaghaft.
Frieder wandte sich um.
»Sie gehört zu den Waffen eines Ritters.«
Eleonore nickte stumm.
»Dann bist du also nicht mehr länger Hagens Bursche?«, erkundigte sie sich dann.
»Nein. Er hat mich aus seinen Diensten entlassen.«
Bei diesen Worten lächelte er kurz. »Aber nicht im Unfrieden.«
Eleonore legte ihrem Sohn die Hand auf den Arm.
»Was hat er gesagt?«
»Er kann über mich als Burschen nichts Schlechtes sagen. Und er hat mir Glück gewünscht.«
Eleonore sah zu, wie er einen seidenen Schal sorgsam zusammenfaltete und dann in der Satteltasche seines Reitpferdes verstaute. Sie wusste, dass er Francesca gehörte.
»Sie wird nicht mit dir kommen, mein Sohn.«
Eleonore hauchte die Worte nur, aber Frieder verstand sie trotzdem. Er nickte hastig. »Ja, ich weiß.«
»Ihr Vater ist noch in derselben Nacht aufgebrochen. Es war gut, dass ihr beide euch nicht mehr begegnet seid.«
Frieder lachte bitter. »Warum? Hast du einen Kampf zwischen uns befürchtet?«
Er wandte sich zu ihr um.
»Darauf kommt es mir auch nicht mehr an, weißt du. Wenn er einen Schwertgang will, ich bin bereit.«
Seine Hand fuhr über den Schild, der am Sattel hing.
»Lass gut sein, Frieder. Die bösen Worte, die gefallen sind, waren schlimm genug.«
Frieder sah seine Mutter eindringlich an.
»Ich werde Francesca nicht aufgeben«, sagte er dann.
Eleonore schluckte.
»Hörst du, Mutter, was ich sage? Ich werde sie nicht aufgeben. Niemals.«
»Frieder, sie ist jetzt Wolfs Ehefrau.«
Nach Eleonores Worten wandte sich Frieder wieder dem Sattel zu. Verbissen zurrte er seinen Helm daran fest.
»Du begehst erneutes Unrecht, wenn du um die Ehefrau eines Ritters buhlst«, fügte Eleonore gefasst hinzu. »Und erst recht um die Frau deines eigenen Bruders.«
»Ich habe keinen Bruder mehr.«
»Frieder ...«
Eleonore hob die Hand und wollte ihn berühren, doch er schob ihre Hand ganz sanft zur Seite.
»Sei unbesorgt, Mama. Ich werde nicht noch mehr Unheil über Greifenberg bringen. Nein, ich tue jetzt das, was du dir wünschst.«
Sie blickte ihn fragend an.
»Ich gehe fort«, erklärte Frieder, »das ist es doch, was du willst, hab ich recht?«
Sie sah ihn unverwandt an. Dann nickte sie langsam.
»Ja«, sagte sie nur.
Frieder seufzte schwer. »Ist Wolf noch immer so voller Zorn?«
»Ja. Aber du kennst ihn ja. Irgendwann wird er sich wieder beruhigen und dann ...«
»Ich weiß, Mutter. Aber das kann dauern.«
»Frieder ...«
Er schüttelte den Kopf.
»Mach dir keine Sorgen. Warum auch? Vater war ein fahrender Ritter, und das werde ich nun auch sein. Ich gehe erst einmal nach Weil. Und wenn Urs mich nicht länger bei sich haben mag, dann gibt es genug neue Herren, die Adelige wie mich als Söldner beschäftigen.«
Er lachte bitter. »Wusstest du, dass ich meinem Stand entsprechend sogar berittene Männer anführen dürfte?«
»Vater wollte, dass du an einen fürstlichen Hof gehst und dort die Kunst der Diplomatie erlernst.«
»Ich weiß. Aber die Zeit wird alles bringen.«
»Frieder!«
Eleonore kämpfte jetzt mit sich und konnte nicht verhindern, dass ihr Tränen übers Gesicht liefen. Sie nahm ihren Sohn heftig in die Arme und drückte ihn so innig wie lange nicht mehr. Frieder ließ es sich zuerst nur regungslos gefallen, bis auch er seine Mutter fest umfasste. So standen sie beide da, und Frieder hörte Eleonores leises Schluchzen. Behutsam machte er sich von ihr los.
»Jetzt sag mir Lebewohl, Mutter. Und wünsch mir Glück.«
Sie nickte stumm, denn zu sprechen war ihr im Moment nicht möglich. Frieder küsste sie erst auf den Mund und dann ihre Augenlider. Anschließend zog er die beiden Pferde am Zügel hinter sich hinaus in den Hof. Dort, neben der großen Tränke, stand Michel.
»Kann ich mit Euch kommen, Herr Graf?«
»Wie redest du denn mit mir? Herr Graf! Hast du etwa meinen Namen vergessen?«
»Nein, Herr, verzeiht mir, Herr ... Frieder.«
Als der Graf zufrieden nickte, hob Michel zaghaft die Hände. Dann fassten sich die beiden jungen Männer gegenseitig an den Schultern.
»Hab ein wachsames Auge auf die Herrin«, raunte Frieder Michel zu.
»Das werde ich. Versprochen.«
»Und auf Hagen, wenn er denn je wieder heimkommt.«
Michel nickte nur, und Frieder sah, dass der Junge mit den Tränen kämpfte. Er beneidete ihn für einen Augenblick darum, denn er selbst konnte nicht weinen. Michel warf einen Blick auf das Packpferd.
»Deine Lanze«, sagte er dann.
»Ja, richtig. Die brauch ich noch«, antwortete Frieder.
»Darf ich sie dir holen?«
»Ja, mein Freund. Ich bitte dich darum.«
Michel lächelte traurig. Er nahm die Lanze, die von den Knechten an die Stallwand gelehnt worden war, und trug sie zu Frieders Packpferd. Dort befestigte er sie sorgfältig und prüfte, ob sie das Pferd bei seinem Marsch nicht behinderte.
»Gott schütze dich, Frieder.«
»Gott schütze auch dich, Michel.«
Frieder stieg in den Sattel. »Keine Sorge, wir sehen uns wieder.«
»Ja, hoffentlich«, antwortete Michel.
Frieder nickte ihm noch einmal zu und lenkte dann sein Pferd über den sonst menschenleeren Burghof. Am Tor wandte er sich ein letztes Mal im Sattel um und sah, dass Michel ihm winkte. Frieder winkte zurück. Sein Blick strich noch einmal suchend über sein Elternhaus, wo sich jedoch niemand zeigte.
»Mein Bruder ist fort, sagst du?«
»Ja, Herr.«
»Wohin?«
»Niemand weiß es, Herr. Er ist fortgeritten, schon vor Tagen.«
»Was denn? Und ich erfahre erst jetzt davon?«
Der Diener zuckte ratlos mit den Schultern.
»Sucht ihn und bringt ihn zurück!«, befahl Wolf.
»Herr ...?«
»Ich bezahle jedem Mann zwanzig Gulden in Gold, der mir meinen Bruder wieder herbeischafft. Verstanden?«
»Ja, Herr Graf.«
»Du kannst gehen.«
»Ja, Herr Graf.«
Kaum war der Diener fort, betastete der Mann in dem langen schwarzen Gewand wieder Wolfs bloßen Arm.
»Das Glück war wirklich mit Euch, verehrter Herr Graf«, sagte der Medicus.
Er tastete nun vorsichtig über Wolfs Brust. Dann legte er den Kopf nahe an sein Herz und lauschte mit angehaltenem Atem. Sichtlich zufrieden richtete sich der Arzt anschließend wieder auf.
»Ihr macht sehr gute Fortschritte, was Eure Genesung betrifft.«
»Und Ihr habt bestimmt keinen gebrochenen Knochen feststellen können?«
»Nein, mein Herr.«
Wolf sog die Luft ein.
»Warum schmerzen mir dann noch immer alle Rippen? Und die Glieder nicht weniger?«
»Nun, Ihr habt Euch den ganzen Leib ordentlich gestoßen, als Ihr aus dem Sattel gestürzt seid. Wir Ärzte nennen dies eine Prellung des Fleisches. Dabei gerät das Blut von einem Moment auf den anderen ganz schnell in Wallung, und es wird heiß. Ja, sehr heiß sogar. So sehr, dass es Euch im Inneren schier alle Knochen verbrüht. Dazu sind auch noch das Fleisch und alle Muskeln und Sehnen von dem Sturz gequetscht worden. Als ob ihr für einen Moment unter einen Mühlstein geraten wärt.«
Wolf nickte nur zu der anschaulichen Beschreibung.
»Also ist das der Grund, warum mich jede Bewegung immer noch schmerzt, ja?«
Der Medicus nickte ebenfalls. »Ja, dies und das gestockte Blut überall in Eurem Körper, edler Herr. Aber mit etwas Geduld wird das alles nach und nach vergehen. Bis Ihr wieder ganz gesund seid.«
Wolf schwieg. Er war froh, dass er sich nichts gebrochen hatte. Und noch mehr freute es ihn, dass die Schmerzen tatsächlich spürbar nachließen. Denn wie ein alter Mann immer auf einen Stock gestützt herumzuhinken, empfand er als lästig und lächerlich zugleich.
»Ihr habt Eure Sache gut gemacht«, sagte er dann weniger unwirsch als zuvor.
»Ich danke Euch, Herr Graf«, antwortete der Arzt.
»Und ich weiß Eure Hilfe zu schätzen.«
Wolf lächelte anerkennend, und der Arzt senkte höflich den Kopf.
»Deshalb wäre es mir recht, wenn Ihr als mein Arzt bleiben könntet«, fuhr Wolf fort.
Der Medicus zog überrascht beide Augenbrauen in die Höhe.
»Ihr meint als Medicus des Hauses Greifenberg?«
»Besser hätte ich es nicht sagen können.«
»Das ehrt mich, mein Herr, das ehrt mich sehr, aber ...«
»Aber was?«
Der Arzt lächelte. »Ich bin Wiedemund von Rothenfels und rettete einst dem Herrn Oswald von Wolkenstein das Augenlicht.«
Wolf hatte von dem einäugigen Minnesänger gehört. Er war wegen seiner großen Sangeskunst weithin bekannt.
»Und der Ritter Gotthart von Kaltern verdankt mir sein rechtes Bein.«
»Ich kenne diese beiden Männer«, sagte Wolf, »aber ich verstehe nicht, was Ihr mir sagen wollt.«
»Nun, bei diesen Herren habe ich ein gutes Auskommen und ...«
»Das hättet Ihr hier bei mir auch«, unterbrach ihn Wolf.
Der Medicus lächelte entschuldigend. »Gewiss, Herr Graf. Das ehrt mich auch sehr, aber Ihr müsst wissen, dass der Kardinal von Bozen und Florenz mir ein ähnliches Angebot gemacht hat.«
»Sieh an, der Kardinal persönlich, ja?«
»Ja, edler Herr.«
»Und? Habt Ihr angenommen?«
Der Medicus lachte. »Nun, ich überlege noch. Obwohl das Salär wirklich großzügig ist. Als ein erstes Angebot, wenn Ihr versteht, was ich damit sagen will.«
Wolf nickte. Diesem Mann war bewusst, was für ein guter Arzt er war, und so war ihm auch klar, was seine Dienste wert waren. Wolf überlegte nur kurz.
»Ich bezahle Euch das Doppelte von dem, was Euch der Bischof von Florenz geboten hat«, sagte er schließlich.
Die erneute Überraschung im Gesicht des Medicus zeigte Wolf, dass das Angebot des Kardinals tatsächlich großzügig gewesen sein musste. Doch noch etwas erkannte Wolf darin: die Gier des Mannes vor ihm. Aber er war sich auch sicher, dass der Mann nun gar nicht mehr anders konnte, als ihm zuzusagen.
»Erlaubt mir, dass ich über Euer großzügiges Angebot nachdenke«, antwortete der Medicus.
Nun war es an Wolf, überrascht zu sein. Er bemühte sich, es sich nicht anmerken zu lassen. Sanft lächelnd beugt er den Kopf.
»Nachdenken, ja? Natürlich, lieber Freund, natürlich. So was bricht man nicht übers Knie, nicht wahr?«
»Ganz recht, mein lieber Herr.«
Der Medicus legte seine Gerätschaften zurück in den hölzernen Kasten, in dem er sie aufbewahrte, und nahm diesen dann lächelnd unter den Arm. Nachdem er sich noch einmal verbeugt hatte, verließ er schließlich den Raum. Und in dem Moment, als die Tür leise ins Schloss fiel, waren Wolfs Gedanken schon wieder woanders.
Auf dem Hof von Burg Weil trafen unentwegt Reiter ein. Ritter und Patrizier mit ihren Knechten und Dienstboten, die von Willkommensrufen und emsiger Geschäftigkeit begleitet wurden. Die Edelleute wie die Abgeordneten der Städte wurden allesamt von Wittek oder Urs persönlich, oft sogar von beiden zusammen begrüßt und dann in den großen Saal der Burg geleitet. Fast zwei Tage lang ging das schon so, und Friederike hatte bisher noch nicht in Erfahrung bringen können, was die Männer herführte. Ihren Ehemann Urs danach zu fragen, wagte sie nicht. Nach der missglückten Hochzeitsnacht waren sie nicht mehr allein miteinander gewesen. Daher hatte Friederike ihre Hofdame und Freundin Lisbeth ausgehorcht, doch die war allen Fragen geschickt ausgewichen. Also nahm sich Friederike vor, sich bei nächster Gelegenheit ein Herz zu fassen und doch mit Urs darüber zu sprechen. Seit der Hochzeit hatte sie keine Nacht mehr zusammen mit ihrem frischgebackenen Ehemann verbracht. Und dass die Ehe zwischen den beiden noch immer nicht vollzogen worden war, galt als offenes Geheimnis auf der Burg, über das jedoch niemand ein Wort verlor. Der Respekt vor dem Baron war groß und sicher der Grund für die allgemeine Zurückhaltung.
Urs hatte verfügt, dass Friederike wie in der Zeit als angehende Braut die kleine gemütliche Kammer mit dem Bett seines Vorfahren bewohnen durfte. Und nach wie vor war Friederikes Zofe Lisbeth dafür zuständig, in der Kammer für Ordnung zu sorgen.
So hatte die Freifrau und Gemahlin des Junkers Wittek an diesem Tag bereits geraume Zeit darauf verwandt, Friederikes Wäsche zu ordnen und mit Nadel und Faden einige Nähte auszubessern. Nun überprüfte sie auch die Unterröcke und Leibhemden. Die Wäsche war Teil der Aussteuer der jungen Baronin, und Lisbeth verstaute alles, was nicht noch geplättet und gedämpft werden musste, in einer großen hölzernen Truhe. Dabei bemerkte sie gar nicht, dass Friederike schon eine ganze Zeit lang in der Tür stand und sie beobachtete.
»Das musst du doch nicht tun.«
Lisbeth fuhr erschrocken herum. »Gott sei bei mir! Habt Ihr mich erschreckt, edle Frau.«
Friederike lächelte amüsiert. »Wie nennst du mich auf einmal?«
»Nun, Ihr seid doch jetzt die Herrin auf Burg Weil. Da werde ich es an Respekt nicht fehlen lassen.«
»Ach, Lisbeth«, seufzte Friederike und ließ sich auf das Bett sinken.
Sie zog beide Schuhe aus und massierte sich die Füße.
»Ich bin sicherlich zu lange damit herumgelaufen! Jetzt sind meine Füße ganz dick. Oder die Schuhe sind geschrumpft.«
Lisbeth aber lächelte höflich. Friederike bemerkte sehr wohl, dass ihre Freundin sich seltsam benahm.
»Aber ich bin ja selbst schuld«, fuhr sie fort. »Der Schuhmacher hat mich gewarnt. Neue Schuhe sollte man niemals einen ganzen Tag lang tragen, hat er gesagt. Aber ich finde sie einfach zu schön und ... Na ja, das hab ich nun von meiner Eitelkeit.«
»Eitelkeit ist eine Sünde«, bemerkte Lisbeth nur und widmete sich weiterhin der Wäsche.
Friederike sah ihr dabei zu.
»Da hast du recht«, sagte sie dann. »Und wenn wir schon mal dabei sind: Welche Sünden begehe ich in deinen Augen noch?«
Lisbeth zuckte mit den Schultern. »Das war einfach nur so dahergesagt, edle Frau. Bitte verzeiht mir.«
Friederike sah Lisbeth erneut eine ganze Weile lang bei der Arbeit zu. Dann fragte sie leise. »Ist es, weil ich mit meinem Ehemann nicht das Bett teile, ja?«
»Das geht mich nichts an«, antwortete Lisbeth schnell.
Sie nahm einen weiteren Wäschestapel aus einem großen Weidenkorb und legte ihn behutsam in die große Truhe. Sorgfältig strich sie das oberste Kleidungsstück glatt.
»Lisbeth, als deine Freundin bitte ich dich, mir zu sagen, was du darüber denkst.«
Die Freifrau schwieg und schien nur Augen für die Wäsche in der großen Truhe zu haben.
»Nun zier dich nicht länger, sondern sag was«, drängte Friederike.
Lisbeth schloss behutsam den Deckel der Kleidertruhe und blickte dann erst Friederike an. »Urs ist ein guter Mann.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich weiß es, glaubt mir. Mein Ehemann dient ihm und kennt ihn schon lange. Wittek sagt, dass die Aufrichtigkeit des Barons noch edler ist als seine Gesinnung.«
»Was für schöne Worte dein Ehemann über meinen Ehemann zu sagen weiß.«
»Du solltest nicht spotten, Friederike!«
Die Baronin von Weil lachte. »Ach, auf einmal bin ich keine ›edle Frau‹ mehr, ja?«
»Verzeiht mir, Herrin.«
»Lisbeth, lass endlich dieses Gerede. Ich habe einen Namen, wie du weißt. Und den trage ich auch weiterhin, selbst wenn ich inzwischen geheiratet habe. Ich will, dass du mich als deine Freundin bei meinem Namen nennst. Und nicht ›Herrin‹ oder ›edle Frau‹.«
Lisbeth nickte stumm. Friederike seufzte tief und streckte ihre Zehen.
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte sie nach einer Weile. »Aber auch wenn ich nun die Ehefrau des Barons von Weil bin. Ich liebe ihn nicht.«
»Das verlangt auch niemand.«
Lisbeths Antwort klang schroff. Friederike blickte die Freundin an.
»Na ja, wenn du das sagst. Aber bei dir ist es anders. Hab ich recht?«
»Ja«, sagte Lisbeth, ohne zu zögern. »Es ist anders.«
Friederike legte den Kopf in den Nacken, betrachtete die Zimmerdecke und sah dann die Freundin aufmerksam an.
»Was immer diese wahrhaftige Liebe ist, ich habe sie mir auch gewünscht. Ja, eine große, tiefe und bedingungslose Liebe für einen anderen Menschen. Aber so habe ich noch nie empfunden, verstehst du mich? Auch nicht bei Urs, sosehr ich mich auch bemühe.«
»Warum?«, fragte Lisbeth und sah die junge Baronin auf einmal ruhig an. »Weil du dich noch immer vor ihm ekelst?«
Friederike streckte erneut ihre langen, schlanken Beine weit von sich und bewegte die Zehen. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Ich ekle mich nicht vor ihm. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich mag ihn. Ja, ich mag ihn sogar sehr. Er ist wirklich so, wie du immer gesagt hast. Klug und verständig. Mit ihm kann man lachen und reden. Sein Herz ist größer als das jedes anderen Menschen, den ich jemals getroffen habe. Ich weiß, dass ich undankbar erscheine, denn bestimmt gibt es zahlreiche Frauen, die einen solchen Mann, ohne zu zögern, heiraten würden. Aber bei mir ist es nicht so wie bei dir mit Wittek. Oder bei meiner Schwester Johanna und ihrem Mann. Oder gar wie bei meiner Mutter.«
Die letzten Worte hatte sie leise ausgesprochen. Lisbeth ließ sich neben ihrer Freundin auf dem Bett nieder und nahm ihre Hände. »Natürlich ist es bei dir anders. Liebe ist immer einzigartig. Das weißt du auch. Und du wirst die wahre Liebe erkennen, wenn es so weit ist.«
Friederike nickte nur. Da vernahmen sie ein Räuspern hinter sich. Sie wandten sich um und erblickten Urs, der in der Tür stand und sie ansah.
»Die Tür stand offen und ...«
Er hob erklärend die Hand und ließ sie dann wieder sinken. Lisbeth war aufgesprungen und beugte respektvoll den Kopf. Friederike dachte daran, wie lange ihr Mann wohl schon dort gestanden und ob er alles mit angehört hatte.
»Mein Gemahl«, begann sie dann, »Ihr braucht Euch doch nicht anzukündigen ...«
»Es ist Eure Schlafkammer«, bemerkte Urs, als müsse er sich rechtfertigen.
Friederike betrachtete ihn. Urs trug die üblichen hautengen strumpfähnlichen Beinkleider aus schwarzer Seide, darüber ein feines Gewand aus Samt, das seinen Stand als Ritter deutlich machte und ihn als Mann mit Geschmack auswies. Er hatte kein Schwert bei sich, trug jedoch einen Umhang, dessen Ende er nach römischer Art über den Arm gelegt hatte. Er trat näher, und mit einem höflichen Kopfnicken in Lisbeths Richtung deutete er an, dass er es schätzte, sie zu sehen. Die Freifrau raffte eilig ihr Kleid.
»Mir fällt ein, ich habe noch so viel zu tun, edler Herr.«
Sie sah auf Friederike. »Wenn Ihr es wünscht, dann komme ich später wieder her und ...«
»Schon gut, Lisbeth. Geh nur.«
»Danke, Herrin, … nein, liebe Freundin.«
Sie huschte hinaus und schloss die Tür der Kammer hinter sich. Urs sah ihr wie in Gedanken nach. Als er sich wieder zu Friederike umdrehte, hatte die sich von ihrem Platz erhoben, und Urs fiel auf, dass sie barfuß vor ihm stand.
»Behaltet doch Platz«, bat er höflich.
»Ihr seid genauso förmlich wie Lisbeth«, begann Friederike.
Er lächelte kaum merklich. »Nun, der Verbindung zwischen uns beiden angemessen, würde ich sagen.«
»Es tut mir leid.«
»Was tut Euch leid?«
»Alles. Diese Verbindung zwischen uns beiden, wie Ihr eben sagtet. Dass es so ist, wie es ist. Und nicht mehr. Genau das tut mir leid.«
»Aber das muss es nicht.«
Friederike sah ihn fragend an.
»Unsere Ehe ist eine reine Zweckehe«, erklärte Urs in ruhigem Ton. »Nur ich, … ich habe das nicht ausreichend bedacht. Meine Gefühle für Euch sind der Grund gewesen, warum ich Euch so bedrängt habe.«
»Aber das habt Ihr nicht, mein Gemahl, es ist nur ...«
»Nein, nein«, sagte er und hob beschwichtigend die Hand, »lasst nur. Ich war zu leidenschaftlich, und das muss Euch Angst gemacht haben. Und das tut mir leid. Sehr leid, ja. Das könnt Ihr mir glauben.«
Er lächelte entschuldigend und seufzte dann tief.
»Aber wenn man das Glück hat, die schönste Frau weit und breit ehelichen zu dürfen, dann ist es schwer, die Fleischeslust zu bezwingen, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
Friederike senkte den Kopf. So offen hatten sie noch nie miteinander gesprochen. Sie schwiegen beide, bis Urs als Erster wieder das Wort ergriff und weitersprach.
»Friederike, wir werden unsere Verbindung so fortführen wie vor unserer Hochzeit. Wir leiten das Lehen fortan gemeinsam, denn ich wünsche mir sehr, dass Ihr mir dabei mit Rat und Tat zur Seite steht. Als Vertraute. Und Gefährtin, wenn Ihr so wollt.«
»Ich verstehe nicht ...«
»Ich habe große Pläne. Aber das wisst Ihr ja längst. Und um sie umzusetzen, brauche ich Euch. Ich denke dabei nicht nur an uns, sondern auch an die Zukunft.«
Friederike lächelte traurig. »Zukunft? Das wären unsere Nachkommen. Glaubt Ihr, dass es je Nachkommen geben wird?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Urs hastig. »Ich wünschte es mir, aber ich werde Euch nicht drängen, sondern warten, bis ...«
Er schüttelte heftig den Kopf.
»Ich weiß selbst nicht, was ich will«, sagte er schließlich leise.
Auf einmal stand eine seltsame Verlegenheit zwischen ihnen. Urs straffte die Brust.
»Heute Morgen sind Patrizier aus Padua und Brescia eingetroffen. Verona und Siena wollen ebenfalls Abgeordnete senden. Sogar die Florentiner haben sich angesagt.«
Sie hob den Kopf. Erfuhr sie nun endlich, was der Grund für das Eintreffen der vielen Gäste auf der Burg war?
»Was wollen sie alle hier?«, fragte sie.
Urs ordnete sorgfältig die Falten seines Umhangs, den er noch immer über dem Arm trug.
»Meinen Beistand«, antwortete er ihr dann.
»In welcher Sache?«
»Sie planen einen Krieg.«
»Um Christi willen, gegen wen denn?«
»Gegen Euren Bruder Wolf.«
Friederike nahm erschrocken beide Hände vor den Mund. Urs’ Miene blieb ernst.
»Ja, das ist der Grund, warum sie alle hier sind«, sagte er ruhig.
Er sah sich in der Kammer um, um dann wieder Friederike anzublicken.
»Versteht Ihr jetzt, wie sehr ich Euch brauche? Ein Krieg würde alle meine Pläne für dieses Land zunichtemachen. Dafür brauche ich Frieden. Für uns beide und für die Menschen hier.«
»Ich verstehe Euch, mein Gemahl«, sagte Friederike, »aber vergesst nicht, dass ich eine Frau bin.«
Er trat noch einen kleinen Schritt näher. »Nicht eine Frau, sondern meine Frau. Der ich vertraue und deren Rat ich schätze.«
Sie blickten sich in die Augen.
»Was Ihr da sagt, ehrt mich sehr«, begann Friederike, »und wenn es Euch hilft, will ich Euch unterstützen und ...«
»Friederike!«
Er nahm ihre Hand. Sie wollte sie zurückziehen, unterließ es jedoch.
»Noch einmal bitte ich Euch um Eure Geduld, mein Gemahl. Ich will mir redlich Mühe geben und ...«
Urs nickte hastig. »Nein, bitte, es ist gut. Sagt nichts mehr, denn ich verstehe Euch.«
Friederike hob die Hand und streichelte seine Wange. Als sie dabei die Narbe über seinem zerstörten Auge berührte, zuckte Urs kurz zusammen. Dann nahm er ihre Hand und küsste sie innig.
»Bleibt bei mir, Baronin von Weil. Wenn nicht in meinem Herzen, dann wenigstens an meiner Seite.«
Sie nickte stumm. Dann bückte sie sich und griff nach ihren Schuhen.
»Lasst mich Euch helfen«, sagte er, und bevor sie etwas erwidern konnte, kniete er bereits vor ihr nieder und half ihr in die Schuhe.
Friederike ließ es mit sich geschehen und legte dabei eine Hand auf seine Schulter, um sich daran festzuhalten. Als sie kurz zusammenzuckte, sah er auf.
»Hab ich Euch wehgetan?«
»Nein. Es sind nur die Schuhe. Sie sind neu und ein wenig zu eng.«
Urs sah sich in der Kammer um. »Ihr solltet andere anziehen.«
»Nein, Urs, erst gehen wir und verhindern den Krieg.«
Er nickte. Dann erhob er sich und zog sie galant an der Hand zu sich, bevor er sie hinausführte.
Der Bratengeruch vermochte Hagen in seiner Schwermut nicht zu trösten, aber er beruhigte zumindest seinen knurrenden Magen. Auf das Abendessen freute er sich, denn er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal eine warme Mahlzeit genossen hatte. Genauso wenig wie er zu sagen wusste, wo er sich befand. Seit seinem Aufbruch von Greifenberg vor über einer Woche hatte er seinem Hengst die Zügel überlassen. Er führte das Leben eines Vagabunden. Mehr als einmal hatte er den Ehrbegriff des Ritters, der so viel Leid hervorgerufen hatte, verwünscht. Am schlimmsten jedoch war für ihn, dass er Eleonore verloren hatte. Denn dass dem so war, daran zweifelte der Ritter Hagen vom Wald keinen Augenblick. Ja, doch, er hatte sie verloren, und das wohl für immer.
Selbstmitleid war ihm stets fremd gewesen, doch die immer wiederkehrenden Gedanken an die zurückliegende Zeit mit ihr ließen ihn fast verrückt werden. Er liebte sie, und das sollte nun vorbei sein? Einfach so? Der Gedanke daran zerriss ihm das Herz in der Brust. Er hätte viel darum gegeben, weinen zu können. Weil er glaubte, dass dies die schwere Last ein wenig mildern würde. Aber es gelang ihm nicht. Das letzte Mal geweint hatte er, als sein Herr und bester Freund Wolfram von Greifenberg gestorben war.
Nun saß er hier an einem kleinen Feuer unter einer mächtigen Eiche und starrte auf ein beinahe gares Rebhuhn auf dem Spieß. Heftig schüttelte er den Kopf. Nein, wenn er schon nicht sein Herzeleid stillen konnte, dann wenigstens seinen Hunger. Er zog sein Messer und hielt den Braten mit spitzen Fingern fest, um dann ein klein wenig in das Fleisch zu schneiden. Bratensaft tropfte zischend in die Flammen, und es roch verführerisch. Das Fleisch schien gar zu sein. Hagen wischte das Messer auf dem moosbedeckten Boden sauber. Etwas zu trinken wäre jetzt ganz recht, dachte er. Seit er aus Greifenberg fortgeritten war, verspürte er unentwegt Durst. Nach seinem Aufbruch war er wie der Teufel geritten, und erst als das Tier unter ihm vor lauter Anstrengung zusammenzubrechen drohte, war ihm bewusst geworden, dass er in seinem Schmerz nicht einmal auf die unschuldige Kreatur Rücksicht nahm. Da hatte er angehalten, das Pferd sich selbst überlassen und sich betrunken, bis er eingeschlafen war. Erwacht war er erst wieder, als ihn der Hengst neugierig beschnupperte. Das brave Tier hatte sich sein Futter selbst gesucht und war dann bei ihm geblieben, geduldig wartend, bis Hagen mit schwerem Kopf aufgestanden war und sich dann in den Sattel hinaufgezogen hatte. Am Abend wollte er sich erneut betrinken, doch sein Vorrat an Branntwein war aufgebraucht gewesen. Seitdem war er nicht einmal in die Nähe irgendeiner Ansiedlung gekommen, wo es vielleicht Nachschub gegeben hätte.
Hagen rieb sich die Hände. Es war schon empfindlich kalt am Abend, und als er sich nach seinem Pferd umsah, sah er das treue Tier wenige Schritte von ihm entfernt ruhig grasen. Er griff nach seinem Wasserbeutel, trank in langen Zügen, nahm dann den Spieß mitsamt dem Braten vom Feuer und biss hinein. Das Fleisch war saftig, wenn auch recht heiß. Aber das war ihm nur recht, denn es wärmte ihm den Magen. Es war ihm gelungen, gleich zwei Vögel zu erlegen, und er war dankbar dafür, dass er den Jagdbogen bei sich hatte. Ursprünglich hatte er ihn gar nicht mitnehmen wollen, weil er glaubte, er würde ihn beim Reiten nur behindern.
Plötzlich hörte der Hengst auf zu grasen.
Das Pferd hob den Kopf, verharrte still und blähte die Nüstern. So stand es eine Weile da, und nur das Spiel seiner Ohren verriet, dass es etwas gewittert hatte. Dann senkte es den Kopf wieder und graste weiter. Hagen war Krieger genug, um die Unruhe des Pferdes beurteilen zu können. Er kaute zu Ende und lauschte den Geräuschen des nächtlichen Waldes. Es war nichts zu hören, doch er vertraute seinem Gefühl und war sich auf einmal sicher, dass er nicht allein war. Er räusperte sich kurz und sprach dann laut und deutlich in den nächtlichen Wald.
»Sicher habt Ihr Hunger! Oder täusche ich mich etwa?«
Es folgte keine Antwort, und Hagen biss erneut in den Braten. Fett tropfte ihm von den Mundwinkeln, während er langsam kaute. Plötzlich warf der Hengst erneut den Kopf in die Höhe. Anschließend schnaubte er leise. Hagen legte sich das blanke Schwert in den Schoß.
»Ihr ziert Euch ohne Grund«, sagte er dann laut in die Dunkelheit hinein. »Euer Magenknurren kann ich bis hierher hören.«
Er warf einen abgenagten Knochen ins Feuer.
»Also, wenn Ihr nicht bald hervorkommt, esse ich den anderen Vogel auch noch. Dann hätte ich nur noch ein Stück Brot zu bieten. Nun kommt schon und esst mit mir.«
Es blieb weiterhin still. Hagen nagte den knusprigen Flügel ab, und während er kaute, sah er aus den Augenwinkeln auf einmal einen Mann langsam näher kommen. Er hielt ein blankes Schwert in der Hand, und Hagen blieb trotz der zur Schau gestellten Gelassenheit auf der Hut. Der Mann schien allein zu sein, sodass Hagen keine Furcht verspürte, wenn er auch nach wie vor wachsam blieb.
»So groß ist der Vogel leider nicht, dass Ihr ein Schwert bräuchtet, um Euch davon zu bedienen«, sagte er.
Der Mann trat in den Lichtschein des Feuers, und Hagen erkannte, dass der Unbekannte noch recht jung war. Zudem war er unglaublich schmutzig. Seine Kleidung mochte einmal elegant gewesen sein, jetzt aber hingen ihm die Beinkleider und das Wams nur noch in Fetzen am Leib. Wie sein Gewand waren auch die Reitstiefel über und über voll Schmutz, und an den Spitzen sahen die blanken Zehen hervor, allesamt schwarz. Das Gesicht des Mannes verschwand hinter einem dichten, verfilzten Bart, was die schlanke Gestalt im fahlen Licht des Feuers unheimlich erscheinen ließ. Hagen war nicht besonders abergläubisch. Trotzdem war er sich einen Augenblick lang nicht ganz sicher, ob da vor ihm nicht vielleicht ein Waldgeist stand. Er deutete auf das zweite Rebhuhn über dem Feuer.
»Seid mein Gast und esst.«
Der Mann nickte stumm und stieß das Schwert neben sich in die Erde. Langsam ließ er sich Hagen gegenüber am Feuer nieder, und die beiden Männer musterten sich gegenseitig. Hagen kam das Gesicht entfernt bekannt vor. Doch bei dem wilden Bart und dem langen zotteligen Haar konnte er sich auch täuschen. Der nächtliche Besucher ließ Hagen nicht aus den Augen, und erst als der Ritter erneut einladend auf das Fleisch deutete, begann der Mann hastig zu essen. Hagen lächelte. Er hatte sich also nicht getäuscht, der Hunger des Mannes war größer als sein Misstrauen. Wortlos sah der Ritter zu, wie der Unbekannte das Fleisch von den Knochen riss, hastig kaute, die Bissen hinunterschluckte, um dann erneut große Stücke abzubeißen.
»Erlaubt, dass ich mich vorstelle«, begann der Ritter höflich, »mein Name ist ...«
»Hagen«, antwortete der Unbekannte schnell.
Die Stimme klang rau in Hagens Ohren, aber irgendwie vertraut.
»Ihr seid der Junker vom Wald«, fügte der Unbekannte hinzu und kaute dann weiter.
Hagen schwieg überrascht und sah dem Mann beim Essen zu.
»Ihr kennt mich?«, fragte Hagen dann, noch immer verblüfft.
»Ja.«
Hagen bat nun den Fremden um seinen Namen.
»Lanfred Freiherr von Marbur.«
Nun hatte es Hagen endgültig die Sprache verschlagen. Wortlos sah er zu, wie der Mann den Rest des Bratens in kürzester Zeit verschlang und nur die Knochen übrig ließ.
»Wollt Ihr mir sagen, was Ihr hier macht?«, begann Hagen, nachdem er sich wieder gefasst hatte, höflich.
Lanfred wischte sich mit dem Ärmel über den fettglänzenden Mund. In seinen Augen glaubte Hagen tiefe Verzweiflung zu erkennen. Aber er konnte sich auch täuschen.
»Ich bin auf Reisen«, sagte Lanfred.
Hagen nickte. Dann deutete er mit der Hand auf den jungen Freiherrn. »Bitte verzeiht mir, aber ich hatte Euch eleganter in Erinnerung.«
Lanfred drehte seine pechschwarzen Hände hin und her, dann zuckte er mit den Schultern. »Ist mir nicht mehr wichtig. Nicht mehr wichtig, nein ...«
Wie in Gedanken schüttelte der Junker den Kopf.
»Ich sehe, Euch ist das Herz schwer«, begann Hagen ruhig, »aber, junger Freund ...«
»Ihr denkt wohl, weil Ihr mich zum Essen eingeladen habt, bin ich Euch nun meine Geschichte schuldig, ja?«, unterbrach ihn Lanfred schroff.
Hagen sah ihn an, dann schüttelte er den Kopf.
»Ihr schuldet mir nichts. Ich dachte nur, da wäre etwas, was man sich erzählen könnte.«
In dem Moment begann Lanfred tatsächlich zu reden. Er erzählte von seinem vergeblichen Werben um Friederike von Greifenberg. Bis er dann endlich eine Chance für sich gesehen hatte, als er sie zu ihrer bevorstehenden Hochzeit von Burg Weil nach Greifenberg zurückbegleiten sollte. Wie ihn in der großen Stallung auf einmal die Leidenschaft übermannt und er sie einfach geküsst hatte. Gegen ihren Willen. Er berichtete auch, dass er gedacht hatte, gegen ihren zukünftigen Ehemann Urs von Weil antreten zu müssen. Zu einem Kampf um ihre Ehre. Stattdessen hatte ihn jedoch ihr Bruder Wolf herausgefordert. Ausgerechnet Wolf, sein Freund, den er so sehr bewunderte. Lanfred erzählte, wie er den Kampf gegen ihn verloren und es nur Friederikes Gnade zu verdanken hatte, dass er noch am Leben war. Wie er dann mit Schimpf und Schande von der Burg gejagt worden war. Dass ihm aber auf der Flucht vor ein paar Bauern, die ihn als den einstigen Raubritter Lanfred erkannt hatten, beinahe ein tückisches Schlammloch zum Verhängnis geworden war, davon erzählte er Hagen nichts. Seine Geschichte endete damit, dass er seit seinem Fortgang von der Burg ziellos herumzog und die Menschen mied. Und dass ihm sein Pferd im Sturm davongelaufen und er seitdem zu Fuß unterwegs war. Am Ende schwieg er und starrte, die Arme um die Brust geschlungen, stumm in die Flammen.
»Und was habt Ihr nun vor?«, fragte Hagen behutsam.
»Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Ihr, mein Herr?«
Hagen sah Lanfred an. Er hatte keine große Lust, diesem Burschen jetzt auch noch seine Geschichte zu erzählen. Zumal er nicht ganz unschuldig an all dem Leid im Lehen war. Doch um den jungen Mann zur Rede zu stellen, war er einfach zu müde.
»Wir sollten versuchen, ein wenig zu schlafen«, schlug Hagen vor. »Morgen ist auch noch ein Tag.«
Lanfred nickte. Dann blickte er sich um.
»Was dagegen, wenn ich am Feuer bleibe?«, wollte er wissen.
Hagen schüttelte den Kopf und erhob sich. Wortlos griff er nach der Satteldecke und warf sie dem Junker zu. Lanfred fing sie geschickt auf und nickte dankbar. Hagen wickelte sich in seine Wolldecke, das Feuer im Blick, nicht ohne das Schwert mit unter die Decke zu nehmen. Als er noch einmal den Kopf hob, um nach dem Junker zu sehen, schien der bereits zu schlafen. Hagen rollte sich auf den Rücken, zog die Decke bis unters Kinn und sah in den nächtlichen Himmel hinauf.
»Eleonore, Liebste«, murmelte er leise vor sich hin, und nur einen Augenblick später war er eingeschlafen.
Von einem Moment auf den anderen war Hagen wach. Er hatte keine Ahnung, wie lange er geschlafen hatte, aber der Instinkt des erfahrenen Kriegers ließ ihn aufmerksam lauschen. Neben den Geräuschen der Nacht hörte er sein Pferd schnauben. Nun wieherte es leise, und Hagen richtete sich unter seiner Decke auf. Er tastete nach seinem Schwert und vertraute darauf, dass er notfalls aufspringen und das Schwert dabei mit nur einer oft geübten Bewegung ziehen konnte. Er warf einen kurzen Blick zu dem Junker hinüber. Der schien die Unruhe des Pferdes nicht bemerkt zu haben, denn er lag bewegungslos unter seiner Decke. Hagen sah erneut zu seinem Pferd, das nun an dem Seil zerrte, mit dem er es an den dicken Ast des Baumes gebunden hatte. Kein Zweifel, irgendjemand schlich um ihr Lager! Hagen musste an die Wölfe denken, die es hier sicher gab. Oder war es vielleicht nur ein neugieriger Fuchs? Behutsam schob er die Decke von sich und richtete sich langsam auf. Den Schatten neben sich bemerkte er zu spät. Es gelang ihm nur noch, sich blitzschnell zur Seite zu rollen. Das war sein Glück, denn so traf ihn der wuchtige Schlag nur seitlich am Kopf und streifte seine linke Schulter. Aber einen Schmerz spürte er nicht, denn ohne einen weiteren Gedanken versank auf einmal alles um ihn herum in tiefe Dunkelheit.
Die Versammlung der vielen Gäste hatte lange gedauert, und mit jeder Stunde mehr war sie ermüdender geworden.
Friederike hatte Mühe zu verstehen, was genau die Adeligen von ihrem Mann wollten. Es gab unterschiedliche Interessen, zum Beispiel wollten die Ritter nicht mit den Patriziern an einem Strang ziehen. Der Niederadel wiederum wehrte sich verbissen dagegen, in einem Krieg nur dienen zu müssen, ohne dafür angemessen entschädigt zu werden. Das Einzige, worin sich alle Parteien einig waren, war, welche Rolle Urs spielen sollte. Wenn jemand einen möglichen Feldzug führen sollte, dann der Baron von Weil. Auch wenn Urs dieses Vertrauen durchaus schmeichelte, wehrte er sich doch mit allen Kräften gegen den drohenden Konflikt. Immer wieder versuchte er den versammelten Männern zu vermitteln, dass er keinen triftigen Grund sah, gegen seinen eigenen Schwager und seine Schwiegermutter ins Feld zu ziehen. Er pochte auf eine diplomatische Lösung und verwies auf seinen Einfluss bei Hof. Der böhmisch-ungarische König würde bestimmt dazu beitragen können. Doch sowohl die Ritter als auch die Patrizier lehnten seine Bemühungen ab. Sie alle drängten darauf, Wolf mit Gewalt von seinem Lehen zu vertreiben.
Urs war längst klar, dass noch andere Interessen hinter diesen Forderungen stecken mussten. Dazu kam, dass die versammelten Männer keinerlei Scheu zeigten, ihre Forderungen im Beisein von Friederike zu stellen. Dies, obwohl sie genau wussten, dass Wolf ihr Bruder und die Gräfin Eleonore von Greifenberg ihre Mutter war. Inzwischen war es beinah Mitternacht, und alle Anwesenden waren müde. Daher widersprach niemand, als Urs eine Vertagung auf den nächsten Tag vorschlug. Der Reihe nach verabschiedeten sich die Edelleute, um sich in ihre Gemächer zurückzuziehen. Die große Anzahl an Gästen bedingte es, dass einige von ihnen in der nicht eben kleinen Burg des Barons in eilig aufgebauten Zelten auf dem Burghof nächtigen mussten.
Als der letzte Gast den Raum verlassen hatte, war neben dem Baron und seiner Ehefrau nur noch Wittek anwesend. Friederike wirkte noch wach und aufmerksam, und Urs wie auch Wittek bewunderten sie dafür.
»Ihr müsst müde sein, meine Liebe«, begann der Baron höflich, während er zusah, wie Wittek der Reihe nach die Öllichter an den Wänden löschte.
»Nicht mehr als Ihr auch, mein lieber Gemahl.«
Urs zuckte kaum merklich zusammen. „Mein lieber Gemahl!“ Daran musste er sich erst gewöhnen.
»Was kann ich noch für Euch tun, mein Freund?«, erkundigte sich Wittek.
»Nichts«, sagte Urs, »geh ins Bett.«
Wittek wollte protestieren, aber Urs schüttelte den Kopf.
»Du hast lang genug ausgehalten, alter Freund. Dafür danke ich dir. Aber jetzt geh in deine Kammer und freu dich auf süße Träume.«
»Das würde ich gerne tun, Urs, aber ...«
»Kein Aber, hörst du? Ins Bett mit dir, los doch!«
Die beiden Männer blickten sich an, und dann mussten sie beide lachen. Wittek verbeugte sich höflich vor Urs, danach auch vor Friederike.
»Eine angenehme Nacht, Euch, liebe Frau.«
Friederike dankte und sah Wittek nach, bis er die große Halle verlassen hatte. Nun waren sie allein, und sofort stand wieder jene eigenartige Verlegenheit zwischen ihnen.
»Ich habe Hunger«, sagte Urs auf einmal. »Und Ihr, meine Liebe?«
»Nein. Ich nicht. Außerdem spüre ich den Wein.«
Sie rieb sich die Schläfen.
»Möchtet Ihr mich vielleicht in die Küche begleiten?«, fragte Urs. »Da findet sich sicher etwas für mich und meinen hungrigen Magen. Und wenn Ihr mir zuseht, wie ich esse, bekommt Ihr am Ende vielleicht doch noch Appetit.«
Friederike zögerte nur einen kurzen Augenblick, dann nickte sie zustimmend. Sie hatte die Vorbereitungen für die vielen Gäste im Hause mit beaufsichtigt und neben dem Aufseher der Küche, dem Truchsess und dem Schenk, der für die Getränke zuständig war, in all dem Trubel noch selbst Hand angelegt.
Urs fühlte sich tatsächlich noch nicht müde. Sein Kopf schien ein wenig schwerer als sonst, was aber auch von dem lauten und angestrengten Reden kommen konnte. Er bot Friederike erneut galant den Arm, und sie hakte sich bei ihm unter. So schritten sie wortlos durch die nachtschlafende Burg. Die Stille in dem großen Haus war ungewohnt. In der Küche, die nur von einer Öllampe an der Wand spärlich beleuchtet wurde, konnte man sich kaum vorstellen, wie lebendig es hier tagsüber zuging.
»Worauf habt Ihr denn Appetit?«, fragte Friederike fürsorglich.
Beinahe hätte Urs geantwortet »Auf dich«. Aber er unterließ es. Er wollte die zarte Vertrautheit, die sich zwischen ihnen eingestellt hatte, nicht zerstören. Er dachte an die zahlreichen Ritter und Patrizier, die sich auf Weil eingefunden hatten. Die Situation erforderte großes diplomatisches Geschick, was für ihn nichts anderes bedeutete, als sich nach allen Regeln der Kunst zu verbiegen, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Auf einmal wünschte er sich, auf Frieders Unterstützung zählen zu können. Mit ihm hätte er eine Person an seiner Seite, die Wolf besser kannte als irgendjemand sonst. Und wenn er selbst nicht allein war, würden die Gäste sicher weniger großspurig auftreten. Davon war Urs überzeugt. Frieder hatte viel gelernt in letzter Zeit und würde möglicherweise einen guten Vermittler abgeben. Zumindest, was den Krieg der Städte gegen das Haus Greifenberg betraf. Vorerst war er froh, dass durch die langen Gespräche erst einmal Zeit gewonnen worden war. Urs gähnte, was Friederike jedoch nicht bemerkte, da sie gerade einen großen mannshohen Kasten durchsuchte, der fast die ganze Stirnwand der Küche einnahm. Plötzlich stützte sie beide Arme in die Seiten und wirkte ein wenig ratlos. Urs beobachtete, wie sich ihre schöne Stirn dabei in Falten legte, und musste schmunzeln.
»Einen Groschen für Eure Gedanken.«
»Dafür würde ich Euch dann einen Topf frische Pastete kaufen.«
»Etwa Hasenpastete?«
Sie nickte zustimmend. »Dabei habe ich dem Koch extra aufgetragen, eine ganze Schüssel nur für Euch allein zu machen. Und das hat er auch getan, das weiß ich genau. Ich weiß nur nicht, wo er sie versteckt hat.«
Erneut sah sie sich suchend um. Urs war gerührt.
»Was denn, Ihr habt ihm aufgetragen ... Nur weil Ihr wusstet, dass ich ...?«
Sie wandte sich zu ihm um. »Dass du sie gern magst, Urs, ja.«
Sie duzte ihn jetzt, was zwischen Eheleuten von Stand als besondere Wertschätzung galt. Urs spürte, wie sein Herz schneller schlug, und ihn überkam wieder jene warme Zärtlichkeit, die er immer verspürte, wenn er sie nur ansah. Friederike blickte sich erneut suchend um.
»Man müsste ihn aufwecken und fragen«, stellte sie dann fest.
»Wen?«, murmelte Urs, ganz von ihrem Anblick gefangen.
»Na, den Koch.«
»Nein, lieber nicht. Lass ihn schlafen.«
Sie nickte nur. »Ist wohl besser.«
»Vielleicht kann ich Euch helfen?«
Die sonore Stimme ließ Friederike und Urs gleichzeitig herumfahren.
Aus dem Schatten der Wand trat ein Mann. Er hielt eine irdene Schüssel in der Hand, die er nun vor den beiden Eheleuten auf den großen Küchentisch stellte. Es war noch ein kleiner Rest Pastete darin. Der Mann blieb stehen und zog sich die Kapuze vom Kopf. Trotz des schwachen Lichts erkannte Urs den Mann sofort.
»Herr von Schlochau!«, sagte er sichtlich überrascht.
»Gott zum Gruße, edler Urs von Weil. Entschuldigt mein theatralisches Auftreten, aber ich habe hier im Eck eine Weile geschlafen. Dann war ich so frei und habe mich selbst bedient. Hasenpastete! Selten zuvor habe ich etwas derart Köstliches gegessen. Ich hoffe sehr, Ihr nehmt mir diesen Raub in Eurer Küche nicht allzu übel.«
Bevor Urs antworten konnte, musterte der enge Vertraute des Königs Friederike ganz unverhohlen. Dann nickte er anerkennend.
»Mein Kompliment, verehrte Baronin.«
Galant verbeugte er sich vor Friederike. »Es ist wahr, was man sich erzählt. Ihr seid tatsächlich von großer Schönheit.«
Sie dankte ihm mit einem freundlichen Kopfnicken für seine Worte und warf dann einen Seitenblick auf ihren Mann. Urs wusste nicht recht, was er von dem nächtlichen Besucher halten sollte. Wie kam von Schlochau, der Vertraute des Königs, hierher? In sein Haus, seine Küche? Und warum wusste er, der Hausherr, nicht, dass er auf der Burg weilte? Nun verwünschte er, dass Wittek bereits zu Bett gegangen war. Dass der Mann hier war, störte ihn. Er hatte ihre erste Begegnung nicht vergessen. Von Schlochau hatte damals ein paar kleine Diebe gnadenlos hängen lassen, und selbst Urs’ Bitte, wenigstens den Jüngsten am Leben zu lassen, hatte den Baron nicht erweichen können. Nein, dachte Urs, ich mag ihn nicht. Die Kälte und die unverhohlene Arroganz dieses Mannes stoßen mich ab.
»Diesmal ohne Fanfarenklang, der Euch ankündigt«, bemerkte Urs statt einer Begrüßung.
Er nickte in Richtung einer Holzbank am Ende des Tisches.
»Wollt Ihr Platz nehmen oder doch lieber gehen?«
Von Schlochau lächelte entschuldigend. »Es tut mir leid, aber ich muss Euch noch etwas stehlen: Zeit, die man lieber mit seiner frisch vermählten Ehefrau verbringen sollte.«
Bei diesen Worten lächelte von Schlochau nicht mehr, und Urs wünschte sich nichts sehnlicher, als dass der Mann dort auf der Stelle verschwinden möge. Friederike war neben ihn getreten, griff nach seinem Arm und fragte mit leiser Stimme: »Wer ist das?«
Urs räusperte sich.
»Herzog von Schlochau, persönlicher Beschützer des Königs von Böhmen, immer für eine Überraschung gut.«
Der Angesprochen nickte kurz.
»Niemand sonst auf der Burg weiß, dass ich hier bin. Außer Eurem Koch natürlich, der, bitte verzeiht ihm das, mich hier schlafen ließ. Dafür musste ich ihn sogar belügen.«
»Könnt Ihr das überhaupt, Herr Baron?«, fragte Urs, und Friederike entging nicht der leise Spott in seiner Stimme.
Von Schlochau schwieg einen Moment und blickte Urs kühl an. Dann grinste er plötzlich. »Bei unserer letzten Begegnung habt Ihr mich noch willkommen geheißen, mein lieber Herr von Weil.«
»Da seid Ihr auch nicht mitten in der Nacht in meiner Küche aufgetaucht«, entgegnete Urs trocken.
Bei diesen Worten musste Friederike schmunzeln. Rasch sah sie zwischen den beiden Männern hin und her.
»Ich sehe, die Herren haben sich viel zu erzählen. Also kümmere ich mich mal um etwas zu trinken.«
Bevor Urs oder von Schlochau dazu etwas sagen konnten, war sie schon durch die kleine Tür verschwunden, durch die man in einen der beiden Weinkeller der Burg gelangte. Von Schlochau sah ihr nach und nickte dann anerkennend.
»Ich beneide Euch, Baron. Schönheit und Anmut in Person sind nun Eure Frau geworden.«
»Was wollt Ihr von mir?«, fragte Urs, ohne auf das Kompliment einzugehen.
Von Schlochau lächelte kühl.
»Mit Euch reden natürlich. Allein. Ohne diese ganzen Herren, die hier unter Eurem Dach weilen.«
Einen Moment lang sahen sich die beiden Männer unverwandt an.
»Und das hat nicht Zeit bis morgen?«, fragte Urs schließlich.
»Nein, hat es nicht, mein Lieber.«
Von Schlochau zog die Schüssel mit dem Rest der Pastete wieder zu sich herüber und sah sich suchend um.
»Etwas Brot?«, bot Urs an.
»Brot ist für die Armen, Herr Baron.«
»Aber nicht in diesem Haus. Hier schätzen wir das Brot. Weil viele Hände dafür arbeiten müssen.«
Von Schlochau sagte nichts, sondern schob die Schüssel wieder von sich. Er wirkte kein bisschen müde oder gar erschöpft, sondern so, wie ihn Urs in Erinnerung hatte: kühl und ungeduldig.
»Bitte setzt Euch doch zu mir, Herr Baron«, forderte er Urs auf.
Der zögerte noch, als Friederike eintrat, einen Krug und zwei Becher in den Händen. Von Schlochau lächelte kurz. Friederike beugte den Kopf in Richtung des nächtlichen Besuchers. »Ihr nehmt doch einen Schluck, nicht wahr, mein Herr?«
Als von Schlochau zustimmend nickte, goss ihm Friederike ein und nahm dann den anderen Becher in die Hand. Urs aber schüttelte ablehnend den Kopf. Friederike stellte den Krug ab.
»Erlaubt, dass ich mich zurückziehe«, sagte sie dann eilig.
Bevor Urs etwas entgegnen konnte, war sie bereits verschwunden. Grimmig biss er sich auf die Lippen.
»Nun setzt Euch doch bitte endlich, Herr Baron!«, wiederholte von Schlochau.
Urs folgte der Bitte, wenn er dessen Verhalten auch so unverschämt fand, dass er ihm am liebsten sofort die Tür gewiesen hätte. Tauchte hier mitten in der Nacht auf und befahl ihm noch bei aller Unverfrorenheit ...
»Ihr habt wirklich keine Ahnung, warum ich hier bin, nicht wahr?«, erkundigte sich von Schlochau.
»Nun, bei Euch muss man mit allem rechnen.«
Von Schlochau lachte leise und griff nach dem Becher. Er kostete kurz und stürzte den Inhalt in einem Zug hinunter. Dann setzte er den Becher ab und sah Urs ernst an.
»Die Hochzeit, so hörte ich, war nicht für alle erfreulich.«
Als Urs schwieg, beugte sich von Schlochau ein wenig näher zu ihm hin.
»Nicht nur deshalb droht Unfrieden im Land.«
»Was wollt Ihr mir sagen?«
»Zuerst muss ich Euch loben. Euren Stand als Baron mehr als deutlich zu machen, das ist Euch gelungen. Die Männer haben Euch die Treue geschworen. Wie ich es, verzeiht, wie es der König gehofft hat. Dafür meinen Respekt. Ihr entpuppt Euch als geschickter Diplomat.«
Urs wollte darauf antworten, aber von Schlochau hob abwehrend beide Hände.
»Nein, bitte, lasst nur! Ihr werdet mir bestimmt wieder eine bescheidene Antwort geben, so wie ich Euch kenne. Das ehrt Euch. Aber nun steht Euch ein Krieg ins Haus. Gegen Euren eigenen Schwager.«
Von Schlochau zuckte gleichmütig mit beiden Schultern. »Dumme Sache, aber doch notwendig«, sagte er dann.
»Was meint Ihr?«
Die beiden Männer sahen einander abschätzend an. Dann sprach der Vertraute des Königs weiter.
»Zuerst sollt Ihr eines wissen: Der König lässt Euch gewähren, was immer Ihr vorhabt. Denkt daran, Sigismund will Ruhe im Reich. Deshalb sind ihm Lehnsmänner, die sich nach dem Gesetz schuldig gemacht haben, ein Gräuel.«
»Lehnsmänner bekommen von jeher Gelegenheit, ihren Treueid zu erneuern«, bemerkte Urs.