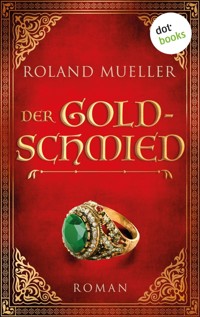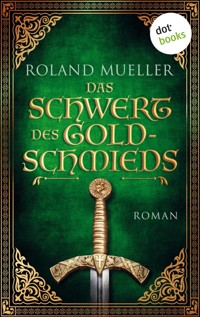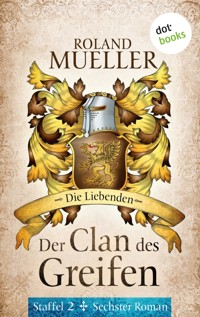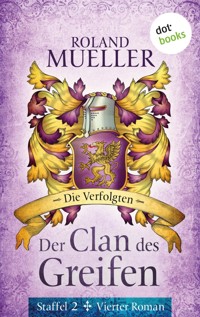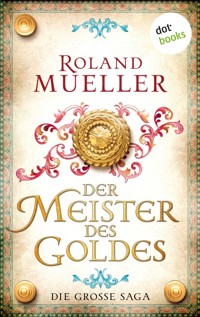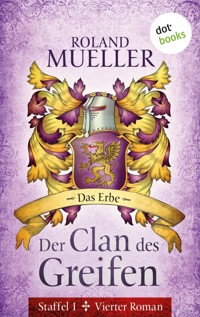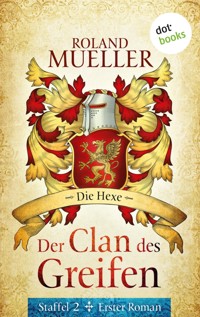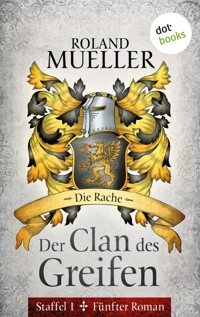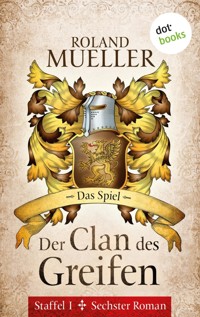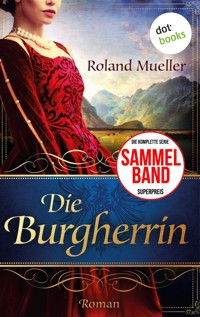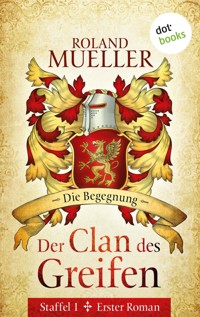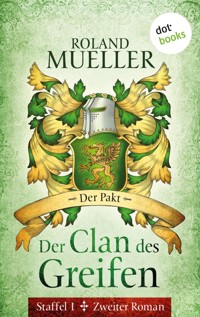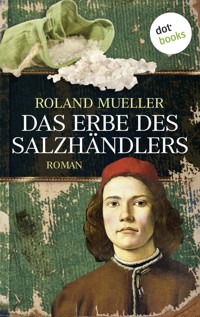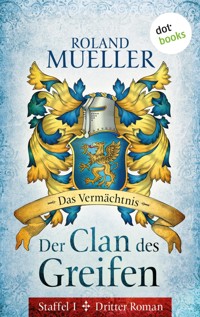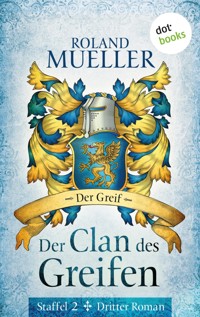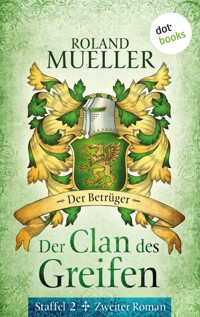5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historischer Abenteuerroman vor dem Hintergrund des Streits zwischen Adel und Kirche im späten 13. Jahrhundert »›Sie ist eine Edle und Du bist ein Idiot.‹ Statt einer Antwort lachte Villard nur.« Im Jahr 1190 finden Holzknechte einen schwerverletzten Mann. Er trägt die Kreuzigungsmale an Händen und Füßen und kann noch die Worte »Leib Christi« sagen, bevor er stirbt. Das waren die Nonnen aus dem nahen Kloster, so das Gerücht. Zur Aufklärung soll eine angehende Nonne, Isabella von Kyrberg, im Auftrag von Kaiser Barbarossa in das Kloster reisen, um ihm zu berichten. Zu ihrem Schutz wird ein Tempelritter mit vielen Geheimnissen berufen, und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und dieser Auftrag entwickelt sich zu einer mörderischen Herausforderung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Äbtissin« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Sandra Lode
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Umschlaggestaltung und Motiv: www.bookcoverstore.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
TEIL 1
Die Gräfin
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Der fünfte Tag
TEIL 2
Der Spielmann
Der sechste Tag
Der siebte Tag
Der achte Tag
Der neunte Tag
TEIL 3
Die Äbtissin
Der zehnte Tag
Der dreizehnte Tag
Der vierzehnte Tag
Der fünfzehnte Tag
TEIL 4
Der Ritter
Der zwanzigste Tag
Epilog
Anmerkungen des Autors
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Der Mann lag am Flussufer, nackt und schwer verletzt. Alles, was er hörte, war das Geräusch seines Atems. Und Stimmen, ganz nah.
»He, Hasenfurz, soll das etwa ein Feuer sein?«
»Was denn, brennt doch!«
»Tut’s nicht! Weil du nasses Holz nimmst!«
»Aber gleich brennt es!«
»Gleich? Wann soll das sein, gleich?«
Der Mann, mehr tot als lebendig, von der Kälte steifgefroren, konnte sich nicht rühren. Wenn er rufen würde, würde man ihn hören können. Vielleicht. Doch dazu fehlte ihm die Kraft …
»Wieland hat recht. Mach nur einmal ein Feuer, das nicht nur raucht!«
»Leckt mich doch alle beide!«
Der Mann hörte sie lachen. Warum hörten sie ihn nicht? Wenigstens seinen keuchenden Atem müssten sie doch hören können …
»Seid mal still!«
»Was ist?«
»Ihr sollt den Schnabel halten … hab was gehört …«
»… da drüben … liegt da nicht jemand?«
»Gott im Himmel, das ist ein Flussgeist!«
»Blödsinn …«
Der Mann spürte warmen Atem über sich.
»Bei allen Heiligen … der blutet ja überall!«
»Michel, schnell eine Decke!«
Der Mann nahm all seine Kraft zusammen. »Leib Christi …«
»Was hat er gesagt?«
»Leib Christi hab ich verstanden.«
»Hier, die Decke …«
Der Fluss rauschte, es blieb das einzige Geräusch, bis jemand sprach.
»Lass gut sein, Michel. Die braucht er nicht mehr.«
TEIL 1
Die Gräfin
Je länger er sie betrachtete, um so mehr drängte ihn die Frage, warum sie ins Kloster gehen wollte?So wie sie aussah, wäre sie doch bestimmt zu verheiraten gewesen.
Erster Teil der Akte zu jenen Ereignissen im Frühjahr des Jahres 1190 des Herrn
Ich, Graf Albrecht Raimund Manfred von Kyrberg, will zu Beginn dieser Notizen erklären, dass diese, wie auch die folgenden Aufzeichnungen, nicht für die Nachwelt gedacht sind. Diese Zeilen sind nur für mich allein, von mir eigenhändig erstellt.
Sie sollen jene Ereignisse bewahren, auf dass mir später die Erinnerung keine Streiche spielen kann. (Weiß man doch, was das Alter mit dem Verstand anstellt.) Angesichts des großen Zieles, das ich anstrebe, ist kein Platz für senile Gedankenlosigkeit oder für die Unfähigkeit, sich eines Tages noch mehr oder eher weniger genau zu erinnern. Darum diese Zeilen.
Ich will mich erinnern können, und zwar zu jeder Zeit.
Gleich zu Beginn stelle ich einmal mehr fest, dass sich nichts hartnäckiger hält als ein Gerücht. Aus Gehörtem und Gesagtem webt sich ein undurchdringliches Gespinst, verdichtet sich mehr und mehr und wird dann irgendwann zum Wort. Und eben dieses Wort ist es, das zur Gefahr wird, bis es wie ein Pesthauch über alles kommt. Kurzum, ein Gerücht verwirrt, verleumdet und am Ende zerstört es. Wie eine Waffe kann so ein Wort also sein, wenn man im Stande ist, es zu nutzen. So wie in meiner Funktion als Dienstmann meines Kaisers an erster Stelle der Nutzen einer Sache von Interesse ist.
Auch das mache ich mit diesen Zeilen deutlich: Mir ging es immer darum, dem Reich zu dienen. Einem großen Reich, das noch am Anfang seiner wahren Größe steht. Ein Reich, das einmal größer sein wird, als es einst Rom oder sonst ein Erdenreich gewesen war. Das römisch-deutsche Staatsreich Friedrichs, den wir »Barbarossa« nennen, römisch-deutscher Kaiser, König von Jerusalem, Erster nach Gott.
Für mich galt es immer, die zu bekämpfen, die an ihm und seinem Amt zweifeln. Ich zweifele nicht. Das habe ich nie getan! Ich glaube fest an die Bestimmung meines Herrn und die Einheit des römischen Reiches. Dafür hat er mich nicht umsonst mit seinem Vertrauen belohnt. Deshalb bin ich auch ohne jede Reue, wenn ich sage: Was getan werden muss, ist gut so und genau deshalb habe ich es so getan.
Denn ich, Graf Albrecht Raimund Manfred von Kyrberg, war und bin unserem Kaiser engster Vertrauter und Freund, dazu ausführende Hand seiner Wünsche und Befehle. Das ist stets meine allerhöchste Aufgabe gewesen.
Ich weiß sehr gut, was ein Gerücht anrichten kann.
Ich weiß um seine Kraft, seine Tücke und seine Gefährlichkeit. Und ganz besonders weiß ich um die einfache Gestalt eines Gerüchts. Ein paar Worte genügen. Es reicht völlig, ungläubiges Staunen oder große Empörung auszulösen. Und schon schwelt der Zorn … (Ich staune immer wieder über angeblich Gesagtes oder ein Geschehen, das irgendwo passiert sein soll und dem auf einmal alles und jeder folgt.)
Ja, das einfache Wort hat durchaus magische Kräfte.
Und obwohl ich nicht an Zauberei glaube, bin ich der festen Überzeugung, dass wenige Worte, geschickt gestreut, ein Werkzeug sein können, mit dessen Hilfe man alles und jeden bewegen kann.
Es begann in jenen Tagen des Jahres 1189 des Herrn.
Wenige Wochen vor dem Jahresende, hielt ich einen Brief des Legaten in Händen und bevor ich auch nur einen Blick darauf geworfen hatte, ahnte ich bereits, was darin geschrieben stand. Wieder einmal ging es um die Parteinahme für oder gegen den deutschen Kaiser. Gott der Allmächtige, das widerte mich so an, so wie es mich in all den Jahren immer angewidert hat! Ein verzehrender Streit, geführt von dummen Laffen, mit Kronen auf den Köpfen, wo es doch Narrenkappen auch getan hätten. Könige, wie Maulwürfe blind, Herzöge, dümmer als ein Topf heißer Brei. Nicht zu vergessen die Kirchenfürsten! Popanz in Legio!
All die Jahre zuvor waren es eben diese Fürsten und Könige der größten Königreiche im Abendland gewesen, die sich auf die Seite des Papstes schlugen. Gott, der Gerechte, das war übel genug! Mehr als einmal geriet ich darüber in unheiligen Zorn. Was für Schwachköpfe waren diese Lenker und Streiter ihrer Länder nur. Sahen sie nicht, was geschieht, wenn die Kirche allein über die Menschen gebietet? (Glaube allein ist wie die Pest! Er korrumpiert!) War niemand mit so viel Weitblick gesegnet, um zu ahnen, was diese Kirche mit aller Macht aus den Menschen machen wird, wenn man sie weiterhin so gewähren lassen würde?
Natürlich sahen sie es nicht. So wie man Dummheit ja auch nicht leibhaftig sehen kann, wie beispielsweise einen Krug Wein. Dieser unselige und zugleich uralte Streit über die wahre Macht zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Kaiserreich ist und bleibt lähmend und ist damit von Übel. Er macht uns Völker unbeweglich. Das war mir bis zu jenem Tag, an dem dieser Akt (den ich hier als Brief bezeichne) in meine Hände gelangte, bewusst.
Natürlich las ich ihn.
Johannes von Salisbury, Bischof von Chartres äußerte darin seinen Unmut über den Kaiser. Ja mehr noch, er wagte es sogar, ihn als Tyrannen zu bezeichnen. Ich selbst hätte damals zu gerne mein Schwert gegen diesen Verleumder erhoben, denn es war mehr als Groll, den ich empfand, als ich lesen musste, was der Legat in des Bischofs Namen schrieb.
»Wer hat die Deutschen zu Richtern über die Völker bestimmt?«, hieß es da und weiter im Text: »Wer gab diesen plumpen und ungestümen Menschen die Autorität, einen Fürsten als Richter über die Häupter der Menschenkinder zu setzen?«
Diese Worte haben in mir damals wie heute Empörung und Zorn ausgelöst.
Und schon begannen sie zu sprießen, die unseligen Gerüchte.
Schneller und mächtiger als ein Pesthauch hieß es auf einmal, dem Kaiser habe man dieses Schreiben nur in abgeschwächter Form präsentiert. Man wollte keinesfalls einen seiner gefürchteten Zornesausbrüche heraufbeschwören. Noch heute muss ich darüber schmunzeln. Denn das war kein Gerücht! Jawohl, es war so wie behauptet und sämtliches Gerede darüber war ausnahmsweise richtig (zu Beginn jedenfalls).
Denn ich gestehe hier an dieser Stelle, für dieses Gerücht ganz allein verantwortlich gewesen zu sein.
Jawohl, ich habe damals recht getan, meinem Souverän das Papier, verfasst in sanfteren Worten, zu überreichen. Er las es ja nicht selbst, sondern bat mich (wie immer eigentlich), es ihm vorzulesen. Als ich das getan hatte, war sein Zorn sichtbar, jedoch gemäßigt und genau das hatte ich beabsichtigt.
Die übrigen Vertrauten des Kaisers waren meine Zeugen. Sie waren samt und sonders gemischter Meinung. Man solle diese Worte nicht so ernst nehmen, war da zu hören. Und wer sei schon dieser Bischof von Salisbury? Doch auch nur ein unbedeutender Kirchenmann in einer Reihe weiterer unbedeutender Kirchenmänner.
Dazu muss ich sagen, dass ich die engsten Vertrauten des Kaisers nicht immer verstanden habe. Noch weniger war ich eins mit ihnen, was die Ansichten und die Gedanken mancher Ratschläge betraf, die seiner Majestät oftmals unterbreitet wurden. Ich will jedoch nicht ungerecht erscheinen. Ja, Barbarossa hatte bedeutende Ratgeber. (Ich will sie hier nur einmal namentlich nennen, weil ich Mühe genug hatte, sie mit all dem Gedankengut zum Wohle des Reiches zu versorgen.) Allen voran Reinald von Dassel. Dann Wichmann von Magdeburg, gefolgt von Philip von Heinsberg und nicht zu vergessen, Christian von Mainz. Keine Frage, alles tüchtige Männer! Dienstherren des Kaisers und Ritter des Glaubens. Aber doch waren und blieben sie seine Diener und er war ihr Herr.
Ich jedoch wollte niemals nur einer von ihnen sein.
Nein, ich sah mich mehr als sie und mehr als einen Dienstmann. Ich war der behutsame Lenker seiner Entscheidungen, jawohl, seine rechte Hand. Und so ward dieses Schreiben, wie auch das erneute Zögern der hohen Herren (mich schließe ich dabei ausdrücklich aus, denn ich bin kein Zauderer), der Grund meines Handelns. In mir reifte der Gedanke, etwas zu finden, was den Kaiser vor allen Völkern als wahren Lenker des Reiches zeigte. Und zwar für alle sichtbar.
Ich, Graf Albrecht Raimund Manfred von Kyrberg, bezeuge die hier von mir eigenhändig verfassten Zeilen, im Vollbesitz meiner Gedanken.
*
Sein Name lautete Albrecht Theoderich von Krems und er war ein Tempelritter.
Bekannt war er eher unter dem Namen Katt. Natürlich nannte man ihn respektvoll Herr Albrecht. Katt oder auch Bruder Katt hieß man ihn nur hinter vorgehaltener Hand. Es gab Zungen, die behaupteten, die Vorfahren des Ritters wären gar keine Edlen gewesen, sondern Tuchfärber. Deren Zunft färbte von jeher mit dem Saft einer Wurzel, die man Krapp nannte und so war möglicherweise daraus der Name Katt geworden. Ganz genau wusste das aber niemand zu sagen.
Tatsächlich entstammte Katt als elftes und zugleich jüngstes Kind einem kleinen unbedeutenden Adelsgeschlecht, dessen Nachfahren im unbeweglichen Stand verarmter Landjunker verharrten, sich jedoch stets stolz darauf beriefen, Nachfahren eines uralten Geschlechts zu sein. Er selbst bildete sich auf seine Herkunft nichts ein. In zwei Kreuzzügen hatte er gedient und jedes Mal war er unversehrt wieder heimgekehrt. Vielleicht war es diesem Umstand zu verdanken, dass er seinem weltlichen Herrn, dem römisch-deutschen Stauferkaiser Friedrich, allgemein nur »Rotbart« genannt, treu und ergeben war.
Sein Amt auf der Saalburg, dem Sitz der kaiserlichen Familie, war der eines Waffenmeisters. Er lehrte den Junkern, neben dem höfischen Umgang, den Gebrauch der Waffen. Der Ritter galt als unbarmherziger und harter Ausbilder. Trotzdem brannten die blutjungen Schüler darauf, die Finten des Kampfes bei ihm, einem der Veteranen der Glaubenskriege, zu erlernen.
An diesem Morgen nahm Katts Leben aber jene Wende, die den Rest seines irdischen Daseins bestimmen sollte. Natürlich ahnten weder er noch sonst irgendjemand davon. Nichts an diesem kühlen Frühlingsmorgen im April des Jahres 1190 wies auf die kommenden Ereignisse hin. Im Gegenteil, der Tag begann für den Templer wie alle Tage.
Gleich nach dem Aufstehen kniete er neben seinem schmalen Bett zum Gebet nieder. Anschließend trank er etwas Wasser, um sich dann sorgfältig zu waschen. Katt hielt sehr auf Reinlichkeit. Wenigstens zweimal in der Woche wusch er sich am ganzen Leib und wann immer er die Gelegenheit für ein Bad hatte, nutzte er sie. Er putzte sich sogar mit einem Wacholderzweiglein die Zähne. Anlass für so manchen Scherz auf der Burg, denn so etwas tat niemand in diesen Zeiten. Warum auch? Zähne faulten nun einmal und fielen dann irgendwann aus. Ein Glück war es, wenn dies erst spät und ohne Schmerzen geschah.
Er war jetzt einundvierzig Jahre alt und erfreute sich noch aller gesunden Zähne, so wie er auch noch gut sehen und hören konnte. Auch sonst plagten ihn keine nennenswerten Gebrechen und das war alles andere als selbstverständlich für einen Mann und Veteranen seines Alters.
Katt trocknete sich Gesicht und Hände und erst dann fuhren seine Fingerspitzen beinahe zärtlich über seinen größten Schatz: Bücher. Bis unter die Decke seiner winzigen Kammer gestapelt, zeugten sie von der Lust und Freude des Lesens. Sie waren das, was er liebte: seine eigene kleine, aber feine Bibliothek.
Jetzt schlüpfte er in seine langen Beinlinge, zog sich die Hentze, das lange hemdartige Obergewand, darüber und band sich den Gürtel um die Hüfte. Er fuhr in ein paar Holzpantinen und trat so hinaus auf den inneren Hof der Burg. Am Himmel dräuten dichte Wolken und es sah so aus, als ob es regnen würde. Katt bemerkte auch eine Handvoll junger Burschen, die allesamt früh auf den Beinen, mit hölzernen Übungsschwertern aufeinander eindroschen. Dicke wattierte Überwürfe schützten ihre Körper. Alle führten schmale, nach unten beinahe spitz zulaufende Schilde, die, nicht besonders schwer, für einen Übungskampf leicht zu handhaben waren.
Die Burschen, alles Knappen und angehende Junker des Adels, bewegten sich flink, laut und übermütig. Eben so, wie es junge Kerle gerne tun, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Sigurd von Delft, Sohn eines Grafen vom Niederrhein, war der Lauteste unter ihnen. Ein Aufschneider vor dem Herrn, nie um ein Wort verlegen. Ein guter Kämpfer, mit allen Anlagen für einen Krieger. Wenn nur sein großes Maul nicht wäre. So jedenfalls lautete Katts Urteil über ihn.
»Jetzt seht einmal, wer da kommt!«
Sigurds Bemerkung ließ die jungen Kämpfer innehalten. Sie starrten den Templer an, als wäre er ein Geist. Die Gestalt groß, schlank, hager. Kein Gramm Fett zu viel auf den sehnigen Gliedern, der blank rasierte Schädel von der Sonne braun gebrannt, das Gesicht scharf geschnitten. Graue wachsame Augen, ein kurzer, immer gepflegter Bart um das kantige Kinn. Ein Profil wie ein Raubvogel, hatte mal jemand gesagt und sogar Katt fand den Vergleich schmeichelhaft. Er war nicht nur für diese Gecken eine Legende, um die sich Geschichten rankten. Wobei kein Mensch zu sagen vermochte, welche davon wahr wäre, denn Katt sprach nie über sich.
Er schritt über den Hof und bemerkte auf einmal in der Tasche seines Gewands ein Buch. Seine Bibel. Eine kleine feine Ausgabe, handgeschrieben in Latein, mit prächtig gestalteten Kapitelüberschriften und nicht weniger prächtigen Bildern versehen. Das Buch war kaum größer als seine Hand. Aldebar von Brunn, ein befreundeter Mönch aus dem nahen Kloster, hatte es ihm einst als Geschenk vermacht. Katt schätzte diese Bibel sehr. Nicht nur, weil es ein besonderes Geschenk war oder gar die Heilige Schrift. Eher weil es Auftakt zu seiner heimlichen Leidenschaft gewesen war. Normalerweise lag diese Bibel in seiner Kammer, doch er musste sie wohl am Abend zuvor für das Abendgebet eingesteckt und dann in seiner Tasche vergessen haben.
Nachdenklich wog er das Buch in seiner Hand. Umkehren, nur um es in seine Kammer zurückzulegen, wollte er nicht. Es war Zeit, mit den Mönchen aus den Schreibstuben an der Morgenvesper teilzunehmen. Dort wurde immer vorgelesen und das mochte er. Außerdem sollte ein neuer Küchenmeister walten, von dem es hieß, er würde sein Handwerk verstehen.
»Ich grüße Euch an diesem frühen Morgen, edler Herr Albrecht!«
Sigurd von Delfts Gruß klang höflich. Aber Katt wusste über den jungen Gecken vor allem, dass er sich gerne über jedermann lustig machte.
»Gott zum Gruße, ihr jungen Herren«, sagte er nicht unfreundlich zu der Schar.
Sigurd grinste breit, schweißdampfend, die Wangen rot.
»Lasst Euch durch mich nur nicht stören«, fügte Katt hinzu.
»Aber Ihr stört doch nicht … Bruder.«
Aus dem Mund dieses blutjungen Kerls klang die Anrede respektlos, ja mehr noch, beinahe unverschämt. Katt legte den Kopf ein wenig schief. Dann trat er auf die Gruppe zu und blieb vor Sigurd stehen.
»Na, dann«, sagte er, »zeigt mir, was Ihr könnt, die jungen Herren.«
Sigurd stieß das Übungsschwert vor sich in den Boden und zog geräuschvoll die Nase hoch. Dann spuckte er neben sich auf den Boden.
»Immer nur aufeinander einschlagen ist auf Dauer langweilig!«
»So, langweilig?« Katt betonte das Wort deutlich hörbar. »Und was denkt Ihr, Junker, könnte man gegen solcher Art Langeweile tun?«
»Einen richtigen Gegner rausfordern, sage ich!«
»So, und wer käme da in Frage, als … richtiger Gegner?«
»Na Ihr zum Beispiel … Herr.«
»Ach so, an mich denkt Ihr dabei also?«
»Ja, ganz recht. Zeigt doch mal Euer Können als Kämpfer und nicht immer nur als Lehrer!«
Katt hob kaum merklich den Kopf. »Junker, meint Ihr mit Können das Handwerk eines Ritters oder eher die Kunst, einem Maulaffen feines Benehmen beizubringen?«
Aus der Gruppe der jungen Männer lachte jemand leise. Sigurd fletschte die Zähne.
»Es geht das Gerücht, dem frommen Bruder Katt fehlt seit Jerusalem der Schneid für einen richtigen Kampf.«
»Sieh an, sieh an! Zu all der Langeweile kommt auch noch ein Gerücht.«
»Ja, aber wer weiß? Vielleicht ist was dran, an diesem … Gerücht?«
Der Templer sog langsam die Luft ein und sah in die Runde der jungen Burschen.
»Es ist leicht, einen Mann zu schmähen, der unbewaffnet ist. Vergesst aber niemals: Schwache Worte gegen einen Edelmann ziehen die Revanche, wie man im Reich der Franken sagt, nach sich.«
»Was wollt Ihr damit sagen?«, fragte Sigurd.
»Das man besser vorher wissen sollte, was man sagt. Und vor allem zu wem, Junker!«
»Dann sage ich jetzt, dass ich Euch auf Ehre fordere, Herr … Katt!«
Sigurd spuckte den Namen des Templers beinahe aus. Katt blieb gelassen. Ohne ein Mienenspiel sah er von einem der Männer zum anderen. »Wie bedauerlich, bin ich doch im Moment ohne Schwert.«
»Sicher leiht Euch einer meiner Gefährten eins«, knurrte Sigurd.
»Nein, bitte! Macht Euch nicht die Mühe! Zudem, um Euch, Junker, eine Lektion in ritterlichem Benehmen zu erteilen, brauche ich kein Schwert.«
Die Augen des jungen Burschen blitzten. Katt wusste, dass der vorlaute Kerl diese Worte nicht ignorieren würde. Und tatsächlich ließ Sigurd seinen Schild neben sich auf den Boden fallen. Katt jedoch stieß blitzschnell seine Hand mit der Bibel nach vorne und traf den jungen Burschen damit am Kehlkopf. Sigurd hielt sich den Hals mit beiden Händen und sank langsam mit einem gurgelnden Geräusch in die Knie.
»Nun wird er eine Weile lang sein dummes Maul halten müssen«, sagte Katt ungerührt zu den übrigen Burschen. »Legt ihn nur ja nicht auf den Boden! Er muss atmen können. Habt Ihr mich verstanden!«
Sie nickten hastig. Einer der Burschen versuchte, dem gierig nach Luft Ringenden etwas Wasser einzuflößen, doch es rann nur über Kinn und Brust.
Katt beugte sich zu ihm. »Und Ihr, Junker, werdet eine Extrastunde bestreiten. Mit mir ganz allein. Bis dahin erholt Euch gut, denn Ihr werdet alle Kraft dazu brauchen, das versichere ich Euch.«
Er ließ die jungen Männer stehen und ging. Diese Vorstellung hatte unnötig Zeit gekostet, wie er fand, und er hoffte inständig, die Vesper wäre noch nicht vorbei. Denn, wie gesagt, der neue Koch sollte alles andere als schlecht sein.
Graf Albrecht von Kyrberg trat in die Tür der winzigen Kammer.
Er blieb dort stehen und sah zu, wie Katt ein Buch auf ein sauberes Stück Leinen legte und es behutsam zurechtrückte.
»Gelobt sei unser Herr!«, grüßte der Graf den Veteranen.
»Und sein Sohn, Jesus Christus!«, antwortete Katt.
»In Ewigkeit, Amen. Erlaubt Ihr mir, dass ich eintrete, Herr Albrecht?«
Der Templer machte eine einladende Geste. Der Graf betrat die schmale Kammer. Ringsum stapelten sich, sorgsam aufgeschichtet, unzählige Bücher. Überall, neben dem schmalen Bett an der Wand genauso wie auf dem winzigen Tisch unter dem kleinen Fenster. Gewichtige Folianten genauso wie schmale Bände, großformatige Pergamentsammlungen und kleine Handausgaben. Alle in Leder gebunden, alle Seiten von Hand geschrieben, Bilder, Überschriften und Einfassungen von Künstlerhand gemalt. Die Bibliothek eines leidenschaftlichen Lesers und Sammlers.
»Habt diesem Rotzbengel gerade eine Lektion erteilt, was?«, bemerkte von Kyrberg, während er sich neugierig umsah.
Katt ließ seine Hand auf dem Buchrücken liegen. »Es war notwendig, Herr.«
»Wenn Ihr es sagt«, meinte von Kyrberg nur.
Katt rückte das Buch auf dem Leinen gerade, darauf wartend, was sein Besucher von ihm wollte.
»Es geht um einen Auftrag«, begann der Graf.
»Herr!«
»Im Namen unseres allergnädigsten Herrn, Friedrich, Kaiser und Herr, dem zu dienen ich die besondere Ehre habe.«
Katt beugte höflich das Haupt.
»Er wünscht ein Geleit«, fügte der Graf hinzu.
»Und wer soll es anführen?«
»Ihr natürlich.«
»Ich?«
»Jawohl!«
»Und wann, hoher Herr?«
»Wann immer Ihr so weit seid.«
Katt hob den Buchdeckel ein klein wenig an und schloss ihn wieder.
»Es ist kein gewöhnlicher Auftrag«, sagte der Graf.
Katt bemühte sich um ein Lächeln. »Soll ein kostbarer Schatz begleitet werden, ja?«
Von Kyrberg antwortete ihm nicht. Stattdessen sah er sich demonstrativ um und strich dann mit den Fingerspitzen sanft über einen Bucheinband. »Das hier bedeutet Euch viel, hab ich recht?«
Katt antwortete nicht gleich.
»Ja, Bücher bedeuten mir etwas«, sagte er dann.
Albrecht von Kyrberg sah Katt nun unverwandt an. Der Mann da vor ihm galt als wortkarg. Dass er jetzt zu seiner Leidenschaft etwas bemerkt hatte, war bereits mehr, als er sonst von sich Preis gab.
»Erinnert Ihr Euch noch an meine Nichte?«, wollte der Graf wissen.
Katt nickte bedächtig. »Dunkelblondes Haar, große Augen, vier oder fünf Jahre alt. Man trug ihren Vater zu Grabe. Sie weinte die ganze Zeit über, während Ihr sie an der Hand gehalten habt.«
»Ja, richtig. Das ist jetzt bald fünfundzwanzig Jahre her.«
Katt räusperte sich höflich. »Hoher Herr, lebte sie seitdem nicht im Kloster?«
»Ja, bis zu ihrem zwanzigsten Lebensjahr, um genau zu sein. Dann kehrte sie auf das Familienlehen derer von Kyrberg zurück.«
Katt legte behutsam das gebleichte Leinen über dem Buch zusammen, bis es einem Paket gleich vor ihm lag. So verpackte er meistens seine Bücher, denn in der Burg wimmelte es von Mäusen und das fein gegerbte Leder der Einbände war ihnen wie ein Leckerbissen.
»Sie ist hier«, sagte von Kyrberg.
»Das Geleit ist also für das hohe Fräulein bestimmt?«
»Ja, ganz recht. Sie wird endgültig ins Kloster gehen und Ihr stellt Schutz und Begleitung dorthin.«
Beide Männer sahen sich einen Moment lang stumm an.
»Das ist alles?«, fragte Katt.
»Jawohl, das ist alles.«
»Und wenn ich ablehne, Herr?«
»Seine Majestät wird wissen wollen, warum. Immerhin, das einzige Kind meines verstorbenen Bruders ist des Kaisers Patenkind. Also, was werdet Ihr dann seiner Majestät sagen?«
»Dass ich für diese Aufgabe nicht tauge, Herr.«
»Eure Bescheidenheit ehrt Euch. Aber es ist mir wichtig, dass Ihr dieses Geleit übernehmt. So wie es auch unserem Kaiser wichtig ist.«
Katt schwieg. Darauf wollte er keine Antwort geben. Er wusste nur, dass er diesen Auftrag nicht übernehmen wollte. Hier, auf der Saalburg, das war sein Leben. Ruhig, beschaulich, alle Tage geordnet. Sein Dienst als Waffenmeister angesehen und respektiert. Am Abend, bei einem Becher Wein, die Gespräche mit den Künstlern der Schreibwerkstatt, den Mönchen und Glaubensbrüdern. Über Gott und die Welt. Und über Bücher. Vor allem über Bücher. Nein, keine Frage, das hier war seine Welt und sie genügte ihm vollkommen.
»Ihr sollt es ja auch nicht umsonst machen«, sagte von Kyrberg.
»Ich hab alles, ich brauche nichts.«
Der Graf lachte leise und hob den Deckel eines der Bücher an. »Das Buch des Heiligen Augustinus ist nun fertig. Meister Wolfram hat Tag und Nacht daran gearbeitet. Bei Gott, all diese prächtigen Bilder! Ich muss sagen, einmal mehr ist es ein Meisterwerk geworden.«
»Ja, das ist es tatsächlich, hoher Herr. Ein kostbares Geschenk für den König von Frankreich. Ich weiß, es ist für ihn bestimmt.«
»Nein, da irrt Ihr Euch.« Der Graf lächelte kaum merklich. »Das Buch ist nicht für ihn, sondern für Euch.«
»Ich verstehe jetzt nicht, Herr …«
»Am Tag Eurer Rückkehr wird es seinen Platz hier haben. Euer Salär für meiner Nichte Geleit. Seine Majestät selbst will es so.«
Katt war sprachlos. Ein kostbareres Geschenk für einen Bücherliebhaber schien kaum möglich.
»Ihr erlaubt Euch jetzt einen Scherz mit mir, nicht wahr, hoher Herr?«
Von Kyrberg lachte leise. »Sehe ich so aus, als ob ich scherze?«
Er klopfte ganz leicht mit den Fingerspitzen auf einen der Büchereinbände.
»Seine Majestät bedauert den Schritt seines Patenkindes ins Kloster«, begann er zu erklären. »Aber er respektiert es natürlich. Deshalb also das fürstliche Salär. Natürlich nur, wenn Ihr annehmt.«
Katt rieb sich das Kinn, schluckte. Dann nickte er. »Euer Diener, Herr Graf.«
Von Kyrberg schloss die Tür und erklärte Katt, was er von ihm erwartete.
Die drei Männer standen bereits den dritten Tag am Pranger.
Den Hals in den hölzernen Kragen gezwängt, an den Füßen schwere Ketten. Nass bis auf die Haut, die Lippen blaugefroren, standen sie unbeweglich im Schlamm, knöcheltief. Jeder Einzelne von ihnen war immer wieder einmal ohnmächtig geworden. Dann übergoss man ihn mit einem Schwall Wasser, damit er wieder zu sich kam. Dies übernahm jetzt der eiskalte Regen, der deutlich machte, dass der Winter noch nicht zu Ende war. Auf den Pfützen am Boden glitzerte das Eis.
Der Tempelritter stand am Fenster des großen Saals der Burg und sah in den Hof hinunter. Von Kyrberg trat neben ihn, um einen der schmalen Holzläden zu schließen. »Was haben diese Kerle eigentlich verbrochen?«
»Gott gelästert, Herr.«
Der Graf wog tadelnd den Kopf. »Lumpenpack …«
»Und auf den Kaiser geflucht«, fügte der Ritter hinzu.
»Das verlangt allerdings eine harte Bestrafung«, meinte von Kyrberg und hielt prüfend eine Hand in den Regen hinaus, der jetzt in nassen Schnee überging.
»Dreißig«, murmelte der Ritter auf einmal, ohne den Blick von den Verurteilten zu nehmen.
»Was meint Ihr?«
»Dreißig Peitschenhiebe, Herr. Dazu hat man sie verurteilt.«
»Wird ihnen eine Lehre sein«, entgegnete der Graf ungerührt und rieb sich die feuchtnasse Hand.
Wenn sie es denn überleben!, dachte Katt. Zehn Hiebe mit der schweren Peitsche auf den bloßen Rücken fetzten die Haut bis auf das nackte Fleisch herunter. Zehn weitere Hiebe und der Rücken war eine einzige Wunde. Dann fiel selbst der stärkste Mann in Ohnmacht. Nein, dreißig Peitschenhiebe überlebte kaum jemand.
»Wann wünscht Ihr, dass ich aufbreche, Herr?«, wollte Katt wissen.
»Sobald Ihr beisammenhabt, was Ihr für die Reise braucht.«
Ein Diener begann, Talglichter zu entzünden. Katt sah zu, wie der Mann Kerzen in die schweren Leuchter steckte und sie der Reihe nach anzündete. Von Kyrberg räusperte sich und entließ den Diener mit einem Wink.
»Ich nehme diese drei Männer!«, sagte Katt.
Von Kyrberg sah ihn fragend an.
»Als Begleiter«, fügte Katt hinzu.
»Was? Ihr braucht geübte Waffenknechte, zähe Burschen! Nicht solche Strauchdiebe!«
»Die drei sind zäh, Herr.«
Von Kyrberg lächelte ungläubig. »Wie könnt Ihr das wissen?«
»Männer, die drei Tage so aushalten, sind vielleicht die übelsten Kerle weit und breit. Gotteslästerer, jawohl Strauchdiebe. Oder sogar Schlimmeres. Aber sie sind noch am Leben. Gibt es einen besseren Beweis für die Zähigkeit eines Mannes?«
Der Graf legte den Kopf schief, als hätte er nicht richtig gehört. »Das ist alles, ja?«
»Den großen Kerl kenne ich. Sein Name ist Rufus, genannt der Riese. Er war Mineur bei der Belagerung von Akkon. Gut zu gebrauchen, der Mann. Der mit dem Bart heißt Johannes. Ein Bogenschütze. Wenn er nüchtern ist, soll er nicht schlecht sein, wie ich hörte. Der Dritte ist ein Hofknecht. Ihn kenne ich nicht. Er ist wohl an die falschen Leute geraten.«
Von Kyrberg schüttelte unwillig den Kopf. »Herr Albrecht, Ihr sollt meine Nichte sicher durchs Land geleiten. Dazu braucht Ihr Männer, die mein Mündel beschützen können. Aber doch nicht solche Strolche!«
»Sie werden sie beschützen, Herr. Mit ihrem Leben, wenn es sein muss.«
Von Kyrberg schüttelte erneut den Kopf. »Und woher wollt Ihr das jetzt wissen?«
»Weil sie in meiner Schuld stehen werden.«
Von Kyrberg sah Katt unverwandt an, bevor er seufzend die Arme ausbreitete. »Na gut, meinetwegen. Obwohl ich glaube, dass Ihr einen Fehler macht. Aber was soll’s, ist Eure Entscheidung. Gott sei mein Zeuge.«
Katt nickte höflich und trat an ihm vorbei zur Tür. »Bitte, Herr, noch auf ein Wort …«
»Ja …?«
»Überlasst mir einen Krug Wein. Aber vom Tisch der hohen Herren. Und drei Laib Brot. Weißes Brot.«
»Jungfernbrot und Wein?« Von Kyrberg lachte spöttisch. »Warum nicht noch ein seidenes Wams für jeden und ein paar neue Stiefel dazu, hm?«
Katt lachte nicht und der Graf sah ihn an, wartete, ob er noch etwas sagen würde. Dann seufzte er ergeben. »Also gut. Ich nehme an, Ihr werdet Eure Gründe haben.«
»Seid versichert, mein Herr, die habe ich.«
Von Kyrberg sagte nichts mehr und sah zu, wie der Templer durch die Tür in der Dämmerung verschwand.
Mehr tot als lebendig hingen die drei Männer in den hölzernen Halskrausen des Prangers, die Körper triefend nass vom kalten Schneeregen.
Katt stand in dem breiten Tor, das in den Hof führte, ohne in den Regen hinauszutreten. Der Wächter neben ihm zog geräuschvoll die Nase hoch und kratzte sich am Bauch.
»Mach sie los!«, befahl Katt.
Der Knecht trat zu den drei armen Teufeln und der Ritter sah, wie der Mann erst die eisernen Ketten von den Füßen, dann die Bolzen von den Schandgeigen entfernte. Dumpf polterten die Holzbretter auf den Boden. Schwere, massive Eiche. Es war Teil der Strafe, sie als Bürde auf den Schultern zu spüren, Stunde um Stunde mehr. Die Verurteilten lehnten sich erschöpft aneinander. Der Knecht deutete auf Katt, der noch immer in dem breiten Torbogen stand, die Arme vor der Brust verschränkt, geduldig wartend. Der Jüngste der drei taumelte los, gefolgt von den anderen zwei Männern. Einmal fiel einer von ihnen zu Boden und der Knecht trat ihn grob mit dem Fuß, damit er sich wieder erhob. Als sie vor Katt standen, gebot der ihnen, ihm zu folgen. Er ließ sie in eine der Torkammern eintreten und auf dem strohbedeckten Boden niedersetzen.
»Der Rest der Strafe ist euch erlassen!«
»Und die Peitsche …?«, hauchte der Jüngste der drei kaum hörbar.
»Auch die Peitsche.«
Der Bursche schnappte nach Luft und Tränen schossen ihm in die Augen. Er fuhr sich mit dem Ärmel über das Gesicht und zitterte heftig.
»Ihr steht nun in meiner Schuld!«, sagte Katt.
Alle drei Männer nickten hastig.
»Das heißt, ihr dient mir! Mir allein! Und nur ich oder der Tod entbinden euch von dieser Schuld. Habt ihr das verstanden?«
»Ja, Herr«, sagte Rufus.
Die beiden anderen murmelten zustimmend. Katt drückte jedem einen Brotlaib in die Hand. Die Männer machten große Augen. Weißes Brot, so hell wie die Haut eines jungen Mädchens. Daher der Name für diese Köstlichkeit. Jungfernbrot! So etwas aßen nur die feinen Leute. Jawohl, sie aßen es zur Gänze auf und nahmen es nicht wie sonst das harte dunkle Brot als Geschirr bei einem Festmahl, um es am Ende den Armen oder den Schweinen zu geben.
Gierig rissen die Männer große Stücke ab und stopften sie sich in den Mund. Katt ließ sie essen. Dann, nach einer Weile, kauten sie langsamer, immer noch schweigend. Ab und zu schlossen sie die Augen, während sie weiter schluckten und jetzt geradezu andächtig kauten. Als dann der Weinkrug von Hand zu Hand wanderte, jeder von ihnen erst zaghaft ansetzte, dann gierig trank, verklärten sich ihre Gesichter. Der Mann, den man Rufus nannte, leckte sich die Lippen und wog anerkennend den Kopf.
»Esst, trinkt!«, sagte Katt. »Dann werdet ihr schwören.«
Sie sahen ihn an, warteten darauf, was er noch sagen würde.
»Wer das nicht will, muss es nicht tun«, erklärte er weiter. »Er darf sein Brot in aller Ruhe aufessen. Dann aber wird er die Burg verlassen und nie mehr zurückkommen. Habt ihr auch das verstanden?«
»Ja, Herr …«
»Gut. Dann esst und trinkt jetzt. Und dann schwört.«
Zweiter Teil der Akten zu jenen Ereignissen im Frühjahr des Jahres 1190 des Herrn
Ich war zu jener Zeit tatsächlich damit beschäftigt, einen Plan zu entwerfen, der den Machtanspruch des Kaisers deutlich sichtbar machen sollte.
Der Gedanke dabei war, wie es denn wäre, wenn eine Tat des Kaisers die Kritiker aller Lager auf einen Schlag hin verstummen lassen könnte? Welche Tat dies sein könnte, wusste ich noch nicht zu sagen. Aber es musste etwas sein, was so gut durchdacht war, dass es auch der Kaiser selbst so erdacht haben könnte. Dieser Gedanke erfüllte mich. So sehr, dass ich oftmals an nichts anderes denken konnte. Der Grund ist einfach gewesen: weil mir dieser Gedanke gefiel. Und es gefiel mir zudem auch, Teil eines großen Handelns zu sein.
Ich erhielt bald darauf ein weiteres Papier, dieses Mal von Herrn Rainald von Dassel (der sich immer als des Kaisers besonderer Günstling bezeichnet, Arschkriecher, der er ist!).
Das Papier erklärte in langen geistlosen Worten, dass wir Deutsche ein imperiales Verständnis von der Welt hätten. Das sei der Grund, warum wir den Papst und sein Wort nicht anerkennen wollten! Von dem lächerlichen und schmähenden Inhalt einmal abgesehen, sind und waren diese Behauptungen nicht grundsätzlich falsch. Nur, was kann daran so falsch sein, wenn ein starker Souverän auf der Kraft und damit Macht seines Wortes besteht? Es ist und war keine Niedertracht in jenem Ansinnen (auch wenn das die Kirchenfürsten Barbarossa ständig unterstellten) und erst recht kein Geheimnis, wenn man sagt:
Das Wort des deutschen Kaisers stehe über dem Wort Roms!
Und zwar für alle Zeiten!
Bevor ich hier ins Detail gehe, rekapituliere ich noch einmal die Brisanz dieser Behauptung und des daraufhin bekräftigten Anspruchs des Heiligen Stuhls in Rom: allein die Kirche stehe über der weltlichen Nation.
(Dieses widerliche römische Gekläffe bringt mich selbst jetzt, mit dem Abstand des Gehörten, noch immer zur Weißglut!)
Die Behauptung war und ist natürlich lächerlich!
Wir Dienstmänner, die wir um des Kaisers Wohl bedacht, wussten natürlich um die erneute Vehemenz dieses wiederholt vorgebrachten Anspruchs. Das ging ja ständig so. Seit Menschengedenken wurde Rom nicht müde, dies immer und immer wieder aufs Neue zu behaupten (selbst wenn es an der Lächerlichkeit der Behauptung nichts änderte). Wenn dann Fürsprecher des Papstes, so wie jener Johannes von Salisbury, sich so ereifern, dann haben derlei Worte natürlich durchaus Gewicht. Zur damaligen Zeit (… und ich meine damit die Wochen des Jahreswechsels 1189/1190), sahen die Diener des Kaisers dies jedoch gelassen. Viel zu gelassen, wie ich mir später immer sagte. Und seinerzeit zitierte ich Jesus Christus, der einst sagte, man solle sich vor jenen hüten, die lange Gewänder mit Quasten tragen!
Diese Worte sprach ich im engsten Kreis der Dienstherren und ich fügte zudem an, dass, wenn sich noch mehr hohe Geistliche an dieser endlosen Debatte beteiligen würden, es so immer mehr Fürsprecher für den Stuhl Petri geben würde. Und das galt es zu verhindern. Und zwar beizeiten!
Dafür musste ich mich verspotten lassen!
Allen voran Wichmann von Magdeburg. Er weigerte sich strikt, meine Warnung ernst zu nehmen. Zu der Zeit konnte er das leicht tun. Friedrich, unser Kaiser, war anderweitig beschäftigt und somit von den Staatsgeschäften abgelenkt. Die Kriege gegen die lombardischen Städte erforderten seine ganze Aufmerksamkeit und so war er öfter in Italien auf dem Schlachtfeld anzutreffen als in den Kaiserpfalzen am Rhein. Wichmann, den ich in diesen Zeiten vor allem als Intriganten kennenlernte (widerlicher Emporkömmling, der!), brachte ja ständig neue Akten ins Spiel, die er als »Briefe« bezeichnete. Darin ward der Staufer als »Herr der Welt« und als »Fürst der Fürsten dieser Erde« besungen.
Also, wo lag denn da eine Gefahr?, fragte er laut.
Ich frage aber damals wie heute: Wen sollten derlei »Briefe« denn beruhigen? (Zumal Wichmann den Verfasser der Schriften nicht nennen konnte.) Für ihn waren sie Beweis genug, dass an der Stärke Friedrichs nicht gezweifelt werden brauchte. Die Stimmung pro Barbarossa war gut. Briefe wie diese der Beweis dafür. Ich aber dachte schon damals, dass Wichmann tatsächlich dumm genug war, zu denken, es wäre alles gut, weil er ein Loblied auf den Kaiser verlas. Er war wahrhaftig der Ansicht, dieses ganze Pack an Reichsbischöfen wäre ein charakterloser Haufen von Kirchenmännern.
Mir war das alles zu einfach gedacht.
Mein Ziel war ein ganz anderes und damit auch mein Vorgehen. Ich drängte von jeher darauf, die deutschen Kirchenfürsten der Reihe nach für unsere Seite zu gewinnen. Diplomatie statt Schmähung und unverhohlene Arroganz.
Deshalb begann ich bereits vor Jahren bei Friedrichs Onkel, Otto von Freising, um dessen Stimme zu werben. Er beschrieb in seinem großen Werk, die »Geschichte zweier Staaten«, den Unterschied zwischen dem guten himmlischen und dem bösen irdischen Reich (wobei er damit einen Staat gleichermaßen meinte).
Zu lesen keine leichte Kost. (Dass Wichmann bereits daran scheiterte, zeugt von seiner geringen Fähigkeit, zu denken und zu verstehen!)
Doch weiter: Als Otto von Freising verstarb, übernahm der Freisinger Kapellan, Notar und Privatsekretär Ottos, namentlich Rahewin, die Fortführung des Werkes. Es ist nun beinahe vollständig (zumindest behauptet Rahewin dies so). Darauf gab ich damals nichts und ich tue es auch heute nicht. So sehr ich auch buhlte, die Freisinger stehen aufseiten des Papstes und gelten somit nicht als Unterstützer der Krone. (Warum Rahewin das Werk des Bischofs trotzdem fortführt, weiß der Himmel. Hat er sonst im Leben nichts zu tun?) Wie dem auch sei, ich habe zu Rahewin keinerlei Verbindung mehr und schon deshalb misstraue ich ihm.
Ich, Graf Albrecht Raimund Manfred von Kyrberg, bezeuge die hier von mir eigenhändig verfassten Zeilen im Vollbesitz meiner Gedanken.
*
Katt traf die Gräfin Isabella von Kyrberg zum ersten Mal unweit der Stallungen.
Eine bestimmte Vorstellung hatte er nicht von ihr und so fand er sie auf den ersten Blick recht ansehnlich. Hohe Stirn, ein voller Mund, zarte Wangenknochen. Große wache Augen, ein heller Blick. Sie schien eine schlanke Figur zu haben. Ganz genau ließ sich das nicht erkennen, denn sie trug einen langen ärmellosen Mantel aus dick gewebtem Wollstoff, der ihr wie ein Umhang um die Schultern lag. Darunter ein einfaches schmuckloses Leinenkleid, das bis auf den Boden reichte. Auf dem Kopf der übliche Schleier, unter dem Kinn straff gebunden. An den schmalen Händen trug sie feine weiche Lederhandschuhe in dunkelgrüner Farbe, die entgegen der Mode, noch vor dem Handgelenk endeten.
Er schätzte sie auf etwa dreißig Jahre und je länger er sie betrachtete, um so mehr drängte ihn die Frage, warum sie ins Kloster gehen wollte? So wie sie aussah, wäre sie doch bestimmt zu verheiraten gewesen. War sie zu arm und somit keine »gute Partie«? Oder war es ihr nicht möglich, Kinder zu gebären? Diesen Umstand hätte er sogar verstanden. Frauen in diesem Alter waren ja längst verheiratet und hatten wenigstens ein halbes Dutzend Kinder geboren. Selbst wenn sie aus dem Adel stammten. Von jeher galt es Besitz durch die Eheschließung zu sichern oder gar zu vergrößern. Nur war sie eigentlich schon beinahe zu alt für eine Ehe, stellte er fest.
Sie hatte sich eine Stute ausgesucht und er fand ihre Wahl gut. Ein noch recht junges Pferd mit hellbraunem Fell und einer schneeweißen Blesse auf der Nase, schlank gewachsen, feinnervig, kein bisschen nervös.
Während Katt das Pferd musterte, warf er immer wieder einen kurzen verstohlenen Blick auf sie. Er wusste nicht recht, wie er sie begrüßen sollte. Die Sitte verlangte von ihm als Rangniederem eine höfliche, aber zurückhaltende Geste. Doch er hatte keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Also verbeugte er sich nur tief vor ihr.
Von Kyrberg erklärte, dass seine Nichte nach wie vor im Stand einer Gräfin war. Erst an ihrem Reiseziel wollte sie allem entsagen, um in den Orden einzutreten. Katt beugte daraufhin vor ihr die Knie und küsste ihr die Hand. Das war ehrerbietig für ein hohes Fräulein, wie man eine unverheiratete Edle allgemein nannte, respektvoll dazu und keineswegs falsch.
Der Graf wollte wissen, wie weit Katt mit seinen Vorbereitungen war. Der begann daraufhin zu erklären, wie er sich die Ausrüstung für die Reise vorstellte. Je ein Reitpferd für das hohe Fräulein und ihn selbst und zusätzlich ein Saumpferd als Ersatz. Dazu noch drei Maulesel, beladen mit Vorräten, wollenen Decken, einem Wetterschutz aus grobem Leinen für die Gräfin, Ziegenlederschläuche für das Trinkwasser, etwas Wein in versiegelten Krügen. Nicht zu vergessen seine Waffen: Schild, Helm und ein Schwert. Keine Lanze, kein Kettenhemd. Beides war zu schwer und wenig hilfreich bei dieser Art von Geleit. Eher Handwaffen, also eine Streitaxt und kurze Spieße für die Knechte, einen guten Langbogen und ein Köcher mit ausreichend Pfeilen für den Bogenschützen. Zum Schluss das, was jeder für sich selbst brauchen würde. Die drei Knechte würden zu Fuß gehen, versehen mit dem, was sie am Leibe trugen. Am Ende wies Katt darauf hin, dass er das Gewand der Gräfin für die Reise nicht besonders praktisch fand. Darauf ging von Kyrberg nicht weiter ein und Isabella lächelte nur still.
Nach diesen Ausführungen des Templers war der Graf mit allem einverstanden und setzte den Reisebeginn für den nächsten Morgen fest. Er wies darauf hin, dass sie so früh wie nur irgend möglich aufbrechen sollten. Seiner Ansicht nach war es besser, wenn möglichst wenig Augen und Ohren ihren Aufbruch mitbekamen. Das verstand Katt nur zu gut. Mit einem kurzen Gruß zog sich von Kyrberg zurück und ließ seine Nichte mit dem Ritter allein.
Die Gräfin war eine der Steintreppen hinauf zu den breiten Wehrmauern gestiegen. Katt folgte ihr höflich in einigem Abstand. Oben angekommen, stand sie da und sah über das weite, von Wäldern bedeckte Land. Die letzten Regenwolken der Nacht waren fortgezogen, die Luft war klar, aber eisig. Isabella zog ein weißes Tüchlein aus ihrem Ärmel und tupfte sich damit dezent die Nasenspitze. Dies fand Katt irgendwie elegant.
»Bitte, Herr Albrecht, sagt mir, wie lange werden wir wohl unterwegs sein?«
Erst jetzt fiel ihm auf, dass sie bisher noch kein Wort miteinander gesprochen hatten. Er räusperte sich umständlich. »Nun, wenn wir schnell genug vorankommen und …«
Er stockte in seiner Rede. Sie sah ihn an und lächelte. Grüne Augen! Sie hat grüne Augen! Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Und Gott, der Gerechte, wie sie einen damit ansieht! Als ob sie durch mich hindurchsehen könnte!
»… nicht allzu lange, denke ich …«, hörte er sich sagen.
Die Antwort schien ihr zu genügen. Sie sah ihn weiterhin nur an, als wolle sie noch eine Frage stellen. Katt fühlte sich ein wenig unbehaglich und hätte nicht sagen können warum. Vielleicht lag es an ihrem Blick. Ein kluger Blick, wie er fand. Neugierig, herausfordernd, prüfend. Er mochte es jedoch nicht, wenn man ihn so prüfend ansah. Aber bei allem, was mir heilig ist, dachte er auf einmal, ich werde mir von einem Weibsbild bestimmt nichts sagen lassen. Selbst wenn sie im Rang über mir steht. Ich allein bin der Verantwortliche für dieses Geleit und somit gilt mein Wort!
»Habt Ihr eben etwas gesagt, Herr Albrecht?«, fragte sie.
»Nein, hohes Fräulein. Vielleicht laut gedacht. Passiert mir manchmal.«
Für diese Worte hätte er sich gleich auf die Zunge beißen wollen. Was redete er da nur? Das ging dieses Frauenzimmer doch gar nichts an!
»Erlaubt mir, Euch noch eine Frage zu stellen«, begann sie erneut.
»Aber natürlich, hohes Fräulein!«
»Habt Ihr schon einmal ein Geleit angeführt?«
»Jawohl, das habe ich, hohes Fräulein.«
Wieder blickte sie ihn fragend an.
»Im Heiligen Land«, fügte er hinzu. »Ist aber lange her.«
»Das klingt aufregend …«
Katt hob nur die Schultern. »Nicht so aufregend, wie Ihr vielleicht glauben möchtet, hohes Fräulein.«
Sie lächelte. »Vielleicht haben wir Gelegenheit, dass Ihr mir davon etwas erzählt. Ich mag Geschichten, müsst Ihr wissen …«
»Natürlich, warum nicht?«, begann er höflich ausweichend.
Er räusperte sich. »Ein Wort noch zu den Maultieren …«
Sie sah ihn aufmerksam an.
»Die Tiere mögen es nicht, wenn man ihnen zu viel aufbürdet.«
Jetzt legte sie den Kopf ganz leicht schief.
»Dann werden sie störrisch«, erklärte er weiter. »Ich bitte Euch, wählt also mit Bedacht, was Ihr mitnehmen wollt.«
»Ihr meint, ein paar Hemden und wollene Strümpfe sollten ausreichen, ja?«
Er hob wie ratlos die Schultern und sie lächelte noch immer.
»Noch etwas, worauf ich achten sollte, Herr Albrecht?«, fragte sie dann.
»Nun, wie Euer Oheim bereits sagte: Wir wollen unauffällig reisen in diesen Zeiten.«
»Natürlich. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Ihr mit allem Unbill zurechtkommen werdet.«
Katt räusperte sich erneut. Wieso sagte sie das jetzt?
»Mag sein …«
Er räusperte sich wieder und hätte im Moment für einen Schluck Wasser weiß Gott was gegeben. »Also, es gibt noch einiges zu tun, bevor wir aufbrechen. Wenn Ihr mich nun bitte entschuldigen wollt, hohes Fräulein?«
»Nein«, sagte sie nur.
»Hohes Fräulein …?«
»Ich sagte, nein! Ich entschuldige Euch nicht, Herr Albrecht, denn ich habe noch Fragen an Euch.«
Das fing ja gut an! Was, bei allen Heiligen, wollte sie denn noch? Es war doch alles gesagt!
»Herr Albrecht, ist Euch jenes Frauenleiden bekannt?«
»Was?«
»Wir Frauen sind doch das eine oder andere Mal unpässlich. Oder wusstet Ihr das etwa nicht?«
»Wie? Ja, nun … ich, doch, ich weiß schon … davon hab ich gehört, ja.«
»Also habt Ihr davon Ahnung?«
Er fühlte sich bei dieser Frage unbehaglich und hob erneut die Schultern. »Ahnung? Nun, wie ich sagte, ich habe davon gehört. Ahnung würde ich das wohl nicht nennen …«
»Ich möchte Euch schon jetzt darum bitten, mir nicht gram zu sein, wenn ich Euch deshalb über Gebühr aufhalten sollte«, meinte sie.
»Aber nein, nur keine Sorge, hohes Fräulein. Gewiss wird eine Rast möglich sein, sollten es die Umstände verlangen.«
Sie lächelte ihn dankbar an. »Das beruhigt mich, Herr Albrecht.«
»Waren das der Fragen genug?«
»Nein, noch nicht …«
Katt bemühte sich, sich seine Verwirrung wie auch den leisen Unmut nicht anmerken zu lassen.
»Herr Albrecht, bei Eurem Geleit im Heiligen Land. Galt da Euer Dienst einem hohen Fräulein oder gar einer ehrenwerten Frau?«
Er sah sie an und überlegte, was er antworten sollte.
»Beidem«, sagte er dann. »Also sowohl als auch …«
Er fand seine Antwort eher ungenau, aber sie war ihm so rausgerutscht.
»Und? Wie war es da?«, wollte sie wissen.
Er hustete jetzt kurz. »Ihr meint jene … Unpässlichkeiten?«
Sie lächelte höflich. »Ja, die auch …«
»Eine Rast war natürlich immer möglich gewesen, hohes Fräulein.«
»Natürlich. Ich verstehe.«
Sie lächelte ihn an. Er fand sie noch immer ansehnlich. Aber wenn er es recht bedachte auch ein wenig zu neugierig. Nein mehr noch, er hielt sie für penetrant und er müsste sich in seiner Einschätzung schon sehr irren. Und warum, bei allen Heiligen, stellte sie ihm so eine Frage?
»Nun bin ich wirklich beruhigt, Herr Albrecht.«
»Ja, wie schön …«, murmelte er mehr für sich.
»Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen.«
»Was? Ja, sicher, warum auch nicht, hohes Fräulein. Ganz bestimmt …«
Jetzt lächelte sie erneut und Katt lächelte dünn zurück. Dann ließ sie ihn gehen. Er stellte fest, dass er anfing, seinen Auftrag ein klein wenig zu bereuen.
Der erste Tag
Es war noch dunkel und am Himmel war noch nicht einmal eine Ahnung des kommenden Tages zu sehen.
Katt ließ die Männer im fahlen Schein der Fackeln die Tiere bepacken. Sie waren noch damit beschäftigt, als Rufus vor ihn hintrat. Bevor Katt etwas sagen konnte, fiel der Mann vor ihm auf die Knie und küsste ihm die Hand. Seine Art zu danken, vermutete Katt. Er war sich im Klaren darüber, dass Rufus zweifelsohne wusste, was ihm durch den Erlass der restlichen Strafe erspart geblieben war.
»Sei stets wachsam!«, sagte Katt nur und Rufus nickte hastig.
Dann erhob er sich wieder und half weiter, die Maultiere zu beladen.
Katt sah ihm nach. War ein guter Mann und es konnte nicht schaden, auf ihn zu bauen. Ich werde ein besonderes Auge auf ihn haben, dachte er weiter, während er der Reihe nach die Sattelriemen überprüfte. Er fand dann, dass der Riemen bei der Stute der Gräfin straffer sein könnte. Katt winkte Johannes, den Bogenschützen, zu sich und befahl ihm, den Gurt fester zu ziehen. Als er sah, wie geschickt sich der Mann dabei anstellte, war er beruhigt. Katt wusste nicht viel von ihm. Nur dass er sich aufs Bogenschießen verstand und gerne etwas trank. Betrunken jedoch musste man sich vor ihm in Acht nehmen, so hieß es.