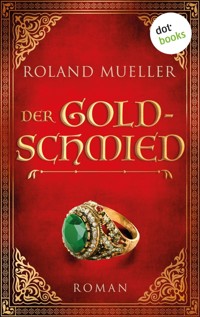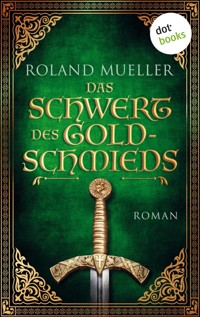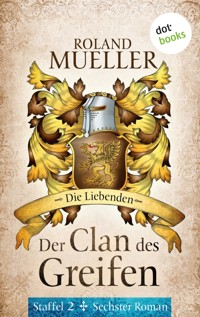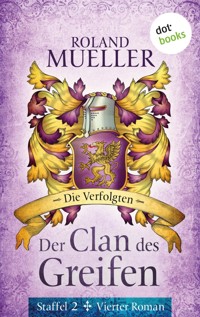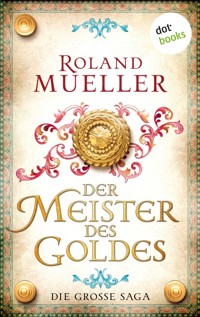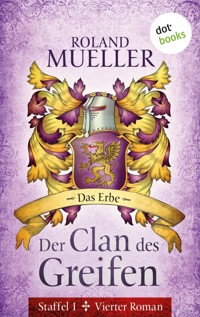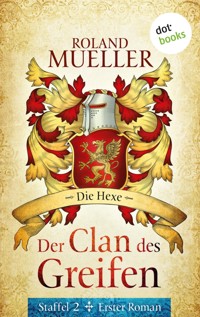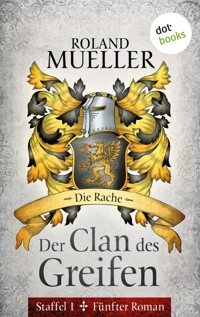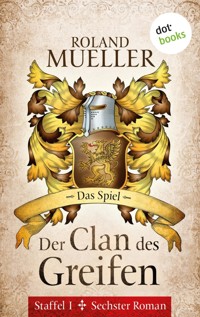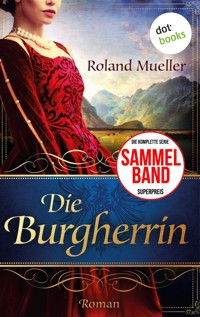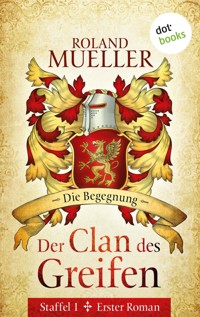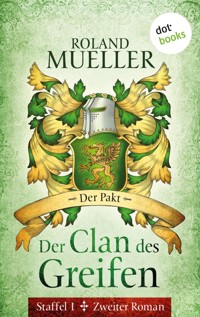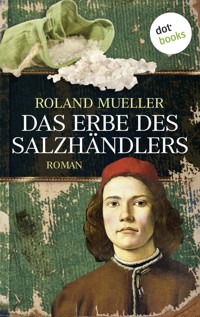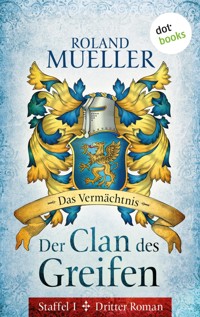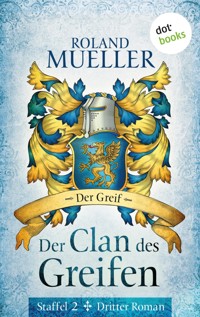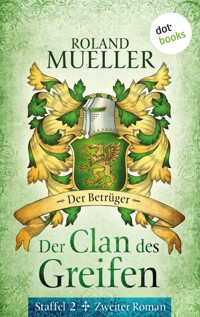Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Burgherrin
- Sprache: Deutsch
Sie kämpft für ihre Familie: Das historische Epos "Die Kinder der Burgherrin" von Bestsellerautor Roland Mueller jetzt als eBook bei dotbooks. Südtirol im 15. Jahrhundert: Sie sind die Erben der Gräfin Eleonore von Greifenberg. Doch während die Burgherrin alles für den Erhalt ihrer Familie und des Lehens tut, droht ihr ungezügelter und jähzorniger Sohn Wolf, die wohldurchdachten Pläne seiner Mutter zu durchkreuzen. Auch Tochter Friederike begehrt auf und weigert sich, den Mann zu heiraten, dem sie versprochen ist. Und Frieder wirft ein Auge auf eine Frau, die für ihn unerreichbar ist. Damit bringen die Kinder der Gräfin nicht nur die Ehre der von Greifenbergs in höchste Gefahr, sondern drohen, die gesamte Familie von innen heraus zu zerstören. Denn ausgerechnet bei der großen Hochzeit kommt es zur Katastrophe … Sechs Romane in einem Band! Die gesamte zweite Staffel der Erfolgsserie "Der Clan des Greifen" von Roland Mueller jetzt unter dem Titel "Die Kinder der Burgherrin" als eBook kaufen und genießen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Südtirol im 15. Jahrhundert: Sie sind die Erben der Gräfin Eleonore von Greifenberg. Doch während die Burgherrin alles für den Erhalt ihrer Familie und des Lehens tut, droht ihr ungezügelter und jähzorniger Sohn Wolf, die wohldurchdachten Pläne seiner Mutter zu durchkreuzen. Auch Tochter Friederike begehrt auf und weigert sich, den Mann zu heiraten, dem sie versprochen ist. Und Frieder wirft ein Auge auf eine Frau, die für ihn unerreichbar ist. Damit bringen die Kinder der Gräfin nicht nur die Ehre der von Greifenbergs in höchste Gefahr, sondern drohen, die gesamte Familie von innen heraus zu zerstören. Denn ausgerechnet bei der großen Hochzeit kommt es zur Katastrophe …
Sechs Romane in einem Band! Die gesamte zweite Staffel der Erfolgsserie »Der Clan des Greifen« von Roland Mueller jetzt unter dem Titel »Die Kinder der Burgherrin«.
Über den Autor:
Roland Mueller, geboren 1959 in Würzburg, lebt heute in der Nähe von München. Der studierte Sozialwissenschaftler arbeitete in der Erwachsenenbildung, als Rhetorik- und Bewerbungstrainer und unterrichtet heute an der Hochschule der Bayerischen Polizei. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher.
Bei dotbooks veröffentlicht sind bereits Roland Muellers historische Romane:»Der Goldschmied«»Das Schwert des Goldschmieds«»Im Land der Orchideenblüten«»Das Erbe des Salzhändlers«»Der Fluch des Goldes«Die beiden historischen Romane »Der Goldschmied« und »Das Schwert des Goldschmieds« sind ebenso als Sammelband unter dem Titel »Der Meister des Goldes« verfügbar.
Außerdem hat Roland Mueller bei dotbooks die historische Serie »Der Clan des Greifen« veröffentlicht, die folgende Bände umfasst:»Die Begegnung. Staffel I – Erster Roman«»Der Pakt. Staffel I – Zweiter Roman«»Das Vermächtnis. Staffel I – Dritter Roman«»Das Erbe. Staffel I – Vierter Roman«»Die Rache. Staffel I – Fünfter Roman«»Das Spiel. Staffel I – Sechster Roman«»Die Hexe. Staffel II – Erster Roman«»Der Betrüger. Staffel II – Zweiter Roman«»Der Greif. Staffel II – Dritter Roman«»Die Verfolgten. Staffel II – Vierter Roman«»Die Braut. Staffel II – Fünfter Roman«»Die Liebenden. Staffel II – Sechster Roman«Die komplette Serie ist außerdem in den drei Sammelbänden »Die Burgherrin«, »Die Kinder der Burgherrin« und »Das Vermächtnis der Burgherrin« enthalten.
Daneben hat Roland Mueller die beiden historischen Kinderbücher »Die abenteuerliche Reise des Marco Polo« und »Der Kundschafter des Königs« bei dotbooks veröffentlicht.
***
eBook-Sammelband und -Neuausgabe Januar 2017
Die Einzelbände dieses Sammelbands sind bereits unter den folgenden Titeln 2016 bei dotbooks GmbH, München erscheinen:
»Der Clan des Greifen. Staffel II. Erster Roman: Die Hexe«
»Der Clan des Greifen. Staffel II. Zweiter Roman: Der Betrüger«
»Der Clan des Greifen. Staffel II. Dritter Roman: Der Greif«
»Der Clan des Greifen. Staffel II. Vierter Roman: Die Verfolgten«
»Der Clan des Greifen. Staffel II. Fünfter Roman: Die Braut«
»Der Clan des Greifen. Staffel II. Sechster Roman: Die Liebenden«
Copyright © der Originalausgabe2016 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Sammelband-Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Anja Rüdiger
Titelbildgestaltung: Nele Schütz unter Verwendung von shutterstock/Olga Rutko
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-905-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Kinder der Burgherrin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Roland Mueller
Die Kinder der Burgherrin
Roman
Der Clan des Greifen - die komplette zweite Staffel in einem eBook
dotbooks.
Buch 1Die Hexe
Im Frühjahr des Jahres 1414 war Eleonore von Greifenberg fest davon überzeugt, dass das Lehen vor einem Neuanfang stand. Zwar hatte sie die Wiedergutmachung an die Stadt Bozen noch nicht bezahlt, aber sie war sich sicher, es dieses Mal aus eigener Kraft schaffen zu können. Kein neuer Kredit mehr! Das hatte sie sich geschworen. Diese eine letzte Zahlung würde noch einmal schmerzhaft für die Finanzen des Lehens werden. Doch sie sollte gleichzeitig das Ende aller Verbindlichkeiten gegenüber den Städtern markieren. Leider hatte Hagen mit dem Rat der Stadt nicht mehr als einen Aufschub aushandeln können. Doch immerhin wollte man den Greifenbergs die Strafsumme ein ganzes Jahr lang stunden.
Nun war Eleonore voller Pläne und Ideen für dieses neue Jahr. Als Erstes wollte sie sich um ein besseres Verhältnis zum Kloster bemühen. Die Mönche dort hatten den, von Eleonores Söhnen verübten, Überfall noch längst nicht verwunden. Der Abt hatte sogar den künftigen Schwiegersohn der Gräfin, Urs von Weil, um Schutz gebeten. Einen Schritt, den sie nicht verhindern konnte. Allerdings war Urs bislang diesem Wunsch nicht gefolgt, wenn sie auch den Grund dafür nicht kannte. Aber sie war froh darüber. Sobald als möglich wollte Eleonore dem Abt des Klosters persönlich den Vorschlag unterbreiten, die Handelsstraße, die das Lehen durchquerte, gemeinsam auszubauen. Zu diesem Plan gehörten eine weitere Brücke über den Fluss und eine neue Straße unweit der Burg. Eleonore wollte die Arbeiter stellen und sie auch verköstigen, wenn das Kloster im Gegenzug dafür die Kosten für das Baumaterial und die Löhne übernahm. Die später einmal anfallenden Zollgebühren sollten dann unter beiden Seiten aufgeteilt werden. Mit diesem Vorschlag verband Eleonore zudem eine besondere Form der Buße. Um den Überfall ihrer Söhne auf das Kloster zu sühnen, wollte sie eine Kapelle bauen lassen. Hagen führte die Verhandlungen mit den Klosterbrüdern in ihrem Auftrag. Damit ersparte Eleonore ihren beiden Söhnen wie auch den frommen Brüdern die Peinlichkeit, einander gegenüberzutreten.
Die Mönche waren ihrem Vorschlag nicht abgeneigt und beseelt von diesen ersten guten Nachrichten des Jahres, ritt die Gräfin von nun an wieder öfter durch das Land. Immer war Hagen jetzt an ihrer Seite. Sie ermutigte in jedem Dorf und in jedem Weiler die Bauern, mehr Wälder und Brachland zu roden und die Sümpfe trockenzulegen, um so neues Ackerland zu gewinnen. Zudem ließ sie noch weitere Fischteiche anlegen. Außerdem sollten mehr Treibjagden als früher durchgeführt werden, denn die Schäden durch die zahlreichen Wildschweine waren immens. Die Treiber sollten großzügig mit Fleisch belohnt werden. Außerdem erlaubte sie den Hirten, ihre Schafherden auf dem gesamten Lehnsgrund weiden zu lassen. Sie verlangte kein Weidegeld mehr dafür und hoffte so auf eine stete Vergrößerung der Herden. Was sich nicht änderte, waren die Abgaben der Bauern. Die Höhe des »Zehnt« blieb gleich, allerdings durften die Familien die Zahlung der Abgaben an die Burg über das ganze Jahr ausdehnen. Sogar die Stundung auf ein weiteres Jahr wollte Eleonore erlauben. All diese Entscheidungen entstammten ihren Plänen, die sie den Winter über geschmiedet hatte.
Nur auf eine Frage hatte Eleonore noch keine Antwort gefunden: Wie sollte es zwischen ihr und Hagen weitergehen? Wann wollten sie ihr Zusammensein offiziell machen? Wobei sie beide überzeugt davon waren, dass sämtliche Burgbewohner längst Bescheid wussten. Auch wenn es kein loses Wort gab. Der Respekt vor ihr wie auch vor Hagen war zu groß. Nur wenn sie die Burg verließ, um über Land zu reiten, dann kursierten allerlei Geschichten. Doch daraus machte sich Eleonore nicht viel. Im Grunde war sie ganz zufrieden mit der Situation, die es ihr erlaubte, sich voll auf die Führung des Lehens zu konzentrieren. Doch was war mit Hagen? Wollte er mehr?
Die Ernennung ihres ältesten Sohnes Wolf zu ihrem Stellvertreter hatte keine großen Veränderungen gebracht. Nach wie vor trug sie die Hauptlast der Verantwortung. Auch wenn Hagen sie soweit wie möglich unterstützte. Die wenigen Begegnungen von Wolf und Frieder und dem alten Haudegen waren geprägt von Misstrauen und der mühsam unterdrückten Wut ihrer beiden Söhne. Vor allem Wolf hatte sichtlich Mühe, Hagen gegenüber höflich zu bleiben. Daher achtete Eleonore darauf, den alten Freund ihres Mannes von ihren beiden Söhne möglichst fernzuhalten.
Wolf und Frieder gingen nach wie vor ihrer eigenen Wege. Ihren Freund Lanfred von Marbur immer im Schlepptau, kamen sie nur ab und an zum Schlafen auf die Burg, um dann wieder zu verschwinden. Obwohl es alle ahnten, sprach niemand laut aus, womit die drei Burschen ihre Tage verbrachten. Und niemand wagte, sie darauf anzusprechen. Nicht einmal Eleonore.
Doch dies war nicht das Einzige, was man lieber im Dunkeln ließ. Denn auch die Frage, warum der Goldschmied und Kaufmann Heinrich Silberhorn nach seiner Freilassung niemals nach Bozen zurückgekehrt war, blieb im Grunde unbeantwortet. Zwar hatte er sich samt Begleitung dorthin auf den Weg gemacht und Hagen versicherte, dass der Händler bei ihrer letzten Begegnung noch wohlauf gewesen war. Dennoch waren Silberhorn und sein Gefolge niemals in der Stadt eingetroffen. Um allen Geschichten und Gerüchten um diesen Umstand ein Ende zu setzen, bemühte man sich schließlich um eine offizielle Erklärung: Die schrecklichen Erlebnisse während seiner Entführung und Gefangenschaft hatten ihn angeblich so sehr verletzt und verbittert, dass er lieber darauf verzichtete, mit Bozen noch weitere Geschäfte zu machen. Diese Erklärung schien den meisten Menschen zu genügen. Nicht so Robert Caldio, dem wohlhabenden Papierhändler und einflussreichen Mitglied des Rats der Stadt. Er ließ auf eigene Rechnung nach dem Verschollenen suchen. Etliche Ratsmitglieder unterstützten ihn darin, wenn auch nur heimlich. Schließlich wollte man die Angelegenheit so schnell wie möglich vergessen. Und die finanziellen Verluste sollten durch die anstehende Entschädigungszahlung der Greifenbergs ausgeglichen werden. Doch Caldio war das nicht genug. Er und ein paar weitere Kaufleute der Stadt hatten Andachtsbilder, Madonnenschreine, kostbare Leuchter, sowie Kelche und Monstranzen bei Silberhorn bestellt, um damit gute Geschäfte zu machen, auf die sie nun nur ungern verzichteten. Außerdem hatte Silberhorn erhebliche Anzahlungen für diese Waren erhalten. Was war mit diesem Geld geschehen? Dann allerdings mehrten sich die Berichte über erneute Überfälle. Nun wurden nicht mehr nur Handelszüge, sondern auch Pilger, ja, sogar bewaffnete Haufen Opfer der Räuber. Eleonore ließ mehrmals versichern, dass ihre beiden Söhne damit nichts zu tun hätten, was die Angst und die Unsicherheit der Einwohner nicht minderte. Zumal es weder Spuren noch Augenzeugen gab. Bald sprach man von einer unheimlichen Geisterhorde, die durch das Land zog, um wieder und wieder zuzuschlagen. Der Papierhändler war ratlos. Wollte Gott die Menschen einmal mehr prüfen? Diese Frage stellte sich nicht nur er allein, sondern auch die Geistlichen in den Kirchen. Doch im Gegensatz zu Meister Caldio beantworteten sie diese Frage gleich an Ort und Stelle: Ja, auch jetzt sollten die Menschen nicht aufhören, fest und innig zu glauben. Also flehten sie den Herrn des Himmels und alle Heiligen an, sie von diesen Schergen der Finsternis zu befreien.
Nach diesem Aufruf, von der Kirchenkanzel herab, besuchte eine weitere Abordnung des Rates die Burg. Was gedachte die Gräfin gegen die geisterhaften Räuber zu unternehmen? Eleonore selbst nahm zu den Gerüchten auf ihrem Grund und Boden keine Stellung mehr. Dafür machte Wolf, angeblich in Vertretung seiner Mutter, ein überraschendes Angebot: Er versprach, dass die Überfälle aufhören würden, wenn Bozen auf die Strafzahlung verzichtete. Denn dann wollte die Familie von Greifenberg als Lehnsverwalter persönlich die Sicherheit des Landes garantieren. Die Boten aus der Stadt berichteten bei ihrer Rückkehr von dem Stolz, den der junge Graf dabei an den Tag gelegt habe, und von da an hielt sich hartnäckig das Gerücht, Wolf sei längst der alleinige Herr auf Greifenberg.
Inzwischen war es April geworden und die ersten angenehm warmen Tage ließen auf ein mildes Frühjahr hoffen. Das Grün der Wintergerste drängte aus dem Boden, und die Obstbäume zeigten bereits so pralle Knospen wie selten zuvor um diese Jahreszeit. In diesen Tagen gewann noch ein weiteres Gesprächsthema immer mehr an Bedeutung: die Geschehnisse in Konstanz. Es schien, als folge die gesamte Christenheit dem Aufruf König Sigismunds von Böhmen, der die Stadt am großen See für das nächste Konzil vorgeschlagen hatte. Dort sollten wichtige Entscheidungen für die Christenheit fallen.
Eleonore verschwendete allerdings kaum einen Gedanken an die ferne Stadt am Bodensee. Sie konzentrierte sich auf das, was in ihrem Lehen geschah. Trotz der anhaltenden Überfälle ließ sie von ihren Plänen nicht ab und war fest davon überzeugt, dass dieses Jahr die Veränderungen bringen würde, die es möglich machten, das Lehen in eine neue, bessere Zukunft zu führen. Darin sollte die Herrin von Greifenberg recht behalten, denn tatsächlich würden einschneidende Veränderungen ihr Leben entscheidend verändern. Wenn auch ganz anders, als Eleonore es sich vorgestellt hatte.
Die gemeinsame Zeit mit Hagen empfand Eleonore als Geschenk. Vor allem die Nächte, die sie zusammen verbrachten. Bevor sie einschlief, lag sie dann still da und lauschte auf seinen gleichmäßigen Atem, wenn er neben ihr bereits eingeschlafen war. Ihre Gedanken waren dann oft bei den vertrauten Momenten, die sie beide verbanden. Spätestens dann stellte sie fest, wie gut er ihr tat. Es war alles so gekommen, als hätte es sich von unsichtbarer Hand gefügt. War dies Gottes Wille, oder war es ihr seliger Mann Wolfram, der die Geschicke aus einer anderen Welt lenkte? Liebte sie Hagen? Sie wusste es nicht. Bisher war sie fest davon überzeugt gewesen, dass sie all ihre Liebe ihren Kindern geschenkt hätte. Allen voran Wolf. Aber jetzt? Anfangs hatte sie Hagen mit ihrem seligen Mann verglichen. Doch das hatte sie bald aufgegeben. Warum auch? Es war eben alles so, wie es war. Hagen fragte nicht und vor allem bewertete er nichts, was sie tat. Er hieß es einfach gut, und er war für sie da, immer an ihrer Seite. Getreu dem Gesetz eines Ritters ging er in der Rolle des Beschützers und Gefährten auf. Dass er auch das Bett mit ihr teilte, gehörte inzwischen irgendwie dazu. Eleonore bemerkte sehr wohl, dass alles, was Hagen tat, sie zufrieden, ja, glücklich machte. Das war seine Art, ihr seine tiefe Zuneigung zu zeigen. Sie genoss es sehr, wenn er sie wie zufällig berührte, küsste, ihren Körper streichelte oder sie innig liebte. Lag es daran, dass sie diese Zärtlichkeiten so lange vermisst hatte? Oder war es, weil Hagen, wenn er bei ihr war, anders war als sonst? Dann war er nicht mehr der eher schweigsame Ritter, dessen wachsamen Augen nichts und niemand entging. Wenn sie allein waren, war er einfach nur Hagen. Der Mann, der all ihre Sinne berührte.
»Sie sind wieder mal fort.«
Hagen, neben ihr, antwortete nicht. Doch sie wusste, dass er nicht schlief.
»Hast du eine Ahnung, wo sie stecken könnten?«, fragte sie.
Eine Weile hörte sie nichts weiter, als seinen ruhigen, gleichmäßigen Atem.
»Nein«, antwortete er auf einmal.
Eleonore seufzte leise.
»Es heißt, sie gehen noch immer auf Raubzug.«
»Geschwätz.«
»Alle sagen es.«
»Eben weil es alle sagen, ist und bleibt es Geschwätz.«
»Liebster, ich habe so viele Leute dazu befragt und ...«
Sie sprach nicht weiter.
»Ja, und weiter?«, wollte Hagen wissen.
»Man weicht mir aus. Jedermann sagt, man hätte wohl davon gehört, aber mehr wisse man auch nicht zu sagen.«
Hagen antwortete ihr nicht gleich.
»Vergesst nicht«, begann er dann, »manche Menschen haben Freude daran, Geschichten zu erzählen, meistens ist nicht ein Körnchen Wahrheit dabei.«
Er seufzte tief, bevor er weitersprach. »Es sind nun mal unruhige Zeiten. Und es ist viel Gesindel unterwegs. Überfälle gibt es immer wieder.«
»Ach, Hagen, ich weiß nur nicht mehr, was ich glauben soll.«
»Meine Liebe. Dass die beiden damit zu tun haben, habe ich auch gehört, aber ...«
Er schwieg plötzlich, und sie ahnte, dass er nach den richtigen Worten suchte.
»Ich weiß auch nicht, ob es stimmt«, sagte er dann nur.
Eleonore war sicher, dass er es wusste. Oder zumindest annahm, dass Wolf und sein Bruder hinter den Überfällen steckten. Hagen war ja nicht dumm. Aber mit Sicherheit würde er damit nicht den kostbaren Moment zerstören, da sie so vertraut aneinandergeschmiegt die gemeinsame Zeit genossen.
»Der Rat der Stadt stundet mir das Strafgeld bis zum Fest der Heiligen Drei Könige im nächsten Jahr«, begann sie erneut. »Man hat mir versichert, ein Bote sei unterwegs, um das Pergament zu überbringen, auf dem alles genau geschrieben steht. Aber das gegebene Wort gilt bereits jetzt.«
Hagen lachte rau.
»Wie großzügig diese Städter auf einmal sind, nicht wahr?«
»Nicht großzügig genug«, seufzte Eleonore, »denn auf das Geld verzichten werden sie nicht.«
Hagen lachte erneut. »Ich hab so eine Ahnung, wer hinter all der Plänkelei steckt.«
»Meinst du etwa Herzfeld?«
»Ja, genau den meine ich. Wenn das keine Posse ist: Ausgerechnet er, der reiche Mann, der immer alles bekommen hat, was er haben wollte, muss auf das Kostbarste verzichten.«
Nach diesen Worten drückte er Eleonore zärtlich an sich. Ihre Fingerspitzen suchten nach seinem Mund, aber er nahm ihre Hand und küsste sie. Eleonore seufzte glücklich.
»Ihr Männer wollt immer alles erobern. Selbst eine Frau ist für einen Mann wie eine Burg, die es zu stürmen gilt.«
Hagen streckte sich neben ihr, dass die Bettstatt knarrte.
»Ja, so ist es. Und glaubt mir, Geliebte, so ein Sieg versüßt alles.«
Er tastete erneut in der Dunkelheit nach ihr, legte dann beide Arme um sie und küsste sie innig. Eleonore drückte sich dabei ganz fest an ihn und ihre Fingerspitzen fuhren prüfend über seinen vernarbten Körper. Sie erinnerte sich noch gut daran, dass es einmal eine Zeit gegeben hatte, da sie zu jeder Narbe ihres seligen Mannes die entsprechende Geschichte hören wollte. Würden Hagens Narben auch Geschichten über Wolfram erzählen? Geschichten, die sie noch nicht kannte? Nein, dachte sie, selbst wenn es sie gibt, will ich sie nicht hören. Mich interessieren nur Hagens eigene Geschichten und der Augenblick wird kommen, in dem er sie mir erzählen wird. Mit diesem Gedanken schlief sie ein.
***
»Verdammt, Bruder, ich rede mit dir!«
Frieder hob den Kopf. Wolf stand neben seinem Pferd, bereit aufzusteigen.
»Ich war in Gedanken«, murmelte Frieder müde.
»Das bist du oft in letzter Zeit«, sagte Wolf.
Als Frieder keine Anstalten machte, sich von seinem Platz zu erheben, um in den Sattel zu steigen, trat Wolf ungeduldig zu ihm.
»Du bist die ganzen Tage schon so seltsam. Beim Gehörnten, was ist los mit dir?«
Frieder schloss die Augen, atmete tief ein und sah dann seinen Bruder ernst an.
»Ich komme nicht mit euch.«
»Was ...? Sag das noch mal!«
»Warum? Weil du hoffst, ich ändere meine Meinung?«
»Frieder ...«
»Ich komme nicht mit euch.«
Wolf richtete sich auf. Er biss sich auf die Unterlippe und sah zu, wie die Söldner ihre Waffen überprüften, sich die Gesichter mit Ruß schwärzten, ihre Helme oder die sonst noch erbeuteten Rüstungsteile zurechtrückten, die fast alle von ihnen trugen. Tobias schob sich ein Messer in den Stiefelschaft. Wolf musste bei diesem Anblick beinahe lachen. Tobias, der längst nichts mehr zu sagen hatte und als einstiger Anführer der wilden Horde vollkommen in seinem Schatten stand. Tobias, dem dies offenbar nichts weiter auszumachen schien, solange ihre Raubzüge erfolgreich waren. Wolf sog langsam die Luft ein und wandte sich wieder an Frieder. Der ließ den Kopf hängen und starrte zu Boden. Wolf spürte die leise Wut, die ihn immer dann ergriff, wenn sich jemand seinem Wort widersetzte. Alle Männer waren nun bereit zum Aufbruch. Ein Großteil von ihnen ging nach wie vor zu Fuß, denn sie hatten nicht genügend Pferde, und keiner von den Kerlen konnte reiten. Es reichte völlig aus, dass sich immer zwei Männer ein Pferd oder ein Maultier teilten. Mehr schlecht als recht versuchten sie dann, sich im Sattel zu halten. Wolf betrachtete sie noch immer. Dieses Pack, dachte er auf einmal, sitzen wie Vogelscheuchen auf diesen Schindmähren. Das also ist mein kampferprobtes, tapferes Heer …
»Dann eben nicht«, knurrte Wolf, an Frieder gewandt. »Ruh dich aus, bis wir wiederkommen. Wir ziehen uns später in den Wald am Moostobel zurück. Du weißt, ja wo das ist und kannst schon mal vorausreiten.«
Ohne Frieders Antwort abzuwarten, stieg Wolf in den Sattel.
»Hört her!«, sagte er laut. »Vergesst nicht, heute geht es gegen Kerle mit Waffen. Gute Waffen. Die wir uns holen werden, verstanden?«
Sie nickten, statt einer Antwort. Wolf ließ einen Moment verstreichen, bevor er weitersprach.
»Dann ziehen wir uns zurück. Vielleicht gehen wir auch ganz und gar fort aus der Gegend hier. Weiter im Süden soll es besser sein.«
Er warf noch einmal einen Blick auf Frieder. Der machte noch immer keine Anstalten, auf sein Pferd zu steigen, um sie zu begleiten. Da stieß Wolf seinem Tier die Sporen in die Seiten. Das Ross zuckte zusammen, bevor es dann gehorsam lostrabte. Lanfred von Marbur lenkte seinen Hengst neben Wolf und beobachtete dabei Tobias, der krampfhaft versuchte, sich am Sattelknauf festzuhalten.
»Fall bloß nicht wieder runter«, grollte Lanfred. »Wir haben keine Lust, auf dich zu warten.«
Tobias trieb sein Pferd an und bemühte sich, zu Lanfred aufzuschließen. Dies gelang ihm erst mit einiger Anstrengung.
»Was soll das, Herr Lanfred?«, begann er wütend.
»Was soll was?«
»Eure Frage!«
»Was stört dich daran?«
»Ich bin Eure ständige Nörgelei leid, hört Ihr? Ich muss mir das von Euch nicht dauernd gefallen lassen.«
»Doch, das musst du«, gab Lanfred trocken zurück.
»Was? Ich ... ich verbiete Euch, mich so zu behandeln«, fauchte Tobias.
Lanfred lachte verächtlich.
»Du? Du verbietest mir gar nichts, verstanden? Lern erst mal, richtig auf einem Gaul zu sitzen.«
Lanfred ließ ihn zurück und trieb sein Pferd an, um mit Wolf weiterhin mithalten zu können. Der Graf drehte sich im Sattel um.
»Er hat recht, Tobias. Lern, verdammt noch mal, endlich reiten!«
Wolf duckte sich, um den tief hängenden Ästen der Bäume auszuweichen. Er trieb sein Pferd den sanften Hang hinauf. Nicht lange und sie würden, am Hangende angekommen, anhalten und im dichten Wald warten. Auf die Kolonne, die seit dem frühen Morgen über die Bergflanke gen Süden zog und dabei an ihnen vorbei musste.
Frieder lauschte den Geräuschen der Gefährten noch eine Weile nach. Dann war es still. Von ihrem kleinen Feuer stieg kein Rauch mehr auf und als er mit einem Stock in der Asche herumstocherte, war nicht einmal mehr der Rest einer Glut zu sehen. Er kämpfte gegen eine unendliche Müdigkeit und konnte sich nicht erinnern, dass sich sein Gemüt jemals so schwer angefühlt hatte. Diese seltsame Mutlosigkeit empfand er noch nicht allzu lange. Sie war von einem Moment auf den anderen über ihn gekommen. Fast wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Aber seitdem war alles anders. Seine Freude am Leben war verschwunden, fortgeschmolzen wie der Schnee nach einem warmen Tag. Er grübelte oft und schlief nachts nur noch wenige Stunden. Sein ganzes Tun ekelte ihn an. Alles, was er mit Wolf, Lanfred, Tobias und den übrigen Kerlen trieb, war ihm nun zutiefst zuwider. Sie waren keine stolzen Ritter mehr! Keine Söhne eines weithin respektierten und geachteten Adeligen. Nein, aus ihnen waren ganz gewöhnliche Diebe und Räuber geworden. Und Mörder. Ja, an jedem Einzelnen von ihnen klebte Blut. Immer wieder hatte er diese eine grausame Szene vor Augen: Wolf, wie er Eberhardt von Schlüsselberg mit einem einzigen Schwertstreich den Kopf abschlug. Einfach so, aus einer blinden Wut heraus. Seitdem war alles anders geworden. Frieders Verhältnis zu Wolf und den übrigen Gefährten war angespannt. Dazu kam eine leise Angst, die sich wie auf leisen Sohlen an ihn heranschlich. Ja, dachte Frieder, auch jetzt wieder, Wolf! Es geht immerzu nur um ihn. Um Wolf. Er war der Urheber all dieser Taten und er machte mit seinem Handeln seinem Namen alle Ehre. Wie ein Raubtier fiel er über die Menschen her. Was war nur aus seinem Bruder geworden? Aus ihnen beiden? Frieder schlang die Arme um sich. Wenn sie unerkannt irgendwo in abgelegenen Weilern Halt machten, hörten sie oft, wie man über sie sprach. Auch deshalb, weil die Menschen sie oft nicht gleich erkannten. Daher wussten sie, wie man sie nannte: die Geisterhorde. Nie fiel der Name Greifenberg, doch immer wieder fiel ihnen auf, dass die Menschen in ihrer Rede innehielten, wenn sie hinzukamen. Sie wussten nie, ob man sie erkannte. Wohl eher nicht bei ihrem wilden Anblick. Bärtig, verdreckt, die Haare verfilzt, die Kleidung wie ihre Leiber stinkend. Doch ihre Schwerter wurden jedes Mal misstrauisch beäugt. Ahnten die Dörfler inzwischen etwas? Frieder wusste es nicht zu sagen. Aber er war sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis jedermann es nicht länger heimlich, sondern laut und deutlich aussprach: Die Raubritter waren die Söhne der Gräfin. Frieder rieb sich die Schultern. Es war ihm auf einmal kalt. Aber was sollte er tun? Wolf glaubte noch immer, lose Zungen einfach mit Schwert und Feuer bestrafen zu können. Der Lehnsherr straft den Untertan! Doch bei aller Furcht ließen sich die Menschen auch von einem Mann des Adels nicht mehr so einfach das Wort verbieten. Wiederum etwas, worüber Wolf sofort in heißen Zorn geriet. Und wenn er versuchte, darüber zu reden, dann ganz besonders. Denn genau das wollte Frieder schon seit längerem: reden! Wie es weitergehen sollte, mit dem, was sie da taten? Und wie lange sie das noch tun wollten? Und natürlich über Hagen und ihre Mutter. Ja, vor allem darüber. Doch spätestens bei diesem Thema wurde Wolf zur Furie und Frieder hatte mehr als einmal bemerkt, dass er sich dann vor seinem eigenen Bruder fürchtete.
Er hob den Kopf. Der Wind hatte sich gedreht. Dort drüben, zwischen den hohen grauen Felsblöcken, führte der Weg durch den Hochwald bis hinauf zur Moosalpe. So wurden die weiten, steilen Wiesenhänge genannt, die als Weideland für Ziegen und Schafe dienten. Jetzt jedoch war dort kein Tier zu sehen. Die Hirten fürchteten die Räuber, die ihnen die Jungtiere stahlen, um sie zu schlachten. Gott erbarme dich, dachte Frieder, selbst die einfachen Hirten haben Angst vor uns. Er sog die kühle Waldluft ein. An der Moosalpe führte ein steiler Weg entlang bis hinauf zu einer wilden Klamm, durch die jetzt, im Frühjahr, das Schmelzwasser tobte. Der Weg in die entgegengesetzte Richtung traf irgendwann auf die Landstraße. Von dort aus war es dann nur noch ein halber Tagesritt nach Hause, auf die Burg. Ja, dachte er für sich, dorthin will ich reiten. Wie zur Bekräftigung seiner Gedanken nickte Frieder und stieg in den Sattel. Doch als er das Pferd nach rechts lenken wollte, nahm er den Schlachtenlärm wahr.
Ganz weit aus der Ferne und doch noch nah genug, um es zu hören. Der Raubritter hat sich wieder auf seine Beute gestürzt! Frieder lauschte mit angehaltenem Atem. Er sah Wolf vor sich, wie er ihn viele Male erlebt hatte: Als Erster voran, mit blank gezogenem Schwert. Kühn, ohne Furcht, getrieben von der Lust am Schrecken.
»Frieder! Bist du da, kleiner Bruder? An meiner Seite? Wie du immer an meiner Seite warst, von Kindesbeinen an?«
»Nein, großer Bruder, diesmal nicht«, murmelte Frieder für sich.
In seinem Kopf begann es zu dröhnen. Ganz deutlich hörte er jetzt das Gebrüll der Söldner, den Waffenlärm, das Keuchen der Pferde und die Schreie der Verwundeten.
»Wolf, lass mich frei, hörst du? Lass mich endlich frei!«
Ein großer Schmerz lag in seinem Aufschrei. Er wünschte sich so sehr, dass dieser Schmerz tief in seinem Inneren ihn nicht länger quälen würde, sondern endlich verschwand. Aber das geschah nicht und am Ende hieb Frieder mit der Faust auf den Nacken seines Pferds und das Tier galoppierte los, genau in die Richtung, aus der der Schlachtenlärm kam.
Den Schreien der Kämpfenden nach zu urteilen, musste es eine blutige Schlacht sein. Knapp zehn Mann stark war die Gruppe, die Wolf zusammen mit Lanfred und Tobias angegriffen hatte. Aber kaum waren Wolf und seine Gefährten aus dem Unterholz gebrochen, begannen sich die Angegriffenen nach Kräften zu wehren. Bevor Wolf schauen konnte, waren zwei seiner Leute tot und drei weitere Männer wälzten sich, vor Schmerzen schreiend, auf dem Boden. Tobias' Pferd scheute und warf ihn ab. Er kam hart auf dem schmalen Waldweg auf und sein Gaul jagte davon, ohne dass ihn irgendjemand aufhalten konnte. Jenseits des Weges, an dem sie nun Mann gegen Mann fochten, erstreckte sich ein Sumpfgebiet. Die Schar der Angegriffenen rannte dort hinein, wohl in der Hoffnung, so zu entkommen. Wolfs Truppe blieb wie gelähmt zurück. Nach der ersten Überraschung nahmen Wolf und Lanfred auf ihren Pferden schließlich die Verfolgung auf. Doch nach wenigen Schritten versanken die Tiere fast bis zu den Steigbügeln in dem morastigen Boden. Die Pferde gerieten in Panik und es wäre den Flüchtenden jetzt ein Leichtes gewesen, umzukehren und die beiden Ritter zu erschlagen. Auf dem festen Waldweg war Tobias inzwischen wieder auf die Beine gekommen. Trotzdem sah er den Mann nicht, der ihm einen langen Stock zwischen die Füße schob und ihn erneut zu Fall brachte. Als der Angreifer dann mit einem Messer auf ihn losging, brach auf einmal Frieder mit seinem Pferd durch das Unterholz. Das Schwert des jungen Grafen traf den Mann mit dem Messer an der Schulter. Doch anscheinend trug er keine ernstliche Verletzung davon, denn bevor Frieder sein Pferd wenden und erneut angreifen konnte, war der Mann mit einem Satz im dichten Schilf verschwunden.
Wenig später war von den Flüchtenden nichts mehr zu hören oder zu sehen. Die Meute sammelte sich. Wolf und Lanfred stapften zu Fuß schwerfällig auf den festen Weg zurück, beide über und über von Schlamm bedeckt. Ihre völlig verdreckten Pferde zogen sie hinter sich her. Als Wolf seinen Bruder erkannte, war er sichtlich überrascht. Auch Lanfred nickte erleichtert und, wie Frieder meinte, anerkennend. Tobias rappelte sich mühsam auf und sank gleich wieder auf den Boden zurück. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rieb er sich das Knie. Frieder schob das Schwert in die Scheide auf seinem Rücken zurück und stieg dann langsam aus dem Sattel. Er betrachtete Lanfred, der schwer atmete und ganz grün im Gesicht war. Das Gefühl kenne ich, dachte Frieder. Gleich darauf taumelte der Freiherr ein paar Schritte in den Wald hinein und alle hörten, wie er sich mit lautem Würgen, übergab. Wolf lachte spöttisch. Frieder sah sich um. Die Blicke der übrigen Männer waren nicht eben freundlich.
»Weißt du, was uns beide verbindet, Bruderherz?«, begann Wolf auf einmal.
»Warum fragst du mich das?«
»Beantworte erst meine Frage. Was verbindet uns beide wirklich und wahrhaftig?«
Die Brüder sahen sich an. Frieder wusste sofort, was Wolf meinte.
»Mutter«, murmelte er.
Über Wolfs Gesicht huschte ein Lächeln.
»Ganz genau, jawohl. Für sie tun wir das hier. Nur für sie allein.«
Frieder schüttelte langsam den Kopf.
»Das glaubst du, ja?«
»Natürlich.«
»Dann wird es niemals aufhören, Wolf. Und weißt du auch, warum?«
»Nein, sag du es mir, Bruder.«
»All das Rauben und Töten, das Stehlen und Brennen wird dir nie genug sein.«
Wolf sog die Luft ein, hob den Kopf und sah an Frieder vorbei. Er betrachtete die übrigen Männer, die sich inzwischen gegenseitig ihre Wunden verbanden, Wasser tranken und ihre Beute begutachteten. Die Angegriffenen waren alle entkommen. Dafür hatten sie, die Angreifer, zwei Tote zu beklagen. Und drei Schwerverwundete. Das alles für eine wahrhaft schäbige Beute: ein uraltes Schwert, eine Axt, ein Messer und vier rostige Hellebarden. Dazu drei Weinschläuche und ein Stück geräucherten Speck, um den sie sich bereits zu zanken begannen. Einer der Männer verband Tobias das Knie mit einem Leinenstreifen. Anscheinend war er ernsthaft verletzt, denn als er aufzustehen versuchte, stöhnte er vor Schmerz. Zähneknirschend sah Wolf sich um. Verflucht, diese Männer waren nicht einmal den Prügel wert, der Tobias zu Fall gebracht hatte. Wolf wischte sich mit dem Ellbogen über die schweißbedeckte Stirn und wandte sich an Frieder.
»Warum bist du zurückgekommen?«
»Ich kann es dir nicht sagen.«
Stumm betrachtete Wolf seinen Bruder.
»Ich kann es dir nicht sagen«, wiederholte Frieder. »Es geschah einfach so.«
Wolf trat einen Schritt auf ihn zu.
»Wir beide, ich und du, wir sind wie ein Mann. Wie eine Person. Nichts und niemand darf zwischen uns kommen.«
Frieder schüttelte heftig den Kopf.
»Nein, du irrst.«
Er umfasste den Zügel seines Pferds.
»Du bist du, und ich bin ich. Es ist längst etwas zwischen uns, auch wenn ich dir nicht sagen kann, was es ist. Aber es macht mir Angst. Weil ich es nicht sehen kann. Oder danach greifen. Aber es ist da, und ich spüre es. Ja, wir sind Brüder, aber wir sind nicht ein Geist oder gar ein Körper. Vielleicht war es einmal anders, ich weiß es nicht. Weil ich überhaupt nichts mehr weiß. Und auch das macht mir Angst.«
Frieder schüttelte den Kopf. »Nein, Wolf. Das war das letzte Mal, dass ich dir zur Seite gestanden habe. Ich kämpfe nicht mehr gegen Leute, die nicht unsere Feinde sind. Ich will Gott nicht länger zürnen. Und Mutter schon gar nicht.«
Die letzten Worte hatte Frieder beinahe geflüstert, aber Wolf verstand sie trotzdem. Stumm sah er zu, wie sein Bruder wieder in den Sattel stieg und das Pferd aus dem Kreis der Männer an den Waldrand lenkte. Wolf holte Luft, als wollte er etwas sagen. Aber er schwieg und sah zu, wie die fahle Dämmerung des Waldes das Pferd samt seinem Reiter verschluckte.
***
Die Vermählung zwischen dem Junker Wittek und Lisbeth, der Edlen von Söstenegg, wurde in kleiner, aber herzlicher Runde gefeiert. Urs von Weil hatte seinem Freund angeboten, für sie eine besonders festliche Hochzeit auszurichten, aber Wittek und Lisbeth hatten dankend abgelehnt. Nein, sie wollten den Bund für ihr gemeinsames Leben still und bescheiden schließen. Wittek stiftete für die Leute auf der Burg ein paar Fässer Bier und Wein, dazu sollten alle essen, was die Burgküche hergab. Urs war erwartungsgemäß Witteks Trauzeuge, für Lisbeth übernahm ihre Herrin Friederike von Greifenberg diese Aufgabe. Der alte Burgkaplan vollzog die Trauung, was ihn jedoch so sehr erschöpfte, dass man ihn nach dem Treuegelöbnis der Brautleute eilig auf einem Sessel platzieren musste, um einem Schwächeanfall zuvorzukommen. Ungeachtet dessen war der Moment ihrer Eheschließung sehr feierlich. Urs beobachtete während der Zeremonie ganz verstohlen Friederike. Dabei dachte er daran, wie es wohl wäre, wenn er hier anstelle von Wittek vor dem Kaplan knien würde, neben ihm die Frau, die er so sehr liebte, mit einem Schleier über dem Haar. Er wusste über Friederikes Gefühle für ihn nichts zu sagen. Denn darüber sprachen sie nicht.
Friederike beneidete Lisbeth um diese Liebesheirat mit dem Junker. Ihre eigenen Gefühle empfand sie inzwischen als endgültig. Sie schätzte Urs. Mehr nicht. Manchmal, wenn sie eine leise Wehmut beschlich, musste sie an die Worte ihrer Mutter denken. »Du musst ihn nicht lieben. Aber du wirst das Leben lieben, dass dir Urs bieten wird. Denk immer daran, die geachtete und respektierte Frau eines geschätzten Mannes zu sein, ist nicht wenig.
Und er ist nicht dumm, dein zukünftiger Gemahl. Und du, mein Kind, bist es auch nicht. Darum kann etwas aus eurer Verbindung werden. Denn eure Gemeinsamkeit wird ein kluger Verstand sein.«
Urs' Hochzeitsgeschenk für seinen Freund war ein kostbares Pferd. Die Burgbewohner schenkten ihm dazu einen extra angefertigten Sattel nebst Zaumzeug. Darüber freute sich Wittek sehr. Lisbeth erhielt von Urs ein Stück Land geschenkt. Er war der Meinung, eine Freifrau wie sie musste über eigenen Grund und Boden verfügen, um darauf einmal ihre Kinder großziehen zu können. Über diese Worte errötete Lisbeth sosehr, dass es deutlich auffiel und allesamt brachen in lautes Gelächter aus. Das half Lisbeth schnell wieder aus dem Moment der Verlegenheit. Friederike schenkte ihrer Freundin einen prächtigen Ring, der aus dem Familienbesitz der Greifenbergs stammte und den ihr Eleonore als Erbteil bereits vorab überlassen hatte.
Nun, am frühen Morgen, nur einen Tag nach der Hochzeit, wollte das frisch vermählte Paar Lisbeths Familie besuchen. Eine Tagesreise entfernt taten ihre Schwestern als Burgfräulein Dienst auf der Festung Runkelstein, die nahe bei Bozen von sehr wohlhabenden, aber nicht adeligen Kaufleuten bewohnt wurde. Friederike half, zusammen mit den Mägden, das Gepäck der Freifrau zu packen. Lisbeth war derweil im Arbeitsraum des Barons, wo sie die Besitzurkunde für das Stück Land entgegennehmen wollte. Zusammen mit Wittek saß sie glücklich und ein wenig aufgeregt vor dem Herrn ihres Mannes. Urs tat so, als bemerkte er ihre Unruhe nicht, während er noch einmal das Dokument durchlas. Plötzlich stand Wittek auf und erklärte, er müsse unbedingt nach den Pferden und dem Gepäck sehen. Und einen Augenblick später waren Urs und Lisbeth allein in dem großen, mit Büchern gefüllten, gemütlichen Raum.
»Wir sind nicht oft allein zusammen gewesen, liebe Frau von Stein.«
Urs hatte sie das erste Mal mit ihrem neuen Namen angesprochen. Lisbeth nickte nur und berührte den kleinen Blumenstrauß auf dem Arbeitstisch des Barons. Wie in Gedanken strich sie mit den Fingerspitzen zärtlich über eine der Blüten. Unterdessen faltete Urs die Besitzurkunde und band sie mit einer roten Seidenschnur zusammen. Die losen Enden tauchte er in einen großen Wachstropfen. Dann erhob er sich von seinem Platz, woraufhin auch Lisbeth aufstand. Mit einer galanten Verbeugung überreichte Urs der Frischvermählten ihr Hochzeitsgeschenk.
»Ich danke Euch, mein Herr.«
»Aber nicht doch, jetzt bedankt Ihr Euch ja schon wieder. Wenn Euch mein Geschenk freut, ist mir das Dank genug.«
Er lachte herzlich. Sie knickste vor ihm und schob das Dokument fast zärtlich in einen der Ärmel ihres Kleids.
»Seid Ihr glücklich, Lisbeth?«, fragte Urs plötzlich.
Sie blickte ihn einen Augenblick lang schweigend an.
»Ja, Herr Baron. Ja, das bin ich.«
Urs schüttelte entschuldigend den Kopf.
»Das war eigentlich eine dumme Frage. Man sieht Euch Euer Glück ja an.«
Lisbeth öffnete den Mund, um etwas zu sagen.
»Ja, Ihr strahlt wie ein Licht«, kam Urs ihr zuvor. »Und das ist ein wirklich schöner Anblick.«
Sie war jetzt sichtlich gerührt von seinen Worten, trat auf ihn zu, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn sanft auf seinen verunstalteten Mund.
»Und Ihr seid ein ganz besonderer Mensch, Herr Baron«, sagte sie dann.
Urs wusste nicht, was er darauf erwidern sollte.
»Eines sollt Ihr unbedingt wissen, mein Herr«, fuhr Lisbeth fort, »Friederike denkt genauso, und Ihr habt längst einen Platz in ihrem Herzen.«
»Glaubt Ihr das wirklich?«
»Nein, ich weiß es sogar. Denn sie hat es mir gesagt.«
Urs fasste sie an den Schultern und küsste sie sanft auf die Stirn. Sie duftete nach Maiglöckchen, wie er feststellte.
»Ich danke Euch, edle Frau von Stein. Und ich hoffe, dass Ihr mit Wittek so glücklich werdet, wie ich es mir immer für mich und meine Braut gewünscht habe.«
»Man kann nichts erzwingen, mein Herr.«
»Nein, da habt Ihr wohl recht. Das kann man nicht.«
Urs nahm Lisbeths Hand und drückte sie sanft. In dem Moment trat Wittek wieder ein. Er nahm seine Ehefrau bei der Hand und führte sie zur Tür.
»Gott auf all Euren Wegen!«, sagte Urs.
Lisbeth lächelte und lehnte ihren Kopf an die Schulter ihres Ehemanns.
»So wie auf den deinen, mein Freund«, antwortete Wittek.
Dann traten sie hinaus und Urs bemerkte erst jetzt, dass draußen strahlend hell die Sonne schien.
Als Wittek und Lisbeth von ihrer Reise zurückkehrten, nahmen beide den Dienst wieder auf. Große Ereignisse kündigten sich an. Der Baron hoffte auf königlichen Besuch und wollte diesem einen gebührenden Empfang bereiten. Daher machte er sich auf den Weg, um den Gast auf seinem Land nicht zu verpassen. In Begleitung Witteks brach er zu Pferd auf. Nachdem sie schon eine Weile unterwegs waren, lag ein Hügel vor ihnen, nicht zu allzu steil. Es ließ sich ganz bequem hinaufreiten, was sie beide taten. Oben angekommen, saßen Urs und Wittek eine Weile stumm im Sattel und blickten über das weite Land. Eingerahmt von den Bergen, erstreckte sich der Besitz des Barons bis zum fernen Horizont, an dem das derzeit vom Dunst verborgene Meer begann. Von diesem Punkt auf der Anhöhe aus waren es bis zur Grenze seines Besitzes noch gute fünf Stunden zu Pferd. Die beiden Ritter waren jedoch nicht allein unterwegs, sondern wurden von einer Schar bewaffneter Knechte begleitet. Alle zu Fuß, hatte Urs sie mit neuen Waffen und prächtigen Kleidern ausrüsten lassen. Der Baron von Weill wollte sich keinesfalls sagen lassen, dass er es an Ehrerbietung fehlen ließ, als er dem König von Böhmen entgegenritt. Bereits am frühen Morgen hatte Urs zwei Knappen zu Pferd als Kundschafter losgeschickt. Es waren die beiden jungen Burschen, die sonst für Friederikes und Lisbeths Schutz zuständig waren, wenn diese die Burg zu einem Ausritt verließen. Während Urs darüber nachdachte, wie lange sie noch auf die beiden Boten warten sollten, ertönte ein lauter Pfiff. Einer der Posten winkte ihnen mit beiden Armen. Das vereinbarte Zeichen, dass es etwas zu sehen gab. Urs und Wittek stellten sich fast gleichzeitig in den Steigbügeln auf.
»Was gibt’s?«, rief Wittek dem Posten zu.
»Reiter, Herr Wittek!«
»Etwa unsere beiden Frischlinge?«
»Ja, Herr. Ich erkenne ihre Farben.«
Wittek nickte und ließ sich in den Sattel zurücksinken. »Diese eitlen Gecken.«
Urs lachte. »Waren wir denn nicht genauso in dem Alter?«
»Bei allem Respekt, Urs, man reitet nicht unter dem Banner seines Herrn und trägt dabei die eigenen Farben. Was sind denn das für Manieren?«
»Lass gut sein, mein Freund.«
»Du bist zu nachsichtig, Urs.«
Der Baron lachte. »Und du zu streng, Meister Wittek.«
Sie sahen zu, wie die beiden jungen Knappen im scharfen Galopp am Fuß des Hanges entlangritten, um dann ihre Pferde zu ihnen hinaufzulenken. Die Tiere keuchten von der Anstrengung, zumal die beiden Reiter mit dem losen Ende der Zügel noch auf den Nacken der Tiere einschlugen. Das sollte sie zu noch schnellerer Gangart bewegen. Wittek schüttelte den Kopf, weil er dies für eine unnötige Quälerei hielt. Bei ihrem Herrn angekommen, sprangen die beiden Burschen aus den Sätteln, traten vor und beugten die Köpfe. Sie keuchten leise, während der Ältere der beiden nach Worten rang.
»Herr Baron, der König ist noch gut eine halbe Tagesreise von hier entfernt.«
»So weit noch?«
Wittek stellte sich erneut im Sattel auf und wandte den Blick in die Ferne, als könnte er dann das Banner des Königs erkennen.
»Wie groß ist sein Tross?«, wollte Urs von dem jungen Mann wissen.
»Wir haben ungefähr hundert Leute gezählt, Herr Baron. Die Hälfte davon zu Fuß. Die Reiter sind, wie es aussieht, alle Ritter von edlem Geblüt. Dazu hat seine Majestät eine Menge Maultiere und Wagen dabei.«
»Hat man euch bemerkt?«
»Nein, Herr. Natürlich nicht.«
Der Knappe sagte es mit Stolz und Urs nickte anerkennend.
»Und der König? Ist er auch zu Pferd unterwegs?«
Jetzt zögerte der Bursche. Dann schüttelte er den Kopf, wobei ein paar Schweißtropfen davonflogen.
»Ich denke, nur von Zeit zu Zeit, Herr. Wir haben auch eine Sänfte gesehen. Darin wird er wohl getragen, wenn er es wünscht.«
»Ist seine Gemahlin bei ihm?«
Die beiden Burschen blickten sich gegenseitig an. Der Sprecher suchte nach den richtigen Worten.
»Was war an der Frage des Herrn Baron so schwer, dass man sie nicht beantworten kann«, knurrte Wittek ungehalten.
»Verzeiht Herr«, begann der Ältere der beiden Knappen, »die Königin haben wir nicht gesehen.«
»Das hat der Herr Baron nicht gefragt. Ob sie und ihr Hofstatt dabei sind, wollen wir wissen. Antworte einfach mit Ja oder Nein.«
»Nein, Herr.«
»Sicher?«
»Ich denke schon, Herr.«
»So, du denkst.«
Wittek schüttelte erneut tadelnd den Kopf und die beiden Burschen blickten verlegen zu Boden.
»Ihr könnt gehen, Männer«, sagte Urs zu ihnen.
Die beiden Knappen verbeugten sich höflich und zogen dann ihre Pferde am Zügel hinter sich her zu den übrigen Knechten, die sie sogleich neugierig umringten. Urs sog genüsslich die frische Bergluft ein. Ja, dachte er, das ist mein Land, grün und fruchtbar. Doch er erinnerte sich nicht daran, dass jemals ein König auf dem Land seiner Ahnen zu Besuch gewesen war. Wenn sich Sigismund von Böhmen wirklich dazu bereiterklärte, seiner Einladung zu folgen, dann wäre dies das erste Mal, dass ein gekröntes Haupt zu Gast auf dem Besitz derer von Weil wäre. Andererseits hatte Sigismund die Grenzen des Lehens sicher noch nicht erreicht. Mit so einem großen Tross konnte das auch noch eine Weile dauern. Und jedermann kannte die Vorliebe des Böhmen, spontan seine Reiseroute zu ändern. Das gilt es, zu verhindern, sagte sich Urs. Außerdem wollte er hier nicht länger warten. Er war bereits schon viel zu lange von zu Hause fort.
»Wittek, ich muss wissen, was der König vorhat.«
»Dann schick eine Botschaft. Wir haben Brieftauben dabei«, antwortete ihm Wittek.
Über die verschmitzte Miene des Freundes musste Urs auf einmal lachen.
»Du denkst an alles, alter Fuchs. Aber nein, das tun wir nicht.«
»Und was ...?«
Bevor er seine Frage stellen konnte, kam Urs ihm mit der Antwort zuvor.
»Ich reite dem König entgegen.«
»Aber mit unseren Leuten zu Fuß wird das eine Weile dauern.«
»Wittek, ich reite allein.«
Der Freund und alte Getreue griff nach Urs' Arm.
»Aber das ..., das wäre nicht klug von dir.«
»Was willst du damit sagen?«
»Das weißt du nur zu gut«, sagte Wittek nun mit gedämpfter Stimme.
»Du meinst, dass mich die Dämonen wieder überfallen könnten?«
Wittek nickte hastig. Urs legte seine Hand auf den Arm des Freundes.
»Deine Sorge rührt mich. Aber ich weiß, was ich tue. Und soll ich dir was sagen? Vor den Dämonen habe ich keine Angst mehr. Denn ich habe ja jetzt jemanden, der mich alle Furcht vergessen lässt.«
»Gebe Gott, dass du recht hast, Urs.«
»Es ist so, mein Freund, wie ich es sage. Und du weißt es.«
Wittek lächelte auf einmal.
»Ja, ich verstehe dich sehr gut, Urs. Denn auch ich habe ja nun jemanden, der mich alle Sorgen vergessen lässt.«
Urs ließ sein Pferd in schnellem Trab laufen. Nur wenn es der Weg zuließ, gab er dem Tier sanft die Sporen und galoppierte eine Weile. Er liebte es zu reiten und dachte daran, wie sehr Friederike diese Leidenschaft mit ihm teilte. Dann sah er sie beide vor sich, auf Reisen quer durch das Land. Bei diesen Gedanken musste er lächeln. In den letzten Wochen und Monaten war aus ihnen ein gutes Gespann geworden. Wenn auch anders, als gedacht. Denn das, was sie verband, war nicht die Liebe, die oft besungene und so verklärte. Zumindest nicht die Art Liebe, die Urs sich immer erträumt hatte. Zwischen ihm und Friederike war ein großer Respekt gewachsen. In ihrer klugen und natürlichen Art fühlte sich Urs an ihrer Seite »zu Hause«. Vertraut und geborgen. Etwas, was er seit seiner frühesten Kindheit auf der Burg seiner Ahnen nicht mehr empfunden hatte. Anders konnte er es nicht erklären. Gemeinsam taten sie Dinge, die zwischen einer Frau und einem Mann in diesen Zeiten nicht üblich waren: Sie sprachen stundenlang miteinander, lachten zusammen und sie ergänzten sich bei der Führung des Landes mit einer Selbstverständlichkeit, die nicht nur ihn immer wieder verblüffte. Bei diesen Gedanken, musste Urs laut lachen. Was seine selige Mutter wohl sagen würde, wenn sie ihn so sehen könnte! »Was ist das für eine seltsame Verbindung?«, hätte sie gefragt. »Ein Mann steht immer über seiner Frau! Wenn er spricht, dann schweigt sie. Und wenn sie sprechen will, dann nur, wenn er ihr die Erlaubnis dazu gibt.« Ja, so in etwa würden ihre Worte lauten. Und noch etwas war Urs in Erinnerung geblieben: Niemals darf eine Frau an der Stelle eines Mannes stehen. Nicht in ihrem Tun oder ihrem Denken! So war er erzogen worden. Du warst im Irrtum, Mutter!, dachte Urs. Beim seligen Andenken, aber du kanntest nicht Friederike von Greifenberg. Oder ihre Mutter, seine zukünftige Schwiegermutter, die ein ganzes Lehen führte. Eine Ausnahme, die nur so lange möglich war, bis Wolf einmal ihren Platz einnehmen würde. Bei dem Gedanken knirschte Urs mit den Zähnen. Wolf war ihm unheimlich und die Tatsache, dass der junge Mann bald sein zukünftiger Schwager sein würde, störte ihn.
Er zügelte das Pferd, bis es anhielt. Es war warm und er zog sich das Halstuch herunter, drehte sich im Sattel um und stopfte das lange Seidentuch in die Satteltasche. Als er sie wieder verschloss, hörte er plötzlich eine Melodie. Urs lauschte angestrengt. Kein Zweifel, da sang jemand. Die Stimme klang hell und klar, wie er feststellte. Und schön. Ja, wirklich, er hatte selten eine schönere Stimme gehört. Er stellte sich in den Steigbügeln auf und sah sich nach allen Seiten um. Aber da war nichts zu sehen. Langsam ließ er sich in den Sattel zurücksinken und lauschte erneut. Er konnte nicht sagen, woher die Stimme kam. Sie schien von überall herzukommen und je länger er lauschte, desto schneller schlug sein Herz. Diese schöne Stimme sang ein Liebeslied. Es klang zärtlich und zugleich so traurig, dass es ihn zutiefst berührte. Auf einmal fühlte sich sein Mund ganz trocken an. War das wieder eine jener Stimmen, die nur er allein hören konnte? Gesungen von schattengleichen Wesen, die ihm von einem auf den anderen Moment so große Furcht einflößten? Urs vermochte es nicht zu sagen. Er wusste nur, dass er auf Wittek hätte hören sollen. Hastig wischte er sich mit der Hand über den Mund. Sein Reithandschuh roch nach dem Schweiß des Pferdes und er schmeckte Salz an seinen Lippen. Der Gesang wurde ein klein wenig lauter, als ob die Stimme näher käme. Aber gut, vielleicht täuschte er sich auch. Jenseits des Wegs lag dichter Wald. Inzwischen meinte er, dass der Klang genau aus dieser Richtung kam. Er bemühte sich, seine Furcht zu bezwingen. Schließlich war er ein Ritter! Jawohl, der Ritter Urs von Weil, Baron des gleichnamigen Landes! Ein Kriegsheld! Er schloss die Augen und sah in Gedanken Friederike vor sich. Sie lachte. Jenes Lachen, für das er seine Seele gegeben hätte. Genau dieses Lachen ermutigte ihn, die Augen wieder zu öffnen. Er lockerte sein Schwert und lenkte sein Pferd mit einem sanften Fersentritt in den Wald hinein.
Das Tier schien der schönen Stimme von allein zu folgen. Urs ließ die Zügel locker und blickte sich immer wieder argwöhnisch um. Hier, im Zwielicht des Waldes, konnte er nicht viel erkennen. Mit seinem gesunden Auge suchte er angestrengt nach einer Lichtung. Doch vor ihm lag nichts als Dunkelheit. Vielleicht sollte er besser absteigen und sich zu Fuß einen Weg durch das dichte Grün suchen. Umgestürzte Bäume versperrten ihm immer wieder den Weg und er musste um sie herumreiten. Und allmählich war er sich auch nicht mehr ganz sicher, ob er sich noch auf seinem eigenen Land befand. Hierher, in diese Grenzgegend, verschlug es ihn nicht allzu oft.
Plötzlich blieb sein Pferd stehen. Urs erkannte vor sich eine nicht zu hohe, aber steile Felskante, die in einen steilen Abhang überging. Erst weiter unten gab es wieder Bäume und Sträucher und dazwischen blinkte das helle Band eines Bachlaufs. Das Pferd trat vorsichtig über den Rand der Kante und ging dann langsam und behutsam Schritt für Schritt hinab. Urs überließ sich ganz dem Tier und dessen Gespür für den tückischen Boden. Wohlbehalten am Fuß des Abhangs angekommen, streichelte er das Pferd. Als er weiterritt, legte er vorsichtshalber die Hand auf den Griff seines Schwerts.
Unweit des Bachufers stand eine Hütte. Eher klein, war sie mit der Rückseite an ein paar mächtige Felsblöcke gebaut, wie es in der Gegend üblich war. Kleine Holzschindeln bedeckten das niedrige Dach, und Felssteine darauf sicherten das Hüttendach gegen die Stürme. Urs hielt an und glitt geräuschlos aus dem Sattel. Seine Hand griff erneut nach dem Schwert. Die kleine Hütte schien bewohnt zu sein, denn die Tür stand weit offen, genau wie die einfachen Fensterläden. Es roch nach einem offenen Herdfeuer und tatsächlich, aus dem gemauerten Kamin auf dem Dach kräuselte sich dünner Rauch. Ein Schemel mit einem Butterfass davor war alles, was an der Hauswand stand. Und erst jetzt fiel ihm auf, dass der Gesang verstummt war.
»Eine Seele zu Hause?«
Keine Antwort. Er trat in die offene Hüttentür und blickte hinein. Bis auf ein einfaches Strohlager, einer Feuerstelle und einen Tisch mit einer Bank davor war der einzige Raum leer. Langsam und vorsichtig trat er zurück und erkundete die andere Seite des Hauses. Ein liebevoll angelegter Kräutergarten und ein Wassertrog, der das Regenwasser vom Hausdach auffing, mehr konnte er nicht entdecken. Jedoch spürte er auf einmal, dass er nicht allein war. Es war jemand hinter ihm, in seinem Rücken. Er fuhr herum.
Der Wolf stand nur wenige Schritte von ihm entfernt.
Urs erschrak weniger vor dem Tier als vor dessen Größe. Er kannte Wölfe und hatte genug von ihnen gesehen. Aber nie zuvor hatte er ein so großes Tier zu Gesicht bekommen. Dieser Wolf war fast so hoch wie ein Kalb, dabei schlank, ja, hager. Er hatte dunkelgraues, fast schwarzes Fell, dazu stechende gelbe Augen, die ihn unverhohlen anstarrten. Urs vermied jede hastige Bewegung. Seine rechte Hand umschloss fest den Schwertgriff. Die Klinge wollte er aber erst dann ziehen, wenn das Tier ihn angriff. Doch der Wolf rührte sich nicht. Er knurrte nur leise und fletschte die Zähne. So standen sie da und starrten sich gegenseitig an. Plötzlich wandte sich das Tier um und lief die wenigen Schritte zurück bis zu den Bäumen, die am Bachufer wuchsen. Unter einer großen Weide blieb er stehen und von diesem Platz aus beäugte er Urs erneut. Noch immer vermied es der Baron von Weil, sich zu bewegen. Wölfe waren meist im Rudel unterwegs. Wenn also dieser Riese unbemerkt an ihn herangekommen war, wo war dann der Rest der Meute? Andererseits war es ein sonniger warmer Frühlingstag. Um diese Jahreszeit waren die Wölfe lieber weit oben in den Bergen auf der Jagd. Und trotz aller Geschichten über Meister Isegrim griff ein Wolf nicht so ohne Weiteres einen Menschen an. Nicht einmal ein Monstrum wie dieser hier.
Da, auf einmal, erklang erneut der Gesang!
Der Wolf verschwand wie ein Schatten. Verblüfft wandte sich Urs um. Aus der gerade noch leeren Hütte trat jetzt eine junge Frau. Sie war einfach, in die hier auf dem Land übliche Tracht, gekleidet, die aus einer ärmellosen Leinenbluse, einem langen Rock und einer bodenlangen Schürze darüber bestand. Auf dem Kopf trug sie weder eine Haube noch ein Tuch und ihr langes, wallendes Haar fiel ihr wie ein Schleier über die Schultern. Er fand, dass sie etwas Gewinnendes an sich hatte und das gefiel ihm sofort. Sie lächelte jetzt und auch dieses Lächeln nahm ihn sogleich gefangen.
»Sieh an, Besuch«, sagte sie nur.
Ihre Stimme klang angenehm. War sie die Sängerin des traurigen Liebeslieds?
»Ja ... Gott zum Gruße, liebe Frau.«
»Ich heiße Esther.«
» Esther. Und du wohnst hier?«
»Ja.«
»Ganz allein?«
»Ja ...«
Urs suchte nach weiteren Worten, die Hand noch immer am Griff seines Schwerts.
»Nimm dich in Acht. Hier schleicht ein großer Wolf herum«, sagte er dann.
Sie lachte, und dieses Lachen perlte wie das helle Geräusch des munter dahinfließenden Bachs zwischen den hohen Bäumen.
»Ich habe keinen Wolf gesehen, Herr Baron.«
»Was denn, du kennst mich?«
Sie lachte erneut und nickte vergnügt. Natürlich, dachte Urs, spätestens beim Anblick meines zerstörten Gesichts weiß jeder, wer ich bin. Er betrachtete sie erneut aufmerksam. Ihre unbedeckten Arme waren zart gebräunt und auch ihr Gesicht war nicht so hell wie die fast weiße Haut der edlen Frauen.
»Ich habe Hunger und Ihr sicher auch, nicht wahr, mein lieber Herr?«, sagte sie.
»Ja ...«
»Gut. Wollt Ihr dann mit mir essen?«
Urs zögerte. Er warf einen verstohlenen Blick zurück zum Bachufer, wo er soeben noch den Wolf gesehen hatte.
»Ich will nur erst nach meinem Pferd sehen«, sagte er dann.
»Lasst es ruhig grasen. Es wird nicht weglaufen.«
Das war alles, was sie sagte, bevor sie lachend in der Hütte verschwand. Urs trat zu seinem Pferd und stellte fest, dass das Tier kein bisschen nervös war. Seltsam, dachte er, vor Wölfen fürchten sich Pferde doch ganz besonders. Ein wenig ratlos führte er das Tier an den Bachlauf und ließ es trinken. Dabei sah er sich erneut aufmerksam um. Da er nur noch ein gesundes Auge hatte, hatte ihm das Licht schon oft einen Streich gespielt. Aber er hatte diesen Wolf doch ganz deutlich gesehen! Suchend wanderte sein Blick über den Boden. Seltsam, nirgendwo eine Spur dieses Raubtiers. Aber ein so großer Wolf musste doch deutlich sichtbare Pfotenabdrücke hinterlassen haben! Urs kniete sich jetzt auf den Boden und suchte ihn erneut aufmerksam ab. Aber da war nichts. Noch immer ratlos, erhob er sich wieder und rückte sein Schwert zurecht. Da war noch etwas, was ihn verwunderte. Diese Frau, Esther, hatte sich bei seinem Anblick nicht erschrocken. Nicht einmal ihre Hand hatte sie vor den Mund genommen. Etwas, was die meisten Menschen taten, wenn sie ihn zum ersten Mal sahen. Seltsam, dachte Urs, das ist alles sehr seltsam. Höchste Zeit, etwas mehr über sie zu erfahren. Wie magisch angezogen, ging er auf die Hütte zu. An der Tür blieb er stehen und blickte hinein. Sie stand am Herd und rührte in einem Topf. Kurz wandte sie ihm das Gesicht zu und lächelte dabei. Sosehr Urs auch sein gesundes Auge anstrengte, sah er nichts anderes vor sich als eben Esther, dort am Herdfeuer. Und er spürte, wie lebendig er sich auf einmal fühlte. Denn sie war splitternackt!
***
»Der König ist auf dem Weg nach Konstanz!«
Als diese Nachricht Gewissheit war, wusste Graf Alfonso Ludwig Maximus Scarpa, Bischof von Florenz, dass es Zeit zum Handeln war. Wenn ihm auch der Gedanke, seine Residenz hier am Ufer des Arno für mehrere Wochen zu verlassen, nicht behagte. Andererseits konnte niemand wissen, wie es der König anstellen wollte, die verfahrene Situation der römischen Kirche zu lösen. Aber wenn es der Monarch aus dem Königreich der Böhmen tatsächlich ernst meinte, musste er, der Bischof von Florenz, unbedingt dabei sein! Nur dass Scarpa keine genauen Informationen hatte, wo sich der König gerade aufhielt. Es hieß nur, er sei auf dem Weg nach Konstanz! Das bereitete Scarpa Kopfzerbrechen. Normalerweise stützten sich seine Nachrichten auf ein System aus zahlreichen Informanten und Beobachtern. Und Brieftauben! Doch im Moment zählte nur: Der König war unterwegs! Scarpa war klar, dass dies nur einen Grund haben konnte: Sigismund wollte die sehnsüchtig erhoffte Neuordnung der Kirche selbst in die Hand nehmen.
»Gino!«
Der Page trat näher.
»Euer bischöfliche Gnaden?«
»Du wirst niederschreiben, was ich dir gleich sagen werde.«
»Soll ich nicht besser den Schreiber holen lassen, Herr?«
»Nein, du schreibst für mich!«
»Sehr wohl, Euer Gnaden.«
Der Page trat an ein Pult, nahm aus einer Lade einen Pergamentbogen und tauchte dann die Feder in ein kleines Gefäß. So blieb er stehen, abwartend, die Hand mit der Feder über dem noch leeren Blatt. Scarpa begann, beide Hände auf den Rücken gelegt, langsam auf und ab zu gehen. Dann diktierte er:
»Geschätzter Bruder Konrad! Lange habe ich nichts mehr von Euch gehört. Wohl sicher, weil Ihr in Eurer Arbeit aufgeht und dabei dem Wort Gottes dient, genauso wie dem meinen. Nun ist es an der Zeit, dass Ihr mir alles berichtet. Deshalb ist es mein Wunsch, dass Ihr auf dem schnellsten Weg nach Konstanz kommt. Auch ich werde dorthin reisen, sodass ich Euch dort antreffen werde. Ich habe Kunde, dass Seine hochwohlgeborene Majestät, der König selbst, kommen wird, um das Konzil zu leiten. Dann will ich Euch an meiner Seite wissen. Es warten große Aufgaben auf uns, und Ihr seid derjenige, dem ich sie anvertrauen möchte. Ich hoffe, Euch in frühestens zwölf Tagen im großen Haus am Seeufer wiederzusehen. Bis dahin segne Euch der Herr und Euer Schaffen.«
Er blieb hinter dem Pagen stehen und sah ihm beim Schreiben über die Schulter.
»Setze 'geschrieben im Namen des hochwohlgeborenen' darunter, ... und dann meinen vollen Namen: Graf Alfonso Ludwig Maximus Scarpa, Bischof von und zu Florenz.«
Der Bischof wartete ab, bis der Mann seiner Aufforderung gefolgt war. Dann nahm Scarpa das Pergament und las es. Am Ende nickte er zustimmend und gab dem Pagen das Schreiben wieder. Der nahm die Feder, tunkte die Spitze in die Tinte und reichte sie sodann seinem Herrn. Scarpa setzte schwungvoll seine Signatur auf das Blatt.
Der Page faltete das Dokument sorgfältig und versiegelte es zuletzt mit einem großen Wachstropfen. Anschließend prägte Scarpa mit einem Ring sein Siegel in das heiße Rot. Der Page nahm den Brief und schickte sich an zu gehen.
»Warte!«, sagte Scarpa, »Hast du bereits eine Ahnung, wer mich auf meiner Reise nach Konstanz begleiten wird?«
Der Mann überlegte einen Augenblick, bevor er antwortete.
»Euer Gnaden, ich weiß von Herrn Balduin de Honnecourt, dem Bruder des Villard de Honnecourt. Ferner Herr von Kyrberg mit seinen Leuten wie auch die edle Freifrau Heilika von Brennenberg. Sie alle sind hocherfreut, sich dem Hofstatt Eurer bischöflichen Gnaden anschließen zu dürfen.«
Scarpa nickte wie in Gedanken. Der Page fuhr in seiner Rede fort.
»Und, Euer Gnaden, Herr Tristan von Hohenstein will auf jeden Fall dabei sein, auch wenn er aus Brescia stammt und dann war da noch ...«