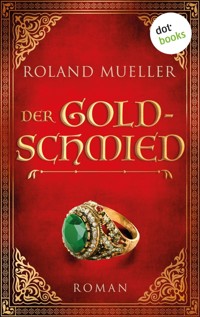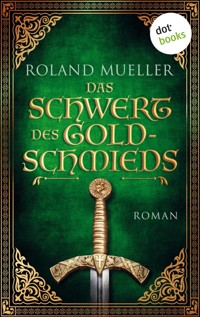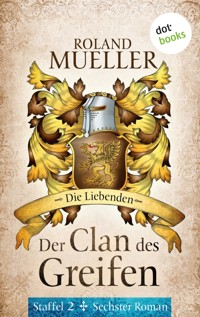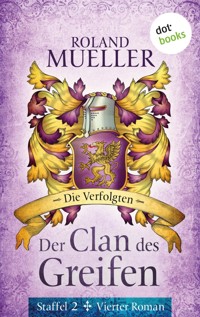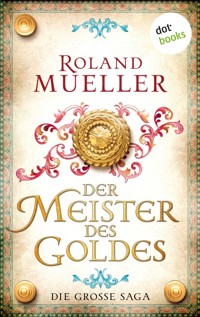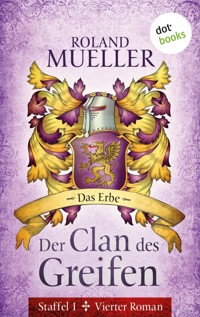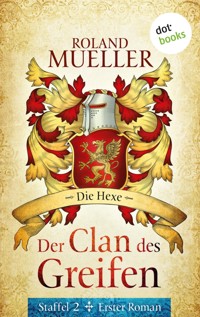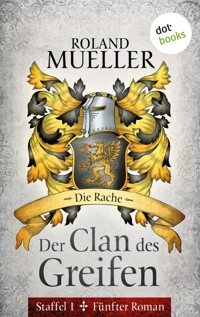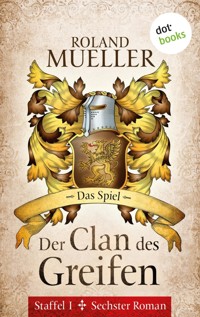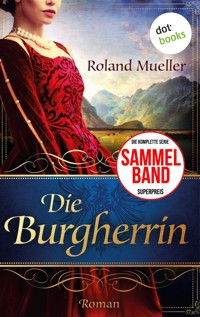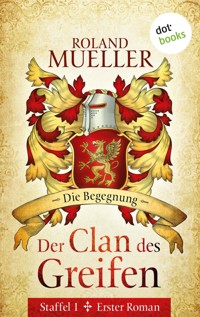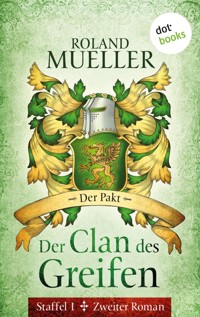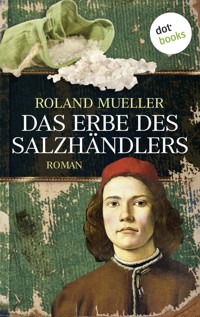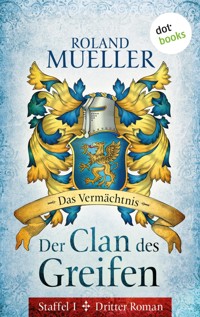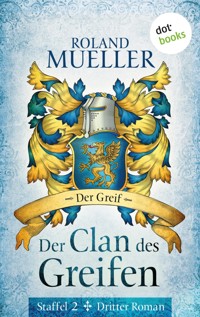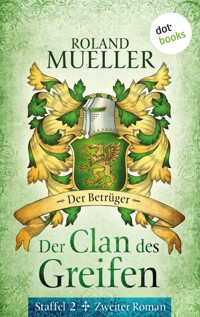Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn der Wunsch nach Freiheit immer größer wird: Der historische Roman »Im Land der Orchideenblüten« von Roland Mueller jetzt als eBook bei dotbooks. Bremen, 1854: Katharina und Maria haben nie geglaubt, einen anderen Platz im Leben zu haben als im Schatten ihres Vaters – aber dann nimmt Gottfried Wilhelm Hegenberg seine Töchter mit auf eine Expedition nach Neuseeland, um eine äußerst seltene Orchideenart zu finden. Die unberührte Wildnis des Maori-Landes weckt etwas in den jungen Frauen: einen Hunger auf mehr, als ihnen bisher zugestanden wurde. Noch dazu begegnen sie dem Abenteurer John Wellington, zu dem sich Maria vom ersten Moment an hingezogen fühlt. Doch als die Suche Hegenbergs nach der exotischen Blume immer besessenere Züge annimmt, wird die Expedition zu einem immer gefährlicheren Wagnis … »Ein Buch, das man kaum aus der Hand legt.« Aachener Zeitung »Ein fesselnder Historienroman!« Für Sie Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der ebenso dramatische wie berührende historische Roman »Im Land der Orchideenblüten« von Roland Mueller. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Bremen, 1854: Für eine seltene Orchideenart ist der besessene Pflanzenjäger Gottfried Wilhelm Hegenberg bereit, in den noch unerforschten Regenwald Neuseelands zu reisen. Gemeinsam mit seinen Töchtern Maria und Katharina durchquert er das wilde, gefährliche Land der Maoris. Doch Hegenberg hat nicht mit dem Freiheitsdrang seiner Töchter gerechnet, und so wird die Suche nach der kostbaren Blume bald zu einem Kampf um Leben und Tod …
„Ein fesselnder Historienroman.“ Für Sie
Über den Autor:
Roland Mueller, geboren 1959 in Würzburg, lebt heute in der Nähe von München. Der studierte Sozialwissenschaftler arbeitete in der Erwachsenenbildung, als Rhetorik- und Bewerbungstrainer und unterrichtet heute an der Hochschule der Bayerischen Polizei. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendbücher.
Bei dotbooks erschienen bereits Roland Muellers historische Romane Der Goldschmied, Das Schwert des Goldschmieds, Das Erbe des Salzhändlers und Der Fluch des Goldes.
***
Neuausgabe Juni 2014
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Titelbildabbildung: Paar: © Thinkstockphoto; istockphoto; Maria Seidel
ISBN 978-3-95520-622-2
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Pflanzenjäger an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
www.gplus.to/dotbooks
Roland Mueller
Die Töchter des Pflanzenjägers
Roman
dotbooks.
»Ich hatte stets vom Leben in der Wildnis geträumt, und jeder ehrliche Träumer wird zugeben, dass er das gleiche Verlangen empfunden hat. Doch glaubt mir, meine Brüder, unsere Herzen sind zu liebesbedürftig, als dass wir ohne einander auskommen könnten, und das Beste, was wir zu tun vermögen, ist, uns gegenseitig beizustehen; denn wir sind wie die Kinder aus einem Schoß, die sich necken, sich zanken, sich sogar prügeln und sich doch nicht voneinander lösen können.«
George Sand
Erster Teil
Der Pflanzenjäger
Ganz gleich, wie grausam die Wechselfälle des Lebens auch sein könnten, Botanik und Gärtnerei gereichten mir immer zum Trost.
Charles de Lécluse, Pflanzenjäger
Um Michaeli (früher oder später, wie es die Jahreszeit erheischt) bringe, wenn das Wetter schön und gewiss nicht neblig ist, deine ausgewähltesten Pflanzen und seltenen Gewächse wie Orangen- und Zitronenbäumchen, indischen und spanischen Jasmin, Oleander, Jupiterbart, Amomum, Geißklee, Chamalaca trioccos, Zistrose, Dattelbaum, Aloe, Mauerpfeffer etcetera unter Dach und Fach.
John Evelyn in The Art of Gardening
»Maria?«
Sie zuckte zusammen, und ihr Herz begann zu schlagen, schneller und schneller.
»Was machst du nur wieder?«, schallte es ungeduldig und zugleich fordernd. Könnte eine Stimme schneiden wie ein scharfes Messer, dann müsste Maria längst mit lauter Narben und noch mehr frischen Wunden herumlaufen. Dabei trug sie Spuren von dem viele Male in grobem Ton Gesagten, da wo es niemand sieht. In ihrem Herzen und in ihrem Bewusstsein als Kind und älteste Tochter, als junge Frau und als Mensch. Die Stimme ihres Vaters. Maria fürchtete sie allein bereits mehr als irgendetwas auf der Welt, und sie konnte sich nicht erinnern, dass es je anders gewesen wäre.
»Nichts, Vater, nichts, ich ...«, stammelte sie.
Sie hörte sich und ihre Worte. Doch für sie klangen sie wie von weither gesagt, und sie begann zu zittern. Dieses Zittern! Dagegen konnte sie sich genauso wenig wehren wie gegen die ständige Furcht vor seinen ungeduldigen Fragen, denn es fiel ihr, wie so oft, keine passende Antwort ein. Wenn überhaupt, gelang eine Antwort eher ihrer jüngeren Schwester Katharina. Deren Furcht vor dem Vater war genauso groß, aber sie war die Jüngere und ihm mehr zugetan. Ein wenig nur, denn genau wusste es niemand. Über »solche Dinge« sprachen sie nicht im Hause Hegenberg.
»Nichts? Das ist doch wohl nicht dein Ernst, Maria?«
Die Stimme. Sie hörte ihren Vater fragen, und der Tonfall in seiner Frage war ungläubig und dann, wie immer, ein wenig höhnisch. Das Herzklopfen war immer noch da. Sie ahnte, es würde sich noch steigern bis zu dem Moment, von dem sie wusste, dass sie in Ohnmacht fallen würde. Wenn sie wieder erwachte, würde sie irgendetwas Scharfes riechen und ihren Vater durch diesen Nebel hören, wenn er tobte, vor lauter Wut. Sie solle nicht so hysterisch sein, schrie er dann, verließ den Raum und schlug die Türen hinter sich zu. Aber die Ohnmachtsanfälle waren in letzter Zeit nicht mehr so häufig gewesen wie in den Jahren zuvor.
Seine Ungeduld rührte von einer Ruhelosigkeit, die diesen – wie jeden – Raum des Hauses füllte bis zu seiner hohen Decke. Wie etwas, was man nicht greifen konnte und das doch da war, schien sie an den mächtigen Bücherregalen aus fast schwarzem Holz an den Wänden ringsum zu haften, hartnäckig zu kleben wie alter Schmutz. Sie stand vor dem Stehpult, alle Glieder angespannt, den Kopf über ein Buch gesenkt. Ihre Nasenspitze berührte fast die Seite, so als wolle sie den Geruch des Papiers und selbst das Geschriebene einatmen, gleichsam aufsaugen.
»Hast du es endlich gefunden?«
Da war sie erneut, diese wartende Ungeduld, leise, nur mühsam beherrscht, aber unerbittlich fordernd. »Noch nicht, Vater«, müsste sie nun antworten, »noch nicht, aber gleich, ich ... ich suche noch.«
»Du suchst? Immer noch?«
Diese oder eine ähnliche Frage würde sogleich kommen, durch die Nase schnaubend, höhnisch und zugleich wütend über das Unvermögen seiner älteren Tochter.
»Was kann so schwer sein, einen simplen Namen zu finden? Rafflesia arnoldii!«
»Ich weiß, Vater, ich weiß doch.«
»Dann finde sie endlich, ich warte!«
Sie wusste, diesen väterlichen Befehl zu missachten, war eine Unmöglichkeit, für die es in ihrem Leben keine Vorstellungskraft gab. Die Liste der Eigenschaften, die den Umgang mit ihrem Vater so schwierig machten, war endlos, und seine Ungeduld stand gleich an vorderster Stelle.
Maria hörte es deutlich, ganz deutlich, das Geräusch seiner schweren Schritte auf dem blanken Holzboden, kurz und hart, wenn er mit der Ferse zuerst auf dem Boden aufsetzte. Eine Tür im Haus fiel ins Schloss. Ihr Herzschlag beruhigte sich, und als sie auf das aufgeschlagene Buch vor sich sah, bemerkte sie Schweißtropfen auf dem Papier. Sie hob den Kopf. So viel Furcht vor etwas, was gar nicht da war, nur Teil ihrer Einbildung! Sie hatte phantasiert, denn sie war doch allein, allein in diesem Raum! Da war niemand, und es würde so bald auch niemand kommen. Ihr Vater befand sich doch auf Reisen, und es würde noch wenigstens eine Woche dauern, bis er zurückkehrte. Zeit genug für sie, all den Aufgaben und Pflichten nachzukommen, die er ihr aufgetragen hatte. Er würde keinen Grund haben, sie zu tadeln, ihre Unfähigkeit und ihre Verzagtheit anzuprangern, erst gefährlich leise, um dann plötzlich zu toben und zu brüllen und seinem Jähzorn, dem sie nichts entgegensetzen konnte, freien Lauf zu lassen. Sie musste unwillkürlich lachen. So weit war es also schon! Sie hörte ihn und seine Stimme, hörte seinen schweren, typischen Schritt, obwohl er gar nicht da war. War es nun so weit? War das der Anfang? Würde sie verrückt werden? So wie ihre Mutter es angeblich geworden war, die kurz nach Katharinas Geburt starb? Oder waren es nur die Spuren jener Hysterie, die ihr Vater ihr stets zuschrieb und die er zu kurieren meinte, indem er seine Töchter und besonders Maria streng unter seiner Aufsicht hielt, sie beschäftigte, wie er es nannte, hier in diesem großen Haus an der Deichstraße in Bremen? Wenn dies nicht ging, weil er auf Reisen war, dann beaufsichtigte Frau Sterling die beiden jungen Frauen. Sie war so etwas wie eine Gouvernante und zugleich Dienstmagd im Hause. Niemand kannte ihr Alter. Sie war schweigsam und darin unerbittlich. Sie sprach nur, um zu tadeln und um mit Nachdruck all die Dinge zu fordern, die ihr der gnädige Herr aufgetragen hatte. Denn auch sie fürchtete sich vor ihm. Kam Marias Vater von einer seiner zahllosen Reisen zurück, musste ihm Frau Sterling sogleich berichten. Über jede Stunde seiner Abwesenheit wollte er genau Bescheid wissen. Vor allem, wo sich seine beiden Töchter aufgehalten hatten und wer mit ihnen gesprochen hatte.
Jetzt schloss Maria die Augen und hielt ihre Fingerspitzen an die Schläfen. Sie atmete tief. Er war nicht da, er war fort, weit fort, und sie war allein! Sie stand da, blass, verletzlich und dennoch anziehend. Maria Hegenberg war eine schöne junge Frau, aber dies erkannte nur, wer sich die Zeit nahm, sie genau zu betrachten. Jeglicher Ansatz von Anmut und Natürlichkeit waren hinter einem Ausdruck ständiger Sorge verborgen. Noch einige Jahre, dann würde dieser stetige Gram sie unscheinbar werden lassen. So, als lasse man eine prächtige Pflanze absichtlich verkümmern und hindere sie daran, sich zu entfalten.
Der große Raum war Bibliothek und Studierzimmer zugleich. An den Längsseiten standen zwei Tische, jeder groß genug, um daran ein halbes Dutzend Gäste bewirten zu können. Die Einrichtung ließ keinen Stil erkennen, eher folgte sie reiner Zweckmäßigkeit. Die Möbel waren schwarz, genauso wie die mächtigen Bücherwände ringsum. Die Tische waren mit Papieren und Landkarten bedeckt. Dazu endlose Listen, voll mit lateinischen Begriffen, mit kleiner Schrift geschrieben, und Unmengen von Zeichnungen und Skizzen. Vorlagen für Kupferstiche. Alles drehte sich nur um ein Thema: Pflanzen. Um Bäume und Sträucher, Gräser und Sukkulenten. Und Blumen, unzählige Arten waren hier mit ihren lateinischen Namen und in Form von Skizzen oder zahllosen feinen Aquarellen abgebildet. Dies war das Studierzimmer von Gottfried Wilhelm Hegenberg, dem Pflanzenjäger. Einem der Männer, die im Auftrag wohlhabender Sammler die unbekannten Teile der Welt durchstreiften, immer auf der Suche nach einer Art, einer Spezies, die noch niemand zuvor entdeckt hatte, die »neu« war. Diese dann zu bestimmen, sie in einem Aquarell festzuhalten, war eine Sensation in den vornehmen Sammlerkreisen, noch mehr, wenn es gelang, die seltene Art unversehrt nach Europa zu schaffen. In London und Paris, in Berlin und Antwerpen, in Brüssel genauso wie in Wien und Rom waren die reich gewordenen Nutznießer der noch jungen Großindustrie wie auch der Hochadel verrückt nach Pflanzen. Sie ließen sich Glashäuser bauen, Palästen gleich, die sie mit all den seltenen Gewächsen schmückten, wie sie ihre Frauen als Beweis ihres Reichtums mit Juwelen behängten, die diese auf den zahllosen Festen und Soireen zur Schau trugen. Das ganze Leben der Familie Hegenberg drehte sich einzig nur darum, Pflanzen zu finden, sie zu dokumentieren und – wenn möglich – ihrem Auftraggeber zu bringen. Unversehrt in einen irdenen Topf gepflanzt, zahlten die Auftraggeber oftmals Unsummen. Manchmal aber zahlten sie gar nichts, dann nämlich, wenn sie das so scheinbar seltene Gewächs längst als Bestandteil ihrer Sammlung ihr Eigen nannten.
»Mein Lieber, da ist Ihnen aber ein Malheur passiert, dass Sie das nicht gewusst haben, dies Kräutlein gibt es schon«, sagten sie dann nicht ohne Schadenfreude und lachten. Aber er lachte nicht, denn er wusste um die Dummheit und Unkenntnis dieser Leute. Wusste, dass sie eine echte Lilie nicht von einer Bromelie unterscheiden konnten, wusste, welche Arten es gab, noch geben musste, denn kaum eine Pflanze stand ganz für sich allein, jede hatte Geschwister, die sich in vielerlei Hinsicht ähnelten und doch verschieden waren, eben anders, und damit als Art neu. Aber das wussten diese hochnäsigen und zugleich einfältigen, neureichen Geldsäcke nicht. Sie plapperten ihr Halbwissen, oft einen ganzen Abend lang, zum Glück ohne ihn. Denn zu solchen Festivitäten war kein Pflanzenjäger geladen. Einen Jäger bittet man doch nicht zu Tisch, wenn es gilt das Wildbret zu goutieren!
Jetzt erinnerte sich Maria wieder. Vater hatte sie getadelt, vor seiner Abreise. Es war aber auch dumm gewesen von ihr. In ihrer Furcht vor seiner verletzenden Ungeduld hatte sie Rafflesia arnoldii, eine Aasblume, in John Parkinsons berühmtem Buch Paradisi in sole Paradisus terrestris gesucht. Dieses erste, große Gartenlexikon überhaupt war ein kostbares Stück, und ihr Vater besaß ein rares Original aus dem Jahre 1619. Darauf war er sehr stolz. Die Nachfrage nach exotischen Pflanzen hatte in den letzten Jahren enorm zugenommen. Die Sammelleidenschaft hatte vor Büchern und Folianten, Stichen und Aquarellen genauso wenig Halt gemacht wie der Wunsch nach den echten botanischen Kostbarkeiten. Aber die Aasblume konnte Parkinson zu seiner Zeit gar nicht bekannt gewesen sein, denn die Pflanze war erst vor wenigen Jahren überhaupt entdeckt worden. Das hatte sie in dem Augenblick ganz vergessen, und als ihr Vater sie voller nervöser Hast in eben jenem Buch suchen sah, begann er zu toben und sie als einfältig und ungebildet zu bezeichnen. Das Ende war wie immer: Zorn und Verachtung angesichts so viel Unverstands bei ihrem Vater, Tränen bei ihr selbst. Alles, was sie über Pflanzen wusste, hatte er ihr beigebracht. Sie war damit so etwas wie seine rechte Hand, und in genau dieser Eigenschaft ging sie all den Aufträgen nach, die ihr Vater ihr auftrug. Marias Fingerspitze fuhr über die Seiten, und ihre Augen sogen die Begriffe samt und sonders in Latein auf, als wären die Worte ein Elixier. Jeder Name, jeder Begriff sagte ihr etwas, und bei jeder Bezeichnung konnte sie sich die benannte Pflanze im Geiste vorstellen. Sie musste den Namen weiterer Arten dieser Gattung finden, aber sie war sich nicht sicher, ob es davon mehrere Arten gab. Konnte die Art Rafflesia arnoldii für sich alleine stehen? Sie erinnerte sich. Ihr Vater brachte vor vier Jahren als erster diese Blume lebend nach Europa. Entdeckt hatten Pflanzenjäger sie schon früher, aber nie war es gelungen, sie heil und unversehrt einem europäischen Sammler oder Interessenten zu bringen. Rafflesia arnoldii, die Aasblume, die mit ihrem Geruch Insekten anlockte und diese dann tötete, wenn die Flügler sich, dem Geruch folgend, auf der fleischigen, feuerroten Blüte niederließen. Im undurchdringlichen Urwald von Siam, im Grenzland des Königreichs von Laos, kam dieses seltsame Gewächs vor, und ihr Vater hatte drei Expeditionen durchgeführt, bis er eine solche Art nach Hause schaffen konnte. Der Geruch der blühenden Pflanze sei entsetzlich, das war alles, was man bis dahin über sie wusste. Und richtig, das erste Mal war der Gestank von zwei gefundenen Exemplaren im Dschungel so stark gewesen, dass eine Meuterei der Träger gedroht hatte. Als es ihrem Vater damals endlich gelungen war, zwei der eben verblühten Pflanzen, unversehrt in Töpfe gesetzt, in ihr Lager zu schaffen, hatte ihr Geruch nach Tod und Verwesung dennoch alles verpestet. Jeder, der sie riechen musste, hatte Hegenberg beschworen, sie so, wie sie waren, zurückzulassen, in ein Loch zu werfen und mit Erde zu bedecken, sie lebendig zu begraben, der einzige Ausweg, ihren infernalischen Geruch zu tilgen. Aber er hatte sich geweigert, das kostbare Gewächs zu vernichten. In der folgenden Nacht hatten sich die Träger heimlich der beiden ausgegrabenen Pflanzen bemächtigt und sie in Stücke zerhackt, keines größer als ein Daumen. Sie hatten die Teile wie eine bereits verwesende Leiche in der Erde verscharrt, und der Zorn der Männer war dabei so groß gewesen, dass es aussah, als blühe Hegenberg dasselbe Schicksal. Nur seinem indischen Führer Lamu gelang es damals, die aufgebrachten Träger zu beschwichtigen. Gottfried Wilhelm Hegenberg hatte vor Wut gekocht, Gott beschworen, ihm zu helfen und diese unwissenden und ignoranten Heiden zu strafen. Aber das Einzige, was Gott ihm zur Besänftigung seines Zorns geschickt hatte, waren heftige tropische Regengüsse, die sich als warme Sturzbäche über ihrem Urwaldlager ergossen hatten. Am nächsten Tag hatte sich die Expedition zurück auf ihren Weg an die Küste gemacht. Von diesem Tag an trennte er sich nie mehr von seinem schweren amerikanischen Armeerevolver, den er einem Marineoffizier in Batavia abgekauft hatte. Hegenberg war ein sonderbarer Mensch, und über seine verschrobene, barsche, oft genug jähzornige Art kursierten längst Geschichten, genauso wie über seine Einstellung zur Gewalt, der er sich als Quäker einerseits verschloss, jedoch nicht immer so, wie es sein Glaube von ihm verlangte. Dieser verbot ihm den Gebrauch von Waffen. Doch er hatte sich die Mühe gemacht und das Buch seines Glaubens genau auf diese vermeintliche Verfehlung hin studiert. Nirgendwo fand er eine Stelle, in der Gott das Tragen einer Waffe verurteilte. Der Quäker und seine Waffe waren dankbarer Gesprächsstoff in den Salons, und so war es auch einmal geschehen, dass Hegenberg bei einem Empfang in Paris wegen seines Revolvers aufgezogen wurde: »Sagen Sie, Monsieur Hegenberg, Ihren Revolver, Sie legen ihn nie ab, wenn Sie auf Reisen sind, nicht wahr?«
Darauf hatte er nicht geantwortet.
»Auch nicht, wenn Sie zu Bett gehen?«
Erneut hatte er geschwiegen, was die Umstehenden als Bestätigung der soeben gestellten Frage genommen und sich in Gelächter ergossen hatten.
»Aber doch wohl, wenn Sie ein Bad nehmen, Monsieur?«, hatte der Neugierige wissen wollen.
»Nicht einmal da«, hatte Hegenberg darauf geantwortet.
Da hatten sie erneut gelacht, alle, aber nicht lange, denn er hatte nur dagestanden und keine Miene verzogen. Da hatten sie verstanden, dass das kein Scherz war, dass Hegenberg niemals scherzte. Er hatte so ernst geantwortet, wie sie ihn als Pflanzenjäger kannten, der zu seinem Auftraggeber sagte: »Ich werde finden, was Sie wünschen, und ich werde es mitbringen, wenn Sie dies wünschen.«
Und sie waren froh, dass er sich nie lange in ihren Salons und vornehmen Kreisen aufhielt.
Gottfried Wilhelm Hegenberg galt als einer der größten Pflanzenkenner weit und breit, und keine Wildnis konnte ihn abschrecken, dort nach Spezies zu suchen, die nur vage bekannt, aber ungeheuer begehrt waren. Vor knapp vier Jahren war er erneut mit einer Expedition nach Rangun aufgebrochen. Lamu, seinem einzigen Vertrauten, erklärte er, dass er noch einmal einen Versuch wagen wollte, die Aasblume zu finden, und dass er jeden, der sich ihm bei dieser Expedition widersetzte, niederschießen würde. Dass es nicht so weit kam, lag am Wetter. Die Regenzeit war damals früher als gewöhnlich angebrochen, und es war unmöglich gewesen, in dem strömenden Monsunregen irgendwo im dunklen Urwald von Siam nach der Blume zu suchen. Denn bei Regen roch sie nicht, die Rafflesia arnoldii.
Als der Pflanzenjäger die Zeit des Monsuns mit Warten überbrückt hatte, sollte ihm ein zweiter Versuch ausreichen, um mit neuen Trägern an der gleichen Stelle wie zuletzt die Suche nach der Aasblume fortzusetzen. Anfangs war ihm das Glück hold gewesen. Bereits zwei Tage nach dem Abmarsch vom Lager in die dichten Hangwälder bei Sambal hatten sie die Pflanze gefunden.
Lamus feine Nase witterte sie schon von weitem. Der Geruch war tatsächlich schier alles betäubend gewesen, und die riesige Pflanze einfach mitzunehmen, hatte sich als unmöglich erwiesen. Zu schnell war sie in der feuchtheißen Luft aufgeblüht, und ihr grauenvoller Geruch sollte Tage anhalten und jedem, der in ihre Nähe kommen sollte, den Atem verschlagen. Hegenberg wollte einen Ableger, weil er hoffte, diesen vor dem ersten Erblühen in einem Topf nach Europa schaffen zu können. Er hatte auch sechs Ableger gefunden und sie alle mitgenommen. Die Pflanze benötigte ganz bestimmte Bedingungen, um zu blühen und ihren typischen Geruch zu verbreiten. Deshalb hatte Hegenberg fast dreihundert Kilo Walderde in Körbe schaufeln lassen. Die Träger mussten sie mitnehmen. Auch das Wasser aus den zahlreichen kleinen Bächen ringsum ließ er in große Lederschläuche füllen. Ein Teil der Träger musste sogar das Regenwasser von den Blättern ringsum in Schläuche füllen. Dieses Mal wollte er nichts dem Zufall überlassen. Er hatte jedem Mann gedroht, ihn sofort davonzujagen, sollte er sich aus Durst an dem Wasser vergreifen. Die Erde aus dem Dschungel und eben dieses Wasser sollten den Setzlingen Nahrung sein, bis ein Schiff sie zurück nach Genua gebracht hatte. Das würde etwa fünf Wochen dauern, ungünstigenfalls acht. Dann wäre die Pflanze reif zum Blühen, und er könnte sie dem Grafen Battista bringen. Diesem eitlen Genueser, der alles Grün sammelte, wenn es nur exotisch genug aussah. Sein Glashaus am Rande der Stadt glich einem Urwald. Er hatte in knapp dreißig Jahren Arten gesammelt, besser ersammeln lassen, um die ihn viele botanische Fakultäten beneidet hätten. Kaum auf See, begannen die Setzlinge zu verkümmern. Hegenberg hatte in seinem Argwohn die Mitglieder der Besatzung im Verdacht, die Pflanzen zu schädigen, sodass sie kränkelten, welk und ohne Kraft geworden waren. Er konnte den Beweis dafür nicht erbringen, und dies machte ihn noch zorniger, denn er war sich sicher, dass man seine Ladung sabotierte. Noch bevor das Schiff die Südspitze Afrikas passierte, waren alle Ableger verfault. Erst im dritten Anlauf gelang es ihm, vier Samenkörner von einem Bergstamm zu erhandeln. Alle Samen keimten, gingen aber bald darauf bis auf eine Pflanze ein. Doch dieses letzte Samenkorn wuchs mit einer Selbstverständlichkeit zu einer kräftigen Pflanze heran und bildete eine große Blüte, die in dem Moment aufging und ihren bestialischen Geruch ausströmte, als Hegenberg die Pflanze beim Grafen ablieferte.
Hegenberg sah dies als Wink Gottes und wünschte sich zu seinem ausgemachten Honorar noch eine Messe, die der Graf lesen lassen sollte: als Dank dafür, dass Gott der Herr ihn diese seltene Aasblume als kostbares Handelsgut, blühend und unbeschadet nach Europa zurückbringen hatte lassen.
Maria hatte keine weitere bekannte Art aus der Gattung der Aasblumen gefunden. So schrieb sie den lateinischen Namen noch einmal auf ein Blatt Papier und dazu alles, was man bisher über die Pflanze zu sagen wusste. Das meiste waren die Erkenntnisse ihres Vaters, der alles über diese Blume in seinen Aufzeichnungen vor Ort niedergeschrieben hatte. Die ältere Tochter des Pflanzenjägers würde sie nun mit ihrer klaren Schrift auf die unzähligen Folianten übertragen. Hegenberg selbst machte sich die Mühe, diese Schriftstücke aufs Genaueste zu studieren. Manchmal ergänzte er noch etwas eigenhändig. Seltsamerweise hatte er fast die gleiche Schrift wie seine Tochter. Wer es nicht besser wusste, musste glauben, all die Aufzeichnungen stammten von ein- und derselben Person.
Die Rafflesia arnoldii blühte nur bei einer bestimmten Temperatur und nur, wenn die Luft ringsum schwer war vom warmen, feuchten Dunst der fernen Täler in den Wäldern von Siam und dem feuchten Boden des Regenwaldes. Einzig ihr Geruch ließ sich kaum beschreiben. Ein Geruch nach verwesendem Fleisch.
»Gentlemen, Gentlemen, bitte! Ich bitte um Ruhe! Ruhe bitte!«
Das Stimmengewirr wurde leiser und leiser, bis es fast ganz verstummte. Der Auktionssaal von Protheroes in London war brechend voll. Eilig herangeschaffte Sessel für immer weitere Interessenten konnten dem Ansturm trotzdem nicht gerecht werden, und so standen viele Besucher an den Wänden auf ihre Spazierstöcke gestützt. Es waren ausschließlich Männer in feinen Gehröcken, die meisten mit einem Zylinder auf dem Kopf, den Kragen nach neuer Mode hoch geschlossen und mit einem Seidentuch gebunden. Vertreter der britischen wie ausländischen Hochfinanz waren genauso vertreten wie Adelige und Inhaber der aufkeimenden Industrieunternehmen aus allen Teilen der Alten Welt. Wer nicht selbst anwesend sein konnte, hatte seinen Agenten geschickt.
»Gentlemen, wir kommen nun zu einem Höhepunkt unserer Versteigerung!«
Das Raunen, das durch die Menge gegangen war, verwandelte sich in ein leises Murmeln. Alle wussten, was der Auktionator nun ankündigte, war der Traum jedes Pflanzensammlers. Die Königin der Blumen, die Orchidee, stand zum Verkauf und nicht etwa eine einzelne Pflanze, sondern ein ganzes Konvolut sollte zum Aufruf kommen. Ein Auszug der Katalognummer 772 war von livrierten Bediensteten des Auktionshauses bereits auf einem langen, schweren Tisch aufgestellt worden: unzählige kleine und große Töpfe aus blau glasiertem chinesischem Ton. Jeder enthielt nur eine Pflanze: eine Orchidee, deren prächtige Blüte sich auf dem Höhepunkt ihres Wachstums um bald 180 Grad dreht, sodass die reife Blüte fast auf dem Kopf steht. Drei Kelchblätter umschließen die drei Kronblätter in einer inneren Blütenhülle, wobei Kelchblätter und die beiden seitlichen Kronblätter einander sehr ähnlich sind. Nur das dritte Kronblatt sieht immer ein wenig anders aus. Meist größer, unterscheidet es sich in Form und Farbe von den anderen. Viele Arten sind an dieser Stelle stark geteilt oder gar becherförmig. Die Vielfalt der Blütengestalt war es, die zahllose Sammler seit Jahren zu Liebhabern dieser Blume werden ließ. Die Orchidee kam fast überall auf der Welt vor, und doch waren die meisten noch gar nicht entdeckt worden. Zugleich hatten Pflanzenliebhaber und Botaniker der Alten wie der Neuen Welt längst damit begonnen, die bekannten Arten miteinander zu kreuzen.
»Gentlemen!«, hob der Auktionator an. »Bevor wir beginnen, ein paar Worte zu dieser Sammlung. Wie Sie vielleicht wissen, stammt sie aus dem Nachlass des seligen Lord Compton.«
Ein erneutes Raunen ging durch den Raum, und der Auktionator hob die Hand, um fortzufahren.
»Seine Lordschaft war ein Kenner und ein großer Sammler zugleich. Das Ergebnis einer so großen Leidenschaft für Orchideen sehen Sie hier: ein großer Posten, die Kollektion eines Sammlerlebens, so etwas wird nur selten angeboten. Aber das brauche ich hier, in diesem Kreis, wohl nicht extra zu betonen, nicht wahr ?«
Einige Zuhörer lachten und bestätigten so seine Worte. Hier galt jeder als Kenner. Etliche durfte man allerdings als Spekulanten bezeichnen, die mit kostbaren Pflanzen Handel trieben. Andere waren echte Sammler, die in bisweilen fanatischer Manier den Bestand ihrer ansehnlichen Glashäuser um weitere Exemplare zu ergänzen trachteten. Sie alle besaßen seltene Rosen, Tulpen und Lilien, manche auch eine der heiß begehrten Orchideen. Die Orchidee war die Pflanze der auserwählten Menschen dieses Zeitalters.
»Gentlemen, die Namen aller einzeln aufgeführten Arten entnehmen Sie bitte unserem Katalog. Die Pflanzen befinden sich alle in einem guten und gesunden Zustand, und was Sie hier sehen, ist verständlicherweise nur eine winzige Auswahl dessen worüber wir heute zu befinden haben. Unser Haus erlaubt sich hier noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Verkauf dieser Sammlung nur komplett erfolgen kann und die Kaufsumme nach erfolgtem Zuschlag, aber spätestens nach dem Souper, zu begleichen ist.«
Die Anwesenden lachten erneut, aber der Auktionator verzog keine Miene, sondern ergriff den Hammer. Augenblicklich wurde es still. Nur das leise zischende Geräusch der Gaslampen an den Wänden ringsum war zu hören.
»Dieser Posten aus dem Nachlass des seligen Lord Compton umfasst mindestens 10 000 lebende Pflanzen der Familie Orchidaceae, dazu ein Posten Lilien, die sich ebenfalls in gesundem Zustand befinden.«
Er machte eine Pause, und alle Anwesenden wussten, er würde nun das Mindestgebot ausrufen, und bereits diese Summe würde ein kleines Vermögen sein.
»Gentlemen, angesetzt ist eine Mindestsumme von 6500 Pfund. Ich höre nun Ihr Angebot.«
Die angesetzte Summe war enorm, und so dauerte es einen Moment, bis die ersten Gebote fielen.
»7000!«
»Sir ...!«
»7500!«
»7500! Habe ich gehört!«
»8000!«
»8500!«
Einige Bieter riefen die Summe laut, während andere nur auf einen kurzen Blick des Auktionators hin nickten oder, wie rein zufällig, ihr seidenes Schnupftuch hoben oder den Hut lüpften. Die Gebote kletterten zunächst um jeweils 500 Pfund in die Höhe. Ab einer Summe von 10 000 englischen Pfund, so die Gepflogenheiten des Auktionshauses, galten Schritte von jeweils 1000 Pfund. Das geschah längst, aber noch immer riefen laute Stimmen dem Mann auf seinem Podest unglaubliche Summen zu.
»16!«
»16 000 Pfund, Sir. Vielen Dank ...«
»17!«
»17 000 Sir? Ich habe es gehört, ich danke Ihnen.«
»18! Ich sage 18!«
Die Gebote kamen nun ein wenig zögernder als noch Minuten zuvor, sodass der Auktionator einige höfliche Worte daran hängen konnte: »Sir, hörte ich 18 000, ja? 18 000 Pfund Sterling war das letzte Gebot dieses Gentleman in der vordersten Reihe. Noch jemand? «
Das Publikum schwieg und einige der Anwesenden begannen sich rasch nach allen Seiten umzudrehen, nur um zu sehen, wer ein weiteres Gebot abgeben wollte.
»Niemand, nein? Nun dann sage ich 18 000 zum Ersten ...«
»19 000!«, tönte plötzlich ein lauter Ruf aus der letzten Reihe.
Erneut raunten die versammelten Männer, und erstaunt wandten sich die Köpfe, um nach dem Gesicht des Rufers zu suchen. Die soeben genannte Summe entsprach etwa dem Jahresgehalt eines Bankiers der Bank von England.
»19 000 Pfund!«, wiederholte der Auktionator. »Meine sehr verehrten Herren, 19 000 Pfund sind für dieses Konvolut geboten worden. 19 000 Pfund Sterling, und ich sage 19 000 zum Ersten, zum Zweiten ...«.
Jetzt hob er den hölzernen Hammer.
»... und 19 000 zum ...!«
»Zwanzig!«, rief eine Stimme.
Alle Augen richteten sich auf den Mann, der das letzte Gebot gerufen hatte. Er stand direkt an der Wand, und als die Umsitzenden ihn anblickten, sank seine Hand langsam wieder.
»Pitcairn! Das ist Angus Pitcairn!«, raunten Stimmen unter den Wartenden.
Köpfe senkten sich, und es wurde aufgeregt geflüstert.
»Ich kenne ihn, Agent für die Amerikanische Gesellschaft, vor zwei Tagen erst aus New York gekommen.«
»Hab ich gehört. Der Schoner kam spät, ungewöhnlich schwere See die ganze Zeit, von Halifax bis Portsmouth.«
»Weiß der Teufel allein, wie er es angestellt hat, trotzdem rechtzeitig hier zu sein.«
»Oh, Mister Crones, dieser Pitcairn verfügt über unbegrenzte Mittel. Wahrscheinlich hat er jeden Fetzen Tuch setzen lassen, nur um pünktlich hier zu sein.«
»Verehrte Freunde der Schönheit!«, rief der Auktionator mit lauter Stimme, »20 000 Pfund lautet das Gebot dieses verehrten Gentleman dort drüben. Wenn es dabei bleibt?«
Er warf erst einen raschen Blick auf den Amerikaner und dann auf das übrige Publikum.
»20 000 zum Ersten, zum Zweiten, und zum ...«
»Halt«, rief eine Stimme, »ich biete 21 000 Pfund!«
Erneut fuhren alle Köpfe herum. Aber niemand sprach ein Wort, denn keiner der Anwesenden hatte nach dem letzten Gebot des New Yorkers noch an eine Erhöhung der Summe geglaubt. In der ersten Reihe saß ein noch junger Mann, auffallend elegant gekleidet, den derzeit modischen Backenbart sorgfältig und kurz gestutzt. Schlanke Finger spielten scheinbar beiläufig mit einer silbernen Kette, woran ein Augenglas hing.
»Kohnstamm«, raunten diejenigen, die ihn erkannt hatten.
»Ich dachte immer, ein Jude bietet nur, wenn es um Kohl oder Kartoffeln geht?«, bemerkte jemand spitz.
»Oder Konterbande!«
Ein anderer lachte verhalten.
»Gentlemen!«, rief der Auktionator, der selbst überrascht war, »ich sehe, die Runde ist noch nicht zu Ende.«
Er bemühte sich, das Frohlocken in seiner Stimme nicht gar zu deutlich werden zu lassen.
»21 000 englische Pfund für die Sammlung Orchidaceae des seligen Lord Compton, aufgeboten von dem Gentleman hier in der ersten Reihe. Vielen Dank, Sir.«
Er nickte ihm zu und hob dann schnell den Hammer, so, als wolle er das Gebot des Mannes dort so rasch wie möglich besiegeln, konnte es doch sein, dass er sich die Sache noch einmal anders überlegte. Obwohl dies nach den Bedingungen des Auktionshauses nicht möglich war, denn er hatte sein Gebot abgegeben, und es war bindend.
»21 000 zum Ersten, zum Zweiten und zum ...«
» 22! «, rief der Amerikaner mit dem Namen Angus Pitcairn, hob dabei beide Hände zugleich, und sein Blick wirkte nicht gerade freundlich. Nun waren die Stimmen im Saal so laut geworden, dass niemand mehr die Bemerkungen verstand, die man sich gegenseitig zurief. Zwischen dem Deutschen Kohnstamm und dem Amerikaner Pitcairn war ein Bieterduell entflammt, das für alle Beteiligten Spannung offenbarte, die nur mit einem dramatischen Finale auf der Rennbahn in Ascot oder Humble zu vergleichen war.
»Gentlemen!«, rief der Auktionator laut, »Gentlemen, ich bitte Sie! Beachten Sie die Gepflogenheiten unseres Hauses. Eine Unterbrechung der Auktion wäre jetzt nicht statthaft. Bitte! «
Nur schwer ließen sich die Anwesenden beruhigen. Kohnstamm wandte sich auf seinem Sitz um, und als die Umsitzenden und Wartenden ein wenig ruhiger wurden, erhob er sich kurz, blickte auf Angus Pitcairn und lüpfte galant seinen Zylinder. Der Amerikaner erwiderte die Geste durch ein knappes Nicken. Erneut war es still im Saal, denn niemand wollte sich auch nur einen Augenblick dieses Bietergefechtes entgehen lassen.
»Gentlemen, 22 000 Pfund Sterling waren das letzte Gebot, und ich sage diese Summe zum Ersten, zum Zweiten und zum ...«
Diesmal wartete er einen winzigen Moment, aber es blieb still, atemlos still in dem Auktionssaal.
»Dritten!«
Mit einem dumpfen Knall fuhr der Hammer auf das Pult nieder.
»Der Posten 772 geht an den Gentleman dort drüben. Vielen Dank, Sir! «
Alle Anwesenden begannen nun laut zu applaudieren und scharrten mit den Füßen. Kohnstamm erhob sich als Erster, wandte sich dem Amerikaner zu und lächelte. Pitcairn lächelte säuerlich zurück. Noch immer applaudierten die Männer ringsum und schufen eine Gasse, als der Agent, von einigen weiteren Herren begleitet, nach vorne trat, um die unglaubliche Summe zu begleichen, die für das Lebenswerk des Sammlers Lord Compton aus dem legendären Fulham Palace fällig war.
»Kohnstamm, Sie sind ein Teufelskerl.«
Unzählige Hände klopften ihm auf die Schulter, und die Stimmen wollten sich gar nicht mehr beruhigen. In einem Salon des Auktionshauses Protheroe umstanden rund zwei Dutzend Männer den Deutschen. Sie stammten wie Julius Aron Kohnstamm aus Preußen und waren für diese Auktion extra nach London gereist. Da die Versteigerung noch den ganzen Tag über andauern würde, waren Bevollmächtigte damit beauftragt worden, weitere Posten zu ersteigern, selbst wenn keiner mehr so bedeutend sein sollte wie das Los Nummer 772.
»Aber nun sagen Sie einmal, was hat Sie geritten, den Amerikaner so herauszufordern?«
»Nun, sagen wir, der Sportsgeist?«, fragte Kohnstamm mit unschuldigem Lächeln.
Die Antwort war Gelächter ringsum.
»Das hätte auch schief gehen können!«, rief Legationsrat Färber mit geröteten Backen.
»Ja, das hätte es, aber das wusste ich.«
Die Anwesenden schwiegen erstaunt.
»Natürlich hätte ich die Sammlung selbst kaufen können, aber ...«
»Aber?«, fragte Färber.
»Ich wollte sie doch gar nicht.«
Erneut lachten die Männer.
»Freunde!«
Die Anwesenden beruhigten sich.
»Ich wusste doch genau, wie sehr Pitcairn die Sammlung wollte. Ich wusste auch, dass er zum Auktionstermin in London sein musste. Er würde bieten, notfalls bis zur Schmerzgrenze. Diese Grenze lag irgendwo bei 20 000 Pfund und siehe da, genau da habe ich ihn erwischt. Geld ausgeben kann wohl schmerzen und sehr viel Geld erst recht, nicht wahr?«
Jetzt lächelte Julius Aron Kohnstamm nicht mehr, und seine Zuhörer schwiegen. Er kannte all die Gesichter vor sich gut, wusste um Prominenz und Wichtigkeit jeder einzelnen Person. Da waren Männer aus dem preußischen Rat, ranghohe Diplomaten, Großindustrielle und etliche Mitglieder des deutschen Adels. Julius Aron Kohnstamm hatte etwas mit ihnen gemeinsam: Er war reich und galt als Liebhaber der schönen Künste, Gönner und Mann mit Geschmack. Er war ein gut aussehender Mann, kaum über vierzig Jahre alt, mittelgroß, Kleidung und Bart entsprachen der gängigen Mode, hatten aber eine eigene Note. Alle Anwesenden in diesem Raum wussten, dass er Jude war, und viele Mitglieder der botanischen Gesellschaft waren aus den üblichen antisemitischen Vorurteilen des deutschen Großbürgertums mit Kohnstamms Aufnahme in ihren Kreis nicht einverstanden gewesen. Trotzdem war es dazu gekommen, denn der erfolgreiche Unternehmer brachte ein gewichtiges Argument mit: Er war ein leidenschaftlicher Pflanzenfreund. In Teblitz besaß er neben seinem prächtigen Haus eines der größten privaten Glashäuser Europas, und selbst Sammler aus Übersee schätzten seine erlesene und ausgewählte Sammlung. Allein auf drei Reisen in diesem Jahr nach England und Holland hatte er einige sehr seltene Spezies erworben. So war ein Skandal ausgeblieben, denn all dies machte ihn nicht nur für die Gesellschaft der Pflanzenfreunde, sondern auch für das gesellschaftliche Parkett interessant.
»Bitte, hoffentlich hat es jeder von Ihnen bequem.«
Einige Männer sahen sich nach Aschenbechern für ihre Zigarren und Pfeifen um.
»Liebe Freunde der Botanik, und erlauben Sie mir diese Worte, auch Freunde im Geiste.«
Er machte eine winzige bedeutungsvolle Pause, um vor allem die letzten Worte wirken zu lassen. Niemand machte Anstalten, durch sein Mienenspiel zu verraten, was er wirklich von diesen Worten dachte. So fuhr er fort.
»Ich freue mich, dass wir uns alle hier treffen konnten. London ist ein vergnüglicher Ort und wird uns sicherlich noch viel Freude bereiten. Wie ich weiß, wird kaum jemand von uns in den nächsten Tagen heimreisen. Sie alle kennen mich als Liebhaber und Freund seltener und zugleich faszinierender Pflanzen. Es sind Werke eines Schöpfers, der uns damit zeigt, wie gut er es mit uns meint. Denn was wäre sonst der Grund für die verschwenderische Fülle von Pflanzen auf der Welt? Und wie Sie alle wissen, niemand hat bisher einen Platz ausgemacht, an dem es keine Pflanzen gibt.«
Die Zuhörer nickten beifällig.
»Außer natürlich an den eisig kalten Plätzen dieser Welt. Aber ich frage Sie, nach welchen Pflanzen sollte man denn dort Ausschau halten?«
Die Anwesenden lachten, und Kohnstamm lächelte zufrieden. Er hatte seine Zuhörer so weit vorbereitet, und seine angenehme Art zu sprechen machte es ihm leicht, sie für seine Rede zu interessieren.
»Wie wir alle, bin ich ständig auf der Suche nach Pflanzen, und der Austausch mit Gleichgesinnten über dieses Thema ist mir höchste Freude. Aber noch mehr beglückt es mich, nach Spezies Ausschau zu halten, die selten sind, einmalig, weil sie noch nie vorher jemand gesehen hat, und – weil niemand gewusst hat, dass es sie gibt.«
»Hört, hört!«, murmelten einige Zuhörer halblaut.
»Ich bin gewillt, in diesen Kreis, der mich einst so überaus herzlich aufgenommen hat, eine besondere, nennen Sie es ruhig Mitgift – ja eine Mitgift – einzubringen. Lassen Sie mich deshalb ein paar Worte darüber erzählen. Wie Sie vielleicht wissen, war es Sir Gilmore Tradescant selbst, der vor knapp vier Jahren das erste Mal darüber berichtete. Aus der Gattung Dendrobium sind uns bereits viele Spezies bekannt. Nicht nur ich, nein, viele von Ihnen lieben diese Arten so sehr, dass sie längst einen Platz in Ihren Sammlungen und Glashäusern gefunden haben. Aber die Krönung, liebe Freunde, fehlte bis jetzt.«
Jetzt begann ein Gemurmel in den Reihen der Zuhörer. Sie flüsterten miteinander, beugten sich dabei zu den neben sich sitzenden Nachbarn und tuschelten. Kohnstamm lächelte zufrieden. Es war ihm gelungen, in wenigen Sätzen Aufmerksamkeit bei den Mitgliedern zu wecken. Er wusste um den Dünkel in diesen Kreisen, mehr noch, als sich hier ein Teil der wohl einflussreichsten Köpfe des jungen und dynamischen Preußen versammelt hatte. Die Leidenschaft, welche diese Herren pflegten, war keine bloße Spielerei. Denn über den Austausch von Pflanzen mit Sammlern in ganz Europa korrespondierten diese Männer mit Industriellen und Fürstenhäusern gleichermaßen. Pflanzen waren gleichbedeutend mit Geschäften, guten Geschäften, aber auch mit Diplomatie. Kohnstamm blickte in die Runde, und die vor ihm Sitzenden schwiegen erwartungsvoll. »Meine Herren!« Er trat an einen kleinen Tisch, neben dem eine Staffelei stand. Darauf war ein Gegenstand mit einem großen Tuch verhüllt. Julius Kohnstamm zog das Tuch zur Seite, und alle Augen blickten auf ein hübsches Aquarell. Einige Herren nahmen Brillen oder Augengläser aus ihren Westen, beugten sich nach vorn und studierten das Bild mit Kennermiene. Vor dem angedeuteten Hintergrund einer Baumrinde war eine Blütenrispe gemalt, die nach unten hing. Die kleinen, einzelnen Blüten waren gelb-orangefarben. Es war eine Orchidee, die epiphytisch, also auf Bäumen aufsitzend, wuchs. Der unbekannte Künstler hatte kein zartes Gelb, sondern einen warmen orangefarbenen Ton dafür verwendet.
»Meine Herren«, wiederholte er, »dies hier ist eine völlig unbekannte Orchidee, und ein begabter Botaniker hat sie vor mehr als zwei Jahren nach den Skizzen des Entdeckers angefertigt. Leider nur ein Bild, aber wunderschön, nicht wahr?«
Einige Herren in der Runde nickten beifällig. Keiner von ihnen konnte sich dem prächtigen Anblick der exotischen Blume entziehen. Kohnstamm fuhr fort und deutete auf das Kunstwerk: »Diese Pflanze ist bisher von niemandem glaubhaft gesichtet und katalogisiert worden. Und noch nie wurde sie in einer Sammlung in Europa oder sonst wo gesichtet. Wir wissen nur, dass es eine Orchidaceae, und ihre Gattung wohl Dendrobium ist. Aber die Art ist uns völlig unbekannt. Leider können wir den einzigen Menschen, der sie je gesehen hat, nicht mehr um weitere Auskünfte bitten.«
Einer der Anwesenden hob seine Hand.
»Warum dies, lieber Kohnstamm?«
»Nun, dieser Mann ist tot.«
Er trat ein paar Schritte zwischen die Sessel der Männer, schweigend, und wartete, bis sich die Mitglieder vor ihm in ihrem Geflüster über diese Nachricht wieder beruhigt hatten.
»Es stellt sich doch die Frage, ob wir, die Botanische Gesellschaft, uns nicht das Vergnügen gönnen sollten, mit eben dieser Art zu zeigen, welchen Stellenwert, ja welche Bedeutung unsere Stiftung hat. Wie sähe das aus, wenn wir sagen könnten, wir sind im Besitz einer neuen Spezies aus der Gattung Dendrobium, die in Farbe und Form so prächtig, ja geradezu einzigartig ist? Wir, und nicht die englischen oder französischen Sammler oder gar die amerikanische Gesellschaft?«
»Bravo!«, riefen einige Männer sogleich und lachten in Erinnerung an das Bietergefecht vor kaum einer halben Stunde.
Julius Kohnstamm schritt, die Daumen in seiner Weste aus grünem Samt eingehakt, zurück an die Staffelei.
»Es ist damit eine preußische und zugleich deutsche Aufgabe, mit einer solchen Spezies zu glänzen. Sie wird erneut zeigen, wie unser Vaterland auf dem Weg ist, sich als führende Nation unter den Völkern zu behaupten.«
Einmütig klopften die Männer mit den Knöcheln auf die hölzernen Lehnen und Platten der Sessel und Tische ringsum. Die Zustimmung für seine Worte erschien eindeutig.
»Also Freunde, warum nicht jemanden ausschicken, der uns diese geheimnisvolle Pflanze bringt? Nicht als Bild gemalt, sondern in einem Topf voll Erde, blühend, gesund.«
»Bravo!«, riefen die Umsitzenden erneut, diesmal lauter und durchaus begeistert.
Kohnstamm lachte und dämpfte mit einer höflichen Handbewegung die Erregung ein wenig, und jeder sah, dass er noch mehr sagen wollte. Ein Diener öffnete die Tür und ließ einen Mann ein.
Der wäre wohl niemandem weiter aufgefallen, denn seine schwarze Kleidung, der lange Gehrock und der hohe Zylinder unterschieden ihn nicht von den meisten Männern, denen man in diesen Tagen auf den Straßen Londons begegnete. Doch dieser Mann war sehr groß und hager. Sein düsteres Gesicht, umrahmt von einem schwarzen Bart, dazu die schmucklose Kleidung, verbreiteten sogleich eine Aura der Verschlossenheit um ihn.
»Liebe Freunde«, begann Julius Kohnstamm zu sprechen, »erlauben Sie mir, diesem Kreis einen Landsmann vorzustellen: Herrn Gottfried Wilhelm Hegenberg!«
Der Vorgestellte trat näher und verbeugte sich kühl.
»Herr Hegenberg kommt aus Bremen und ist Botaniker. Aber was noch wichtiger ist, er ist der Mann, der bereit ist, das zu tun, was ich, Verzeihung, was wir uns wünschen: die Suche nach der unbekannten Orchidee! Herr Hegenberg ist ein Pflanzenjäger.«
Alle schwiegen und sahen zu dem Mann, der jetzt kerzengerade, fast steif auf einem Sessel Platz genommen hatte, den Zylinder auf seinen Knien. Er sah in die Runde vor sich, ohne wirklich einen der Sitzenden anzusehen. Alle hatten die unzähligen Geschichten über jene Männer gehört, die im Auftrag der Pflanzenliebhaber die Welt bereisten, hin zu den entlegensten Orten der Erde, um nach Pflanzen Ausschau zu halten, über die es keinerlei Erkenntnisse gab. Diese Männer brachten oft nur Skizzen oder Beschreibungen der exotischen Gewächse in ihren abgegriffenen Tagebüchern zurück nach Europa. Das war ihnen aber Beweis und Herausforderung genug, erneut aufzubrechen und sie zu suchen. Es waren Abenteurer, deren Beweggründe im Dunkeln blieben und die niemand so recht einzuschätzen wagte. Doch dieser Mann hier entsprach nicht ihren Vorstellungen eines Abenteurers.
»Herr Hegenberg hat für mich bereits Erkundigungen getätigt. Nach seinen Aussagen kann er diese Blume finden, und ich vertraue ihm, und ...«
»Moment, lieber Kohnstamm! Einen Moment ...«, unterbrach ihn einer der Herren, Friedrich Wehrnacker, ein wohlhabender Großgrundbesitzer aus der Gegend um Potsdam, »ich möchte selbst ein Wort an den Herrn richten.«
»Aber bitte sehr, natürlich!«, antwortete Julius freundlich und unterstrich dies mit einer Geste, hin zu dem Platz, auf dem der seltsame Gast saß.
»Herr Hegenberg!«, begann der Mann und senkte ein wenig den Kopf. Er lächelte dabei, doch war es ein Lächeln, das seinem Gegenüber nur sagen sollte, ich vertraue dir nicht, ja mehr noch, wer weiß, ob du für solch eine Aufgabe überhaupt geeignet bist.
»Sie haben also diesbezüglich Erfahrung, mein Lieber? Ich meine damit, Pflanzen zu finden, sie zu bestimmen, sie unbeschadet nach Europa zu bringen?«
Hegenberg rührte sich nicht, als er mit dunkler, gleichmütiger Stimme antwortete.
»Ich tue nichts anderes, mein Herr.«
»Sie sind also Pflanzenjäger?«
»Jawohl«, antwortete Hegenberg knapp.
Wehrnacker sah sich zu seinen Kollegen um und wandte sich dann erneut zu Hegenberg.
»Haben Sie so etwas wie Referenzen? Wenn Sie verstehen, was ich meine?«
»Ich sagte bereits, ich tue nichts anderes, als Pflanzen aufzuspüren.«
»Und Ihre Referenz?«
»Ich finde die Pflanzen auch, die ich suche. Das ist meine Referenz.«
»Oho ...«
Wehrnacker war nach diesem Wortwechsel sichtlich verblüfft.
»Wo hoffen Sie denn diese Spezies zu finden, Ihrer Erfahrung nach?«
»Ich hoffe es nicht, ich weiß es.«
»Hört, hört!«, riefen einige lachend und verstummten sogleich wieder, um nichts von dem Dialog zwischen dem Preußen und dem schwarz gekleideten Mann zu versäumen.
»Wo ist die Pflanze also zu finden?«
»Das ist und bleibt meine Sache, Herr.«
»Ach so?«, sagte Wehrnacker eher ungläubig und sah sich erneut um. Die übrigen Mitglieder der Runde begannen zu murmeln.
»Gut, mein Lieber, woher ...?«
»Ich weiß den Platz, wo sie zu finden ist«, sagte Hegenberg schroff.
Die halblauten Gespräche ringsum verstummten.
»Gut, aber woher? Woher wissen Sie von dem Fundort?«, drängte Wehrnacker.
»Ich kannte Jan van Mart, den einzigen Mann, der sie je gesehen hat.«
»Sie kannten van Mart, den berühmten Pflanzenjäger?«, fragte Wehrnacker ungläubig.
»Ja.«
»Und er hat Ihnen aus Freundschaft erzählt, wo diese Blume zu finden sei?«
»Nein, das hat er nicht. Das hätte er niemals getan. Pflanzen suchen, sie aufstöbern und zu sammeln ist ein Geschäft. Van Mart und ich waren keine Freunde. Ich war nur dabei, als er vor zwei Jahren hier in London darüber berichtete.«
»Und seitdem haben Sie ihn nicht mehr gesehen?«
»Doch, vor einer Woche. Erneut hier in London. Flussschiffer haben ihn aus der Themse gezogen. Da muss er schon eine Weile darin gelegen haben, aber das, was die Fische von ihm übrig gelassen haben, habe ich noch wieder erkannt.«
Die Männer starrten alle wie gebannt auf Hegenberg, der für einen Moment den Mund zu einem winzigen bösen Lächeln verzog. Alle schwiegen, bis Kohnstamm erneut das Wort ergriff.
»Meine verehrten Freunde, sagt selbst, wer wäre besser für diese Expedition geeignet als dieser Mann? Beauftragen wir ihn mit der Suche. Alles Weitere wird sich dann finden. Was sagen Sie dazu?«
Die Frage war an die Mitglieder dieser Runde gerichtet, und alle nickten zustimmend, und dann begannen sie als Zeichen ihres Einverständnisses zögernd zu applaudieren. Kohnstamm lächelte und beugte leicht den Kopf. Dann bat er mit einer höflichen Geste noch einmal um Aufmerksamkeit.
»Ihr Herren, alles Weitere werde ich mit Herrn Hegenberg besprechen, und ich bin mir sicher, er wird uns ein Exemplar dieser seltenen Pflanze bringen. Wir werden sie alle bewundern können. Herr Hegenberg, wenn Sie einstweilen so freundlich wären, draußen zu warten!«
Mit diesen Worten war der Pflanzenjäger entlassen. Er erhob sich steif, grüßte mit einem kurzen Nicken die vor ihm versammelte Runde und verließ dann den Raum. Als er gegangen war, schwieg die kleine Gruppe. Alle Augen waren auf Kohnstamm gerichtet, der noch immer neben der Staffelei stand.
»Ich habe vergessen, noch etwas zu erwähnen, liebe Freunde. Der Holländer Jan van Mart hatte einen Sohn. Er heißt Gus van Mart, und ist wie sein Vater Pflanzenjäger. Erst wollte ich ihn beauftragen, aber er war leider schon vergeben. Und wissen Sie was? Auch er ist auf der Suche nach einer besonderen Spezies von Dendrobium.«
»Was ...?«
Die Umsitzenden sahen sich gegenseitig an.
»Freunde!«
Kohnstamm hob die Hand.
»Glauben Sie mir, ich war genauso überrascht wie Sie. Aber ich denke, es reicht, wenn wir dies wissen. Wir sind Sportsmen, wie die Engländer zu sagen pflegen. Sehen wir das ganze als Rennen auf die andere Seite der Welt. Mal sehen, wer gewinnt.«
Die Männer nickten, lachten dann und applaudierten dazu. Kohnstamm lächelte und strich mit einer Hand über das Bild neben sich auf der Staffelei.
»Kohnstamm!«
Wehrnacker winkte mit seiner Pfeife so heftig, dass Aschereste auf seinen Anzug rieselten.
»Kohnstamm, wer hat den jungen van Mart losgeschickt?«
»Na, wer wohl?«, lächelte Julius und blickte triumphierend in die Runde.
»Pitcairn und seine amerikanischen Freunde natürlich.«
Der Rest ging unter in lautem und fröhlichem Gelächter.
Sie saßen zu Tisch. Hegenberg an der Stirnseite, Maria, die ältere seiner beiden Töchter zu seiner Linken, ihrer Schwester Katharina gegenüber. Sie, die jüngere der beiden, war gerade neunzehn Jahre alt und hatte so etwas wie die hausfraulichen Pflichten übernommen. Sie kochte für alle. Ob sie dies immer gerne tat, war nicht sicher, aber Maria wusste, dass ihre Schwester in der Küche Ruhe vor dem launischen und ungeduldigen Vater hatte. Als hervorragende Köchin besänftigte ihr oft raffiniertes Essen jeglichen Groll des Vaters immer so weit, dass die gemeinsamen Mahlzeiten in gewisser Harmonie verliefen. Sie hatte einen Quark aus Ziegenmilch und Kräutern gemacht, der mit frischem duftendem Brot gegessen wurde, danach eine Gemüseterrine und dann einen raffiniert gewürzten Steinbutt mit winzigen Kartoffeln in Butter.
Aber die Prozedur bei Tisch war immer die Gleiche. Es begann mit einem Tischgebet, das Gottfried Hegenberg immer selbst sprach. Aber in seinen Worten schien es keine Ehrerbietung an Gott zu geben, sondern wenn er betete, klang dies eher wie die Abrechnung aller Unzulänglichkeiten des täglichen Lebens. Immer dann, wenn er sich an seinen Herrn und Meister wandte, zeugten seine Worte davon, wie sehr er ihn als widerspruchslosen Zuhörer brauchte.
»Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, sieh nieder auf mich, deinen Knecht und deine Kinder. Wir danken dir für das, was du uns gebracht, Speis und Trank und Platz um zu ruhen, wenn wir müde sind. Aber allmächtiger Gott, verdamme all die Ketzer und Pharisäer, die falschen Freunde, all diese Speichellecker, nicht würdig deinen Worten und Botschaften zu lauschen, verdamme all die Feinde unseres Glaubens, ewige Finsternis sei ihnen sicher, und die Pforten des Heils und das Licht der Wahrheit sollen ihnen verschlossen bleiben auf alle Zeit. So sei es, Herr! Amen!«
Eines war auffallend bei all seinen Gebeten. Nie nannte er seinen Herrn Vater. Das erschien ihm wohl zu vertraut.
Jetzt aßen sie schweigend, und dass ihr Vater sich gleich zweimal nahm, war für Katharina ein Zeichen, dass ihr das Essen wieder einmal sehr gelungen war. Es schien ihr deshalb eine passende Gelegenheit zu sein, ihn über seine Reise nach England zu befragen.
»Sag Vater, das Wetter. War es in London schön?«
»Ja.«
»Und, und ... du warst in Kew Garden?«
»Ja.«
»Hast du die Orangensammlungen gesehen?«
»Ja.«
»Waren viele Menschen dort?«
»Ja.«
»Oh, hat es denn geregnet?«
»Nein.«
»Ich meine, weil es doch in England öfter regnet, so erzählt man es.«
Katharina schienen keine weiteren Fragen mehr einzufallen. Sie sah über ihren Teller hinweg zu ihrer Schwester, die den Kopf kaum merklich schüttelte. Er war spät in der Nacht zuvor zurückgekommen. Eine Droschke hatte ihn und sein bescheidenes Gepäck vom Hafen zurück in die Deichstraße gebracht. Haushälterin und Anstandsdame zugleich, die stille, immer traurige Frau Sterling hatte beide Mädchen mitten in der Nacht geweckt, damit sie ihren Vater kurz und steif begrüßen konnten.
»Warst du in Kew Garden auch einmal spazieren, Vater?«
»Nein!«
Die Antwort war grob gewesen, und er hob den Kopf, warf seiner jüngeren Tochter einen missbilligenden Blick zu. Katharina schluckte ihren Bissen schnell hinunter und spürte, wie sie rot im Gesicht wurde.
»Spazieren gehen! Wie um Gottes willen kommst du nur auf solch einen Unsinn?«
»Ich dachte nur ...«
»So, du hast gedacht?«
Sie bewegte die Lippen und wollte etwas sagen.
»Jetzt sollst du essen und nicht denken«, sagte er grob.
»Natürlich, Vater. Ich dachte ja nur ...«
»Du denkst ja schon wieder!«
»Nein, ich ..., verzeih. Verzeih mir meine dumme Frage, Vater.«
Er lehnte sich in seinem Stuhl ein wenig zurück und sah seine beiden Töchter an.
»Ihr denkt wohl, dies war eine Vergnügungsreise? Spazieren gehen ist reiner Müßiggang! Ich habe Protheroes Auktion abgewartet. Dort findet sich die Kundschaft, auf die ich hoffte, und Gott war in seiner Güte mit mir. Ich werde seinem Wunsch nachkommen.«
Die beiden jungen Frauen hatten mit dem Essen aufgehört und sahen ihn an. Aber Hegenberg strich mit einem Stück Brot einen Rest Butter auf seinem Teller zusammen und schob sich diesen letzten Bissen in den Mund und kaute lange. Mit einem Tuch fuhr er sich über den Mund, stopfte es zurück in seine Westentasche und lehnte sich dann erneut in seinem Stuhl zurück. Er betrachtete seine beiden Töchter, die langen Hände auf dem Tisch liegend.
»Ich werde reisen. Einen Auftrag erfüllen, den mir Herr Direktor Julius Aron Kohnstamm aus Berlin übertrug. Die Suche nach einer besonderen Orchidee aus der Gattung Dendrobium. Ihr wisst, es gibt Exemplare dieser Gattung in vielen Sammlungen bereits in Europa wie in Amerika. Aber Kohnstamm hat mir das Bild einer ganz neuen Art gezeigt. Doch da, wo sie vermutet wird, gibt es sie nicht. Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, sie zu finden. Mit dieser Reise werde ich genug verdienen, und dann werde ich nur noch nach Pflanzen suchen, die mich interessieren und nicht irgendeinen Dummkopf, der davon gar keine Ahnung hat.«
»Ein neuer Auftrag, Vater? Wie schön.«
»Ich werde eine Expedition ausrüsten und ...«
Er sah sie beide an, dann war auf seinen Lippen tatsächlich so etwas wie ein Lächeln zu erkennen.
»... und ihr werdet beide mitkommen.«
Beide Mädchen hielten die Luft unwillkürlich an. Eine Reise? Fort von Bremen? Sie sahen sich an. Maria hielt unwillkürlich die Hand vor ihren Mund, und sie spürte, wie ihr Herz vor Aufregung schneller schlug als gewöhnlich. Sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss, und sie wagte kaum zu atmen. Als sie zu ihrer Schwester sah und bemerkte, wie sehr diese strahlte, griff sie über den Tisch, nahm ihre Hand und drückte sie fest. Dann ließ sie los, denn jede weitere Begeisterung verbot sich in Gegenwart des Vaters. Er mochte es nicht, wenn man ihn berührte und fand dies nicht einmal bei seinen beiden eigenen Töchtern schicklich.
»Du nimmst uns mit, Vater?«
»Ja, da habe ich euch im Auge, und Frau Sterling kann in unserer Abwesenheit das Haus hüten. Ich wünsche, dass du, Maria, mir bei der Suche zur Hand gehst. Du wirst alle Aufzeichnungen dieser Reise machen, neue Arten zeichnen und zugleich katalogisieren. Was wir an neuen Spezies finden, nehmen wir mit, wann immer dies möglich ist. Dafür haben wir hier in Europa genug Kunden, das wisst ihr beide. Und du, Katharina, du wirst für uns kochen und hilfst beim Botanisieren und Ordnen der Pflanzen deiner Schwester, wann immer es nötig ist.«
Beide Frauen nickten gehorsam.
»Und merkt euch: Das ist keine Vergnügungsreise. Dafür haben wir weder Zeit noch Geld.«
»Natürlich, Vater«, beeilte sich Maria zu sagen.
»Wohin, Vater, wohin fahren wir?«, wollte Katharina wissen.
Er antwortete nicht auf die Frage. War das Essen fertig, betete Gottfried Wilhelm Hegenberg erneut, dann aber kürzer. Aber heute tat er das nicht, sondern schlug hastig ein Kreuz, stand auf und trat ans Fenster. Dort blieb er stehen und sah hinaus auf die Straße. Die beiden Schwestern strahlten sich noch immer an, und nun drückten sie sich beide Hände, darauf hoffend, dass er noch etwas sagen würde.
Endlich drehte er sich zu ihnen um. »Wir fahren auf die andere Seite der Welt. Nach Neuseeland.«
Zweiter Teil
Die Reise
Lieber Gott!
Wenn ich das traurige Schicksal so vieler Jünger der Botanik bedenke, fühle ich mich versucht, die Frage zu stellen, ob die Männer noch bei Verstand sind, die wegen ihrer Liebe zum Pflanzensammeln ihr Leben und alles andere aufs Spiel setzen.
Carl von Linné
Es regnete ohne Unterlass, als Hegenberg zwei Kabinen auf der Ystad buchte. Ein schwedisches Schiff, das einer kleinen Reederei in Hälsingborg gehörte und in Bremen Station machte, um seinen Bauch mit Fracht zu füllen. Es war ein gedrungen gebautes Segelschiff, nicht so lang und mächtig getakelt wie die Tee- und Opiumklipper, aber groß genug, um englischen Tweed, flämische Kohle und deutsches Bier in jeden Teil der Alten Welt zu bringen.
Die Ystad segelte in nur eineinhalb Tagen nach Portsmouth. Und dort im Hafen lagen sie, die Klipper, legendäre Segelschiffe, allesamt Viermaster mit den größten Segelflächen, die je an Masten geschlagen wurden. Sie wurden auch China- oder Teeklipper genannt, weil sie Tee aus Indien und China holten, um ihn in England zu verkaufen. Die Klipper waren auf Geschwindigkeit gebaut, mit Mannschaften, die wie ihre Kapitäne nur eines wollten: jeden Fetzen Tuch setzen, um das Schiff ständig in Fahrt zu halten. 16 bis 18 Knoten in der Stunde mussten zu schaffen sein, manchmal sogar zwanzig. Auf eine Passage mit einem dieser Schiffe hoffte Hegenberg, denn so ein Viermaster konnte die Strecke von Portsmouth im Südwesten Englands bis nach Melbourne in Australien in weniger als neunzig Tagen schaffen. Später, von Melbourne aus, gingen immer ein paar Kutter hinüber auf die Nordinsel Neuseelands. Wenn alles nach Wunsch verlief, würden sie Neuseeland Ende Oktober erreichen. Und es schien, als sei ihnen das Glück hold. Sie fanden nicht nur zwei freie Kabinen auf einem solchen Klipper, sondern auch eine ungewöhnliche Passage: Die Sea Bird steuerte direkt, ohne den üblichen Umweg über Singapur und Australien Wellington, die noch junge Hauptstadt Neuseelands, an.
Jetzt waren sie den vierten Tag auf See unterwegs und noch immer machte das Schiff prächtige Fahrt. Am ersten Tag hatte sich der stolze, schlanke Klipper seinen Weg durch die raue Nordsee gekämpft. Dem Kapitän, Tyler Ross, war daran gelegen, so rasch wie möglich in gemäßigtere Gefilde zu kommen. Jetzt fuhr der Klipper auf der Höhe von Gibraltar, die Sonne schien das erste Mal seit ihrer Abreise aus Bremen, und ein steter Wind blies und blähte die mächtigen Segel. Mit sanfter Schräglage pflügte das Schiff das tiefblaue Meer. Maria und ihre Schwester standen an der Steuerbordreling und genossen die Fahrt. Der Wind blies noch immer kühl, aber nicht so sehr, dass es unangenehm war. Dann und wann schob sich eine kräftige Dünung unter den schwarzgrauen Rumpf und hob das Schiff scheinbar spielerisch aus dem Wasser, um es nur einen Augenblick später wieder loszulassen. Dann tauchte der Bug zuerst und danach sogleich der Rest des Rumpfes sanft in die See und Gischt und feiner Wasserstaub bildeten eine Wolke aus unzähligen Salzwassertropfen. Die Luft war ständig erfüllt vom frischen Geruch nach See und Salz. Maria lachte und sog die Luft mit Nase und Mund zugleich ein. Die Sea Bird flog übers Wasser, und es war allen an Bord, als wären sie eins mit den Elementen.
Die Sea Bird lag gut im Wind, und es schien dem Kapitän, als ließen sich noch ein bis zwei Knoten mehr herausholen, aber nur wenn das Schiff noch mehr Segel trug. Beide Mädchen standen an die Reling gedrückt, die Köpfe im Nacken und sahen hinauf, wo die Männer, viele von ihnen barfuß des besseren Gefühls wegen, auf den Rahen herumturnten, flink mit jedem Handgriff das Schiff führten.
»Welchen hast du dir ausgeguckt?«, wollte Katharina auf einmal wissen und war nahe an ihre Schwester herangetreten.
Maria sagte nichts, sondern gab ihr einen verstohlenen Klaps. »Tu nicht so! Du hast dir einen ausgeguckt und hast mir versprochen, dass du mir's sagst, wer es ist«, sagte Katharina.
»Hab ich gar nicht.«
»Hast du.«
»Hab ich nicht.«
»Hast du doch.«
Maria legte den Kopf in den Nacken. Mit einem knatternden Geräusch entfaltete sich das große Segel über ihnen und warf einen Schatten über das darunter liegende Deck. Matrosen begannen mit lauten Anfeuerungsrufen, das Segel dicht zu holen. Der Klipper begann, sich noch um einige Grad nach Steuerbord zu neigen.
Beide Mädchen schrien erschrocken auf, aber eine Hand griff nach Maria, und als sie sich umwandte, stand ein Mann vor ihr. Es musste einer der Matrosen sein. Er war von kräftiger Gestalt, schlank, und seine gebräunte Hand hielt ihren Arm fest. Er lächelte, und Maria sah, dass er schneeweiße Zähne hatte. Mit einem sanften Ruck zog er sie von der Bordwand des Schiffes weg, bis sie einigermaßen sicher stehen konnte. Katharina hielt sich die ganze Zeit am Rock ihrer Schwester fest, und Maria griff mit ihrer freien Hand neben sich und zog die jüngere Schwester noch näher heran. Jetzt lag das Schiff sicher und nahm sogleich noch mehr Fahrt auf.
»Aufpassen, Ladies«, sagte er und lächelte erneut.
Maria nickte nur und sah auf ihren Arm. Der Mann hielt sie noch immer fest, und sie ließ es auch geschehen, dass er sie, zwei Schritte rückwärts gehend, bis an das Deckshaus zog. Das Deck des Schiffes lag nun so schräg, dass es alle Menschen auf dieser Seite zwang, weit vornüber gebeugt zu gehen, so als bestiegen sie einen Hügel.
»Das Schiff ...«, sagte er nur, »wir machen gute Fahrt, aber wenn jemand ins Wasser fällt, müssten wir wenden, und das wär schade.«
»Schade?«, fragte Maria und hielt sich an der Reling fest, die in Hüfthöhe um das dunkle Deckshaus führte. »Was wäre schade?«
Sie bemühte sich, mit einer Hand ein paar vorwitzige Haare unter ihre Haube zu schieben. Der Mann lächelte wieder, und sie fand ihn keinen Moment lang unangenehm. Noch immer hielt er sie am Arm fest, aber nicht mit Kraft, eher behutsam, sodass sie nicht ausrutschen oder gar fallen konnte, wenn das Schiff sich erneut dem Spiel der Wellen hingeben sollte.
»Was wäre schade?«, wiederholte Maria.
»Wenn Sie hineinfallen würden.«
»So?«, fragte sie keck, und zugleich errötete sie, nachdem sie diese Frage gestellt hatte.
»Ja, um Sie ... und Ihr schönes Kleid.«
Maria lachte, und Katharina strahlte. Der Mann bedachte auch sie mit einem freundlichen Blick.
»Man könnte glauben, das Schiff kippt ...«
»Was?«
»Es kippt, fällt um.«