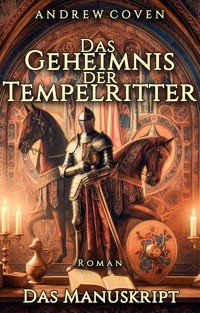
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Archäologe DeBleek erhält eine Nachricht von seinem ehemaligen Professor. Ein verschollenes Manuskript ist gefunden worden, das möglicherweise Hinweise gibt auf den legendären Schatz der Tempelritter. Zusammen mit einigen Freunden versucht er, die vorhandenen Fragmente zu entschlüsseln und das Puzzle zusammenzufügen. Doch schon bald muss er erkennen, dass sie nicht die einzigen sind, die sich auf der Suche nach dem Geheimnis befinden. Und die Gegenseite scheint vor nichts zurückzuschrecken, um diesen Wettlauf zu gewinnen. Aber erst als DeBleek und sein Team herausfinden, mit wem sie es wirklich zu tun haben, erkennen sie die wahre Größe der Gefahr, in der sie schweben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andrew Coven
Das Geheimnis der Tempelritter
Roman
Copyright © 2024 by Andrew Coven
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts, dieses Buch oder Teile davon in irgendeiner Form zu vervielfältigen.
Die Charaktere in diesem Roman sind fiktiv und jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig. Historische Charaktere und Orte sind so genau wie möglich dargestellt.
Vollständiges Impressum am Ende des Buches.
Inhalt
Das Geheimnis der Tempelritter
Copyright
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Impressum
Prolog
Mai 1308Die königlichen Verliese, Paris
Philippe schritt vorsichtig die Stufen hinunter in die feuchte, übelriechende Luft der Verliese, eine Reise, die er seit der Gefangennahme von Jaques De Molay jede Woche unternommen hatte. »So Gott will, wird der alte Narr dieses Mal reden«, dachte Philippe bei sich.Bisher hatte sich De Molay trotz schrecklicher Folterungen geweigert zu sprechen.
Philippe trat über das frisch gelegte Stroh und würgte beim Geruch, während er spürte, wie seine Schuhe in den Exkrementen und dem Urin unter ihm versanken.
Er blickte zu dem nackten De Molay hinüber, der in einer Ecke kauerte, an Ketten aufgehängt, die ihn in Position hielten, ihm nicht erlaubten, richtig zu sitzen, und ihm starke Schmerzen in seinen gebrochenen Beinen verursachten.Die Zeichen der Folter waren überall an seinem Körper zu sehen, Striemen von der Peitsche, Verbrennungen von den Eisen. Sein Körper war mit Blutergüssen und Blasen übersät, aber es war das Gesicht, das Philippe am meisten schockierte; seine Augen waren blutunterlaufen und die Haut um sie herum war violett. Sein Mund stand offen und zeigte leere Zahnfächer, wo die Folterknechte bei früheren Versuchen, De Molay zum Geständnis zu zwingen, Zähne herausgerissen hatten.
»Nun, alter Mann. Bist du diesmal bereit zu reden?« knurrte Philippe De Molay an.
»Ich werde mit dir reden, aber nur allein. Wenn Ihr wollt, dass ich spreche, dann schafft mir diese Trottel aus den Augen.« antwortete De Molay.
»Geht alle. Ich will mit diesem Gotteslästerer allein sein.«
Als alle gegangen waren, winkte De Molay Philippe zu sich.
»Mein Herr König, Ihr könnt mich alles fragen.«
»Alter Mann, Ihr wisst, warum ich immer wiederkomme. Ich will wissen, wo Eure Tempelritter und der Schatz sind.«
»Sire, Ihr habt unseren Schatz, es sei denn, Eure Männer haben unser Gold für sich selbst gestohlen.«
»Belügt mich nicht, De Molay. Ihr wisst von dem Schatz, den ich suche. Ich will den blasphemischen Kopf, zu dem Eure Schergen beten.«
De Molay schüttelte den Kopf und lächelte, bevor er antwortete. »Ihr könnt niemals einer sein, der auf den Kopf schaut; Ihr seid ein Heide und Gotteslästerer.«
Philippe stürmte auf De Molay zu und trat ihn mit den Füßen. Alles, was De Molay tun konnte, war ein leises Wimmern.
»Philippe, du und dein Marionettenpapst seid nichts. Ich bin nichts. Das Wort wird weiterleben. Für jeden gefangenen Tempelritter haben sich jetzt hundert und mehr versteckt und werden auf ihre Zeit warten, denn sie wird kommen, und du und deinesgleichen werden vor den Rittern von Salomon knien und um Gnade flehen.«
»Alter Mann, ich verspreche dir, du wirst um Gnade flehen, bevor meine Inquisitoren mit deinem Körper fertig sind!«
»Ich mag ein alter Mann sein, aber ich habe mir dieses Ende selbst ausgesucht. Ich werde dir auch ein Versprechen geben. Du solltest dies als letzte Warnung beherzigen. Merke dir das Datum, an dem ich sterbe, denn innerhalb der folgenden zwölf Monate wirst du und dein Papst ebenfalls sterben, und zwar in meinem Namen. Wenn ich in deiner Haut stecken würde, in meiner eigenen Scheiße, würde ich dafür sorgen, dass mir kein weiterer Schaden zugefügt wird und ich ein langes Leben führe. Denn wenn ich zu meinem Herrn gehe, läuft die Sanduhr für dich langsam ab, und mein Wille wird geschehen, beherzige das, du Bastard und Trottel.
Philippe stotterte, er wusste um die Macht der Templer und dass neunzig Prozent der Ritter zusammen mit ihren wertvollen Schätzen seinen Klauen entkommen waren. Er wusste, dass es so kommen würde, wenn De Molay dies sagte.
»Alter Mann, ich werde dich am Leben lassen, nicht aus Angst, sondern weil es dein Leiden verlängern wird, und ich möchte sehen, wie du um den Tod bettelst.«
»Ich bin für diese Welt bereits tot; du kannst diese Hülle nur als Erinnerung an deine begrenzte Zeit behalten. Ich bin an einem anderen Ort, der großartig und gut ist. Nun geh, du fauliger Schwachkopf, oder ich könnte einfach aufhören zu atmen und deinen Todeskampf einleiten.« De Molay blickte Philippe in die Augen und stieß ein Gekicher aus, das seinen gequälten Mund zeigte.
Philippe musste sich fast übergeben und wandte sich ab. Dann verließ er den Kerker und ging an den Wachen und Inquisitoren vorbei.
»Sorgt dafür, dass De Molay weiterhin leidet, aber wenn er stirbt, werdet ihr alle einen Vorgeschmack auf sein Leiden bekommen, bevor ihr sterbt. Habe ich mich klar ausgedrückt? De Molay soll am Leben bleiben!«
König Philippe kehrte zitternd vor Wut, aber auch vor Angst in seine Gemächer zurück. Er rief seine Diener, um Wein zu holen, und sobald dieser eintraf, trank er genug, um in einen Rausch zu verfallen, nur damit ihn De Molays zahnloses Grinsen in seinen Albträumen quälte.
Zurück im Kerker legten die Inquisitoren De Molay vorsichtig auf den Boden, nachdem sie ihm die Ketten abgenommen hatten. Einer wusch den Körper des alten Mannes, während ein anderer ihm Brot und eine schwache Suppe reichte.
»Das müsst Ihr nicht tun«, sagte De Molay zwischen zwei Bissen Suppe.
»Mein Herr, der König, befiehlt uns, Euch am Leben zu erhalten und Euer Leiden fortzusetzen, unter Androhung unseres eigenen Todes«, antwortete ein junger Inquisitor.
»Euer Leiden tut mir leid, mein Herr; Eure Ritter waren gut zu unserem Dorf.«»Junger Mann, macht Euch keine Sorgen, ich bin nicht mehr an diesem Ort. Ich bin glücklich, dieser Körper kann nur noch eine Hülle sein und ich werde nicht länger leiden. Aber um Eurer selbst willen solltet Ihr Euch eine andere Arbeit suchen; denn Philippe wird Euch alle töten, nachdem dieser Körper aufgegeben hat. Hört auf meine Worte, der König wird diesen Körper zerstören und dann Euch alle töten.«
Zurück in ihren Quartieren besprachen die Inquisitoren und Wachen, was De Molay gesagt hatte.
Innerhalb eines Monats war die Hälfte von ihnen ersetzt worden, aber drei von ihnen, darunter der junge Inquisitor, blieben, um De Molays Leben zu schützen.
Juli 1311
»Albert«, flüsterte De Molay, »warum bleibst du immer noch hier? Ich werde schwächer und der König wird immer wütender, weil es ihm nicht gelungen ist, mich über unseren großen »Schatz« sprechen zu lassen. Ich habe dir gesagt, dass du gehen sollst, um deinetwillen.«
»Mein Herr De Molay, ich habe mit meinen Freunden, die ebenfalls geblieben sind, um dich zu beschützen, ein Gelübde abgelegt, aber auch, um dem König vorzugaukeln, dass du immer noch gefoltert wirst. Ich bin es dir und deinen Rittern schuldig, meine Familie weiß davon und ist bereit, meinen Tod als Sühne für meine Foltersünden zu betrachten, in der Hoffnung, dass ich Gott und den Himmel sehen kann, bevor ich in die Hölle geschickt werde.«
»Albert, du wirst die Engel im Himmel sehen, denn du hast sowohl meine Vergebung als auch meinen Segen, aber du musst bald von hier verschwinden. Ich warne dich noch einmal, der König wird mich in Kürze auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. Ich möchte, dass du und deine beiden Freunde bis dahin so weit wie möglich von diesem Ort entfernt seid. Wirst du das für mich tun?«
»Wie können Sie sich da sicher sein, mein Herr?«
»Ich bin mir meines Todes sicher, aber über den Zeitpunkt und den Ort bin ich mir noch unsicher, aber wenn ich es weiß, müsst ihr gehen.«
Februar 1314
»Albert, komm näher, ich möchte, dass du das verstehst«, hörte man die schwache Stimme von De Molay.
Albert beugte sich näher an den Mund des alten Mannes. Er schämte sich für den Zustand von De Molay. Der einst große Anführer der Tempelritter war tatsächlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Er hatte sogar darauf bestanden, dass man ihn folterte, und die Grausamkeit der letzten drei Jahre war nun an seinem verwüsteten Körper zu erkennen.
»Albert, höre auf meine letzten Worte an dich und deine Freunde: Ich werde bald sterben, durch das Feuer, und wenn ich tot bin, wird Philippe versuchen, euch alle zu beseitigen. Ich habe es dir schon einmal gesagt, aber du hast dich geweigert zu gehen. Jetzt bitte ich euch nicht, sondern befehle euch, heute Nacht zu gehen.«
»Aber mein Herr, wer wird sich um eure Bedürfnisse kümmern?«
»Ich werde eure Freundlichkeit kaum benötigen. Ich möchte, dass ihr eine Nachricht von hier zu den Tempelrittern Tueton im Osten bringt. Ihr müsst sie dem Großgebietiger Ludolf von Plauen überbringen. Denkt an diesen Satz, um Einlass zu erhalten: ´Mein Meister ist eins mit eurem Meister.´ Wiederholt ihn.«
Albert tat dies.
»Sag dem Großgebietiger, dass De Molay noch in diesem Jahr Gerechtigkeit für seine Entführer einfordern möchte. Wiederhole es, mein Junge.«
Wieder wiederholte Albert die Worte.
»Nun, du und deine Freunde, die ihr freundlich zu diesem alten Wrack wart; verlasst heute Nacht diesen Ort des Todes und haltet nicht an, bis ihr die Ritter gefunden habt, um die ich euch bitte.«
»Was werdet Ihr tun?«
»Warum Albert, ich werde sterben. Das wusste ich schon die ganze Zeit und Philippe, dieser Bastard, denkt jetzt, dass er sicherer ist, wenn ich tot und weg bin.«
Albert kniete sich neben ihn und Tränen liefen ihm über das Gesicht. »Auf Wiedersehen, mein Herr. Möge Euer Weg friedlich sein.«
»Das wird er sein«, log De Molay. »Ich spüre keinen Schmerz mehr.«
In dieser Nacht verließen drei zerlumpte Männer die Kerker und machten sich auf den Weg aus der Stadt. Es dauerte drei Wochen, bis sie das Gebiet der Tütonen erreichten, und weitere zwei, bis sie mit dem Großgebietiger in Kontakt traten.
Er hörte den Worten Alberts zu und senkte dann den Kopf zum Gebet. »Ich muss Euch mitteilen, dass Lord De Molay vor mehr als einer Woche von dem fränkischen Bastard dem Feuer übergeben wurde.«
Albert und seine beiden Freunde hatten Tränen in den Augen, als sie diese Nachricht hörten, und beschlossen, ihre Beteiligung an der Folter zu gestehen.
Von Plauen hörte zu und sprach dann: »Ich weiß von all euren Taten und dass De Molay euch befohlen hat, seine Folterungen fortzusetzen. Er tat dies zu eurer Sicherheit. Hat er euch die Absolution erteilt?«
»Das hat er, Sire.«
Dann ist euer Anteil daran vorbei. Ihr könnt alle innerhalb dieser Grenzen bleiben oder ihr seid frei zu gehen, und wenn das eure Wahl ist, werdet ihr eine angemessene Entschädigung erhalten.«
Albert entschied sich weiterzumachen, aber seine Freunde beschlossen zu bleiben.
»Das ist eure Entscheidung, aber ihr seid hier jederzeit willkommen, und ich kann euch versichern, dass die Gerechtigkeit, die De Molay anstrebt, ausgeübt werden wird, und zwar innerhalb des von ihm festgelegten Zeitrahmens.«
Innerhalb eines Monats starb der Papst eines natürlichen Todes. Der König erwies sich als schwieriger, aber noch innerhalb des Jahres starb er bei einem Jagdunfall. Beide erfuhren von ihrem Schicksal kurz bevor sie ermordet wurden.
Kapitel 1
12. Juni 1306Trani, Königreich Sizilien
Jaques de Molay ging mit Roger De Courcy durch die dunklen Gänge des Ordenshauses. Er blickte in Richtung der untergehenden Sonne, die er durch die Bögen erblickte, während sie weitergingen.
»De Courcy«, begann er, »ich werde dir die schwierigste Aufgabe anvertrauen. Ich wünschte, diese Zeit wäre nie gekommen, aber es scheint, dass unser Orden in Gefahr ist, und ich bin sicher, dass du alles ertragen kannst, was vor dir liegt. Du wirst die Verantwortung für alle Tempelaufzeichnungen und unsere sogenannten Schätze übernehmen, sowohl für die, die wir hierher gebracht haben, als auch für die, die gerade in Häfen in Aragon und La Rochelle gebracht werden. Wir haben über fünfzehn Schiffe angehäuft, einige davon sind die neuen portugiesischen Cougas, die für längere Seereisen ausgelegt sind, und du musst über ihre zukünftigen Reisen entscheiden. Was wir haben, darf niemals in die Hände des Papstes oder Philipps von Frankreich fallen. Dein Leben besteht nun darin, so viele dieser Güter wie möglich zu bewachen und zu verstecken, wie es ein Mensch kann. Möge Gott dich beschützen.«
Alles, was De Courcy sagen konnte, war: »Es wird meine Pflicht und Ehre sein, dies zu tun, mein Herr. Mit der Gnade unseres Herrn werde ich mich bemühen, erfolgreich zu sein.«
»De Courcy, dies ist streng geheim. Derzeit haben nur eine Handvoll meiner vertrauenswürdigsten Kommandanten dieses Wissen geteilt und sie wissen, dass du meine Wahl als Kommandant bist. Nach dem heutigen Tag werden wir uns vielleicht nie wieder sehen, also sei mutig und glücklich bei all deinen Handlungen.«
In der darauffolgenden Nacht traf sich der Großmeister mit den übrigen Komturen der Tempelritter. Er hatte persönlich um dieses Treffen mit seinen Ordensbrüdern gebeten, nachdem er und Fulques de Villaret Anfang des Jahres eine Einladung zu einem Treffen mit Papst Clemens V. erhalten hatten.
Dies war von seinen Spionen vorhergesagt worden, und was nun geschah und beschlossen wurde, sollte die katholische und menschliche Geschichte für die kommenden Jahre prägen.
Mit ihm am Tisch saßen Fulques De Villaret, der Meister der Hospitaliter, Albert de Cluny, Großkomtur, und Marschall Luc Du Bleque. Außerdem Geurian Larouche, Komtur der neu eingeweihten Malteserritter. Von den Deutschen Rittern: Verner von Orseln, Hochmeister, Ludolf von Plauen, der Großgebietiger, der Großkomtur und der Marschall der Deutschen Ritter.
Neben de Molay saßen Geoffroi de Charney, Roger de Courcy, Bérenger de Cardona, Vasco Fernandes, Meister, und Bertrand de Silva de la Selve, Präzeptor.
»Meine Herren Brüder«, begann Molay, »wir stehen kurz davor, in unserem Leben in eine dunkle, hysterische, gottlose Zeit einzutreten. Ich habe von unseren Quellen in Frankreich und im Kirchenstaat erfahren, dass diese Einladung hauptsächlich dazu dient, die Auflösung und Zerstörung einiger oder aller unserer Orden sicherzustellen. Einige von uns hier werden von ihren bevorstehenden Reisen nicht zurückkehren. Wir haben Berichte gehört, dass Philipp von Frankreich erwägt, unsere Präzeptoreien wegen der darin enthaltenen Gelder zu überfallen. Philippe steht bei uns mit einem riesigen Betrag in der Kreide und wegen seiner Kriege mit England geht ihm das Geld aus, um seine Armeen zu bezahlen. Er muss Clemens noch davon überzeugen, einen Grund für einen Angriff zu finden. Dies könnte jedoch durch den Verrat des Narren Heralic einfacher geworden sein.«
De Molay fuhr fort: »Heralic hat einige unserer Initiationszeremonien an Philippe weitergegeben, im Gegenzug für Gold. Er wird dies nutzen, um einen päpstlichen Segen für seinen Angriff auf Paris zu erhalten. Bisher hält Clemens noch durch, aber unseren Quellen zufolge ist es nur eine Frage der Zeit, bis Clemens seinem Druck nachgibt. Bedenkt, dass er bestenfalls eine Geisel des Königs ist.«
»Ich muss sagen, dass wir bereits damit begonnen haben, unsere Aufzeichnungen und andere Artefakte aus allen Gebieten zu entfernen, die unter Philippes Gerichtsbarkeit stehen. De Villaret hat den Rest unserer Artikel bereits aus Zypern hergebracht und während wir uns treffen, werden sie für den Transfer auf die besten Schiffe unserer Flotte vorbereitet. Alle Aufzeichnungen eurer eigenen Orden, die ihr uns mitschicken möchtet, werden mit Respekt behandelt, als wären es unsere eigenen. Ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass De Charney und ich höchstwahrscheinlich verhaftet werden, ebenso wie De Villaret.«
«Dieses Treffen soll sicherstellen, dass unsere Bruderschaften auch in Zukunft bestehen bleiben, da meine Templerbrüder in Frankreich mit ziemlicher Sicherheit Gefahr laufen, verhaftet und gefoltert zu werden.«
Fernandez antwortete, dass König Denis bereit sei, jede Bedrohung aus Frankreich zu ignorieren, ebenso wie König Jakob II. der Gerechte von Aragon. Da sie beide noch immer gegen die Mauren kämpften, sahen sie die Notwendigkeit von Ritterkriegern.
»Unsere Aufgabe hier ist es, dafür zu sorgen, dass Philippe glaubt, er habe seinen Schatz wiedererlangt und die Tempelritter vernichtet«, begann de Molay. »Wir werden uns jedoch bemühen, einen sicheren Aufbewahrungsort für die Artefakte zu finden. Unsere Brüder setzen sich mit den St. Claires in Schottland in Verbindung, sie kennen vielleicht Länder, die außerhalb des Einflussbereichs der sich bekriegenden Könige Europas liegen.«
Am nächsten Tag durchsuchten De Courcy und Vasco Fernandez die Gebäude des Ordenshauses und beobachteten die Handwerker, wie sie Papiere, Pergamentbücher, historische Dokumente der Templer und einiger anderer Orden in wetterfeste Truhen luden. Sie gingen weiter in die Innenräume, wo die Templer für das sorgfältige Verpacken und Verstauen islamischer Aufzeichnungen und einer Reihe von, in De Courcys Augen, magischen Instrumenten und Plänen für großartige Bautechniken verantwortlich waren. Diese Dinge wären in seiner Heimat unbekannt und unerhört gewesen.Diese außergewöhnlichen Stücke wurden von den vertrauenswürdigen Verladern in ähnliche Truhen und Kisten gelegt, die dann für die Verladung auf die Schiffe der inzwischen versammelten Templerflotte vorbereitet wurden.
Fernandez führte De Courcy dann zum Hafenbereich und zeigte ihm die neuesten Ergänzungen der Flotte. Im Hafen stachen Schiffe hervor, die fast so groß waren wie die Koggen, aber etwas kleiner als die Holks, die normalerweise für Transport und Kampf eingesetzt wurden. Der Unterschied zwischen diesen Schiffen, die Cougas genannt wurden, war ein drittes Segel mit dreieckigem Schnitt über dem Heckkastell, das De Courcy erkennen konnte. »Die Bauart dieses Schiffes ermöglicht eine schnellere Fahrt, wenn der Wind nicht mitspielt«, erklärte Fernandez.
Es dauerte fünf lange Tage, bis über hundert Truhen und Kisten im Laderaum von vier der Holks verstaut waren. Dann mussten die Ritter, ihre Sergeants, Knappen und Seeleute zu einem bewaffneten Konvoi aus zehn Schiffen formiert werden. Dieser sollte aus den Holks, Cougas und Carracks bestehen. Auf diesen befanden sich zwischen Rittern, Sergeants, Knappen, Schreiberpriestern und Seeleuten fast fünfhundert Männer, alle hochqualifiziert und äußerst loyal.
Am 29. Juni 1306 stach eine wahre Armada in Richtung Peniscola in Aragonien in See. Bei gutem Wind und unter Verwendung der geheimen Karten des Flottenführers Jacobus über das Mittelmeer sollte die Reise mindestens siebzehn Tage dauern. Diese Karten sollen sehr alt und aus dem Osten gewesen sein, aber sie verkürzten die Segelstrecke, da der Flottenführer eine direktere Route wählen konnte und nicht in Sichtweite des Landes bleiben musste.
4. Juli 1306Peniscola, Königreich Aragon
Die Vorbereitungen für die Ankunft der Flotte von De Courcy waren im Gange. Aus Paris und anderen Präzeptoreien in Frankreich trafen Aufzeichnungen und Pergamente ein. De Molay hatte diese Entscheidungen sicherlich schon lange vor seinem in Trani vereinbarten Treffen getroffen.
Im Hafenbereich wurden mehrere Schiffe zum Beladen vorbereitet, drei weitere Holks und vier Karacken wurden für eine sicherlich beschwerliche Reise vorbereitet. Meister Gallatias sorgte dafür, dass seine Besatzungen mit ihren neuen Schiffen vertraut waren, und seine handverlesenen Besatzungen und Kapitäne gehörten zu den vertrauenswürdigsten und loyalsten gegenüber ihren Templer-Prinzipalen.
Wieder an Land herrschte innerhalb der Mauern reges Treiben, als Handwerker Truhen und Kisten herstellten, die dann gefüllt und katalogisiert wurden, um für den Transport zu den Holks bereit zu sein. Dies sollte nach der Ankunft von De Courcy geschehen. Eine Garnison von etwa vierhundert Rittern aller Orden sorgte zusammen mit ihren Begleitern für die Sicherheit und den Schutz des Gebiets.
Es dauerte länger als Jacobus angedeutet hatte, aber die Templerflotte aus Trani erreichte Peniscola am 21. August. Dort wartete eine Nachricht von De Molay auf sie. »Meine Kollegen und Brüder, ich werde mich am 12. September heimlich mit dem Papst treffen. In der Hoffnung, dass wir die Lage noch retten können, flehe ich euch an, dort zu bleiben, wo ihr seid, bis ich oder mein Bruder Allain Crantus euch seine Entscheidung mitteilen. Dies sollte euch spätestens Anfang Oktober vorliegen. Wenn ihr bis November nichts Neues gehört habt oder wenn irgendwelche Truppen in der Nähe auftauchen, dann führt meine Anweisungen aus, wie sie in Trani gegeben wurden.«
Diese Notiz trug das Siegel und wie De Courcy bestätigte, die Unterschrift von De Molay.
Jacobus und Gallitas sagten beide, dass es unmöglich sei, die in Trani gegebenen Anweisungen zu erfüllen, wenn man bis November warten würde.
»Wir müssen entweder Mitte September in See stechen oder bis März warten, um günstigen Wind und Wetter zu haben«, beharrte Jacobus und Gallitas stimmte ihm zu. Es wurde eine Versammlung der hochrangigen Ritter, Meister und Hauptleute einberufen, die am 24. August in der Burg stattfand. Die Diskussionen dauerten über drei Tage und es wurde beschlossen, bis März zu bleiben, es sei denn, es kämen bald Nachrichten von De Molay.
Die Schiffe wurden entladen und die Truhen und Kisten wurden sicher im Schloss untergebracht. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Garnison in Peniscola über siebenhundert Ritter und ihr Gefolge, was zusammen mit über dreihundert ausgebildeten und loyalen Seeleuten eine beträchtliche Streitmacht an Land darstellte. Dies war größer als jede Streitmacht in der Region, sowohl an Land als auch auf See.
Die Fracht konnte innerhalb von zehn Stunden an Bord verladen werden, sodass die Segel dreißig Stunden später gesetzt werden konnten, um die Gezeiten zu berücksichtigen. In der Zwischenzeit standen für alle Trainingseinheiten auf dem Tagesplan, ebenso wie Gebete und die Durchsicht einiger Archive, die zum Kopieren ausgepackt worden waren.
De Courcy beobachtete in einem Skriptorium, wie Schreibmönche seltsame Holzstifte verwendeten, um Dokumente schneller kopieren zu können. Als er sich einem näherte, erkundigte er sich, was dort getan wurde.
Bruder Aloysius erklärte: »Sire, diese Stifte sind mit den Buchstaben des Alphabets in umgekehrter Reihenfolge geschnitzt. Schaut«, sagte er und reichte De Courcy einen, »ihr seht den Spiegel eines Buchstabens B. Wir erstellen mit diesen eine Textzeile und legen sie dann auf einen eingefärbten Block wie diesen. Wenn sie dann auf das linierte Pergament gelegt werden, hinterlässt dies einen Text auf der Seite.«
»Woher kommt das?«
»Majestät, wir haben sie von den Muslimen, die das Wissen aus den östlichen Ländern erlangt haben. So kann man schneller Text auf einem Dokument platzieren, aber es erlaubt keine Verzierung des Manuskripts.«
De Courcy war von dieser Technik sehr beeindruckt. Er war einer der wenigen Ritter, die die Kunst des Lesens und Schreibens beherrschten. Er fragte sich, ob in seiner riesigen Fracht noch andere geheimnisvolle Gegenstände oder Ideen enthalten waren.
18. November 1306
Am späten Abend erreichte eine kleine Kogge mit einem Boten an Bord, der eine Nachricht von De Molay überbrachte, den Hafen von Peniscola. Die Nachricht war kurz und bündig.
»Brüder, ich habe euch alle enttäuscht. Es konnte keine Einigung erzielt werden. Philippes Hand war in allen Diskussionen zu spüren. Macht eure Pläne und entfernt euch bei nächster Gelegenheit. Folgt den ursprünglichen Plänen, auf die wir uns geeinigt haben. Gott sei mit euch allen und möge Gott eure Reise beschleunigen.«
Die Nachricht war von De Molay versiegelt und unterschrieben.
Jacobus und Gallitas waren beide der Meinung, dass es unmöglich sei, die in Trani gegebenen Anweisungen zu erfüllen, wenn man bis November warten würde. »Wie wir bereits sagten, musste unsere Flotte spätestens in der zweiten Septemberhälfte auslaufen. Jetzt müssen wir bis März warten, um günstigere Wind- und Wetterbedingungen zu erhalten«, beharrte Jacobus und Gallitas stimmte erneut zu.
Es folgte eine lange Diskussion darüber, wann die Flotte auslaufen könnte, die in einer kurzen Erklärung an die Versammelten gipfelte.
»Nun«, sagte Jacobus, »frühestens Anfang März können wir auslaufen. Das gibt uns über drei Monate Zeit, um unsere Schiffe auf das raue Wetter vorzubereiten, das wir dann haben werden. Denkt daran, hier sind wir geschützt, aber wir können mit starken Winden und mächtigen Meeren rechnen, wenn wir Gibraltar umrunden und durch die Meerengen fahren.«
11. März 1307
Als der große Tag anbrach, bereitete sich die Flotte, die nun vierzehn Schiffe zählte, auf die Abfahrt vor. Wie die Schiffe einer Invasionsarmee, mit insgesamt fast 1200 Mann, entfernten sich die Schiffe in drei Reihen, bestehend aus Karacken, Cougas und mit den Holks in der Mitte, von der Küste.
De Courcy blickte zurück und wusste, dass jeder Anblick von nun an neu für ihn sein würde und er nicht in einen Hafen zurückkehren konnte, von dem aus sie aufgebrochen waren.
»Sire«, die Stimme von Jacobus riss ihn aus seinen Gedanken, »ich werde Euch unsere Karten zeigen, da ich mindestens drei Personen an Bord jedes Schiffes brauche, die in der Lage sind, sie zu lesen.«
In der Kabine entrollte Jacobus eine Reihe von Karten. Er fuhr fort, die Methoden des Segelns der Schiffe mithilfe eines Astrolabiums zu erklären, das nachts den Mond und die Sterne nutzt und tagsüber den Sonnenwinkel misst. Er zeigte De Courcy auch einen Kompass in einer Art Messinggehäuse, das die Nadel und die Box unabhängig vom Winkel des Außengehäuses sicher hielt.Jacobus sagte, er glaube, dass der Kompass, das Astrolabium und die hervorragenden Karten mit den frühen Tempelrittern zurückgekommen seien und ihnen einen Vorteil beim Handel und beim Transport von Truppen verschafft hätten. Sie ermöglichten es den Tempelritterflotten, auf direkteren Routen zu segeln, ohne dass sie Land sehen konnten.
Dies war von entscheidender Bedeutung, da es den Anschein hatte, dass Philipp über jede Sichtung von Tempelrittern informiert werden wollte. Mit diesen Geräten konnte die Flotte den ersten Abschnitt ihrer Reise außer Sichtweite segeln und erst an Land gehen, wenn der sichere Hafen von Portugal erreicht war.
Kapitel 2
Schottland 1307
Die Flotte legte in Portugal an, um Vorräte aufzunehmen. Etwa zwanzig Ritter und ihr Gefolge durften von Bord gehen, da sie aus der Bevölkerung und dem Adel dieser Gegend stammten.
Unsere Flotte suchte in und um Temar Schutz, während wir auf die Ankunft von vier weiteren Schiffen warteten. Unsere Ordensbrüder führten Verhandlungen mit Clemens. Dies war jedoch erfolglos und die Flotte, die nun aus achtzehn Schiffen bestand, begann eine gefährliche Reise über die stürmischen Gewässer zwischen Temar und dem Südwesten Englands, wo wir uns vornahmen, die Flotte zu teilen.
Dies musste geschehen und aufgrund der Gefahr durch englische und französische Schiffe mussten wir das Risiko eingehen, Schiffe an den möglicherweise gefährlichen Ozean westlich von Irland zu verlieren.
Zumindest konnte die Flotte dort in den Häfen im Südwesten Zuflucht suchen, wo unsere Brüder noch immer das Sagen hatten.
Der kleinere Teil der Flotte, insgesamt sieben Schiffe, und der am schwersten bewaffnete Teil, nahm die Route nach Osten und näherte sich der Gefahr durch die Engländer, Holländer und Franzosen. Hoffentlich würden sie sich mit keinem von ihnen auseinandersetzen müssen, wenn die Schiffe der Templer den Engpass kurz vor den Niederlanden erreichten. Leider musste diese gefährliche Reise unternommen werden, um die Insel Bornholm in der Ostsee zu erreichen, wo weitere Brüder Aufzeichnungen und Artefakte gesammelt hatten, die in Sicherheit gebracht werden sollten.
Die größere Gruppe, die nun elf Schiffe umfasste, segelte nach Westen, dann nach Norden, über das Land Englands hinaus, und weiter in die irischen Länder, wo wir mit unseren Brüdern dort einen sicheren Hafen anlaufen können. Von diesen Ländern aus werden wir dann, so Gott will, auf den Inseln an der Westseite Schottlands an Land gehen.
Die kleinere Flotte segelte, sobald sie den schmalen Kanal durchquert hatte, weiter nach Osten in die Ostsee, legte eine gute Reise zurück und fuhr dann zurück in die Ostsee, wo sie nach Norden fuhr und in den östlichen Häfen in der Nähe der Ländereien von St. Claires an Land ging.
Die Templer wurden von den St Claires im Osten Schottlands und von den Häuptlingen der Macdonald, Macleod und Macrae auf den westlichen Inseln um die Meeresarme Fyne, Long und Goil herum willkommen geheißen. Sie luden ihre jeweilige Fracht ab und ließen sich in den versteckten Tälern in der Nähe der Inseln und vor neugierigen Blicken geschützt nieder. Die Schiffe im Westen konnten leicht in zwei der Meeresarme in der Nähe der Festungen der Macrae, Macleod und Macdonald versteckt werden. Im Osten wurden die Schiffe, sobald sie geleert waren, im Norden der Ländereien der St. Claire platziert und in den Flussmündungen und Buchten versteckt.
Die Templer schätzten zwar die schottische Gastfreundschaft, hatten aber dennoch Angst vor den ständigen Konflikten zwischen ihren Gastgebern und den Engländern unter Edward II. 1311 befanden sich der größte Teil Westschottlands und Teile Ostschottlands unter der Kontrolle von De Bruce, sodass die Templer sich ohne Angst verstecken konnten.
De Courcy teilte St. Claire offen mit, dass seine Männer die Schiffe seetüchtig halten müssten, falls eine schnelle Flucht nötig sei.
Obwohl die Engländer nicht mit Eifer gefolgt waren, könnte sich die Nicht-Gefangennahme eines Tempelritters ändern, wenn Edward Wind von dem großen Schatz bekäme, der sich nun in der Nähe beider Küsten Schottlands versteckte.
Dieses unruhige Leben dauerte über drei Jahre an, Grenzübergriffe, versuchte Invasionen, politische Intrigen und offene Kämpfe waren hier ein normaler Bestandteil des Lebens.
Anfang 1314 hatten die Anführer der Ritter jedoch herausgefunden, dass der junge Edward die Absicht hatte, die schottische Krone zu übernehmen. Sie mussten nun entscheiden, ob sie gehen oder bleiben sollten, um ihren Gastgebern zu helfen, falls diese Hilfe erwünscht war.
Dies, zusammen mit den schrecklichen Nachrichten aus Paris, änderte die Ansichten der Ritter und ihres Gefolges.
Kapitel 3
Mai 1314Bruce' Quartier, westlich von Stirling
Bruce und sein Gefolge warteten im Herrenhaus. Dies war ein wichtiges Treffen und De Courcy verspätete sich. Ein Reiter näherte sich mit hoher Geschwindigkeit, stieg ab und rannte zur Tür des Herrenhauses.
»Mein Herr De Courcy bittet demütigst um Entschuldigung; wir haben die schrecklichsten Nachrichten aus Paris erhalten.« Der Bote fuhr fort: »Er ist auf dem Weg und wird im Laufe des Tages eintreffen. Mein Herr wird alles erklären, wenn er mit Euch eintrifft.«
Fast vier Stunden später kam eine kleine Gruppe von Rittern in Sicht. Die Männer von Bruce machten sich sofort kampfbereit. Einer zog den Botenritter zum Fenster. »Was ist das für ein Verrat? Das sind keine Tempelritter, und wie ihr seht, trägt keiner von ihnen den weißen Mantel.«
Bruce selbst hielt seinen eigenen Ritter zurück. »Montgomerie, sieh, dort vorne ist De Courcy selbst.«
»Aber Sire, warum sind sie so gekleidet?« Montgomerie sah immer noch nervös aus.
»Ich bin sicher, dass wir bald aufgeklärt werden. Die Knappen sollen sich um ihre Pferde kümmern und sie in den Saal begleiten.« Bruce wandte sich vom Fenster ab. Auch er war ratlos und dachte, dass es vielleicht mit den Nachrichten zu tun hatte, die De Courcy erhalten hatte.
Zehn Minuten später betrat De Courcy die Halle und führte eine Gruppe von vier weiteren Rittern an. »Mein Lord De Bruce, ich bin gekommen, um Euch über das schreckliche Schicksal zu informieren, das der Bastard von Frankreich meinem Lord De Molay bereitet hat, und für das er bezahlen wird.«
Bruce konnte nicht länger warten. »De Courcy, meine Männer wären fast mit Euch in die Schlacht gezogen. Warum tragt Ihr eine solche Kleidung?«
»Sire, wir haben wegen des Verlusts unserer Anführer und wegen des Massakers an etwa siebzig unserer Brüder durch den Bastard Trauer getragen. Wir haben alle ein Gelübde abgelegt, den weißen Mantel unserer Bruderschaft abzulegen, und dies wird, bis unser Orden von allen Anklagen befreit ist, unsere Kleidung sein.«
Bruce blickte auf den Ritter, der vor ihm stand. Anstelle des üblichen weißen Baumwoll-Überwurfs mit einem großen roten Kreuz war nun ein schwarzer Überwurf zu sehen, der nur ein kleines rotes, kastriertes Kreuz auf der linken Brust trug.
»Wir haben hier in eurem Land Zuflucht gefunden, und während ihr darauf wartet, dass Edward die Garnison in Stirling ablöst, haben meine Brüder beschlossen, nicht nur unsere Ausbildung eurer Truppen in unseren Kampfmethoden fortzusetzen, sondern euch auch unsere Hilfe anzubieten, wenn ihr dies wünscht. Ich kann auf einhundert Ritter zählen, und wenn die Sergeanten und Knappen dazukommen, können wir knapp dreihundertsechzig Kämpfer stellen, einhundertneunzig davon zu Pferd.«
De Courcy verbeugte sich, während er dies sagte, und kniete dann nieder, um dem schottischen König sowohl seine als auch die Treue der Bruderschaft zu geloben.
Und so war die Szene vorbereitet: Die Armen Ritter des Salomonischen Tempels hatten sich selbst von ihrem Papst exkommuniziert und für die meisten von ihnen bedeutete dies, dass sie ihr Zuhause und ihr Land verlassen mussten, um einen König in einem kleinen Land zu unterstützen, der sie akzeptierte und ihnen Zuflucht gewährte.
Robert de Bruce lächelte, als De Courcy ging; er konnte nun auf fast 360 der besten Kämpfer der Welt zählen, nicht nur, um seine Truppen auszubilden, sondern auch, um an der Seite seiner Streitkräfte gegen die Engländer zu kämpfen.
Nur eine Sache beunruhigte ihn: De Courcy hatte ihn über englische Spione informiert, ausgerechnet über Frauen, und hatte ihre Namen und Aufenthaltsorte genannt. Er hatte jedoch gesagt, dass seine Brüder sie beobachteten und sie nur einen schlecht ausgebildeten Haufen sehen würden, der keine Bedrohung für Edwards gut ausgebildete Streitkräfte darstellen könne.
De Courcy hatte betont, dass der Name der Templer nicht in Umlauf gebracht werden dürfe, da die englischen Spione ihn sonst entdecken könnten. Es wäre ein umso größerer Schock, wenn sie bei Bedarf auftauchten.
23. Juni 1314Bannockburn, Zentralschottland
De Bruce war seinen Truppen ein Stück vorausgeritten. Er erkundete die Lage und machte ihnen Mut, indem er seine Verachtung für die Übermacht des Gegners zeigte.
Plötzlich ritt ein Ritter mit erhobener Lanze in vollem Tempo auf De Bruce zu. Bruce hatte nur seine Lieblingsaxt zur Hand. Henrie De Bohun ritt wütend auf den schottischen König zu. Bruce blieb bis zur letzten Minute ruhig stehen, wich dann seinem Pferd aus, sodass die Lanze vorbeiging, und ließ gleichzeitig seine Axt auf den Helm von De Bohun herabsausen. Der Schlag schnitt nicht nur in den Helm, sondern spaltete fast seinen Kopf in zwei Hälften. Bruce wandte sich dann um und führte sein Pferd absichtlich zurück zu den schottischen Linien.De Courcy beobachtete dies und versammelte eine Gruppe von vier Tempelrittern um sich, die ihm folgten, und ging unter dem Hügel hindurch, um sich mit den engen Beratern von De Bruce zu treffen. Sie tadelten ihn für seine Sorglosigkeit.
»Mylord De Bruce«, rief De Courcy, »ich kann nicht zulassen, dass Ihr Euch noch einmal so tollkühn verhaltet. Mit der Erlaubnis Eurer Lords und Berater möchte ich diese Männer«, er winkte sie nach vorne, »als Eure persönliche Leibwache einsetzen, denn sie gehören mir.«
»Das ist nicht nötig, De Courcy. Ich brauche nur eine neue Axt, denn ich habe meine an dem Kopf dieses Narren zerbrochen.«
»Ich werde sie reparieren lassen und sie bis morgen früh zurückgeben, Sire.« Während er sprach, winkte De Courcy einen Sergeant heran. »Sorgt dafür, dass der König sie bis zum Ende des Morgens zurückbekommt. Mylord, ich bestehe darauf, dass meine Männer hier bei Euch bleiben, und sei es nur, um Eure zerbrochenen Äxte zu ersetzen, wenn die Engländer angreifen.«
Beide Männer lachten, und De Courcy wendete langsam sein Pferd und blickte zur englischen Armee hinüber. Er schüttelte den Kopf und rief De Bruce über die Schulter zu: »Ich denke, Ihr werdet uns irgendwann brauchen, Mylord.« De Courcy lächelte in sich hinein und dachte, dass dies seine eigenen Männer auf die Möglichkeit einer Schlacht vorbereiten würde, in der sie unterwegs sein würden.
»Wir müssen mit den Vorbereitungen beginnen, dieses Land zu verlassen, unabhängig vom Ausgang«, flüsterte er Jacobus zu, während sie ihre Pferde über die Anhöhe führten und zu dem Ort zurückkehrten, an dem seine Männer versteckt waren.
Ein schottischer Angriff, der auf die Absetzung von De Bohun folgte, war im Gange, als sie das Feld verließen, aber De Courcy konnte sehen, dass De Bruce das Kommando hatte. Seine Truppen hatten das erste Gefecht geschlagen und auf seinen Befehl hin die Verfolgung eingestellt.
»Vielleicht irre ich mich und wir werden nicht eingesetzt«, dachte er. »Ich muss mir das genau ansehen, denn meine Männer brauchen Blut, das in der Schlacht vergossen wurde.«
Er ließ eine Nachricht an De Bruce schicken, und am späten Nachmittag kam eine Antwort. »De Courcy, ich flehe Euch an, habt Geduld. Morgen ist ein neuer Tag, und ich kann Euch versichern, dass er Euch gehören wird, wenn Ihr es wünscht. Mögen Gott und die Heilige Maria mit uns allen sein.«
De Courcy war zufrieden, aber es schwang auch etwas Traurigkeit mit, da sie dieses Land mit seinen seltsamen, aber freundlichen und gastfreundlichen Menschen verlassen würden. Was sie in Zukunft erwartete, würde wahrscheinlich nicht so einladend sein. »Zumindest«, dachte De Courcy, »zeigten die Papiere, die er gesehen hatte, dass sie sich auf Teilen ihrer Reise darauf verlassen konnten, auf religiöse Seelen zu treffen. Allerdings gab es an manchen Orten auch Heiden und mörderische Kriegerstämme.« Er beschloss zu diesem Zeitpunkt, dass er, wenn er könnte, ein Tagebuch über seine Reisen führen würde und nach Abschluss aller Aufgaben nach Outreamer, seiner einzigen wahren Heimat, zurückkehren würde.
24. Juni 1314
Es war Vormittag am zweiten und wichtigsten Tag der Schlacht, die nun schon seit einigen Stunden tobte. Die schottische Armee war müde und in der Unterzahl, behauptete sich aber noch. Die Chilterns bildeten mit den zusätzlichen geformten Schilden, die die Fußsoldaten vor den englischen Pfeilen schützen sollten, eine sichere Verteidigungsstruktur und drängten die Engländer stellenweise sogar zurück.
Robert de Bruce beobachtete mit Interesse, wie sich die Schlacht vor ihm abspielte: »De Courcy, ich denke, es ist Zeit.«
»Ja, Sire, lasst uns unsere Vorbereitungen treffen«, antwortete De Courcy. Dann wandte er sich an einen Waffenmeister: »Los, gib das Signal, die Zeit ist gekommen.«
»Sire, seht Ihr The Bruce? Er zieht sich auf den Hügel zurück.«
Bruce und seine Leibwache hatten sich von der Schlacht abgewandt und bewegten sich auf die Anhöhe zu.
König Edward und seine Begleiter sahen, wie Bruce sein Pferd anhielt und abstieg, seine Decke ablegte und eine andere, diesmal eine weiße, überreicht bekam. »Sire, so können wir sein Blut sehen, wenn wir ihn abschlachten.«
Bruce bestieg sein Pferd, immer noch mit dem Rücken zur Schlacht, und drehte sich dann, sobald er auf dem Pferd saß, um und zeigte allen auf seiner Decke einen aufgerichteten Löwen, der von einem kleinen, gespreizten roten Kreuz überragt wurde. Wieder auf seinem Schild ein gespreiztes rotes Kreuz, geviertelt mit dem Schwarz und Weiß des Beausant und des aufgerichteten Löwen.
»Was für eine Torheit ist das?«, fragte Edward, ohne sich an jemanden Bestimmten zu wenden.
Auf der anderen Seite des Schlachtfeldes hörten die Truppen des Königs einen Befehl, dann ein Trommelwirbel, gefolgt von einem dreimal geblasenen Horn. In diesem Moment schien auch die schottische Armee den Rückzug aus der Schlacht angetreten zu haben.
»Ja! Geht vor und sagt den Kommandanten, dass sie keine Gnade zeigen sollen«, forderte Edward. »Ich will, dass all diese schottischen Rebellen sterben, schlachtet sie alle ab. Denkt daran, bringt den verräterischen Bruce lebend oder tot; stellt sicher, dass seine Decke vollständig mit dem Blut seiner Armee rot getränkt ist.« Da er keine Antwort erhielt, folgte Edward II., König von England, dem Blick des Grafen.
Rechts von Bruce, hinter der Spitze des Hügels, ertönte ein Grollen. Unten verlangsamten auch seine Truppen ihren Kampf. Ihre Augen wurden auf knapp zweihundert Ritter gelenkt, die alle in wallende schwarze Umhänge über schwarzen Decken gekleidet waren und ein kleines, gespreiztes rotes Kreuz trugen. Ihre Sergeanten waren ebenfalls in Schwarz gekleidet, ebenfalls mit dem Kreuz, und trotteten den Hügelkamm entlang, bevor sie sich aufstellten und die Speere nach vorne richteten, um sich auf den Angriff vorzubereiten.
Edward stammelte: »Was in Gottes Namen ist das? Wer sind diese Reiter und wem gehört die Flagge, die sie hissen?«
»Mein Herr, es ist die Beausant-Schlachtflagge der Tempelritter, aber diese Männer tragen nicht die heiligen Gewänder der Templer.« Obwohl das rote Kreuz auf Weiß fehlte, reichte der Anblick der Beausant aus, um unter den Truppen ein Gefühl der Angst auszulösen. Die ersten Anzeichen von Panik zeigten sich bereits, als englische Ritter, Bogenschützen und Infanterie sich auf die Brücke und den Fluss zurückzogen.
Die Ritter begannen im Trab und wechselten dann in den Galopp. Von der anderen Flanke erschienen weitere Reiter, die leichter bewaffnet waren. Es handelte sich um die eigene Kavallerie von Bruce, und alle trugen den aufgerichteten Löwen neben einem gespreizten roten Kreuz, mit Beausant und dem aufgerichteten Löwen auf den Schilden, genau wie ihr Anführer und König.
Zwischen ihnen kamen weitere Männer, die schreiend und mit Bogen und Lanze bewaffnet in die Schlacht stürmten. Es handelte sich um die Knappen der Tempelritter und die Gefolgsleute von Bruce. Der Anblick all dieser zusätzlichen Truppen und Kavallerie zusammen mit den Tempelrittern versetzte die Engländer in Panik.
Sie kannten die Geschichte hinter dem Rosenkreuz und trotz der ungewohnten Kleidung wussten die englischen Truppen um den furchterregenden Ruf der Männer, die unter dem Banner des Beausant kämpften. Aufgrund des zahlenmäßigen und waffentechnischen Gesamtvorteils begann sich die Flucht zu entfalten. Fußsoldaten und Bogenschützen versuchten, die Brücke erneut zu überqueren, während andere sich ins Wasser stürzten und versuchten, schwimmend oder paddelnd hinüberzukommen.
Englische Ritter kehrten um und flohen, viele ertranken im Wasser, als ihre Pferde vor den eigenen Männern scheuten, die bereits im Wasser waren. Als Edward die Templer auf sich zukommen sah, mähte er die Reste seiner Truppen nieder, die sich über die Brücke zurückzogen, und kehrte ebenfalls um und zog sich zurück. Dies führte zu einer Flucht vom Schlachtfeld, bei der viele Engländer von schottischen Kriegern und Tempelrittern und ihren Anhängern getötet wurden.
Beim Blick über das Schlachtfeld bot sich ein Bild des Grauens. Männer lagen tot, sterbend und verwundet da. Die Schotten hatten sie mit einem Schwertstreich oder einer Speerspitze getötet.
Über dem Gemetzel feierte The Bruce mit Roger de Courcy. »Danke, mein Herr, dass wir wieder den Atem des Kampfes spüren durften. Es ist lange her und wir waren es leid, nur Hüter der Reliquien zu sein. Meine Brüder und ich wünschen Euch Erfolg. Vielleicht wird Edward es sich gut überlegen, bevor er so etwas noch einmal versucht.«
Bruce stieg von seinem Pferd, ging auf De Courcy zu und nahm seine Hand. »Sir, ich danke Euch und Euren Rittern für Eure Hilfe an diesem Tag. Dieser Sieg wird lange in Erinnerung bleiben. Ich werde dafür sorgen, dass Euer Anteil an diesem Sieg über Edward in den Annalen festgehalten wird, damit alle unsere Nachkommen davon profitieren können.«
»Sire, ich würde es vorziehen, wenn unser Anteil an Eurem Sieg aus der schriftlichen Geschichte dieses bedeutsamen Ereignisses herausgehalten würde. Wir müssen Euch inständig bitten, Euch an die Gründe zu erinnern, warum wir überhaupt in Euer Land gekommen sind. Es ist unerlässlich, dass unser Orden wieder in Vergessenheit gerät und sich wieder versteckt. Bitte, mein Herr, lasst dies nicht auf Pergament festhalten, und ich flehe Euch an, es zu leugnen, wann immer das Thema unserer Beteiligung angesprochen wird.«
Bruce, der zwar etwas schockiert war, bestätigte, dass dies geschehen würde. »Sir Ritter, ich werde bekannt machen, dass unsere Diener und Gefolgsleute den entscheidenden Beitrag in dieser Schlacht geleistet haben. Aber ich muss darum bitten, dass wir Euch auf irgendeine Weise danken.«
»Ja, Sire, das könnt Ihr. Erhält unseren Orden in Eurem Land am Leben, entweder im Untergrund oder durch die Bildung von Gruppen, in denen wir die Tempelritter offen verstecken können. Es gibt andere, die die Bruderschaft anderswo in dieser und der unentdeckten Welt am Leben erhalten. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie sich durch einen Handschlag und ein Wort zu erkennen geben. Mögen Gott und die Magdalene mit Euch sein, Robert de Bruce; Ihr seid wahrhaftig ein König der Schotten.«
Nach der Schlacht zogen sich die Ritter auf ihre Besitztümer in der Nähe von Edinburgh und nach Argyll im Westen zurück. Nach einigen Wochen der Diskussion wurde beschlossen, dass Schottland zwar vorerst sicher, aber nicht stabil war, und es wurde die widerwillige Entscheidung getroffen, die Artefakte, die an beiden Orten sorgfältig versteckt worden waren, zu entfernen. Es wurden Vorkehrungen für ihre Verlegung zu den Flotten getroffen, die für den Fall, dass eine solche Zeit kommen würde, noch in gutem Zustand waren.
Die Ritter hatten die Wahl, weiterhin als Wächter zu fungieren oder sich in diesem Land niederzulassen. Einige beschlossen, in Schottland zu bleiben und den Orden am Leben zu erhalten, aber die Mehrheit, darunter auch einige schottische Konvertiten, stimmte der Entscheidung zu, zur See zurückzukehren. Nach dem Treffen wandte sich De Courcy an den Heiligen Klara und bat ihn um Rat bezüglich der Wikingersagen und um Hilfe bei der Bestimmung ihrer Routen zu einem neuen Land auf der anderen Seite des Wassers.
St. Claire sorgte dafür, dass ein nordischer Seefahrer zu den Templerlagerstätten in der Nähe von Edinburgh gebracht wurde. Bei seiner Ankunft wurden Pläne für die Schiffe entworfen, die ihre westlichen und östlichen Stützpunkte verlassen und sich vor Orkney, einer Hochburg von St. Claire, sammeln sollten. Die Nordländer hatten drei weitere Seefahrer mitgebracht, die alle mit den nördlichen Meeren vertraut waren. Nach ihren Erzählungen von zugefrorenen Meeren und schwimmenden Eisbergen, die sich nun über Island bilden würden, beschlossen die Kapitäne, die Abfahrt auf das Frühjahr zu verschieben. Dies würde auch eine umfassendere Umrüstung der Flotte ermöglichen und mehr Zeit für die Beschaffung von Proviant bieten, der von The Bruce dankbar zur Verfügung gestellt wurde.
Am 3. Mai verließ der östliche Konvoi den Firth of Forth und segelte nach Osten, dann nach Norden in Richtung der Festung St. Claire. Zwei Tage später folgte die westliche Flotte der schottischen Westküste und umrundete die äußeren Inseln.
Am 10. Mai 1315 trafen die beiden Flotten mit jeweils acht Schiffen, bestehend aus zwei Holks, drei Karacken und drei Cougas, vor der Ostküste von Orkney aufeinander. Die Flotte suchte Schutz in einem großen, abgeschlossenen Becken, um in letzter Minute Vorräte an getrocknetem Fisch und mehr Frischwasser für ihre lange Reise aufzunehmen.
Mit etwa zwanzig Männern von St. Claires an Bord schlossen sie sich nun den Flotten an, die nordwärts von Schottland wegfuhren. Acht Tage lang war das Wetter gut, aber am neunten Tag verursachte ein großer Sturm, dass eines der Schiffe volllief und fast verloren ging. Es konnte nur durch das Festzurren von zwei anderen Schiffen gerettet werden, die es über Wasser hielten.
Kapitel 4
25. Dezember 1914Burke und Meissen während des Weihnachtsfriedens 1914
Kapitän James Mathew Burke wachte auf, irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Als er sich mit seinen Stiefeln abmühte, wurde es ihm klar: die Stille, kein Gewehr- oder Maschinengewehrfeuer und kein Artilleriefeuer.Er beeilte sich und kletterte die Leitern hinauf, die vom Bunker in den Schützengraben führten. Einige seiner Truppen saßen herum und tranken das stinkende Gebräu, das sie Tee nannten. Korporal Steele bot ihm einen an.
»Steele, was ist hier los?«, rief Burke.
Die Antwort haute ihn fast um: »Wir haben Waffenruhe, Sir. Bosch hat heute früh angerufen. Sie dachten, es sei Weihnachten, und wir sollten uns heute nicht gegenseitig umbringen, und wir haben zugestimmt.«
Burke ging zu den Sturmleitern, kletterte vorsichtig über die Grabenmauer und blickte zu den deutschen Schützengräben hinüber. Er konnte bereits etwa hundert Männer herumschlendern sehen. Einige hatten sogar ein Fußballspiel begonnen; andere hatten Feuer entfacht und kochten Kaffee und Tee. »Etwas Warmes, in das man Rum geben kann«, dachte er. Burke hatte die deutsche Sprache studiert und beschloss, es mit dem ersten »Hunnen« zu versuchen, dem er begegnete.
»Guten Morgen, Sir.« Burke drehte sich schnell um und sah einen deutschen Offizier auf sich zukommen, der ihm die Hand reichte. Bevor er sich zurückhalten konnte, hatte er ihm die Hand geschüttelt und ein Gespräch mit dem Feind begonnen. »Mein Name ist Meissen, Oberleutnant Franz Meissen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Sir.«
»Gleichfalls, mein Name ist James Burke, Captain, Zigarette?«
»Danke. Sir, ich sehe, dass Sie den Ring der Tütonen tragen. Darf ich fragen, wie Sie zu Ihrem gekommen sind; ich habe nämlich einen fast gleichen.«Burke war sprachlos; er konnte nicht glauben, dass er sich mit dem Feind unterhielt, aber auch, dass sein Feind den Templerring seines Vaters bemerkt hatte. »Das hier«, begann er, »ist der meines verstorbenen Vaters. Ich habe zu Hause einen genau wie diesen.«
»Ich auch. Er gehört der alten Bruderschaft der Deutschen Ritter an. Captain, darf ich fragen, ob Ihr zu den Tuetonen gehört?«
»Ich gehöre zu den Armen Rittern des Tempels, und habt Ihr Euch im Hause Salomons geeinigt, damit wir dieses Gespräch fortsetzen können, mein Freund?« Beide Männer verstanden diesen kurzen Code; sie waren in der Tat Brüder in der Loge, standen aber derzeit auf entgegengesetzten Seiten des Konflikts.
Die beiden gingen und redeten mehr als drei Stunden lang und hielten nur an, um ihre jeweiligen Blechnäpfe aufzufüllen. Meissen erzählte Burke von seinen Recherchen zu Papieren, die sein Onkel 1909 auf einer Reise nach Ägypten erworben hatte. »Diese Papiere sind für unsere beiden Bruderschaften von äußerster Wichtigkeit, aber besonders für eure. Ich hoffe, dass wir beide eines Tages ihre Ursprünge genauer untersuchen können. Ich bete zu Gott und der Heiligen Magdalena, dass wir eines Tages die Wahrheit dieser Papiere bestätigen können.« Als es kälter und dunkler wurde, wurde allen Truppen befohlen, in ihre jeweiligen Schützengräben zurückzukehren. Beide Männer schüttelten sich erneut die Hände und wünschten sich, ihr Treffen hätte in glücklicheren Zeiten stattfinden können.
Am 12. November 1917 wurde Captain Burke in ein Feldlazarett gerufen, das etwa 19 Kilometer von seiner Position entfernt lag.
»Sir«, schimpfte der Läufer, »im Gefangenenbereich des Feldlazaretts 19 ist ein Deutscher, der darauf besteht, Sie zu treffen.«
Drei Stunden später wurde Burke in einen hinteren Bereich des Lazaretts geführt, das sich innerhalb eines Stacheldrahtzauns befand, um einen blassen, verwundeten Franz Meissen zu sehen.
»Ich freue mich, dass du überlebt hast, mein Freund, aber ich weiß nicht, ob ich überleben werde, und deshalb möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Ich kann dir meine Adresse in München geben. Wenn ich sterbe und du überlebst, könntest du dann meiner Frau sagen, dass ich einen Freund getroffen habe? Sag ihr: ´Meine Frau, ich bin ein Freund der Tschetschenen und ihr Bruder.´ Sie wird es verstehen und dir die Dinge geben, die wir vor so vielen Jahren besprochen haben.«
Burke unterhielt sich noch eine Weile mit Meissen, bis klar wurde, dass der Deutsche erschöpft war. »Ich sehe dich, wenn dieser verdammte Kampf vorbei ist, mein Kamerad und Bruder.« Burke fragte sich, ob er jemals vorbei sein würde, obwohl es mit den Amerikanern, die jetzt beteiligt waren, wahrscheinlicher schien.





























