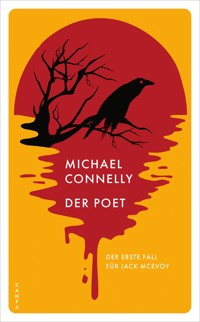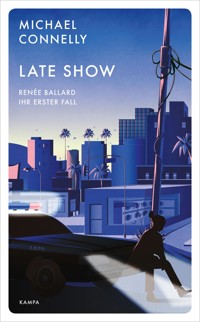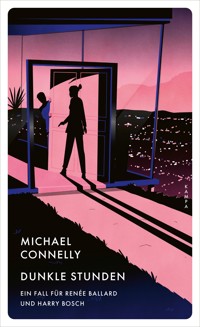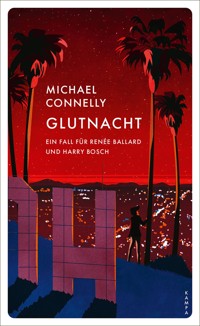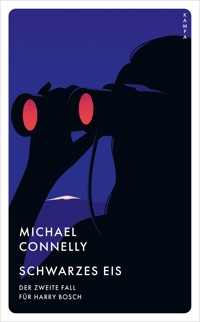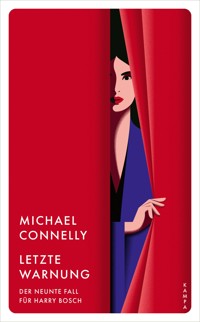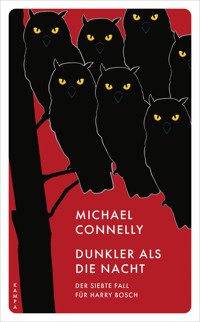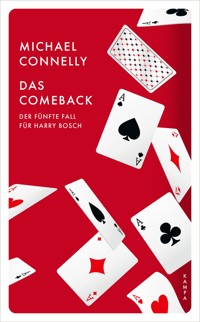Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für den Lincoln Lawyer
- Sprache: Deutsch
Seine Fälle löst er von der Rückbank seines Wagens, was ihm den Spitznamen »Lincoln Lawyer« eingebracht hat. Wer ihn chauffiert? Mandanten, die sich die Anwaltskosten nicht leisten können. Jetzt steht Michael Haller vor dem spektakulärsten Fall seiner Karriere: Nach dem kaltblütigen Mord an seinem Kollegen Jerry Vincent wird Haller dessen hochkarätiger Klientenstamm übertragen. Der Verdacht liegt nahe, dass der Mörder unter Vincents Mandanten zu finden ist. Ist auch Haller in Gefahr? Der hat keine Zeit, sich Sorgen zu machen. Vincents letzter Fall fordert seine Aufmerksamkeit: Der Hollywood-Mogul Walter Elliot ist des Mordes an seiner Ehefrau und deren Geliebten angeklagt. Je näher Haller der Wahrheit kommt, desto größer wird die Gefahr. Und dann verschwindet er …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Connelly
Das Gesetz der Straße
Der zweite Fall für den Lincoln Lawyer
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Zum Gedenken an Terry Hansen
und Frank Morgan
Teil EinsDumm gelaufen – 1992
1
Alle lügen.
Polizisten lügen. Anwälte lügen. Zeugen lügen. Die Opfer lügen.
Ein Prozess ist ein wahrer Lügenwettstreit. Und jeder im Gerichtssaal weiß das. Der Richter weiß es. Sogar die Geschworenen wissen es. Sie betreten das Gericht in der sicheren Erwartung, getäuscht zu werden. Sie nehmen auf der Geschworenenbank Platz und erteilen damit unausgesprochen ihre Einwilligung, dass man sie hinters Licht führt.
Für einen Strafverteidiger besteht die Aufgabe vor allem darin, Geduld zu haben. Zu warten. Aber nicht auf irgendeine beliebige Lüge. Sondern auf eine, die man packen und wie ein glühendes Eisen zu einer scharfen Klinge schmieden kann. Und mit dieser Klinge schlitzt man dann den Fall auf und lässt seine Innereien herausquellen.
Das ist mein Job. Die Klinge zu schmieden. Sie zu schärfen. Sie ohne Gnade oder Skrupel einzusetzen. An einem Ort, an dem alle lügen, die Wahrheit zu vertreten.
2
Am vierten Verhandlungstag in Saal 109 des Criminal Courts Building in Downtown L.A. bekam ich die Lüge serviert, die zu der Klinge wurde, die den Fall aufschlitzte. Infolge zweier Mordanklagen war mein Mandant Barnett Woodson auf dem besten Weg in diese stahlgraue Kammer in San Quentin, wo sie einem die tödliche Giftspritze setzen.
Woodson, ein siebenundzwanzigjähriger Drogendealer aus Compton, wurde beschuldigt, zwei Studenten aus Westwood beraubt und getötet zu haben. Sie hatten Kokain von ihm kaufen wollen, aber er hatte ihnen nur ihr Geld abgeknöpft und sie dann mit einer abgesägten Schrotflinte erschossen. Behauptete jedenfalls die Anklage. Dass er Schwarzer war und seine Opfer Weiße, gestaltete die Sache für Woodson nicht gerade aussichtsreicher. Vor allem da sich die Tat gerade mal vier Monate nach den schweren, die Stadt in zwei Lager spaltenden Rassenunruhen ereignet hatte. Zusätzlich erschwerend wirkte sich der Umstand aus, dass der Mörder die beiden Leichen im Hollywood Reservoir versenkt hatte. Dort lagen sie vier Tage auf dem Grund, bevor sie an die Oberfläche stiegen wie Äpfel in einem Fass. Faule Äpfel. Bei der Vorstellung, dass Leichen in dem Reservoir verwesten, das als wichtige Trinkwasserquelle der Stadt diente, drehte es der Bevölkerung sozusagen kollektiv den Magen um. Und als Woodson durch Telefonunterlagen mit den Toten in Verbindung gebracht und festgenommen werden konnte, wurde er zur Zielscheibe der allgemeinen Empörung. Prompt erklärte die Staatsanwaltschaft, sie werde die Todesstrafe beantragen.
Doch die Beweislage im Fall Woodson war nicht so eindeutig, wie es zunächst schien. Sie beruhte vorwiegend auf Indizien – den Telefonunterlagen – sowie auf Aussagen von Zeugen, die selbst Kriminelle waren. Allen voran der Hauptzeuge Ronald Torrance, der behauptete, Woodson habe ihm die Morde gestanden.
Torrance hatte im selben Block des Men’s Central Jail eingesessen wie Woodson. Beide Männer waren auf einem Flur des Hochsicherheitstrakts untergebracht gewesen, der aus zwei einander gegenüberliegenden Reihen von jeweils acht Einzelzellen bestand, die sich zu einem Aufenthaltsbereich hin öffneten. Zum fraglichen Zeitpunkt waren alle sechzehn Häftlinge in dem Trakt Schwarze. Dem lag die in Gefängnissen weithin übliche, wenn auch fragwürdige Praxis der »Rassentrennung aus Sicherheitsgründen« zugrunde. Man teilte die Inhaftierten nach Hautfarbe und Bandenzugehörigkeit auf, um Streitereien und Gewalttätigkeiten zu verhindern. Torrance hatte sich während der Rassenunruhen an Plünderungen beteiligt und wartete auf seinen Prozess, in dem er sich wegen Raub und schwerer Körperverletzung verantworten musste. Die Häftlinge im Hochsicherheitstrakt hatten von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends Zugang zum Aufenthaltsbereich. Unter den wachsamen Blicken der Wärter, die sich in erhöht angebrachten verglasten Abteilen befanden, nahmen sie dort ihre Mahlzeiten zu sich, spielten Karten oder beschäftigten sich anderweitig. Laut Aussagen von Torrance hatte ihm mein Mandant die Ermordung der beiden Westside-Studenten gestanden, während sie gemeinsam an einem der Tische dort hockten.
Die Anklage legte sich mächtig ins Zeug, um Torrance den Geschworenen, unter denen nur drei Schwarze waren, präsentabel und glaubwürdig erscheinen zu lassen. Man verpasste ihm eine Rasur, seine Zöpfchenfrisur wurden entflochten, sein Haar gestutzt, und man steckte ihn in einen hellblauen Anzug ohne Krawatte, bevor er am vierten Tag des Woodson-Prozesses in den Zeugenstand trat. Während der Befragung durch den Staatsanwalt Jerry Vincent schilderte Torrance das Gespräch, das er angeblich eines Vormittags im Aufenthaltsbereich mit Woodson geführt hatte. Woodson habe ihm nicht nur die Morde gestanden, sondern auch zahlreiche Details der Tat offenbart. Dabei wurde den Geschworenen immer wieder zu verstehen gegeben, dass es sich um Details handelte, die nur dem Mörder bekannt sein konnten.
Vincent führte Torrance an der kurzen Leine durch seine Zeugenaussage. Er stellte ihm lange Fragen, die auf knappe Antworten abzielten. Seine Fragen waren derartig überfrachtet, dass man sie schon als suggestiv hätte bezeichnen können. Aber ich verzichtete auf einen Einspruch, obwohl Richter Companioni mich mit hochgezogenen Augenbrauen förmlich darum anbettelte. Ich wollte, dass die Geschworenen das Spiel der Anklage selbst durchschauten. Wäre ich dann bei Torrance an der Reihe, würde ich ihm bei seinen Antworten viel Raum lassen und mich bewusst zurückhalten, während ich die Klinge schmiedete.
Um elf beendete Vincent seine Zeugenbefragung, und der Richter erkundigte sich, ob ich eine frühe Mittagspause wolle, bevor ich mit dem Kreuzverhör begann. Ich erwiderte, ich brauche oder wolle keine Pause. Dabei schlug ich einen leicht empörten Ton an, als könnte ich keine Stunde länger warten, mir den Mann im Zeugenstand vorzuknöpfen. Dann erhob ich mich, schnappte mir meinen dicken Aktenordner und einen Notizblock und marschierte vor zum Pult.
»Mr. Torrance, mein Name ist Michael Haller. Ich arbeite für das Public Offenders Office und vertrete Barnett Woodson. Sind wir uns schon einmal begegnet?«
»Nein, Sir.«
»Das dachte ich eigentlich auch nicht. Aber Sie und der Angeklagte, Mr. Woodson, sind alte Bekannte, ist das richtig?«
Torrance schüttelte grinsend den Kopf. Ich hatte mich gründlich über ihn informiert und wusste genau, mit wem ich es zu tun hatte. Er war zweiunddreißig Jahre alt und hatte ein Drittel seines Lebens in Haftanstalten verbracht. Die Schule hatte er bereits in der vierten Klasse abgebrochen, ohne dass ein Elternteil davon Notiz genommen hätte. Infolge der Drei-Verurteilungen-Regel des Staates Kalifornien drohte ihm eine lebenslängliche Haftstrafe, sollte er in dem in Kürze gegen ihn angesetzten Prozess für schuldig befunden werden. Ihm wurde zur Last gelegt, die Geschäftsführerin eines Münzwaschsalons beraubt und mit einer Pistole niedergeschlagen zu haben. Begangen hatte er diese Straftat im Zuge der dreitägigen Unruhen und Plünderungen, ausgelöst durch die Freisprüche der vier Polizisten, die der übertriebenen Gewaltanwendung gegenüber Rodney King angeklagt gewesen waren – ein schwarzer Autofahrer, den sie wegen zu schnellen Fahrens angehalten hatten. Kurz gesagt, Torrance hatte gute Gründe, dem Staat dabei zu helfen, Barnett Woodson hinter Gitter zu bringen.
»Wir kennen uns höchstens ein paar Monate«, grinste Torrance. »Aus der Hochsicherheit.«
»Aus der Hochsicherheit?« Ich stellte mich dumm. »Reden Sie hier von irgendeiner Sicherheitsorganisation? Oder wie soll ich das verstehen?«
»Nein, der Hochsicherheitstrakt. Hier im County.«
»Sie meinen also das Gefängnis, richtig?«
»Richtig.«
»Und Sie wollen damit sagen, dass Sie Barnett Woodson erst dort kennengelernt haben?«
Ich tat überrascht.
»Ja, Sir. Wir haben uns erst im Gefängnis kennengelernt.«
Ich schrieb etwas auf meinen Block, als wäre das ein wichtiges Eingeständnis.
»Dann lassen Sie uns mal nachrechnen, Mr. Torrance. Barnett Woodson wurde am fünften September dieses Jahres in den Hochsicherheitstrakt eingeliefert, in dem Sie bereits inhaftiert waren. Erinnern Sie sich daran?«
»Ja, ich weiß noch, wie er eingeliefert worden ist, klar.«
»Und warum saßen Sie im Hochsicherheitstrakt?«
Vincent erhob Einspruch, mit der Begründung, diese Punkte seien bereits bei seiner Befragung des Zeugen zur Sprache gekommen. Ich führte an, ich sei an einer umfassenderen Erklärung für Torrances Haftaufenthalt interessiert, und Richter Companioni gab mir recht. Er forderte Torrance auf, die Frage zu beantworten.
»Wie schon gesagt, ich bin wegen Körperverletzung und Raub angeklagt.«
»Und zu diesen mutmaßlichen Straftaten kam es während der Unruhen, ist das zutreffend?«
Angesichts des polizeifeindlichen Klimas, das bereits vor den Unruhen bei den Minderheiten der Stadt geherrscht hatte, hatte ich bei der Auswahl der Geschworenen darum gekämpft, so viele Schwarze und Braune wie möglich auf die Geschworenenbank zu bekommen. Und jetzt bot sich die Gelegenheit, auch die fünf weißen Geschworenen weichzuklopfen, die die Anklage an mir vorbeizuschleusen geschafft hatte. Ich wollte ihnen vor Augen führen, dass der Hauptzeuge der Anklage mitverantwortlich für die Bilder war, die sie im Mai auf ihren Fernsehgeräten gesehen hatten.
»Ja, ich bin damals dabei gewesen, wie alle anderen auch«, antwortete Torrance. »Die Cops in L.A. nehmen sich einfach zu viel raus, wenn Sie mich fragen.«
Ich nickte, als teilte ich diese Meinung.
»Und Ihre Reaktion auf die Ungerechtigkeit der Urteile im Rodney-King-Fall war, loszuziehen und eine zweiundsechzigjährige Frau auszurauben und mit einem Metallabfalleimer bewusstlos zu schlagen? Trifft das zu, Sir?«
Hilfesuchend blickte Torrance zuerst zum Ankläger und dann zu seinem eigenen Anwalt, der in der ersten Reihe des Zuschauerbereichs saß. Aber selbst für den Fall, dass die beiden eine entsprechende Antwort mit ihm einstudiert hatten, konnten sie ihm jetzt nicht helfen. Er war auf sich allein gestellt.
»Nein, das habe ich nicht getan«, antwortete er schließlich.
»Sie haben die Straftat, deren Sie beschuldigt werden, nicht begangen?«
»Richtig.«
»Wie sieht es mit Plünderungen aus? Haben Sie sich während der Unruhen etwas zuschulden kommen lassen?«
Erst nach einer längeren Pause und einem weiteren Blick zu seinem Anwalt erwiderte Torrance. »Ich verweigere die Aussage.«
Mit dieser Antwort hatte ich gerechnet. Und ich stellte Torrance nun eine Reihe weiterer Fragen, die alle so formuliert waren, dass er sich entweder selbst belasten oder von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen musste. Nachdem er sechsmal in den sauren Apfel gebissen hatte, wurde der Richter des Spiels überdrüssig und verwies mich auf den anstehenden Fall. Ich leistete widerstrebend Folge.
»Also gut, genug über Sie geredet, Mr. Torrance. Befassen wir uns wieder mit Ihnen und Mr. Woodson. Waren Sie mit den Einzelheiten des hier verhandelten Doppelmords bereits vertraut, bevor Sie Mr. Woodson in der Haft kennenlernten?«
»Nein, Sir.«
»Tatsächlich? In den Medien wurde aber ausführlich über den Fall berichtet.«
»Ich war im Gefängnis, Mann.«
»Gibt es im Gefängnis kein Fernsehen und keine Zeitungen?«
»Zeitungen lese ich keine, und der Fernseher in der Hochsicherheit ist kaputt, seit ich dort bin. Wir haben deswegen einen ziemlichen Aufstand gemacht, und sie haben gesagt, sie lassen ihn reparieren, aber getan haben sie einen Scheiß.«
Der Richter ermahnte Torrance, auf seine Ausdrucksweise zu achten, und der Zeuge entschuldigte sich. Ich fuhr fort:
»Den Gefängnisunterlagen zufolge kam Mr. Woodson am fünften September in den Hochsicherheitstrakt, und laut der Beweismitteloffenlegung der Staatsanwaltschaft sind Sie am zweiten Oktober an die Anklage herangetreten, um Mr. Woodsons angebliches Geständnis zu melden. Hört sich das für Sie richtig an?«
»Ja, hört sich ziemlich richtig an.«
»Für mich nicht, Mr. Torrance. Sie wollen den Geschworenen tatsächlich weismachen, dass ein Mann, der wegen Doppelmords angeklagt ist und mit der Todesstrafe rechnen muss, seine angebliche Tat jemandem gesteht, den er noch nicht einmal vier Wochen gekannt hat?«
Torrance zuckte mit den Achseln, bevor er antwortete.
»War aber so.«
»Behaupten Sie. Welche Erleichterungen hat Ihnen die Anklage zugesichert, wenn Mr. Woodson wegen dieser Straftaten schuldig gesprochen wird?«
»Keine Ahnung. Niemand hat mir was versprochen.«
»Angesichts Ihrer Vorstrafen und aufgrund der Ihnen gegenwärtig zur Last gelegten Verbrechen droht Ihnen im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von mehr als fünfzehn Jahren, richtig?«
»Davon weiß ich nichts.«
»Wirklich nicht?«
»Nein, Sir. Darum kümmert sich mein Anwalt.«
»Hat er Sie etwa nicht darauf aufmerksam gemacht, dass Sie, wenn Sie diesbezüglich nichts unternehmen, sehr lange ins Gefängnis wandern?«
»Davon hat er mir nichts gesagt.«
»Verstehe. Worum haben Sie den Ankläger als Gegenleistung für Ihre Aussage gebeten?«
»Um nichts. Ich will nichts.«
»Demnach sagen Sie hier aus, weil Sie es für Ihre Bürgerpflicht halten, ist das richtig?«
Der Sarkasmus in meiner Stimme war unüberhörbar.
»Ganz genau«, gab Torrance ungehalten zurück.
Ich hielt den dicken Ordner hoch, sodass er ihn sehen konnte.
»Kommt Ihnen dieser Ordner bekannt vor, Mr. Torrance?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Sie haben diesen Ordner nie in Mr. Woodsons Zelle gesehen?«
»Bin nie in seiner Zelle gewesen.«
»Sie haben sich also nicht heimlich dort Zutritt verschafft und diesen Beweisoffenlegungsordner durchgesehen, während Mr. Woodson im Aufenthaltsraum oder unter der Dusche oder vielleicht auch im Gericht war?«
»Nein, hab ich nicht.«
»Mein Mandant bewahrte viele Ermittlungsunterlagen zu seiner Strafsache in seiner Zelle auf. Diese enthielten einige der Einzelheiten, die Sie heute Morgen bezeugt haben. Sie finden das nicht verdächtig?«
Torrance schüttelte den Kopf.
»Nein. Ich weiß nur, dass er mit mir am Tisch saß und mir von seiner Tat erzählt hat. Er hat deswegen ein schlechtes Gewissen gehabt und mir sein Herz ausgeschüttet. Ist doch nicht meine Schuld, wenn sich jemand bei mir ausheulen will.«
Ich nickte, als könnte ich verstehen, welch schwere Bürde es für Torrance darstellte, wenn andere sich ihm anvertrauten. Insbesondere wenn es sich dabei um einen Doppelmord handelte.
»Natürlich nicht, Mr. Torrance. Aber könnten Sie jetzt den Geschworenen berichten, was genau Ihnen Mr. Woodson erzählt hat? Und bitte nicht in der Kurzfassung, die Sie Mr. Vincent aufgetischt haben, als er Sie in den Zeugenstand gerufen hat. Ich möchte im Detail hören, was Ihnen mein Mandant erzählt hat. Und in seinen Worten, bitte.«
Torrance schwieg eine Weile, als müsse er erst in seinem Gedächtnis kramen und seine Gedanken sortieren.
»Also, es war so«, begann er schließlich. »Wir saßen da, jeder für sich, und dann fing er plötzlich einfach an zu reden. Darüber, dass er ein schlechtes Gefühl hätte wegen dem, was er getan hat. Und ich hab ihn gefragt: Was hast du denn getan? Und er hat mir erzählt, wie er in dieser Nacht diese zwei Typen umgebracht hat und dass ihn das ziemlich belastet.«
Die Wahrheit bevorzugt immer knappe Worte. Lügen dagegen tendieren zum Ausschweifen. Ich wollte Torrance zum Plaudern bringen. Etwas, das Vincent erfolgreich zu verhindern gewusst hatte. Knastspitzel haben eine Sache mit anderen professionellen Lügnern und Betrügern gemeinsam. Sie versuchen häufig, den Schwindel hinter irreführendem Geschwätz und witzigem Geplänkel zu verbergen. Sie verpacken ihre Lügen in Berge von Watte. Aber in diesem ganzen Flausch steckt oft der Schlüssel für die Aufdeckung der großen Lüge.
Vincent erhob erneut Einspruch, mit der Begründung, der Zeuge habe bereits alle meine Fragen beantwortet und ich würde ihn nur einzuschüchtern versuchen.
»Euer Ehren«, entgegnete ich, »dieser Zeuge legt meinem Mandanten ein Geständnis in den Mund. Denn nichts anderes ist hier nach Ansicht der Verteidigung der Fall. Das Gericht würde sich eines groben Versäumnisses schuldig machen, wenn es mir nicht gestattet, den Inhalt und Zusammenhang einer derart belastenden Aussage in vollem Umfang klarzustellen.«
Noch bevor ich zu Ende gesprochen hatte, nickte Richter Companioni zustimmend und forderte mich auf, mit der Befragung des Zeugen fortzufahren. Ich wandte mich wieder an Torrance und setzte die Befragung mit deutlich hörbarer Ungeduld in der Stimme fort.
»Mr. Torrance, nach wie vor schildern Sie uns den Sachverhalt nur in Kurzform. Sie behaupten, Mr. Woodson habe Ihnen die Morde gestanden. Dann erzählen Sie doch den Geschworenen, was er zu Ihnen gesagt hat. Was waren seine genauen Worte, als er Ihnen seine Tat gestand?«
Torrance nickte, als würde ihm erst jetzt klar, was ich von ihm wollte.
»Das Erste, was er zu mir gesagt hat, war: Mann, ich fühl mich echt Scheiße. Und darauf hab ich erwidert: Wegen was, Bruder? Und dann hat er mir erzählt, er müsse ständig an diese beiden Typen denken. Ich hatte keine Ahnung, von was er überhaupt redete, weil ich ja, wie gesagt, nichts über den Fall gehört hatte. Deshalb hab ich ihn gefragt: Welche zwei Typen? Und er hat gemeint: Die zwei Nigger, die ich im Reservoir versenkt hab. Ich wollte wissen, was er genau mit denen angestellt hat, worauf er mir beschrieben hat, wie er sie beide mit ’ner abgesägten Schrotflinte umgenietet und dann in Maschendraht eingewickelt hat. Er hat gesagt: Ich hab einen Riesenfehler gemacht, und ich hab ihn gefragt, wieso. Darauf hat er nur gemeint: Ich hätte ihnen mit einem Messer den Bauch aufschlitzen sollen, damit sie nicht wieder an die Oberfläche kommen. Das war alles, was er mir erzählt hat.«
Aus dem Augenwinkel hatte ich bemerkt, wie Vincent an einer Stelle in Torrances langer Antwort zusammengezuckt war. Und ich wusste auch, warum. In aller Ruhe setzte ich die Klinge an.
»Hat Mr. Woodson tatsächlich dieses Wort benutzt? Hat er die Opfer als Nigger bezeichnet?«
»Ja, hat er.«
Ich ließ mir Zeit bei der Formulierung der nächsten Frage. Ich wusste, Vincent würde sofort Einspruch erheben, wenn ich ihm nur die geringste Chance dazu bot. Auf keinen Fall durfte ich Torrance zu einer Interpretation auffordern. Die Frage nach dem »Warum« musste unterbleiben, wenn ich spezifizieren wollte, was Woodson mit diesem Wort gemeint oder beabsichtigt hatte.
»Mr. Torrance, unter Schwarzen kann das Wort Nigger alles Mögliche bedeuten, ist das richtig?«
»Schätze schon.«
»Darf ich das als ein Ja auffassen?«
»Ja.«
»Der Angeklagte ist Afroamerikaner, richtig?«
Torrance lachte.
»Sieht jedenfalls ganz so aus.«
»Und auf Sie trifft das ebenfalls zu, ist das richtig, Sir?«
Torrance begann erneut zu lachen.
»Seit meiner Geburt.«
Der Richter klopfte einmal mit seinem Hammer und musterte mich streng.
»Mr. Haller, ist das wirklich nötig?«
»Ich bitte um Entschuldigung, Euer Ehren.«
»Fahren Sie bitte fort.«
»Mr. Torrance, hat es Sie schockiert, als Mr. Woodson, wie Sie behaupten, dieses Wort verwendet hat?«
Torrance rieb sich das Kinn, als dächte er über die Frage nach. Dann schüttelte er den Kopf.
»Eigentlich nicht.«
»Warum waren Sie nicht schockiert?«
»Wahrscheinlich, weil ich es ständig höre, Mann.«
»Von anderen Schwarzen?«
»Richtig. Aber von Weißen habe ich es auch schon gehört.«
»Gut, und wenn andere Schwarze dieses Wort so verwenden, wie es Mr. Woodson angeblich getan hat, wen bezeichnen sie dann üblicherweise damit?«
Vincent erhob Einspruch, mit der Begründung, Torrance könne nicht für andere sprechen. Companioni gab dem Einspruch statt, und ich überlegte kurz, auf welchem anderen Weg ich die gewünschte Antwort erhalten könnte.
»Also schön, Mr. Torrance«, sagte ich schließlich. »Dann lassen Sie uns nur über Sie reden, einverstanden? Benutzen Sie dieses Wort gelegentlich?«
»Ich denke schon.«
»Gut, und wen bezeichnen Sie damit, wenn Sie es verwenden?«
Torrance zuckte mit den Achseln.
»Andere Typen.«
»Andere Schwarze?«
»Klar.«
»Haben Sie jemals Weiße als Nigger bezeichnet?«
Torrance schüttelte den Kopf.
»Nein.«
»Okay, wie haben Sie es dann aufgefasst, als Barnett Woodson die zwei Männer, die er im Reservoir versenkt hatte, als Nigger bezeichnete?«
Vincent erhob sich halb aus seinem Stuhl. Seine Körpersprache war die eines Mannes, der Einspruch erheben will, sich aber im letzten Moment bremst. Er wusste, es wäre vergeblich gewesen. Ich hatte Torrance in die Falle gelockt, und jetzt gehörte er mir.
Torrance beantwortete die Frage.
»Ich habe es so aufgefasst, dass sie Schwarze waren und dass er sie beide umgebracht hat.«
Erneut veränderte sich Vincents Körpersprache. Er sank in sich zusammen, weil ihm klar wurde, dass sein Manöver, einen Knastspitzel in den Zeugenstand zu rufen, gründlich in die Hose gegangen war.
Ich blickte zu Richter Companioni hinauf. Auch er wusste, was jetzt käme.
»Euer Ehren, darf ich zum Zeugen gehen?«
»Dürfen Sie«, erklärte der Richter.
Ich ging zum Zeugenstand und legte den Ordner vor Torrance. Es war ein Standardordner, ziemlich abgenutzt und in einem verblichenen Orange. Die Farbe, mit der in Bezirksgefängnissen private juristische Unterlagen gekennzeichnet werden, die ein Häftling besitzen darf.
»Mr. Torrance, ich lege Ihnen hier einen Ordner vor, in dem Mr. Woodson Dokumente aufbewahrt, die ihm von seinen Anwälten ins Gefängnis gebracht werden. Ich frage Sie noch einmal, ob er Ihnen bekannt vorkommt?«
»Ich hab im Hochsicherheitstrakt jede Menge orangefarbener Ordner gesehen. Aber das heißt nicht, dass ich den hier gesehen hab.«
»Sie haben also Mr. Woodson nie mit seinem Ordner gesehen?«
»Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr.«
»Mr. Torrance, Sie waren mit Mr. Woodson zweiunddreißig Tage im selben Zellengang inhaftiert. Sie haben ausgesagt, dass er sich Ihnen anvertraut und Ihnen ein Geständnis abgelegt hat. Und gleichzeitig behaupten Sie, Sie hätten ihn nie mit diesem Ordner gesehen?«
Zunächst antwortete Torrance nicht. Ich hatte ihn in die Enge getrieben. Ich wartete. Wenn er weiter darauf beharrte, den Ordner nie gesehen zu haben, wäre seine Behauptung, Woodson habe ihm den Mord gestanden, in den Augen der Geschworenen fragwürdig. Wenn er allerdings zugab, dass er den Ordner kannte, öffnete er mir eine große Tür.
»Ich wollte damit nur sagen, dass ich ihn zwar mit diesem Ordner gesehen, aber nie reingeschaut hab.«
Bingo. Ich hatte ihn.
»Dann möchte ich Sie bitten, den Ordner jetzt zu öffnen und einen Blick hineinzuwerfen.«
Der Zeuge befolgte meine Anweisung und betrachtete die beiden ersten Seiten des Ordners. Ich kehrte an mein Pult zurück und spähte auf dem Weg dorthin zu Vincent hinüber. Er hielt die Augen gesenkt, sein Gesicht war blass.
»Was sehen Sie, wenn Sie den Ordner aufschlagen, Mr. Torrance?«
»Auf einer Seite sind Fotos von zwei Leichen, die auf dem Boden liegen. Sie sind mit einer Klammer aneinandergeheftet. Die Fotos, meine ich. Und auf der anderen Seite sind alle möglichen Dokumente und Berichte.«
»Könnten Sie uns vorlesen, was auf dem ersten Schriftstück auf der rechten Seite steht? Lesen Sie einfach die erste Zeile der Zusammenfassung.«
»Das geht nicht – ich kann nicht lesen.«
»Sie können überhaupt nicht lesen?«
»Nicht richtig. Ich war nicht so lang in der Schule.«
»Können Sie eins der Wörter neben den Kästchen lesen, die oben auf dem Dokument angekreuzt sind?«
Torrance starrte auf die Akte, und seine Augenbrauen zogen sich angestrengt zusammen. Ich wusste, dass während seines letzten Gefängnisaufenthalts seine Lesefähigkeit getestet worden war. Dabei hatte sich herausgestellt, dass sie sich auf dem niedrigsten messbaren Level befand, unter dem eines Zweitklässlers.
»Nicht wirklich«, sagte er. »Ich kann nicht lesen.«
Ich schritt rasch zur Anklagebank und nahm einen anderen Ordner sowie einen dicken Filzstift aus meinem Aktenkoffer. Damit ging ich zum Pult zurück und schrieb in großer Blockschrift das Wort WEISS auf den Aktendeckel. Ich hielt den Ordner hoch, sodass es sowohl Torrance als auch die Geschworenen sehen konnten.
»Mr. Torrance, das ist eins der Wörter, die in dem Formular angekreuzt waren. Können Sie dieses Wort lesen?«
Vincent sprang auf, aber Torrance schüttelte bereits verlegen den Kopf. Vincent erhob Einspruch gegen die Demonstration ohne hinreichenden Grund, und Companioni gab ihm statt. Damit hatte ich gerechnet. Ich legte nur das Fundament für meinen nächsten Schritt und war mir sicher, dass die meisten Geschworenen das Kopfschütteln des Zeugen bemerkt hatten.
»Na gut, Mr. Torrance«, fuhr ich fort. »Wenden wir uns der anderen Seite der Akte zu. Können Sie uns die Toten auf den Fotos beschreiben?«
»Äh, es sind zwei Männer. Sieht so aus, als wären sie aus Maschendraht und ein paar Planen ausgewickelt worden. Jedenfalls liegen sie auf dem Kram. Um sie herum stehen mehrere Polizisten, die sie untersuchen und Fotos machen.«
»Welche Hautfarbe haben die Männer auf den Planen?«
»Es sind Schwarze.«
»Haben Sie diese Fotos schon mal gesehen, Mr. Torrance?«
Vincent sprang auf, um Einspruch zu erheben, weil die Frage bereits gestellt worden und hinlänglich beantwortet sei. Aber dieses Manöver war in etwa so effektiv, als versuche man mit bloßer Hand eine abgefeuerte Pistolenkugel zu stoppen. Der Richter erklärte ihm streng, er solle Platz nehmen. Das war seine Art, dem Ankläger zu verstehen zu geben, er solle das Folgende gefälligst schweigend ertragen. Wenn man einen Lügner in den Zeugenstand ruft, geht man auch gemeinsam mit ihm unter.
»Sie dürfen die Frage beantworten, Mr. Torrance«, fuhr ich fort, nachdem sich Vincent gesetzt hatte. »Haben Sie diese Fotos schon einmal gesehen?«
»Nein, Sir, ich seh sie heute zum ersten Mal.«
»Würden Sie mir recht geben, dass auf diesen Bildern das zu sehen ist, was Sie mir vorhin beschrieben haben? Die Leichen zweier getöteter Schwarzer?«
»Sieht jedenfalls so aus. Aber ich hab das Foto vorher noch nie gesehen, ich weiß nur, was er mir erzählt hat.«
»Und da sind Sie absolut sicher?«
»So was würde ich nie vergessen.«
»Sie haben uns erzählt, Mr. Woodson hätte zugegeben, zwei Schwarze getötet zu haben. Aber er steht wegen Mordes an zwei Weißen vor Gericht. Würden Sie mir also recht geben, dass er Ihnen offensichtlich gar nichts gestanden hat?«
»Nein, er hat es gestanden. Er hat mir erzählt, er hätte die beiden umgebracht.«
Ich blickte zum Richter.
»Euer Ehren, die Verteidigung beantragt, den vor Mr. Torrance liegenden Ordner als Beweisstück eins der Verteidigung zu den Beweismitteln zu nehmen.«
Vincent versuchte es mit einem Unbegründetheitseinspruch, aber Companioni gab ihm nicht statt.
»Er wird zugelassen. Und wir werden die Geschworenen darüber befinden lassen, ob Mr. Torrance die Fotos und den Inhalt des Ordners gesehen hat oder nicht.«
Ich hatte gerade einen Lauf und war fest entschlossen, den Sack endgültig zuzumachen.
»Danke«, sagte ich. »Euer Ehren, jetzt dürfte für den Ankläger auch der richtige Zeitpunkt gekommen sein, seinen Zeugen auf die drohenden Strafen für Meineid hinzuweisen.«
Dieser Schachzug war auf die Geschworenen gemünzt. Ich rechnete eigentlich damit, mit Torrance weitermachen und ihm mit der Klinge seiner eigenen Lüge den Rest geben zu müssen. Doch Vincent erhob sich und bat den Richter, die Verhandlung zu vertagen, damit er sich mit dem Vertreter der Gegenpartei beraten könne.
Das verriet mir, dass ich Barnett Woodson gerade das Leben gerettet hatte.
»Kein Einwand seitens der Verteidigung«, erklärte ich dem Richter.
3
Nachdem die Geschworenen den Saal verlassen hatten, kehrte ich zum Tisch der Verteidigung zurück, wo gerade ein Deputy auf meinen Mandanten zukam, um ihm Handschellen anzulegen und ihn in seine Zelle im Gerichtsgebäude zurückzubringen.
»Dieser Typ ist ein verlogener Haufen Scheiße«, zischte Woodson. »Ich hab die beiden Schwarzen nicht umgebracht. Es waren Weiße.«
Ich hoffte, der Deputy hatte es nicht gehört.
»Halten Sie bloß die Klappe«, zischte ich. »Und wenn Sie diesen verlogenen Haufen Scheiße im Knast wiedersehen, sollten Sie ihm die Hand schütteln. Wegen seiner Lügen wird der Ankläger darauf verzichten, die Todesstrafe zu beantragen, und sich auf einen Deal einlassen. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich weiß, wie sein Angebot aussieht.«
Woodson schüttelte theatralisch den Kopf.
»Schon möglich, aber vielleicht will ich ja gar keinen Deal mehr. Sie haben einen dreckigen Lügner in den Zeugenstand geholt. Das ganze Verfahren sollte eingestellt werden. Wir können diesen beschissenen Prozess gewinnen, Haller. Lassen Sie sich auf keinen Deal ein.«
Ich musterte Woodson. Ich hatte ihm gerade das Leben gerettet, und schon wollte er mehr. Weil der Staat nicht fair gespielt hatte, fühlte er sich plötzlich im Recht. Dass er eine gewisse Verantwortung für die beiden Kids trug, die er umgebracht hatte, schien er dabei völlig zu vergessen.
»Werden Sie jetzt nicht übermütig, Barnett«, warnte ich ihn. »Sobald ich Näheres weiß, komme ich zu Ihnen.«
Der Deputy führte ihn durch die Stahltür, die zu den an den Gerichtssaal angrenzenden Zellen führte. Ich blickte ihm hinterher. Ich hatte bezüglich Barnett Woodsons nie irgendwelche Illusionen gehegt. Obwohl ich ihn niemals direkt gefragt hatte, wusste ich, dass er die beiden Westside-Studenten umgebracht hatte. Aber das sollte nicht meine Sorge sein. Meine Aufgabe war es, die Beweisführung des Staates gegen ihn auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen, und das mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Genau das hatte ich getan, und dabei war mir die Klinge in die Hand gefallen. Jetzt würde ich sie dazu benutzen, seine Situation deutlich zu verbessern. Aber seinen Wunschtraum, die Verantwortung für die beiden Leichen, die im Wasser schwarz geworden waren, einfach abzuwälzen, konnte Woodson vergessen. Vielleicht hatte er das noch nicht kapiert, aber sein unterbezahlter und unterschätzter Pflichtverteidiger war in diesem Punkt ziemlich unnachgiebig.
Nachdem sich der Saal geleert hatte, blieben nur noch Vincent und ich zurück. Wir musterten uns von unseren Tischen aus.
»Und?«, begann ich.
Vincent schüttelte den Kopf.
»Zuallererst«, sagte er, »möchte ich eines klarstellen. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass Torrance gelogen hat.«
»Natürlich nicht.«
»Warum sollte ich meinen eigenen Fall derart sabotieren?«
Ich winkte ab.
»Machen Sie sich da mal keine Gedanken, Jerry. Ich habe Ihnen schon bei der Vorverhandlung gesagt, dass sich dieser Kerl die Beweisoffenlegung aus der Zelle meines Mandanten unter den Nagel gerissen hat. Das lag doch auf der Hand. Mein Mandant hätte Ihrem Zeugen, einem vollkommen Fremden, niemals etwas anvertraut. Und jeder wusste das, außer Ihnen.«
Vincent schüttelte energisch den Kopf.
»Ich wusste es wirklich nicht, Haller. Er ist auf uns zugekommen. Einer unserer besten Ermittler hat ihm auf den Zahn gefühlt, und wir konnten keinen Hinweis auf eine Lüge entdecken, so unwahrscheinlich es uns auch vorkam, dass Ihr Mandant mit ihm geredet haben soll.«
Ich stieß ein kurzes Lachen aus.
»Was heißt hier, mit ihm geredet, Jerry? Er hat ihm angeblich zwei Morde gestanden. Das ist ein kleiner Unterschied. Vielleicht sollten Sie zukünftig lieber auf die Dienste Ihres tollen Ermittlers verzichten – der Kerl ist sein Geld nämlich nicht wert.«
»Er hat mir gesagt, der Zeuge kann nicht lesen. Also konnte er seine Informationen unmöglich aus der Beweisoffenlegungsakte haben. Von den Fotos hat er nichts erzählt.«
»Genau. Und deswegen sollten Sie sich nach einem neuen Ermittler umsehen. Und ich will Ihnen noch was sagen, Jerry. Mit mir kann man normalerweise über vieles reden. Ich versuche immer, mit der Staatsanwaltschaft gut auszukommen. Aber ich habe Sie von Anfang wegen dieses Zeugen gewarnt. Und deshalb werde ich ihn nach der Pause auseinandernehmen, dass es sich gewaschen hat. Und Sie werden nichts weiter tun können, als dazusitzen und zuzuschauen.«
Inzwischen hatte ich mich richtig in Rage geredet, und sie war größtenteils sogar echt.
»Ich werde ihn richtig dumm dastehen lassen. Aber wenn ich mit Torrance fertig bin, wird er nicht der Einzige sein, der dumm dasteht. Spätestens dann ist nämlich den Geschworenen klar, dass Sie entweder wussten, dass dieser Kerl ein Lügner ist, oder zu blöd waren, es zu merken. So oder so – Sie werden keinen besonders guten Eindruck hinterlassen.«
Vincent starrte ausdruckslos auf seinen Tisch und ordnete die vor ihm gestapelten Prozessunterlagen. Er sprach sehr gefasst.
»Ich möchte nicht, dass Sie mit dem Kreuzverhör fortfahren«, sagte er.
»Schön. Dann lassen Sie Ihre Ausflüchte und den ganzen anderen Scheiß und machen Sie mir einen Vorschlag, mit dem ich …«
»Ich verzichte auf die Todesstrafe. Fünfundzwanzig Jahre bis lebenslänglich.«
Ich schüttelte ohne Zögern den Kopf.
»Da müssen Sie sich schon was Besseres einfallen lassen. Das Letzte, was Woodson gesagt hat, bevor sie ihn in seine Zelle zurückgebracht haben, war, dass er es darauf ankommen lassen will. Um genau zu sein, hat er gesagt: Wir können diesen beschissenen Prozess gewinnen. Und ich glaube, damit könnte er durchaus recht haben.«
»Was wollen Sie dann, Haller?«
»Maximal fünfzehn. Das kann ich ihm vermutlich schmackhaft machen.«
Vincent schüttelte energisch den Kopf.
»Vollkommen ausgeschlossen. Wenn ich Ihnen das für zwei kaltblütige Morde anbiete, lassen die mich wieder Verkehrsdelikte bearbeiten. Alles, was ich Ihnen anbieten kann, sind fünfundzwanzig ohne Bewährung. Weniger kommt nicht infrage. Nach den momentanen Richtlinien kommt er in sechzehn, siebzehn Jahren wieder raus. Nicht schlecht für das, was er getan hat.«
Ich musterte ihn und versuchte zu ergründen, was in ihm vorging. Schließlich beschloss ich, ihm zu glauben. Vermutlich war es tatsächlich das Beste, was er mir anbieten konnte. Und natürlich hatte er recht. Angesichts dessen, was Barnett Woodson getan hatte, war es wirklich kein schlechter Deal.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Aber ich glaube, er wird sagen, ich soll es darauf ankommen lassen.«
Vincent schüttelte den Kopf und blickte mich an.
»Dann müssen Sie ihm mein Angebot irgendwie schmackhaft machen, Haller. Denn mehr kann ich Ihnen nicht anbieten, und wenn Sie mit dem Kreuzverhör weitermachen, kann ich wahrscheinlich bei der Staatsanwaltschaft einpacken.«
Jetzt zögerte ich, bevor ich antwortete.
»Augenblick, Jerry, was soll das heißen? Dass ich Ihren Dreck für Sie wegräumen soll? Sie bauen Scheiße, und mein Mandant soll den Kopf dafür hinhalten?«
»Ich bleibe dabei. Für jemanden, der eindeutig schuldig ist, ist es ein faires Angebot. Sogar mehr als fair. Reden Sie mit ihm und versuchen Sie, ihn rumzukriegen, Mick. Wir beide wissen, dass Sie nicht lange als einfacher Pflichtverteidiger arbeiten werden. Und eines Tages benötigen Sie vielleicht von mir einen Gefallen, wenn Sie sich da draußen in der großen bösen Welt durchschlagen müssen, wo nicht jeden Monat Ihr Gehaltsscheck eintrudelt.«
Ich fixierte ihn, während ich die Vor- und Nachteile dieses Handels abwägte. Ich helfe ihm, und irgendwann hilft er mir, und Barnett Woodson sitzt ein paar Jahre länger ein.
»Er kann von Glück reden, wenn er da drin fünf Jahre überlebt, geschweige denn zwanzig«, legte Vincent nach. »Was macht es für ihn also für einen Unterschied? Aber Sie und ich? Wir bringen es noch zu was, Mickey. Wir können uns hier gegenseitig helfen.«
Ich nickte langsam. Vincent war nur ein paar Jahre älter als ich, versuchte aber, einen auf weisen alten Mann zu machen.
»Die Sache ist nur die, Jerry, wenn ich tue, was Sie vorschlagen; werde ich nie wieder einem Mandanten in die Augen schauen können. Und was noch schlimmer ist, ich werde vor mir selbst als Verlierer dastehen.«
Ich erhob mich und packte meine Unterlagen zusammen. Mein Plan war, Barnett Woodson zu raten, es darauf ankommen zu lassen.
»Wir sehen uns nach der Pause«, sagte ich.
Damit marschierte ich aus dem Gerichtssaal.
Teil ZweiSuitcase City – 2007
4
Normalerweise rief Lorna Taylor nie so früh in der Woche an, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Meistens wartete sie damit bis Donnerstag. Aber nie schon am Dienstag. Deshalb nahm ich an, dass es sich diesmal um mehr als den üblichen Kontrollanruf handelte, als ich nach dem Telefon griff.
»Lorna?«
»Mickey, wo hast du gesteckt? Ich versuche schon den ganzen Morgen, dich zu erreichen.«
»Ich war laufen. Und jetzt komme ich gerade aus der Dusche. Alles okay bei dir?«
»Ja, alles in Ordnung. Und bei dir?«
»Alles bestens. Was liegt an?«
»Du hast von Richterin Holder eine Vorladung erhalten. Sie möchte dich sofort sehen, am besten gestern noch.«
Ich stutzte.
»Weswegen?«
»Keine Ahnung. Jedenfalls hat zuerst Michaela angerufen und dann die Richterin persönlich. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Sie wollte wissen, warum du nicht auf den Anruf reagiert hast.«
Bei Michaela handelte es sich um Michaela Gill, die Sekretärin und Protokollführerin der Richterin. Und Mary Townes Holder war die Vorsitzende Richterin des Los Angeles Superior Court. Dass sie persönlich anrief, deutete darauf hin, dass es um mehr als nur die Einladung zum jährlichen Juristenball ging. Mary Townes Holder meldete sich nie ohne triftigen Grund bei einem Anwalt.
»Was hast du ihr gesagt?«
»Nur, dass du heute keinen Gerichtstermin hast und möglicherweise Golf spielen bist.«
»Ich spiele nicht Golf, Lorna.«
»Ich weiß, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen.«
»Schon gut, ich rufe die Richterin an. Kannst du mir ihre Nummer geben?«
»Mickey, du sollst nicht anrufen. Du sollst hinfahren. Die Richterin will dich im Gericht sehen. Sie hat sich absolut unmissverständlich ausgedrückt. Nur den Grund hat sie mir nicht genannt. Also mach dich gefälligst auf die Socken.«
»Na schön. Ich muss mich nur noch anziehen.«
»Mickey?«
»Was ist?«
»Wie geht’s dir wirklich?«
Ich wusste, was hinter dieser Frage steckte. Sie wollte vermeiden, dass ich vor einem Richter erschien, wenn ich nicht in der entsprechenden Verfassung war.
»Keine Sorge, Lorna. Mir geht’s gut. Ich krieg das schon hin.«
»Na schön. Ruf mich so bald wie möglich an. Ich bin neugierig, was sie wollte.«
»Keine Sorge. Mach ich.«
Ich legte auf und kam mir vor, als würde ich von meiner Frau herumkommandiert und nicht von meiner Ex-Frau.
5
Als Vorsitzende Richterin des Los Angeles Superior Court versah Mary Townes Holder den größten Teil ihrer Arbeit hinter verschlossenen Türen. In ihrem Gerichtssaal wurde zwar gelegentlich über dringende Verfahrensanträge entschieden, aber Prozesse fanden darin nur selten statt. Ihre eigentliche Tätigkeit erledigte sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Richterzimmer. Von dort aus verwaltete sie die gesamte Gerichtsbarkeit von Los Angeles County. Ihrer Aufsicht unterlagen über zweihundertfünfzig Richterämter und vierzig Gerichte. Jede Vorladung eines Geschworenen, die mit der Post rausging, trug ihre Unterschrift, und jede Stellplatzzuteilung in einem Gerichtsparkhaus war von ihr abgesegnet. Sie teilte Richtern ihre Posten nach geographischen und fachlichen Kriterien zu. Wenn ein Richter neu in sein Amt gewählt wurde, war es Holder, die entschied, ob er nach Beverly Hills oder Compton kam und ob er in einem Zivilgericht Finanzprozesse mit immensem Streitwert leitete oder in einem Familiengericht herzergreifende Scheidungsfälle.
Ich schlüpfte rasch in meinen glückbringenden Anzug. Es war ein Italienimport von Corneliani, den ich früher immer am Tag der Urteilsverkündung getragen hatte. Weil ich ein Jahr lang keinen Gerichtssaal mehr betreten und noch länger kein Urteil mehr gehört hatte, musste ich ihn aus einer Plastikhülle nehmen, die ganz hinten im Schrank hing. Danach fuhr ich unverzüglich in die Stadt, mit der dumpfen Befürchtung, dass gleich über mich selbst eine Art Urteil gesprochen würde. Unterwegs ging ich fieberhaft die Fälle und Mandanten durch, mit denen ich ein Jahr zuvor zu tun gehabt hatte. Soweit ich mich erinnern konnte, war nichts offen oder unerledigt geblieben. Aber vielleicht hatte jemand eine Beschwerde eingereicht, oder die Richterin hatte irgendwelchen Tratsch am Gericht aufgeschnappt und daraufhin Nachforschungen angestellt. Jedenfalls betrat ich Holders Gerichtssaal mit einem flauen Gefühl im Magen. Eine Vorladung von einem Richter verhieß normalerweise nichts Gutes. Und eine Vorladung von einer Vorsitzenden Richterin schon gar nicht.
Der Saal war dunkel, und der Platz der Protokollführerin neben der Richterbank leer. Ich trat durch die Schranke und wollte gerade die Tür öffnen, die auf den Flur zum Richterzimmer führte, als diese von innen aufflog und Michaela Gill erschien. Die Protokollführerin war eine erfreulich anzusehende Frau, die mich ein wenig an meine Grundschullehrerin erinnerte. Sie hatte gerade den Saal betreten wollen, ohne damit zu rechnen, dass sich gleichzeitig jemand von der anderen Seite der Tür näherte. Sie erschrak heftig und hätte beinahe einen Schrei ausgestoßen. Ich nannte ihr rasch meinen Namen, bevor sie zum Alarmknopf an der Richterbank stürzen konnte. Sie atmete tief durch und ließ mich dann unverzüglich eintreten.
Ich marschierte den Flur hinunter und traf die Richterin allein in ihrem Zimmer an, wo sie an einem wuchtigen Schreibtisch aus dunklem Holz arbeitete. Ihre schwarze Robe hing in der Ecke an einem Kleiderständer. Sie trug ein konservativ geschnittenes weinrotes Kostüm. Sie war gepflegt und attraktiv, Mitte fünfzig, mit einer zierlichen Figur und braunem Haar, das sie kurz und streng geschnitten trug.
Ich war Richterin Holder noch nie persönlich begegnet, hatte aber schon einiges über sie gehört. Sie hatte zwanzig Jahre als Anklägerin gearbeitet, bevor sie von einem konservativen Gouverneur auf die Richterbank berufen worden war. Sie hatte Strafrechtsprozesse geleitet, auch ein paar richtig große, und war dafür bekannt, das höchstmögliche Strafmaß zu verhängen. Dementsprechend war sie nach ihrer ersten Amtszeit problemlos für eine zweite übernommen worden. Vier Jahre später war sie zur Vorsitzenden Richterin gewählt worden und hatte dieses Amt seitdem inne.
»Mr. Haller, danke, dass Sie gekommen sind«, begrüßte sie mich. »Freut mich, dass Ihre Sekretärin Sie endlich finden konnte.«
Ihre Stimme hatte etwas Ungehaltenes, um nicht zu sagen Herrisches.
»Sie ist zwar nicht meine Sekretärin, Euer Ehren, aber sie hat mich gefunden. Tut mir leid, dass es so lang gedauert hat.«
»Jetzt sind Sie ja hier. Ich denke nicht, dass wir schon mal das Vergnügen hatten, oder?«
»Nein, vermutlich nicht.«
»Also, auch wenn ich Ihnen damit mein wahres Alter verrate, ich bin vor Gericht einmal gegen Ihren Vater angetreten. Es muss einer seiner letzten Fälle gewesen sein.«
Ich revidierte meine Schätzung ihres Alters. Falls sie tatsächlich meinem Vater im Gerichtssaal gegenübergestanden hatte, musste sie mindestens sechzig sein.
»Ich war nur die zweite Assistentin der Anklage, frisch von der USC und noch sehr grün hinter den Ohren. Sie wollten mir zu etwas praktischer Erfahrung verhelfen. Es war ein Mordfall, und sie ließen mich einen Zeugen übernehmen. Ich hatte mich eine Woche auf meine Befragung vorbereitet, aber Ihr Vater hat den Zeugen im Kreuzverhör in zehn Minuten nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Wir haben den Prozess zwar trotzdem gewonnen, aber es war mir eine Lehre. Seitdem bin ich auf alles gefasst.«
Ich nickte. Ich hatte im Lauf der Jahre einige ältere Juristen kennengelernt, die ein paar Mickey-Haller-senior-Anekdoten auf Lager hatten. Ich selber konnte nur mit sehr wenigen aufwarten. Doch bevor ich die Richterin fragen konnte, bei welchem Fall sie ihm begegnet war, kam sie bereits zur Sache.
»Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich Sie herbestellt habe.«
»Habe ich mir fast gedacht. Es hat sich eher nach etwas ziemlich Dringlichem angehört.«
»Allerdings. Kannten Sie Jerry Vincent.«
Dass sie die Vergangenheitsform benutzte, ließ mich stutzen.
»Jerry? Ja, natürlich kenne ich Jerry. Was ist mit ihm?«
»Er ist tot.«
»Tot?«
»Ermordet, um genau zu sein.«
»Wann?«
»Gestern Nacht. Üble Geschichte.«
Ich senkte den Blick und betrachtete das Namensschild auf ihrem Schreibtisch. Die Ehrenwerte M.T. Holder war mit Schreibschrift in die Holzhalterung mit Richterhammer, Füllfederhalter und Tintenfass graviert.
»Wie nahe standen Sie sich?«, wollte sie wissen.
Eine gute Frage, auf die ich keine rechte Antwort wusste. Ich hielt beim Sprechen den Blick gesenkt.
»Wir sind in mehreren Fällen gegeneinander angetreten, als er noch bei der Staatsanwaltschaft war und ich Pflichtverteidiger. Dann haben wir uns beide etwa zur gleichen Zeit selbstständig gemacht und Ein-Mann-Kanzleien geführt. Im Lauf der Jahre haben wir auch ein paar Fälle gemeinsam übernommen, meistens Drogendelikte, und uns gegenseitig ausgeholfen, wenn mal beim anderen Not am Mann war. Gelegentlich hat er mir auch einen Fall zugeschanzt, den er selbst nicht übernehmen wollte.«
Meine Beziehung zu Jerry Vincent war eher beruflicher Natur gewesen. Hin und wieder hatten wir im Four Green Fields einen miteinander getrunken oder waren uns im Dodger Stadium begegnet. Aber zu sagen, wir hätten uns nahegestanden, wäre übertrieben gewesen. Über das rein Berufliche hinaus wusste ich wenig über ihn. Vor einiger Zeit war mir am Gericht etwas Klatsch und Tratsch über seine Scheidung zu Ohren gekommen, ich hatte ihn jedoch nie auf dieses Thema angesprochen. Das war seine Privatangelegenheit und ging mich nichts an.
»Sie scheinen zu vergessen, Mr. Haller, dass ich noch bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet habe, als Mr. Vincent ein junger, aufstrebender Ankläger war. Damals verlor er einen wichtigen Prozess, und von da an war sein Stern im Sinken begriffen. Deshalb hat er sich wenig später selbstständig gemacht.«
Ich blickte die Richterin schweigend an.
»Und wenn mich nicht alles täuscht, waren Sie der Verteidiger bei besagtem Prozess«, fügte sie hinzu.
Ich nickte.
»Barnett Woodson. Ein Doppelmord. Ich habe einen Freispruch für ihn herausgeholt. Beim Verlassen des Gerichtssaals hat er sich bei den Medien entschuldigt, dass er mit zwei Morden ungestraft davongekommen war. Das war natürlich der blanke Zynismus. Aber er hat wohl geglaubt, es dem Staatsanwalt noch mal heimzahlen zu müssen, und hat damit Jerrys Karriere als Ankläger praktisch ruiniert.«
»Warum hat Vincent danach trotzdem noch mit Ihnen zusammengearbeitet und Ihnen sogar Fälle zugeschanzt?«
»Weil ich zwar seine Karriere als Ankläger beendet, aber damit gleichzeitig seine Karriere als Strafverteidiger eingeleitet habe, Euer Ehren.«
Dabei beließ ich es, aber ihr reichte das nicht.
»Und?«
»Ein paar Jahre später hat er ungefähr fünfmal so viel verdient wie bei der Staatsanwaltschaft. Er hat mich angerufen und sich dafür bedankt, dass ich ihn auf den Trichter gebracht hatte.«
Die Richterin nickte wissend.
»Es war also eine Frage des Einkommens. Es ging ihm ums Geld.«
Ich zuckte mit den Achseln und schwieg, als sei es mir unangenehm, im Namen eines Toten zu sprechen.
»Was wurde aus Ihrem Mandanten?«, fragte die Richterin. »Aus dem Mörder, der ungestraft davonkam.«
»Mit einer Verurteilung wäre er besser dran gewesen. Zwei Monate nach seinem Freispruch starb Woodson bei einer Schießerei.«
Die Richterin nickte erneut, als wollte sie damit zum Ausdruck bringen, Fall erledigt durch ausgleichende Gerechtigkeit. Ich versuchte, das Gespräch wieder auf Jerry Vincent zu lenken.
»Ich kann die Geschichte mit Jerry noch gar nicht glauben. Wissen Sie, was genau passiert ist?«
»Das ist noch unklar. Offensichtlich wurde er gestern Nacht tot in seinem Auto aufgefunden. Im Parkhaus neben seiner Kanzlei. Jemand hat ihn erschossen. Soviel ich gehört habe, ist die Polizei noch am Tatort, und es gab bisher keine Festnahmen. Das alles weiß ich nur von einem Times-Reporter, der mich angerufen hat, um sich zu erkundigen, wie es jetzt mit Mr. Vincents Mandanten weitergeht. Insbesondere mit Walter Elliot.«
Ich nickte. Die letzten zwölf Monate hatte ich in einer Art Vakuum gelebt. Aber es war nicht so luftdicht gewesen, dass der Mordprozess gegen den Filmmogul völlig an mir vorbeigegangen wäre. Es war nur einer von mehreren aufsehenerregenden Fällen, die Vincent im Lauf der Jahre an Land gezogen hatte. Trotz des Woodson-Fiaskos hatte ihn seine Vergangenheit als Topankläger von Anfang an für eine Strafverteidigerkarriere prädestiniert. Er hatte sich nie um Mandanten bemühen müssen. Sie hatten sich immer um ihn bemüht. Und in der Regel waren es lohnende Mandanten gewesen, die mindestens eine von drei Eigenschaften besaßen: Sie konnten gutes Geld für rechtlichen Beistand zahlen; sie waren nachweislich unschuldig; oder sie waren zwar eindeutig schuldig, hatten aber aus irgendwelchen Gründen die Sympathien der Öffentlichkeit auf ihrer Seite. Also alles Klienten, für die er bedenkenlos eintreten konnte, was immer ihnen angelastet wurde. Fälle, für die er sich hinterher nicht zu schämen brauchte.
Und Walter Elliot erfüllte zumindest eines dieser drei Kriterien. Als Boss von Archway Pictures war er einer der Mächtigen und Reichen in Hollywood. Er war angeklagt, seine Frau und deren Liebhaber im Affekt ermordet zu haben, nachdem er sie in seinem Strandhaus in Malibu in flagranti ertappt hatte. Vor allem aufgrund der Faktoren Sex und Prominenz hatte der Fall in den Medien für enormes Aufsehen gesorgt. Für Vincent war es eine hervorragende Werbung gewesen, und jetzt wäre das alles zu vergeben.
Die Richterin riss mich aus meinen Träumereien.
»Sind Sie mit Paragraph zweihundertdreißig in den Statuten der kalifornischen Anwaltskammer vertraut?«, fragte sie.
Unwillkürlich kniff ich die Augen zusammen.
»Äh, nicht wirklich.«
»Dann lassen Sie mich Ihr Gedächtnis auffrischen. Es ist der Paragraph, der sich auf die Übertragung oder den Verkauf von anwaltlichen Leistungen bezieht. Wobei es sich in diesem Fall um eine Übertragung handelt. Offensichtlich hat Sie Mr. Vincent in seinem Standardmandatsvertrag als Stellvertreter aufgeführt, damit Sie im Bedarfsfall für ihn einspringen können. Außerdem habe ich herausgefunden, dass er vor zehn Jahren beim Gericht einen Antrag gestellt hat, Ihnen seine Kanzlei zu übertragen, sollte er berufsunfähig werden oder versterben. Dieser Antrag wurde nie geändert oder aktualisiert, aber es geht eindeutig daraus hervor, was seine Intentionen waren.«
Ich starrte sie an. Natürlich wusste ich von der Klausel in Vincents Standardvertrag. In meinen hatte ich die gleiche auf seinen Namen aufgenommen. Aber nun erst dämmerte mir, dass mir die Richterin zu verstehen geben wollte, dass ab sofort Jerrys Fälle mir gehörten. Alle, inklusive Walter Elliot.
Das hieß natürlich nicht, dass ich auch alle Fälle behalten würde. Es stand jedem Mandanten frei, sich einen neuen Anwalt zu suchen, sobald er von Vincents Ableben in Kenntnis gesetzt wurde. Es bedeutete aber zumindest, dass ich die erste Option für sie war.
Ich begann zu überlegen. Ich hatte ein Jahr lang keinen Mandanten mehr gehabt und eigentlich geplant, ganz langsam wieder einzusteigen und nicht gleich mit einem ganzen Schwung von Fällen, wie ich ihn offensichtlich gerade geerbt hatte.
»Bevor Sie sich jedoch wegen dieses Angebots allzu große Hoffnungen machen«, fügte die Richterin hinzu, »muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich in meiner Verantwortung als Vorsitzende Richterin jede erdenkliche Anstrengung unternehmen werde, um sicherzustellen, dass Mr. Vincents Mandanten an einen Ersatzanwalt von gutem Ansehen und entsprechender Kompetenz verwiesen werden.«
Jetzt wurde mir alles klar. Sie hatte mich einbestellt, um mir zu erklären, warum ich Vincents Mandanten nicht zugeteilt bekäme. Sie hatte vor, gegen den Willen des toten Anwaltskollegen jemand anderen zu ernennen, höchstwahrscheinlich einen der großzügigen Spender für die letzte Kampagne zu ihrer Wiederwahl. Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich im Lauf der Jahre rein gar nichts zum Auffüllen ihrer Kasse beigetragen.
Doch die Richterin sollte mich überraschen.
»Ich habe mich bei mehreren Richtern nach Ihnen erkundigt«, fuhr sie fort, »und ich weiß, dass Sie fast ein Jahr nicht mehr als Anwalt tätig waren. Auf eine Erklärung dafür bin ich nicht gestoßen. Bevor ich daher die Anweisung erteile, Sie zum Ersatzanwalt zu ernennen, möchte ich mich vergewissern, dass ich Mr. Vincents Mandanten nicht an den falschen Mann vermittle.«
Ich nickte zustimmend und hoffte, auf diese Weise etwas Zeit schinden zu können, bevor ich antwortete.
»Sie haben völlig recht. Ich habe mich gewissermaßen eine Weile selbst aus dem Verkehr gezogen. Aber ich war gerade dabei, wieder einzusteigen.«
»Warum sind Sie ausgestiegen?«
Sie fragte mich ganz unverblümt und musterte mich dabei unverwandt. Offensichtlich suchte sie in meinem Gesicht nach verräterischen Indizien, dass ich die Wahrheit zu verdrehen versuchte. Ich wählte meine Worte mit großem Bedacht.
»Vor zwei Jahren hatte ich einen Fall. Der Name des Mandanten war Louis Roulet. Er war …«
»Ich erinnere mich an den Fall, Mr. Haller. Sie sind angeschossen worden. Aber das ist, wie Sie selbst gesagt haben, zwei Jahre her. Und soweit ich weiß, haben Sie danach noch eine Weile als Anwalt praktiziert. Ich erinnere mich an die Zeitungsmeldungen über Ihr Comeback.«
»Richtig«, gab ich zu. »Es war nur so, dass ich zu früh wieder angefangen habe. Ich hatte einen Bauchschuss abbekommen und hätte mir mehr Zeit lassen sollen. Stattdessen konnte ich es kaum erwarten, wieder einzusteigen. Prompt begann ich unter Schmerzen zu leiden, und die Ärzte eröffneten mir, ich hätte einen Leistenbruch. Ich musste erneut operiert werden, und es traten Komplikationen auf. Es war nicht richtig gemacht worden. Die Schmerzen wurden schlimmer, und ich kam ein zweites Mal unters Messer. Und um es kurz zu machen, ich musste eine Weile pausieren. Ich beschloss, es diesmal langsamer anzugehen und zu warten, bis ich mich wieder hundertprozentig fit fühle.«
Die Richterin nickte mitfühlend. Vermutlich war es richtig gewesen, meine Schmerzmittelsucht und den Entzug nicht zu erwähnen.
»Finanziell musste ich mir keine Gedanken machen«, fuhr ich fort. »Ich habe etwas Geld zurückgelegt und außerdem von der Versicherung eine Abfindung erhalten. Deshalb habe ich mir mit dem Wiedereinstieg Zeit gelassen. Aber jetzt bin ich wieder so weit. Ich wollte gerade eine Annonce auf der Rückseite des Branchenfernsprechbuchs schalten.«
»Dann trifft es sich ja vermutlich bestens, dass Sie gleich eine ganze Kanzlei erben, oder?«, bemerkte die Richterin.
Ich wusste nicht, wie ich auf ihre Frage oder den süffisanten Unterton darin reagieren sollte.
»Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich mich gut um Jerry Vincents Mandanten kümmern werde.«
Die Richterin nickte, vermied es aber, mich dabei anzusehen. Mir war klar, was das bedeutete. Sie wusste irgendetwas. Etwas, das sie störte. Vielleicht doch von meinem Entzug.
»Den Unterlagen der Anwaltskammer zufolge sind Sie mehrmals verwarnt worden«, sagte sie.
Da hatten wir es wieder. Sie würde die Fälle doch einem anderen Anwalt zuschanzen. Wahrscheinlich einem ihrer Förderer aus Century City, der sich nicht einmal in einem Strafrechtsverfahren zurechtfände, wenn seine Mitgliedschaft in einem Nobelclub davon abhinge.
»Das ist alles lange her, Euer Ehren. Lauter Formsachen. Ich habe einen guten Stand bei der Kammer. Ich bin sicher, man wird Ihnen das jederzeit bestätigen, wenn Sie heute dort anrufen.«
Sie bedachte mich mit einem langen Blick, bevor sie sich wieder den Papieren zuwandte, die vor ihr auf dem Schreibtisch lagen.
»Na schön«, sagte sie schließlich.
Sie setzte ihre Unterschrift auf die letzte Seite des Dokuments. Ein aufgeregtes Kribbeln breitete sich in meiner Brust aus.
»Hier ist der Beschluss, Ihnen die Kanzlei zu übertragen«, erklärte die Richterin. »Möglicherweise brauchen Sie dieses Dokument, um Zutritt zu Vincents Büro zu erhalten. Und lassen Sie mich Ihnen noch eines sagen. Ich werde Sie im Auge behalten. Ich verlange bis Anfang nächster Woche eine aktualisierte Aufstellung Ihrer Fälle. Den Status jedes Falls auf der Mandantenliste. Ich möchte wissen, welche Mandanten bei Ihnen bleiben und welche sich einen anderen Anwalt suchen. Danach erwarte ich zweiwöchige Status-Updates zu allen Fällen, die Sie übernommen haben. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Auf jeden Fall, Euer Ehren. Wie lange?«
»Was?«
»Wie lange wollen Sie die zweiwöchentlichen Updates?«
Sie blickte mich an, und ihre Miene verhärtete sich.
»Bis ich Ihnen sage, dass Sie damit aufhören können.«
Sie reichte mir den Beschluss.
»Sie dürfen jetzt gehen, Mr. Haller. Und an Ihrer Stelle würde ich mich schleunigst auf den Weg machen, um meine neuen Mandanten vor einer unrechtmäßigen Durchsuchung und Beschlagnahmung ihrer Akten seitens der Polizei zu schützen. Sollten Sie dabei Probleme bekommen, können Sie mich jederzeit anrufen. Ich habe meine Privatnummer auf den Beschluss geschrieben.«
»Ja, Euer Ehren. Danke.«
»Viel Erfolg, Mr. Haller.«
Ich stand auf und wandte mich zum Gehen. An der Tür blickte ich mich noch einmal kurz um. Sie hatte den Kopf bereits wieder gesenkt und machte sich an die Abfassung des nächsten richterlichen Beschlusses.
Draußen auf dem Flur des Gerichtsgebäudes überflog ich das zweiseitige Dokument, das die Richterin mir ausgehändigt hatte. Ich wollte mich vergewissern, dass ich nicht alles nur geträumt hatte.
Ich hatte nicht geträumt. Das Dokument in meinen Händen ernannte mich, zumindest vorübergehend, zum stellvertretenden Rechtsbeistand aller Mandanten Jerry Vincents. Es verschaffte mir direkten Zugang zu den Kanzleiräumen des ermordeten Anwalts sowie zu den Akten und Bankkonten, auf die Vorauszahlungen der Mandanten eingegangen waren.
Ich zückte mein Handy, rief Lorna Taylor an und bat sie, mir die Adresse von Jerry Vincents Kanzlei durchzugeben. Dann erklärte ich ihr, sie solle unverzüglich dorthin kommen und unterwegs zwei Sandwiches besorgen.
»Warum?«, wollte sie wissen.
»Weil ich noch kein Mittagessen hatte.«
»Nein – warum fahren wir in Jerry Vincents Kanzlei?«
»Weil wir wieder im Geschäft sind.«
6
Während ich in meinem Lincoln zu Jerry Vincents Kanzlei unterwegs war, fiel mir etwas ein, und ich rief erneut Lorna Taylor an. Als sie nicht ans Telefon ging, probierte ich es auf ihrem Handy und erreichte sie in ihrem Auto.
»Ich werde einen Ermittler brauchen. Wie wäre es für dich, wenn ich Cisco einschalte?«
Sie antwortete erst nach einigem Zögern. Cisco war der Spitzname von Dennis Wojciechowski, seit letztem Jahr ihre bessere Hälfte. Ich hatte die beiden miteinander bekannt gemacht, als ich Cisco für einen Fall engagiert hatte. Meinem aktuellen Wissensstand zufolge wohnten sie inzwischen sogar zusammen.
»Ich habe kein Problem, mit Cisco zusammenzuarbeiten. Aber könntest du mir endlich mal verraten, worum es eigentlich geht?«
Lorna kannte Jerry Vincent nur als Stimme am Telefon. Sie hatte seine Anrufe entgegengenommen, wenn er wissen wollte, ob ich ihn bei einer Urteilsverkündung vertreten oder einem seiner Mandanten bei einer Anklageerhebung das Händchen halten konnte. Aber ich konnte mich nicht erinnern, ob sie sich jemals persönlich begegnet waren. Eigentlich hatte ich ihr nicht am Telefon von seinem Tod erzählen wollen. Doch jetzt entwickelten sich die Dinge einfach zu rasch.
»Jerry Vincent ist tot.«
»Was?«
»Er ist gestern Nacht ermordet worden, und sie übertragen mir erst mal seine Fälle. Einschließlich Walter Elliot.«
Sie schwieg lange, bevor sie antwortete.
»Mein Gott. Wie ist das passiert? Er war so ein netter Mann.«
»Ich wusste nicht mehr genau, ob du ihn jemals persönlich kennengelernt hast.«
Lorna operierte von ihrer Eigentumswohnung in West Hollywood aus. Alle meine Anrufe und Buchungen liefen über sie. Wenn es so etwas wie ein real existierendes Büro der Anwaltskanzlei Michael Haller und Partner gab, dann war es ihr Apartment. Partner gab es allerdings keine, und in den meisten Fällen diente mir der Rücksitz meines Autos als Büro. Infolgedessen ergaben sich für Lorna wenig Gelegenheiten, meine Mandanten oder Berufskollegen persönlich kennenzulernen.
»Natürlich! Er war doch bei unserer Hochzeit, weißt du nicht mehr?«
»Ach ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen.«
»Ich kann es einfach nicht glauben. Wie ist das passiert?«
»Es ist noch nichts Näheres bekannt. Holder meinte, er wäre im Parkhaus seiner Kanzlei erschossen worden. Vielleicht erfahren wir Näheres, wenn wir da sind.«
»Hatte er Familie?«
»Ich glaube, er war geschieden. Keine Ahnung, ob er Kinder hatte. Ich denke, eher nicht.«
Lorna schwieg. Wir hingen beide unseren Gedanken nach.
»Dann lass uns mal auflegen, damit ich Cisco anrufen kann«, sagte ich schließlich. »Weißt du, was er heute vorhat?«
»Nein, hat er mir nicht verraten.«
»Okay, dann probiere ich mal mein Glück.«
»Was willst du für ein Sandwich?«
»Welchen Weg nimmst du?«
»Über den Sunset.«
»Dann besorg mir doch ein Putensandwich mit Cranberrysoße bei Dusty’s. Es ist fast ein Jahr her, dass ich eins davon hatte.«
»Alles klar.«
»Und bring Cisco auch was mit, falls er Hunger hat.«
»Okay.«
Ich beendete das Gespräch und suchte in dem Adressbuch, das ich im Fach in der Mittelkonsole aufbewahre, Dennis Wojciechowskis Nummer. Ich fand seine Handynummer. Als er sich meldete, waren im Hintergrund Fahrtwind und Auspuffdröhnen zu hören. Er war auf seinem Motorrad unterwegs, und obwohl ich wusste, dass sein Helm mit Kopfhörern und Mikro ausgestattet war, begann ich, ins Telefon zu schreien.
»Hier ist Mickey Haller. Fahr mal kurz rechts ran.«
Ich wartete, während er den Motor seiner 63er Panhead abstellte.
»Was gibt’s, Mick?«, fragte er, als endlich Ruhe einkehrte. »Lang nichts mehr von dir gehört.«
»Schraub lieber mal wieder die Schalldämpfer in deinen Auspuff, Mann. Sonst wirst du noch taub, bevor du vierzig bist, und hörst von niemandem mehr was.«
»Ich bin längst über vierzig, und ich höre dich sehr gut. Was liegt an?«
Wojciechowski war ein selbstständiger Anwaltsermittler, den ich bei ein paar Fällen hinzugezogen hatte. Bei einer dieser Gelegenheiten war er, als er sein Honorar abholte, Lorna begegnet. Davor hatten wir uns allerdings schon mehr als zehn Jahre gekannt, wegen seiner Zugehörigkeit zum Road Saints Motorcycle Club, für den ich einige Jahre de facto als Hausanwalt fungiert hatte. Dennis trat zwar nie im RSMC-Outfit auf, wurde aber als außerordentliches Mitglied geführt. Sogar einen Spitznamen hatte ihm die Gruppe verpasst, weil es bereits einen Dennis auf der Mitgliederliste gab – der natürlich unter Dennis the Menace firmierte – und weil sein Nachname Wojciechowski unsäglich schwer auszusprechen war. Wegen seiner langen dunklen Haare und seines Schnurrbarts tauften sie ihn Cisco Kid. Daran änderte auch nichts, dass er hundert Prozent polnischer Abstammung und in der Southside von Milwaukee aufgewachsen war.
Cisco war ein großer, kräftig gebauter Mann, der sich bei seinen Ausflügen mit den Saints nie etwas hatte zuschulden kommen lassen. Er war nie festgenommen worden, und das zahlte sich aus, als er später seine Privatermittlerlizenz beantragte. Inzwischen war er in die Jahre gekommen, die Matte war ab und der mächtige Schnauzbart gestutzt und ergraut. Aber der Name Cisco und seine Vorliebe für alte, in seiner Heimatstadt gebaute Harleys waren ihm geblieben.
Cisco war ein gründlicher und umsichtiger Ermittler. Und noch ein weiteres großes Plus hatte er. Er war ein Hüne, und entsprechend einschüchternd konnte sein Auftreten wirken. Eine Eigenschaft, die sich besonders bei Ermittlungen im Halbweltmilieu als außerordentlich hilfreich erwies.
»Zuallererst, wo bist du gerade?«, fragte ich.
»In Burbank.«
»Geschäftlich?«
»Nein, nur eine kleine Spritztour. Warum, hast du was für mich? Hast du endlich wieder einen Fall übernommen?«
»Einen ganzen Haufen Fälle sogar. Und ich werde einen Ermittler brauchen.«
Ich gab ihm die Adresse von Vincents Kanzlei und bat ihn, so schnell wie möglich hinzukommen. Vincent hatte entweder eine ganze Schar von Ermittlern beschäftigt oder einen speziellen, und es konnte eine Weile dauern, bis Cisco sich in die Fälle eingearbeitet hatte. Doch damit konnte ich leben. Ich wollte unbedingt einen Ermittler, mit dem ich bereits zusammengearbeitet hatte und dem ich vertraute. Außerdem sollte Cisco die Aufenthaltsorte meiner neuen Mandanten ausfindig machen. Aus Erfahrung wusste ich, dass in Strafrechtsprozesse verwickelte Klienten nicht immer unter der Adresse anzutreffen waren, die sie im Mandantenpersonalbogen angaben.
Als ich das Gespräch mit Cisco beendete, stellte ich fest, dass ich bereits an Vincents Kanzlei vorbeigefahren war. Sie lag am Broadway auf Höhe der Third Street, und es herrschte zu viel Verkehr, um einfach zu wenden. Ich vergeudete zehn Minuten damit, mich wieder zurückzukämpfen, weil jede Ampel rot war. Als ich schließlich ankam, war ich so frustriert, dass ich beschloss, so bald wie möglich wieder einen Fahrer einzustellen, um mich weniger auf den Verkehr und mehr auf meine Arbeit konzentrieren zu können.
Vincents Kanzlei befand sich in einem sechsstöckigen Gebäude, das sich schlicht Legal Center nannte. Da es in der Nähe der wichtigsten Downtown-Gerichtshöfe für Straf- und Zivilrecht lag, hatten dort vorwiegend Prozessanwälte ihre Kanzleien. Es handelte sich also genau um die Sorte von Gebäude, dem die meisten Polizisten und Ärzte – beide Berufsgruppen ausgewiesene Anwaltshasser – bei jedem Erdbeben den Einsturz wünschten. Ich entdeckte die Einfahrt zum Parkhaus und rollte hinein.
Als ich den Parkschein zog, marschierte ein uniformierter Polizist auf mein Auto zu. Er trug ein Klemmbrett bei sich.
»Sir? Haben Sie in diesem Haus geschäftlich zu tun?«
»Deshalb will ich hier parken.«
»Sir, könnten Sie mir den Grund Ihres Aufenthalts nennen?«
»Warum wollen Sie das wissen, Officer?«
»Sir, wir führen in diesem Parkhaus polizeiliche Ermittlungen durch, und ich muss den Grund Ihres Aufenthalts erfahren, um Sie hier reinlassen zu dürfen.«
»Meine Kanzlei befindet sich hier im Haus«, erklärte ich. »Genügt Ihnen das?«
Das war keineswegs gelogen. Ich hatte Richterin Holders Beschluss in meiner Jackentasche. Er verhalf mir zu einem Büro im Legal Center.
Die Antwort schien ihren Zweck zu erfüllen. Als der Cop meinen Ausweis sehen wollte, hätte ich geltend machen können, dass ich rechtlich nicht verpflichtet war, mich